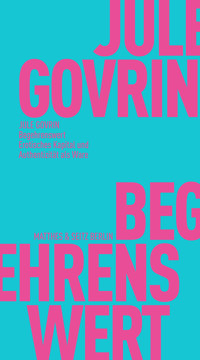27,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Je bedrohlicher die Weltlage wird, umso stärker spüren wir, wie sehr wir global aufeinander angewiesen sind. Doch obwohl wir alle verwundbar sind, ist Verwundbarkeit ungleich verteilt. Wie aber lässt sich Ungleichheit ausgehend von Körpern denken? Anhand von Schulden- und Austeritätspolitiken untersucht Jule Govrin in ihrem fesselnden Buch, wie Menschen durch Formen der differentiellen Ausbeutung ungleich gemacht werden. Und sie begibt sich auf die Suche nach gelebter Gleichheit in der Gegenwart. Gleichheit erscheint so nicht als fernes Ideal, sondern als prekäre Praxis, welche die Sorge umeinander in den Vordergrund stellt. In solidarischen Gefügen und egalitären Körperpolitiken blitzt ein Universalismus von unten auf.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 747
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Cover
Titel
3Jule Govrin
Universalismus von unten
Eine Theorie radikaler Gleichheit
Suhrkamp
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Zur Gewährleistung der Zitierfähigkeit zeigen die grau gerahmten Ziffern die jeweiligen Seitenanfänge der Printausgabe an.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2025
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuch wissenschaft 2456
© Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2025
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlag nach Entwürfen von Willy Fleckhaus und Rolf Staudt
eISBN 978-3-518-78104-3
www.suhrkamp.de
Motto
5»Wir müssen uns der Logik der Ungleichheit entledigen, die im wissenschaftlichen Diskurs am Werk ist […].« Jacques Rancière
»Es waren plurale Beziehungsweisen der Solidarität, die an die Stelle der atomisierenden und konkurrenten Beziehungsweise des Kapitalismus treten sollten.« Bini Adamczak
»Die Versammlung ist der konkrete Ort, wo Worte nicht vom Körper getrennt werden können. Wo die eigene Stimme zu erheben bedeutet, zu gestikulieren, zu atmen, zu schwitzen und zu spüren, dass die Worte gleiten und in den Körpern anderer aufgefangen werden.« Verónica Gago
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Motto
Inhalt
Einleitung
I.
Körper
Politische Körper
Body Politic: mythische Körper und politische Metaphern
Hobbes und die verwundbaren Körper
Eigentümliche Körper
II
. Ökonomie
Feministische Politische Ökonomie
Biopolitische Körper
Body Economic: differentielle Ausbeutung und Arbeitsteilung
Verschuldete Körper, verfügbare Körper
III
. Gleichheit
Gelebte Gleichheit
Ungleiche Körper und universelle Verwundbarkeit
Radikalrelationale Gleichheit
Solidarische Sorge und egalitäre Körperpolitiken
Für einen Universalismus von unten
Schlussbemerkungen
Literaturverzeichnis
Danksagung
Sachregister
Fußnoten
Informationen zum Buch
3
5
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
123
125
126
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
271
272
273
274
275
277
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
297
298
299
300
301
302
303
305
306
307
308
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
9
Einleitung
Die Krisen der globalen Gegenwart lassen uns spüren, wie abhängig wir voneinander sind. Ebenso legen sie offen, in welchem Ausmaß wir ungleich gemacht werden. In den verflochtenen Vielfachkrisen unserer Zeit treten die Tiefenstrukturen hervor, in denen Menschen körperlich ausgezehrt werden. Ausbeutung, Verarmung, Verelendung sind zweifellos fortwährende Phänomene der jahrhundertelangen Körpergeschichte des Kapitals. Jedoch verdichten sie sich im klimakatastrophischen Zeitalter, in dem wir uns inzwischen befinden. Der bedrohliche Wandel von Welt und Umwelt, die Wetterextreme und die sich anbahnenden epochalen Gefahren und Konflikte, folgen wiederum wirtschaftlichen Krisenlagen. Ökonomie und Ökologie, Kapital und Körper wirken aufeinander ein. Das ließ uns die Pandemie erleben, als sich der Virus entlang von globalen Wirtschaftswegen verbreitete und auf Gesundheitssysteme traf, die durch austeritäre Sparmaßnahmen geschwächt waren. In der Coronakrise wurde die Krise der sozialen Reproduktion offenbar, die in dem auf Produktivität und Wachstum gepolten Wirtschaftssystem angelegt ist und die sich durch Jahrzehnte neoliberaler Privatisierung massiv verschärft hat. Im Windschatten von Wirtschaftskrisen entstehen Krisen der öffentlichen Gesundheit. So war es während der Finanz- und Eurokrisen ab 2008, als zahlreiche Menschen neben ihrer Arbeit und ihrem Zuhause den Zugang zur Gesundheitsfürsorge verloren. Dieses Gesamtgefüge einander verstärkender Krisen manifestiert sich physisch und psychisch. Unsere Körper geraten in die Krise, sind gestresst, erschöpft, kränkeln – oder sind Gefahren ausgesetzt, durch drohende Gewalt, mangende Gesundheitsfürsorge, fehlendes Essen, ausufernde Stürme und Überschwemmungen.
In ihren materiellen Auswirkungen verweisen solche Krisenmomente auf unsere Körperlichkeit, eine Körperlichkeit, die verletzlich und versehrbar ist. Ebenjene Verwundbarkeit wirft uns darauf zurück, dass wir miteinander verbunden und aufeinander angewiesen sind. Nicht allein mit den uns nahestehenden, sondern ebenso mit uns entfernten Menschen, wenn auch in verschiedenen Weisen. Die Mehrheit der Menschheit weiß das seit langem. Doch 10viele der bislang wohlstandsgeschützten Menschen in westlichen Gesellschaften nehmen diese Abhängigkeit erst wahr, wenn transnationale Wirtschaftssysteme ins Stocken geraten, Lieferketten zusammenbrechen und der Warenfluss im Supermarktregal ausbleibt, wenn plötzlich auch vor ihrer Haustür Extremwetterphänomene zunehmen, wenn Kriege und Katastrophen bedrohlich nahe kommen und nicht mehr die weit weggerückten Probleme anderer sind. Es ist allerhöchste Zeit, sich mit dieser Abhängigkeit auseinanderzusetzen.
Diese globale Abhängigkeit ist allerdings von Ungleichheit geprägt. Die Vielfachkrisen unserer Gegenwart verdeutlichen, wie Abhängigkeitsverhältnisse asymmetrisch ausgebeutet werden. Fatale Folgen der Gewinnsucht des Kapitals werden einseitig angelastet, und zwar vornehmlich denen, die weder in der Verantwortung stehen noch den Profit einstreichen – auch das führt die Klimakrise vor Augen. Trotz dieser geschichtlich gewachsenen Gegenwartslage der Ungleichheit zeugt Abhängigkeit genauso von Gleichheit. Als erfahrbare Abhängigkeit legt sie offen, dass wir, um bestehende und kommende Krisen zu bewältigen, der Solidarität und der kooperativen Beziehungen bedürfen. Bei allem Schrecken und aller Bedrohlichkeit, die Abhängigkeit und Verwundbarkeit bergen, wohnt ihnen ein Versprechen inne – auf egalitäre, solidarische, sorgende Praktiken.
Unsere Verbundenheit und unsere Verwundbarkeit sind unserer Körperlichkeit geschuldet. Da wir zuallererst körperliche Wesen sind, die von Geburt an Zuwendung brauchen, teilen wir ein Grundbedürfnis nach Sorge. Sosehr wir einander gefährden, so sehr sind wir durch unser Sorgebedürfnis aneinander gebunden (Butler 2005, 37). Da Menschen aufeinander angewiesen sind und sich gemeinsam organisieren müssen, sind ihre Körper politisch. Der Umstand, durch einander verwundbar und aufeinander bezogen zu sein, erfordert ein radikales Umdenken: von Einzelkörpern hin zu Körpern im Plural. Darin zeichnet sich der philosophische Horizont einer relationalen Ontologie ab. Die uns umtreibenden Krisen – Coronakrise, Klimakrise, Sorgekrise, Gesundheitskrise – leuchten die politischen Dimensionen von Körperlichkeit grell aus. Zum einen machen sie sichtbar, wie sehr wir einander beschützen müssen, zum anderen, wie ungleich Schutz und Sorge verteilt sind.
Die krisengeschüttelte Gegenwart wirft folglich Fragen und 11Forderungen nach Gleichheit, Gerechtigkeit und Gemeinwohl auf. Wie lassen sie sich mit unserer verkörperten Verbundenheit zusammenführen? Um Gleichheit und Ungleichheit ausgehend von Körpern zu denken, beginnt mein Vorgehen gewissermaßen »von unten« und setzt bei Verkörperung, Verbundenheit und Verwundbarkeit ein.[1] Für eine solche Erkundung der Gleichheit soll hier das Konzept eines Universalismus von unten eingeführt werden. Es wird in der Auseinandersetzung mit solidarischen Sorgepraktiken, egalitären Körperpolitiken und widerständigen Wissensproduktionen Konturen gewinnen. Zugleich eröffnet es einen normativen Horizont, um bestehende Ungleichverhältnisse im Unterfangen einer Ökonomiekritik von unten zu untersuchen. Das Bestreben meines sozialphilosophischen Bottom-up-Ansatzes liegt darin, eine Theorie der radikalen Gleichheit zu umreißen, die auf Differenz aufbaut und sich in solidarischer Praxis verwirklicht. Dafür verfolge ich eine zweifache Fragestellung: In analytischer Hinsicht frage ich, wie sich Ökonomie als differentielle Körperökonomie betrachten lässt, die Menschen in ungleichem Maße verwundbar macht. In normativer Hinsicht frage ich, wie solidarische Praktiken als egalitäre Körperpolitiken wirksam werden, die Formen gelebter Gleichheit hervorbringen.
Obwohl Verwundbarkeit, als allgemeine Grundbedingung von Körpern verstanden, auf Gleichheit hindeutet, besteht sie ebenso im Besonderen: in der konkreten, körperlichen Erfahrung, verwundbar zu sein und verwundet zu werden, auf je verschiedene Weisen. Der uns einende Umstand, durch Verwundbarkeit verbunden zu sein zu sein, weist auf eine Gleichheit hin, die von unten, von Körpern herkommt. Dennoch scheint Verwundbarkeit ungleich ver12teilt zu sein. Um diese Doppelbödigkeit analytisch zu fassen, ist mir das heuristische Begriffspaar der universellen Verwundbarkeit und der strukturellen Verwundbarmachung behilflich. Universelle Verwundbarkeit bildet einen normativen Begriff, während strukturelle Verwundbarmachung einen analytischen Begriff bereitstellt. In diesem begrifflichen Verhältnis bildet die universelle Verwundbarkeit den normativen Rahmen für die kritische Untersuchung der ungleichen Verwundbarkeitsverteilung in der politischen Praxis. Aufgrund der sozialen Verfasstheit ihrer Körper teilen Menschen eine universelle Verwundbarkeit. Das legt den egalitären Anspruch nahe, allen gleichermaßen Schutz und Sorge zuteilwerden zu lassen. Dennoch werden sie durch Formen der strukturellen Verwundbarmachung, wie sie in den bestehenden Verhältnissen vorherrschen, ungleich gemacht. Während die universelle Verwundbarkeit als Grundbedingung des Lebens allen gemein ist, spielt sich strukturelle Verwundbarmachung inmitten des politischen Geschehens ab und materialisiert sich in prekären Lebensbedingungen.
Um die Feinstofflichkeit zwischenmenschlicher Beziehungen zu fassen, bedarf es einer sozialphilosophischen Sichtweise, die sich zur Politischen Theorie öffnet und danach fragt, wie soziale Bindungen Solidarität stiften und egalitäre Praktiken hervorbringen können. Solch eine Blickrichtung von unten, die Gleichheit und Solidarität nicht auf der Ebene von Recht, Institutionen und Staatlichkeit veranschlagt und sie stattdessen als prekäre Praxis betrachtet, stellt Sorge in den Vordergrund. In praxeologischer Perspektive scheint Solidarität untrennbar mit Sorgebeziehungen verflochten. Wie lassen sich »solidarische Beziehungsweisen« (Adamczak 2017, 263) als sorgende Praktiken und egalitäre Körperpolitiken begreifen? Bleibt man bei der Betrachtungsweise von unten, werden solidarische Beziehungen in ihrer Körperlichkeit und Affektivität sichtbar, schließlich sind sämtliche sozialen Praktiken verkörpert. Diese verkörperte Verbundenheit scheint ein Versprechen auf Gleichheit zu bergen. Durch sie zeigt sich Solidarität als relationale, radikalegalitäre Praxis, die im Wissen um geteilte Verwundbarkeit entsteht – so meine Vermutung. Die Annahme, dass Menschen voneinander abhängig sind, führt zum Anspruch, allen gleichermaßen Schutz und Sorge angedeihen zu lassen – was wiederum den Weg zur Solidarität freilegt.
Wie ist dieses Nahverhältnis zwischen Solidarität und Sorge, Verkörperung, Verbundenheit und Verwundbarkeit zu verstehen? 13Wie lässt sich Differenz mitdenken? Eine Gleichheit zwischen Körpern anzunehmen, kann ja keineswegs bedeuten, diesen ein Gleichsein zu unterstellen oder aufzwingen zu wollen. Auch Solidarität muss Differenz einbeziehen, denn eine Gemeinschaft, die sich auf eine rigide Gruppenidentität beruft, kann schwerlich egalitär sein. Um diesen Fragen nachzuspüren, betrachte ich solidarische Sorgepraktiken als egalitäre Körperpolitiken. Gleichheit wird also in ihrer graswurzelmäßigen Verflechtung mit solidarischen Beziehungen und Bewegungen untersucht, als prekäre, kontingente Praxis. Dieser Gleichheitsbegriff ist insofern radikal, als er – im etymologischen Sinne von »an die Wurzel gehen« – bei Körpern und ihren Lebensbedingungen ansetzt. Er ist in relationaler, materialistischer und politischer Hinsicht radikal. Zunächst ist freilich jeglicher Gleichheitsbegriff relational, da Egalität auf die Beziehung von Menschen abzielt. Doch während Relationalität oftmals Individuen beschreibt, die in Beziehung treten, wird sie hier tiefer gehend gefasst, weil Menschen schon aufgrund ihrer körperlichen Verfasstheit verbunden sind. Mein Verständnis radikaler Relationalität erweitert den geläufigen Gleichheitsgedanken und lässt verkörperte Verbundenheit als philosophischen Ausgangsort egalitärer Beziehungen aufscheinen. Gleichheit wird hier in materialistscher Hinsicht radikal gefasst, insofern Wege alternativer Wirtschaftsweisen gesucht werden, die auf Gemeinwohl und Gemeingüter anstelle von Profit, Wachstum und Privateigentum aufbauen. Daran anknüpfend wird Gleichheit im politischen Sinne radikal gedacht, weil es für solche kommunalökonomischen Praktiken Organisationsmodi der erweiterten demokratischen Lebensformen bedarf. Um uns als Gleiche anzuerkennen, brauchen wir radikalegalitäre, radikaldemokratische Teilhabe- und Organisationsmöglichkeiten. Das ist keineswegs mit dem Dogma einer absoluten Gleichheit zu verwechseln, schließlich ist meine Vorstellung radikaler Gleichheit maßgeblich davon bestimmt, dass wir uns in unseren Differenzen anerkennen und gerade darin als Gleiche behandeln. In solidarischen Beziehungsweisen, im Aushandeln unserer vielfältigen Standpunkte liegt das emanzipative Potenzial gelebter Gleichheit. Sie wird also auch politisch radikal ersonnen, weil sie gegenläufig zur formellen, vom Gesetz gewährten Gleichheit im sozialen Geschehen ansetzt. Radikale Gleichheit ist relational, sie ist differentiell und sie ist praktisch.
14Diese drei Modi radikaler Gleichheit werde ich als Analyseaspekte anwenden. Der relationale Aspekt verweist auf verkörperte Verbundenheit. Der differentielle Aspekt schließt im politisch positiven wie negativen Sinne Differenz ein. Der praktische Aspekt führt dahin, Gleichheit als solidarisches, sorgeökonomisches Beziehungsgeschehen zu betrachten, das unweigerlich prekär bleibt. Mithilfe dieser angerissenen Begriffswerkzeuge und Analyseaspekte soll geprüft werden, ob eine Kernthese dieses Buches trägt. Sie besagt, dass solidarische Praktiken zu egalitären Körperpolitiken werden, sobald sie sich gegen strukturelle Verwundbarmachung wenden und ein Wissen universeller Verwundbarkeit hervorbringen, so dass Gleichheit als gelebte, prekäre Praxis sichtbar wird. Solche Formen der solidarischen Sorge und gelebten Gleichheit lassen sich als Anzeichen eines Universalismus von unten auffassen.
Am Horizont dieser Überlegungen steht der Gedanke eines Universalismus von unten, dessen kontingente Grundlagen auf Differenz beruhen und der das »Recht auf Differenz in der Gleichheit« (Balibar 2012, 110) praktisch umsetzt. Aufklärerische Universalismusmodelle, wie sie sich bei Jean-Jacques Rousseau oder Immanuel Kant finden, bauen auf den impliziten Normen bürgerlicher, weißer Männlichkeit auf. Diese Normen verklammern sich mit der Figur des Vernunftsubjekts, wie sie Kant in seiner Vertragstheorie emporhält, während er in seinen aufklärungsphilosophischen und anthropologischen Schriften Frauen und rassifizierte Menschen aus der Sphäre der Vernunft ausschließt (Kant 1984; 2014, A390-A417; A482). Das aufklärerische Vernunftideal neigt dazu, Körperlichkeit und Affektivität zu überblenden. Dennoch sind Körper nicht gänzlich abwesend. Sie finden sich in Rousseaus romantisierenden Schilderungen des selbstgenügsamen Subjekts ebenso wie in den Naturzustandsszenarien von Thomas Hobbes (1966) und John Locke (1977), wo sie weitaus präsenter sind als in Kants Konzeption des Vernunftrechts. In Hobbes’ und Lockes Schriften wird die Selbstbestimmung über den eigenen Körper epistemisch mit dem Eigentumsrecht verkoppelt – als Selbstbesitz am eigenen Körper –, wodurch die Sphäre der Gleichen gegenüber den Besitzlosen abgegrenzt wird und den Besitzenden vorbehalten bleibt. Fortan galten zu Zeiten der Aufklärung allein weiße, wohlhabende Männer als Gleiche unter Gleichen. Sie konnten zur »körperlosen Norm« wer15den, die seltsam entkörpert erscheinen, wohingegen »allen Anderen politische Handlungsfähigkeit gerade aufgrund einer vermeintlichen Minderwertigkeit oder Mangelhaftigkeit ihrer Körper abgesprochen« (Ludwig 2021b, 659) wird. Diese Ausgrenzungen sind nicht rein philosophischer Art, sie unterliegen materiellen Ausbeutungsstrukturen. Die ungleiche Körperordnung, die zu Lebzeiten von Hobbes und Locke in der englischen Eigentümergesellschaft des 17.Jahrhunderts im Entstehen begriffen ist, gründet auf kolonialer Versklavung und vergeschlechtlichter Arbeitsteilung, die Kernkomponenten des aufkommenden Kapitalismus bilden.
Sicherlich befinden sich alle Menschen situativ und sozial in Abhängigkeitsverhältnissen, so dass sie ihre Bedürfnisse miteinander organisieren müssen. Doch einmal abgesehen davon, dass diese konkreten Abhängigkeiten jeweils anders ausgeprägt und ausgebeutet werden, werden sie verschieden diskursiv gerahmt. Während die Abhängigkeit der einen als quasi naturgegeben dargestellt wird, soll die Abhängigkeit der anderen vergessen gemacht werden. Die Aufklärungsphilosophie nährt das maskuline Ideal des selbstgenügsamen Subjekts und unterschlägt, wie sehr die weißen, bürgerlichen, männlichen Körper von der Arbeit der anderen Körper abhängen und in privilegierter Stellung von ihr profitieren. Der Unterbau der bürgerlichen Ordnung der Gleichen wird von denen getragen, die in den Fabriken ausgebeutet werden, deren Arbeitskraft kolonialwirtschaftlich enteignet wird oder die als Liebesdienst verstandene Hausarbeiten verrichten. Diese Ordnung ausgebeuteter, enteigneter Körper, die als Fundament der bürgerlichen Gesellschaft fungiert, führt dazu, dass sich der aufklärerische Gleichheitsgrundsatz in unhaltbaren Widersprüchen verfängt.
Diese wiederkehrenden Widersprüche sollten allerdings nicht dazu verleiten, mit den Ideen von Gleichheit und Universalismus zu brechen. Ganz im Gegenteil gilt es, die Spuren eines Universalismus von unten zu verfolgen, der das Gleichheitsversprechen radikal erweitert. Neben anderen Mitstreiterinnen des frühen Feminismus wie Mary Wollstonecraft kritisierte etwa Olympe de Gouges, dass die 1789 von der französischen Nationalversammlung verabschiedete Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen Männern vorbehalten blieb (Gouges 1980). Auch die Freiheitskämpfer:innen der Haitianischen Revolution, die nach 1791 den Sturz der französischen Kolonialherrschaft herbeiführten, beriefen sich auf den 16universalistischen Gehalt der Menschenrechtserklärung von 1789 (Buck-Morss 2018, 58f.). Diese egalitär-emanzipativen Bewegungen fechten die Begrenzungen des aufklärerischen Universalismus an, in ihnen zeichnet sich eine Gleichheit ab, die von unten kommt, weil sie von jenen erkämpft wird, die nicht als vollwertige politische Subjekte gelten. Die »Universalität blitzt in jenen Momenten auf, in dem sich die Sklaven selbst bewußt wurden, daß ihre Situation vom Standpunkt der Humanität aus nicht länger zu ertragen war«, schreibt Susan Buck-Morss (2018, 184). Sie begreift dieses Aufblitzen als »Universalismus von unten« (Buck-Morss 2018, 144), der »an den Bruchstellen historischer Abläufe« erscheint, denn »in diesen Momenten der geschichtlichen Diskontinuität verleihen Menschen […] einer Humanität Ausdruck, die die kulturellen Grenzen überschreitet« (Buck-Morss 2018, 183). Erst wenn wir uns »mit diesem rohen, freien und verwundbaren Zustand identifizieren, können wir verstehen, was sie uns sagen wollen« (Buck-Morss 2018, 183). Mithin werden »neue, untergründige Formen der Solidarität« möglich, die »an unser universelles, moralisches Empfinden appellieren, das heute die Quelle des Enthusiasmus und der Hoffnung darstellt« (Buck-Morss 2018, 184). Buck-Morss bringt den Begriff eines Universalismus von unten bloß beiläufig ein, ohne ihn weiter auszuführen. Anlass genug, den Begriff aufzugreifen, auszuarbeiten und sich auf die Suche nach möglichen Erscheinungsformen eines Universalismus von unten zu begeben. Während Buck-Morss ihn innerhalb einer Universalgeschichte erkundet, suche ich seine Spuren in der Gegenwart. Erste Züge deuten sich schon an: In Abgrenzung zu den aufklärungsphilosophischen Ideen baut der Gedanke eines Universalismus von unten auf Differenz in der Gleichheit auf.
Von der Aufklärung bis heute binden Universalismus- und Menschenrechtsdiskurse Gleichheit an Eigentumsrecht. Doch jenes Recht, das Gleichheit verheißt, erlaubte in den Anfängen der Kapitalismusgeschichte ebenfalls die Enteignung der Allmende. Trotz aller Maßnahmen und Fortschritte hin zu einer gerechteren Verteilung bleibt die Gegenwart von enormer Vermögensungleichheit bestimmt. Es gibt also begründete Skepsis gegenüber dem Egalitätsversprechen des Eigentumsrechts. Statt am ökonomischen Primat von privatwirtschaftlichem Eigentum und unternehmerischem Profit festzuhalten, orientiert sich der Gedanke eines Universalismus von unten am Gemeinwohl. In diesem radikalegalitären, öko17nomiekritischen Unterfangen geht es mir nicht darum, alternative Rechtsformen und -erweiterungen zu finden, vielmehr erkunde ich praktische Erscheinungen einer gelebten Gleichheit, die vorführen, wie wir uns gemeinwohlorientiert organisieren können. Deshalb sind Erscheinungsformen eines Universalismus von unten nicht in idealen Entwürfen rechtlicher Freiheit zu finden, die oftmals westliche, eigentumslogische Normen der aufklärungsphilosophischen Universalismusmodelle fortführen. Die Spuren solch eines Universalismus von unten sind in solidarischen Praktiken zu suchen, die das Wohl aller im Sinne haben und es ein Stück weit umsetzen.
Für diese Erkundung bedarf es einer nicht-idealen normativen Theorie, die mit der Untersuchung von Ungleichheit beginnt. Denn um Gleichheit zu denken, muss man begreifen, wie Menschen ungleich gemacht werden. Der Gedanke einer praktischen Gleichheit zielt also nicht auf ideale Modelle einer gerechten Gesellschaft ab, er beginnt mitten im Bestehenden. Solch eine Vorgehensweise folgt dem Vorschlag Theodor W. Adornos, das Leiden in der Welt als Ausgangslage für die philosophische Praxis zu nehmen: »Das Bedürfnis, Leiden beredt werden zu lassen, ist Bedingung aller Wahrheit. Denn Leiden ist Objektivität, die auf dem Subjekt lastet; was es als sein Subjektivstes erfährt, sein Ausdruck, ist objektiv vermittelt« (Adorno 1966, 27). Ohne selbst einen Begriff des Vulnerablen zu entwickeln, bewegen sich seine Betrachtungen des beschädigten Lebens – so der Untertitel der Mimima Moralia (Adorno 2012) –, die unauflöslich mit seiner Philosophie nach Auschwitz verbunden sind, in der Nähe eines Denkens der Verwundbarkeit. Statt auf die Unversehrtheit und Souveränität eines abgeschotteten Subjekts zu setzen, geht es Adorno um das Leiden, das kapitalistische Verwertungsstrukturen erzeugen, ein Leiden, das seinen Ausdruck im Körperlichen findet. Adornos Aufforderung, ausgehend vom geteilten Leiden und beschädigten Leben zu denken, führt in eine materialistische Philosophie, die nach den Bedingungen fragt, in denen Menschen leben. Deshalb bildet Ungleichheit die Ausgangslage, um nach den Ermöglichungsbedingungen einer Gleichheit zu fragen, die sich in solidarischen Beziehungen entfaltet.
Solch eine praxeologische Perspektive erfasst Egalität in ihren konkreten Bezügen. Anstelle von Idealmodellen frage ich nach möglichen Verwirklichungswegen in gegebenen Gesellschaftsverhältnissen. Dieses Vorgehen folgt der Methodik nicht-idealer Theorie, die in der Politischen Philosophie in kritischer Auseinandersetzung mit John Rawls’ Gerechtigkeitstheorie entstand (vgl. Schaub 2010). Wegweisend ist Charles Mills’ Kritik an idealen Theorien (2005), wie sie Rawls’ Gerechtigkeitstheorie (Rawls 2020) repräsentiert. Mills legt dar, wie Rawls’ Theorie Unterdrückungsverhältnisse entweder naturalisiert oder ausblendet. Gemeinhin arbeiten solche analytischen, moralphilosophischen Ansätze mit Modellen einer idealen Gesellschaft (Mills 2005, 166f.). Infolgedessen klammern sie die Aktualität gesellschaftlicher Wirklichkeiten aus. Ideale Theorien, so Mills, stellen entweder stillschweigend das Tatsächliche als eine Abweichung vom Ideal dar, die zu theoretisieren nicht lohne, oder es wird behauptet, der Ausgang von einem Ideal sei der beste Weg, um bessere gesellschaftliche Zustände zu verwirklichen (Mills 2005, 168) Angesichts dessen macht er kennzeichnende Merkmale idealer Theorien aus: Sie idealisieren soziale Institutionen und schweigen sich über Unterdrückungsverhältnisse aus (Mills 2005, 168f.). Sie gehen von einem abstrakten, undifferenzierten, vereinheitlichten, atomistischen Individuum aus, das typisch für den klassischen Liberalismus ist. Es erscheint losgelöst von bestehenden Beziehungen struktureller Beherrschung, von Zwang, Ausbeutung und Unterdrückung, die Menschen in über- oder untergeordnete Stellungen einsortieren (Mills 2005, 168). Die Annahme idealer sozialer Institutionen übersieht die institutionalisierte Strukturhaftigkeit von Ungleichheit in der Familie, der ökonomischen Ordnung und im Rechtssystem (Mills 2005, 169). Auf diese Art werden Unterdrückungsstrukturen systematisch verschwiegen. So verweist Mills darauf, wie Rawls’ Gerechtigkeitstheorie die bürgerliche Familie als Ideal hochhält, wodurch geschlechterpolitische Ungleichheit und patriarchale Gewalt unbeachtet bleiben (Mills 2005, 178f.). Ebenso ausgespart wird die Geschichte von Kolonialismus, Versklavung und rassistischen Strukturen (Mills 2005, 173). Darin macht Mills ideologische Tendenzen aus, die den begrenzten habituellen Horizonten innerhalb der Moralphilosophie geschuldet sind. Indem die Philosophierenden Ungleichheit außer Acht lassen, können sie ebenjene Privilegien verschleiern, die ihnen selbst zugutekommen. Ideale Theorien befördern, schreibt Mills, einen verzerrten Ideenkomplex voller Werte, Normen und Überzeugungen, der Interessen und Erfahrungen einer kleinen Minderheit – 19weiße Männer der Mittel- und Oberschicht – widerspiegelt, die in der philosophischen Fachwelt stark überrepräsentiert ist (Mills 2005, 172). Man sollte daher die Frage stellen: Wem kommen die moralphilosophischen Modelle zupass, die strukturelle Ungleichheit wegabstrahieren (Mills 2005, 172)? Ideale Theorien stützen die Interessen derjenigen, die aufgrund ihrer privilegierten Stellung als weiße, bürgerliche Männer Erfahrungen machen, die dem von ihnen vertretenen Ideal am nächsten kommen, so dass sie kaum kognitive Dissonanzen zwischen ihren Denkmodellen und ihrer Lebenswirklichkeit erkennen und empfinden können (Mills 2005, 172). Dagegen liegt die analytische Stärke nicht-idealer, kritischer Theorien darin, akkurat die gesellschaftlichen Wirklichkeiten zu kartografieren, indem sie die sozialen Stellungen innerhalb der von ihnen beschriebenen Systeme differenzieren und auf diese Weise abstrahieren, ohne zu idealisieren (Mills 2005, 175). Mills argumentiert nicht gegen Abstraktion und Verallgemeinerung, schließlich bergen Partikularismus und Relativismus ihrerseits politische Risiken, da sie die Begründungsmöglichkeiten für Gerechtigkeits- und Gleichheitsforderungen unterlaufen, etwa für racial justice oder Geschlechtergerechtigkeit (Mills 2005, 174). Für ihn bedarf es normativer Theorien, die bestehende Unterdrückungsstrukturen kritisch aufzeigen. Anstelle eines falschen Universalismus, wie ihn ideale Theorien vorgeben, ist eine normative, nicht-ideale Theorie zu entwerfen, die bei Unterdrückung und Ungleichheit ansetzt (Mills 2005, 173). Solch ein nicht-idealisierender Ansatz kann potenziell universalistisch sein, wenn er, wie Mills ausführt, die besondere Erfahrung der Unterdrückten widerspiegelt und Partikularismus und Relativismus vermeidet (Mills 2005, 166). Hier findet sich ein Hinweis auf einen Universalismus von unten, der bei der Kritik von differentieller Unterdrückung und Ungleichheit beginnt.
Als altbekannte, brauchbare Analysebeispiele führt Mills Marx’ Konzept des Kapitalismus, das feministische Konzept des Patriarchats und das antirassistische Konzept der weißen Suprematie an. Sie arbeiten mit Abstraktionen, die Besonderheiten von Gruppenerfahrungen reflektieren, und als kritische Konzepte machen sie Ungleichheit sichtbar, statt diese zu verschleiern (Mills 2005, 173). Dergestalt fungieren sie als Metatheorien, die offenlegen, wie Herrschaftssysteme die idealen Vorstellungen formen (Mills 2005, 174). Zugleich zeigen sie auf, wie dominierende Denksysteme Ungleich20machung und Unterdrückung verunsichtbaren. Vor allem lenken sie die Aufmerksamkeit auf die differentiellen und differenzierenden Strukturen, die kapitalistische Gesellschaftsordnungen hervorgebracht haben. Infolgedessen lehnt sich diese kritische, nicht-ideale Ausrichtung an Marx’ materialistische Herangehensweise an, die nicht bei abstrakten Idealen, sondern bei konkreten, materiellen Bedingungen beginnt (Mills 2005, 182). Im Gegensatz zum reibungslosen Erfahrungsraum des abstrakten, universellen Subjekts der traditionellen Erkenntnistheorie sollen nicht-ideale Theorien die differenzierte Erfahrungsperspektive sozial situierter Subjekte fassbar machen (Medina 2013, 43). Dergestalt können kritische Konzepte, welche die Situiertheit von Wissen und die differentiellen Auswirkungen von Unterdrückung einbeziehen, widerständige Epistemologien hervorbringen. In ihren machtanalytischen Manövern ermöglichen nicht-ideale Theorien gegenüber idealen Theorien, epistemische Asymmetrien und materielle Ungleichheit aufzuzeigen, und vermögen so, Schritte zu ihrer Transformation vorzuschlagen (Mills 2005, 183).
Indem sie sich den materiellen Bedingungen von Ungleichheit zuwenden, überschneiden sich die Herangehensweisen von Adorno und Mills. Allerdings bezieht sich Mills dediziert auf die feministische Standpunkttheorie und weist darauf hin, dass man nicht von einem universellen Subjekt ausgehen sollte und stattdessen differentielle Subjektpositionen entlang der Machtachsen von Klasse, Geschlecht und race betrachten müsse (Mills 2005, 175). Im Anschluss an Mills’ nicht-idealen Ansatz plädiert John Ingram in seinem Entwurf eines Kosmopolitismus von unten für einen Realismus der Möglichkeiten, der politische Praktiken im Blick auf ihre egalitäre Potentialität untersucht (Ingram 2013, 273f.). Diese Suchbewegung umfasst keine feststehenden universalistischen Werte, sie umkreist Politiken der Universalisierung (Ingram 2013, 4). Ebensolchen Politiken der Universalisierung gilt meine Aufmerksamkeit, deshalb verschreibt sich dieses Buch der Aufgabe, konkrete, kontingente Verwirklichungen egalitärer Körperpolitiken aufzufinden und aufzuzeigen, wie sie graduell Gleichheit ermöglichen.
»Von unten« vorzugehen, um von dort aus Gleichheit und Universalismus zu untersuchen, hat eine unzweifelhaft schwierige Unterscheidung zwischen Oben und Unten zur Voraussetzung. Sie sug21geriert eine populistische Gegenüberstellung von gesetzgebenden Mächtigen und entrechteten Aufbegehrenden. Zugegebenermaßen ist diese Assoziation nicht gänzlich ungewollt, doch zuallererst markiert »von unten« meine analytische und normative Vorgehensweise. Schließlich liegt der politiktheoretische Fokus auf molekularen Solidaritätsgefügen und Protestbewegungen und nicht auf den molaren Institutionen von Staat und Recht. Im Zuge der Untersuchung werden ich diese Ebenen – die widerständigen Organisationsformen im Politischen und die Institutionen der Politik – in ihrem Wechselspiel beobachten, im Bemühen, allzu schematische Einteilungen in Oben und Unten zu vermeiden. Da meine Betrachtungen im Politischen beginnen, fangen sie von unten an, und zwar in einer Bottom-up-Ausrichtung, die der Radikalen Demokratietheorie nahesteht. Dabei geht ein »radikaldemokratisches Politikverständnis […] davon aus, dass sich Demokratie und Politik nicht auf Institutionen und Verfahren reduzieren lassen, sondern als eine immer neu und aus sich selbst heraus begründete Praxis freier Gleicher erscheint« (Leonhardt und Nonhoff 2020, 24).[2] Gleichheit als Bewegung von unten im unentwegten Aushandlungsgeschehen anzusehen, folgt unverkennbar Jacques Rancières Gedanken des Unvernehmens, der das Politische darin sieht, dass die Grenzen der Politik von denen angefochten werden, die nicht zur Sphäre der Gleichen gerechnet werden (Rancière 2022).
Diese Blickrichtung ist sozialphilosophisch geprägt, da die Ausgangslage das soziale Beziehungsgeschehen bildet. Von dort aus erkunde ich die realökonomischen Verhältnisse sowie radikalegalitäre Möglichkeiten. Anstelle übergeordneter Werte wie Würde oder Vernunft fängt meine Untersuchung bei Verbundenheit und Verkörperung an, also gewissermaßen bei den basalsten menschlichen Gemeinsamkeiten, um von dort nach Gleichheit und Ungleichheit zu fragen. Insofern kennzeichnet »von unten« meine Frage- und Blickrichtung, ohne sich an der Gegenüberstellung von Oben und Unten abzuarbeiten. Darin entfaltet sich eine praxisphilosophische Perspektive, die spielerisch an Pierre Bourdieus Praxeologie anschließt, um verkörperte Handlungen in die analytische Aufmerksamkeit zu rücken (Bourdieu 2018, 203-207). Um Gleichheit 22von unten zu denken, verwende ich eine Methode, die auch Ungleichheit von unten untersucht. Angelehnt an Bourdieus Arbeiten (1997), betrachte ich die Verkörperungsweisen von sozialer Ungleichheit. Allerdings verkehre ich seinen Ansatz dahingehend, dass ich neben der bestehenden Ungleichheit nach Verkörperungsmöglichkeiten der Gleichheit frage.
Zwar ist es unerlässlich, bei Ungleichheit und – mit Adorno gesprochen – beim Leiden anzufangen. Dennoch darf man Ungleichheit nicht als unhintergehbaren Umstand voraussetzen, weil man sonst riskiert, sie als unveränderbar festzuschreiben. Deshalb unterscheidet Jacques Rancière eine Methode der Gleichheit von einer Wissenschaft der Ungleichheit, wobei Letztere in emanzipativem Selbstverständnis zwar vorgibt, Gleichheit als erreichbares Ziel aufzufassen, doch dieses unaufhörlich verschiebt (Rancière 2021, 134-138). Solch eine Wendung macht er in der zeitgenössischen, sich herrschaftskritisch verstehenden Soziologie aus, wie sie Bourdieu vertritt, an dem sich Rancière ausgiebig abarbeitet (Rancière 2010, 226-229). Bourdieu setze in neuer empirischer Form die alte Überheblichkeit der Philosophie fort, wenn er Arbeiter:innen unterstelle, sie würden ihre Ausbeutung in ideologischer Verblendung verkennen, wodurch er ihnen die Befähigung zu emanzipativem Wissen abspreche (Rancière 2021, 120). Da für Bourdieu in allem sozialen Geschehen versteckte, verkannte Herrschaftsmechanismen am Werk seien, werde Ungleichheit als unwandelbar dargestellt und mögliche Wege zur Gleichheit würden versperrt (Rancière 2021, 122). Diese Wissenschaft der Ungleichheit vollführt einen »Prozess, der Gleichheit für später verspricht und dabei auf unbestimmte Zeit Ungleichheit reproduziert« (Rancière 2021, 134).
Dem hält Rancière eine Methode der Gleichheit entgegen, die den vermeintlich unwissenden Unterdrückten ihr Wissen nicht abspricht und diesen zuerkennt, ihre eigene Ausbeutung zu durchschauen und handlungsfähig zu sein, um die symbolische Platzordnung zu durchbrechen. Insofern bedeutet Emanzipation für ihn, im ästhetischen Erleben mit habituellen Wahrnehmungsmustern zu brechen, sich zu ermächtigen, die Welt anders zu erfahren, und dadurch die Aufteilung des Sinnlichen zu durchkreuzen (Rancière 2021, 124). An geeigneten Stellen werde ich ausführlicher auf Rancières Methode der Gleichheit zu sprechen kommen, die ich aufgreife und leicht abwandle, um egalitäre Körperpolitiken zu erkun23den. Dafür werde ich beide, Rancière wie Bourdieu, gewissermaßen gegen den Strich lesen, weil ich Rancières egalitär-emanzipativen Einsatz mit Bourdieus körpersoziologischen Einsichten verknüpfe. Schließlich, so mein Argument, besteht der Bruch mit habituellen Mustern nicht in einem einmaligen Ereignis, vielmehr muss Gleichheit eingeübt werden, weshalb ich die Methode der Gleichheit mit Bourdieus Begriff der Gegendressur zusammenbringe, was ich mithilfe meines Konzept der affektiven Gegenhabitualisierung zu fassen versuche.
Rancières egalitäre Methode ist für mein Theorievorhaben wegweisend, da sie Gleichheit nicht als zukunftsfernen Zustand fasst, keine Blaupause zur Emanzipation zeichnet, vielmehr die Kontingenz und Prekarität egalitärer Praktiken hervorhebt – all dies entspricht meinem Gedanken radikalrelationaler Gleichheit:
[…] Die Methode der Gleichheit [schlägt] kein Gegenmodell der Zukunft vor. Sie entwirft keine Strategie, um von der gegenwärtigen Situation an ein bereits bekanntes Ziel zu gelangen. Vielmehr betont sie die in jedem Moment vorhandene Spannung zwischen den Gegensätzen. […] Die Methode der Gleichheit ist überall zu jedem Zeitpunkt am Werk. Es mag sein, dass sie keine bestimmte Zukunft verspricht, aber neue Horizonte erschließen sich nicht durch die Planung der Zukunft. Eine unvorhersehbare Zukunft geht ganz im Gegenteil aus der inneren Gespaltenheit der Gegenwart und aus den Erfindungen der Methode der Gleichheit hervor. (Rancière 2021, 136f.)
Praktisch-philosophisch gesehen hat die Methode der Gleichheit drei wesentliche Einsätze: Sie spricht denjenigen, die sich in Ausbeutungsverhältnissen befinden, nicht ihr Wissen ab, sondern sucht aktiv nach deren Einsichten und Erkenntnissen. Sie missachtet die disziplinären Grenzen und methodologischen Regeln der Wissenschaft und »versucht, Formen intellektueller Indisziplin zu fördern« (Rancière 2021, 134). Sie widerstrebt den epistemischen Hierarchien zwischen Expert:innen und Betroffenen und zieht lange transversale Linien quer durch die Diskurs- und Zeitkontexte, um »ein Sprachgeflecht [zu] schaffen, in dem egalitäre Verbindungen mit anderen, in anderen historischen Kontexten und auf anderen Gebieten des Denkens angesiedelten Auftritten erprobt werden können« (Rancière 2021, 132). Das spiegelt sich in meinem Ansatz, bei Körpern anzufangen, den Lebensbedingungen und Erzählungen 24derer zu folgen, die ausgebeutet und enteignet werden, nach ihren Erfahrungen und Erkenntnissen ebenso wie nach den widerspenstigen Wissensproduktionen politischer Bewegungen zu fragen. Dergestalt verweigert sich mein transversales Vorgehen der Zuordnung zu einer klar gekennzeichneten intellektuellen Tradition, der Zugehörigkeit zu einer akademischen Schule oder der Stellungnahme in einem ausgewiesenen Forschungsfeld. Was die einen als methodische Schwäche auslegen mögen, stärkt meinen Gleichheitsbegriff, den ich querlaufend durch disziplinäre Ordnungen aufbaue, ganz im Gedanken der von Rancière gefeierten Indisziplin. Dafür bewege ich mich zwischen geopolitisch und geschichtlich weit entfernten Diskursgeflechten und hoffe gerade so aufzuzeigen, dass egalitäre Praxis jederzeit, allerorts möglich ist, so unvorstellbar und ausweglos dies auch erscheinen mag.
Mithilfe dieser Methode der Gleichheit gehe ich also von einer grundlegenden Gleichheit aus, die durch verkörperte Verbundenheit gestiftet wird. Um Formen der gelebten Gleichheit und solidarischen Gefüge zu sichten, muss man wissen, wogegen sich Menschen wehren. Hierfür bedarf es des analytischen Ausgangs bei der Ungleichmachung von Körpern. Dieses Vorgehen fußt auf der Annahme, dass man nicht von einem einheitlichen ökonomischen Subjekt ausgehen kann, da Ausbeutung differentiell verfährt und bestimmte Körper in stärkerem Ausmaß belastet. Um Formen der differentiellen Ausbeutung und strukturellen Verwundbarmachung zu analysieren, verwende ich im Laufe des Buches eine materialistisch-diskursanalytische Methode. Sie baut auf dem Vorschlag von Verónica Gago und Luci Cavallero auf, ökonomische Prozesse ausgehend von Körpern zu betrachten, auf die sie einwirken (Cavallero/Gago 2021, 3f.). Als Minimaldefinition von Ökonomie dient mir der Begriff der body economic, der Ökonomie als Organisation von Körpern unter Körpern beschreibt (Stuckler/Basu 2013, 139). Meine materialistisch-diskursanalytische Methode, die sich auf sozial- und politikwissenschaftliche Studien stützt, erlaubt mir, Narrative von Betroffenen, politische Diskurse genauso wie strukturelle Bedingungen und Wirtschaftsmaßnahmen zu berücksichtigen. Mithilfe der Analysekonzepte der strukturellen Verwundbarmachung und differentiellen Ausbeutung kann das Zusammenspiel von materiellen Zurichtungen und symbolischen Zuschreibungen erkundet 25werden, um herauszufinden, in welchen Weisen neoliberale Leitideen wie Eigenverantwortung, negative Freiheit und Resilienz die universelle Verwundbarkeit und strukturelle Verwundbarmachung verschleiern und Solidarität erschweren.
Mit diesem methodischen Werkzeug lässt sich aufzeigen, wie bestimmte Körper von ökonomischen Maßnahmen belastet werden. Dadurch treten die differenzierenden Kernelemente des Kapitals hervor, die das Gleichheitsversprechen der Moderne systematisch unterlaufen. Um zu durchleuchten, wie sich symbolische Differenzzuschreibungen und ökonomische Prekarisierungen verstärken, nehme ich eine holistische Perspektive ein und betrachte ökonomische und soziale, materielle und symbolische Ebenen nicht als abgetrennte, sondern als einander durchwirkende Sphären. Der erweiterte, von unten ausgehende Blickwinkel ermöglicht, Ökonomie anders zu sehen. Während »von unten« hinsichtlich Universalismus und Gleichheit eine normative Setzung vollzieht, um das emanzipative Potenzial solidarischer Praktiken sichtbar zu machen, steht es hinsichtlich Ungleichheit und Ökonomie für eine kritisch-analytische, materialistische Methode, die bei wirtschaftlichen Bedingungen und gesellschaftlichen Beziehungen beginnt. Um Solidarität im Zeichen eines Universalismus von unten zu denken, darf man sie nicht identitär verengen. Vielmehr gilt es, die transversalen Linien nachzuzeichnen, die soziale Kämpfe bei aller Verschiedenheit verbinden. Hierzu helfen mir die drei angedeuteten Analysemerkmale relational, differentiell und praktisch, die nicht allein auf Gleichheit und Solidarität bezogen sind, sondern auch auf Ungleichheit und Ökonomie anwendbar sind.
Relational: Wenn man bei Verkörperung beginnt, erscheint Ökonomie als auf Verbundenheit und Kooperation beruhende Körperökonomie. Darin entfaltet sich eine ökonomiekritische Betrachtungsweise kapitalistischer Verwertung und Versehrung. Gleichzeitig eröffnen sich Einsichten in alternative Wirtschaftsweisen, die Allgemeinwohl anstreben. Dieser Gedankengang ist wiederum eingebunden in eine relationale Philosophie: Wenn Ausbeutung, Solidarität und Gleichheit in Bezug zur Sorge gesetzt werden und von der grundlegenden Abhängigkeit aller ausgegangen wird, scheint eine relationale Ontologie auf, die in die liberale, atomistisch angelegte Ontologie interveniert.
Differentiell: Um identitäre Festschreibungen zu vermeiden, ist 26es unerlässlich, Ausbeutung, Solidarität und Gleichheit im Zeichen von Differenz zu sehen. Ausbeutung, so die unterliegende These, richtet sich vorrangig an klassenbedingten, vergeschlechtlichten und rassifizierenden Differenzen aus, deshalb ist es dringend geboten, die differentiellen Arbeitsweisen von Ausbeutung zu analysieren. Demgegenüber widersetzen sich sorgende, solidarische, egalitäre Praktiken den Asymmetrien, die sich aus differentieller Ausbeutung ergeben. Sie bergen gleichsam einem emanzipativen Differenzbegriff, der sich vehement gegen gemeinschaftsidentitäre Verengungsbestrebungen wehrt.
Praktisch: Indem sowohl Ausbeutung und Ungleichheit als auch Solidarität und Gleichheit in ihren materiellen Bedingtheiten und sozialen Bindungen angesehen werden, erweisen sie sich als praktisches Geschehen. Anstatt Wirtschaft als abgekoppelte Sphäre oder anhand abstrakter Modelle zu erfassen, verstehe ich sie feministisch-ökonomiekritisch als soziale Praxis und verorte sie im Alltäglichen. Wie beschrieben, begreife ich Gleichheit nicht als fernes Ideal. Vielmehr entspringt sie einer gelebten Praxis, die unweigerlich prekär und kontingent bleibt. Diese eigensinnige, praxeologische Annäherung an Gleichheit bringt mich schließlich zu radikalegalitären Körperpolitiken, die solidarischen Beziehungsweisen entspringen.
Bei Beziehungen zu beginnen und spiralartig kreisend zu ihnen zurückzukehren, erscheint erst einmal als durch und durch sozialphilosophisches Unterfangen. Doch um Gleichheit und Ungleichheit zu untersuchen, kann man nicht bei Beziehungen stehenbleiben. Schließlich sind sie in breitangelegte, tiefgelagerte gesellschaftliche Strukturen sowie politische, ökonomische und symbolische Ordnungen eingebettet, die sich geschichtlich verfestigt haben. Der Strukturhaftigkeit und Geschichtlichkeit sozialer Beziehungen muss man gedanklich nachkommen. Es ist also unumgänglich, die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse einzubeziehen, die Beziehungen bedingen. Genauso gilt es, die Gegenwart ausgehend von ihrer Geschichte zu erkunden. Dieses vielschichtige Vorgehen kann nicht bei der Sozialphilosophie verharren. Gemäß meiner eigenen Situierung zwischen kritischer Sozialphilosophie, feministischer Politischer Theorie und Ideengeschichte sowie politischer Ästhetik durchkreuzt dieses Buch Felder und Disziplinen. Selbstverständlich lassen sich diese Bewegungen nicht eindeutig einzel27nen Kapiteln zuordnen, sie durchziehen das Buch im Gesamten. Doch beim Schreiben stellte ich fest, dass sich jeder der drei Teile tiefer in ein bestimmtes Feld begibt: Der erste Teil zu Körpern trägt durch die politische Ideengeschichte. Der zweite Teil zu Ökonomie verbindet Feministische Philosophie und Feministische Politische Ökonomie. Der dritte Teil zu Gleichheit öffnet sich weiter in die Politische Theorie.
Diese Gliederung erlaubt mir zweierlei: erstens bewege ich mich von der Geschichte zur Gegenwart und zweitens von der Ungleichheit zur Gleichheit. Zunächst kann ich mich über den genealogischen Weg mit der Gegenwartslage auseinandersetzen, mich ihr, wie es Michel Foucault einmal ausdrückte, seitwärts wie ein Krebs annähern.[3] Das ist unerlässlich, weil sich Geschichte in Körpern sedimentiert und unsere Wahrnehmungsweisen prägt. Diese Vorprägung umfasst sowohl die Symbolik, die sich im Lauf der Ideengeschichte diskursiv einschreibt, als auch die materielle Ungleichheit, die sich in Körpern festsetzt, in ihrer Haltung, ihren Gesten, ihrer Gesundheit, ihren Gefühlen. Um dieses symbolisch-materielle Zusammenspiel innerhalb einer politischen Ästhetik zu verstehen, bedarf es des skizzierten diskusanalytisch-materialistischen Zugangs, der sich den ineinander verschlungenen Ideen-, Körper- und Kapitalismusgeschichten widmet. Zudem ermöglicht die gegenwartsgenealogische Gliederung, den gedanklichen Weg von geschichtlich gewachsener Ungleichheit hin zur gelebten Gleichheit abzuschreiten, wenn auch mäandernd und in immer neuen Anläufen anstatt gradlinig wie im alten Fortschrittsglauben. Um die politischen Gleichheitskämpfe unserer Gegenwart zu verstehen, müssen wir die historischen Hintergründe der uns umgebenden, uns ungleich machenden Gesellschaftsstrukturen kennen. Obwohl sich dieses Buch dem eurozentrischen Glauben an unaufhaltsamen Fortschritt mitsamt seiner Steigerungslogik versperrt und egalitäre Praktiken in ihrer Brüchigkeit und in ihrem beständigen Scheitern betrachtet, öffnet es sich zur Zukunft hin. Denn das derzeit bereits vorhandene Wissen darüber, wie wir uns egalitär organisieren, wie wir anders wirtschaften können, ist geradezu überlebenswichtig angesichts der jetzigen und der kommenden Krisen. Andere Welten waren immer 28möglich, sie werden weiterhin möglich sein und sie werden schon gelebt. Trotz der düsteren Zeiten schimmert darin Hoffnung auf. Vermutlich mag das manchen nahezu naiv anmuten, aber in Anbetracht der Verwüstungen des kapitalistischen Wachstumspfades ist es weitaus ideologischer, an unbegrenztem Profit und uneingeschränkter Akkumulation festzuhalten. Es zeugt schlichtweg von Realismus, nach anderen Wegen, nach anderen Welten zu suchen.
Doch bevor ich diesen Fluchtlinien folge, sei noch etwas zum Aufbau des Buches gesagt: Selbstverständlich sind die titelgebenden Themen Körper, Ökonomie und Gleichheit quer durch das Buch dicht verwoben, genauso wie die drei Teile aneinander anknüpfen. Trotzdem bieten sie kleinere, jeweils für sich stehende Studien, die im Gesamtgefüge lesbar sind, sich aber auch einzeln lesen lassen. Es wäre ebenso unsinnig wie vermessen, eine akribische Lektüreanleitung zu liefern – ob konsequent durchlesen oder sprunghaft querlesen, das sei jeder Leserin selbst überlassen. Doch ein skizzenhafter Überblick mag bei der Wahl des Lektürewegs behilflich sein.
Der erste Teil durchstreift die kapitalistische Körpergeschichte in ihren Verflechtungen mit der politischen Ideengeschichte der europäischen Moderne. Um das verzweigte Verhältnis von Körpern und Politik verständlich zu machen, werden vier analytische Dimensionen vorgestellt: die Dimension der Repräsentation, der Ungleichmachung, der Produktivkraft und der Affektivität. Mit diesem analytischen Raster ausgestattet, setzt der genealogische Gang bei der Vorgeschichte moderner Körpermetaphorik an. Um diese besser zu begreifen, durchstreife ich kulturgeschichtliche Felder, die die Vorstellungswelten politischer Körper entscheidend prägten. Von der mittelalterlichen Machtmetaphorik der body politic wird der Übergang zur Regierung im modernen Staat geschildert, um anschließend die Gleichheitspostulate der Aufklärungsphilosophie kritisch zu beleuchten, und zwar im Blick auf Körperkonzeptionen in philosophischen Szenarien des Naturzustands. Eine exemplarische Lektüre bietet Hobbes’ Leviathan (1966), da seine Naturzustandsschilderungen um verwundbare Körper kreisen. Ich werde seine Überlegungen zur allgemeinen Verwundbarkeit mit Judith Butlers Überlegungen gegengelesen, um zwei Denkwege aufzuzeigen, die völlig gegenläufige Schlüsse aus dem menschlichen Grundzustand der Vulnerabilität ziehen. Nach dieser intensiven Textlektüre umreiße ich die Figur des egalitären Eigentums, die 29sich bei John Locke findet. Er rahmt körperliche Selbstbestimmung als Selbstbesitz im zeitgenössischen Kontext der englischen Eigentümergesellschaft und legitimiert durch seine eigentumsphilosophischen Einlassungen kolonialen Landraub. Dieser Gang durch die Aufklärungsdiskurse soll offenlegen, wie sehr die damaligen politischen Ausschlüsse auf körperlichen Differenzeinschreibungen basieren, die darüber entschieden, wer zur Gemeinschaft der Gleichen gehörte und wer nicht. Um die Ungleichmachung von Körpern über die großen Differenzlinien hinaus distinktionslogisch zu durchdringen, wird ein Exkurs zu Pierre Bourdieus Habitustheorie unternommen. Bourdieu vermag zu verdeutlichen, wie verkörperte Ungleichheit materiell bedingt ist und gleichsam symbolisch verfährt, wodurch sich ungleiche Vergesellschaftungs- und Vermögensverhältnisse fortsetzen. Das überführt in meine Betrachtung von Ökonomie als body economic.
Der zweite Teil bewegt sich in die Gegenwartsepoche der Biopolitik und befasst sich mit Verkörperungsformen von Ungleichheit. Er beginnt folglich mit Foucaults Beschreibungen von biopolitischen Zugriffen auf den Bevölkerungskörper, die durch Achille Mbembes Konzept der Nekropolitik erweitert werden, um aufzuzeigen, dass es bestimmte, differenzmarkierte Körper sind, die der Gefahr, der Gewalt und dem Sterben überlassen werden. Nach dieser breitgespannten kapitalismusgeschichtlichen Betrachtung gehe ich grundlegender auf meinen Vorschlag ein, Ökonomie als Körperökonomie zu betrachten. Mithilfe von Weggefährt:innen aus der Feministischen Politischen Ökonomie wie Amia Pérez Orozco, Verónica Gago, Luci Cavallero, Bini Adamczak und Silvia Federici erläutere ich, was es bedeutet, Ökonomie ausgehend vom Alltäglichen, vom Haushalt, von Körpern, von Sorge und sozialer Reproduktion zu denken. Zum einen ergeben sich daraus neue Einsatzstellen der Kritik, um die kapitalistischen Verwüstungen und Versehrungen zu benennen. Zum anderen öffnen sich Einsichten in die bitter benötigte sozialökologische Transformation, mit der ich mich im dritten Teil ausführlicher befasse. Um die Verfahrensweisen der differentiellen Körperökonomie des Kapitals anhand eines konkreten Fallbeispiels zu veranschaulichen, schließt hier eine Analyse von Schulden- und Austeritätspolitiken an. Diese arbeiten nicht allein über Ausbeutung und Enteignung, da sie sie auch als moralische Ökonomien operieren, um die Schuldner:innen zu disziplinieren. 30Im Zuge dessen verfeinere ich meine Analysekonzepte der differentiellen Ausbeutung und strukturellen Verwundbarmachung, die körperliche Komponenten des Kapitels sichtbar machen sollen.
Der dritte Teil widmet sich Verkörperung, Verwundbarkeit und Gleichheit. Im engen Bezug zu Butler und Rancière skizziere ich in groben Strichen das Konzept der radikalrelationalen Gleichheit. Da es als praxeologisches Theoriekonzept nicht im luftleeren Raum schweben darf, arbeite ich es durch beispielhafte Betrachtungen von solidarischen Beziehungsgefügen wie der feministischen Streikbewegung, Anti-Austeritäts-Protesten und dem kommunalpolitischen Ansatz der Sorgenden Städte konkreter aus. Im Fokus stehen Proteste und Initiativen, die sich gegen die ökonomische Gewalt von Schulden- und Austeritätspolitiken wenden. Die aufgezeigten Alternativen zu den vorherrschenden Ausbeutungsverhältnissen werden als gelebte Utopien in ihren solidarischen Gefügen, Sorgepraktiken und Beziehungsweisen behandelt. Um herauszufinden, wie sie egalitäre Körperpolitiken hervorbringen, führe ich das an Bourdieu angelehnte Konzept der affektiven Gegenhabitualisierung ein. Beim Bestreben, die Vergesellschaftung und Umverteilung von Sorgearbeit zu erschließen, ist das Praxiskonzept der solidarischen Sorge behilflich. Diese gebündelten Beobachtungen fließen schließlich in den überspannenden Gedanken eines Universalismus von unten ein, der im Blick zurück auf die solidarischen Praktiken und egalitären Körperpolitiken an Kontur gewinnt.
Um sich auf die Spurensuche radikaler Gleichheit zu begeben, sollte man bei bestehenden Ungleichverhältnissen beginnen. Dazu führt der Weg hinein in die Körpergeschichte und von dort aus in die gelebte Gegenwart, um den verzweigten Pfaden hin zu einer egalitären, gemeinschaftlich gestalteten Zukunft zu folgen.
31
I. Körper
33
Politische Körper
Körper sind nicht bloß Mittel, Instrument oder Zielobjekt von Politik, ihnen wohnt eine eigene Form des Politischen inne. Diese körpereigene Politizität führt zum Gedanken einer Gleichheit, die sich zwischen ihnen entfaltet. Allerdings muss er seinen Ausgang bei Ungleichheit nehmen, denn um das egalitäre und emanzipative Potenzial von solidarischen Praktiken zu begreifen, bedarf es zuallererst einer kritischen Untersuchung, wie Körper ungleich gemacht werden. Deshalb führt der erste Teil dieses Buches durch die Untiefen der kapitalistischen Körpergeschichte. Wie werden Körper materiell benachteiligt, der Gefährdung und Ausbeutung ausgesetzt, während andere umsorgt, gewertschätzt und bisweilen sogar verehrt werden? Wie begründen symbolische Bewertungen die materielle Ungleichmachung und wie vertiefen sie diese?
Im Hintergrund meiner Fragen steht die Annahme, dass Körper aufgrund ihrer sozialen Verfasstheit verbunden und verwundbar sind. Während ich davon ausgehe, dass Körper relational aufzufassen sind, hinterfrage ich diskursdominante Figurationen der für sich stehenden Einzelkörper. Daran anknüpfend betrachte ich symbolische Körperordnungen in ihren materiellen Auswirkungen, um nachzuvollziehen, wie kapitalistisches Wirtschaften über differentielle Ausbeutung verläuft. Durch diesen Bogen soll der erste Teil einen körpergeschichtlichen Horizont für die Gegenwartsanalyse eröffnen. Zwar steht Gleichheit nicht im Vordergrund, sie bleibt jedoch im Hintergrund des körpergeschichtlichen Durchgangs, um die ungleichmachenden Zurichtungen von Körpern, die in politischen Imaginationen, philosophischen Abhandlungen und ökonomischen Ordnungen zutage treten, an der gegenläufigen Annahme ihres egalitären Grundzustandes zu messen.
Dieser genealogische Überblick dreht sich um Körper als ökonomische Körper – als ausbeutbare, arbeitende, produzierende und konsumierende Körper –, befasst sich aber gleichfalls mit deren Politizität. Inwiefern sind Körper politisch? Wieweit ist Politik von Körperlichkeit geprägt?[1] Diese chiastische Fragestellung öffnet eine 34lange ideengeschichtliche Linie, die sich von der antiken Philosophie und der politischen Theologie des Mittelalters über Bevölkerungskörper der Moderne bis zu Körperordnungen der Gegenwart zieht. Schließlich bilden Körper stets den primären Schauplatz politischer Kämpfe (Turner 2008, 40). Entsprechend verästelt sind die Zusammenhänge zwischen dem Körperlichen und dem Politischen. Nach Imke Schmincke lassen sich drei zentrale Zugänge zum Verhältnis von Körpern, dem Politischen und der Politik anführen: erstens die mittelalterliche body politic, die Körperbilder als Herrschaftsimagination nutzt; zweitens die Biopolitik als Lenkung und Regierung von Körpern; drittens die feministischen body politics, die Körper in ihrem Wissen und Widerstandspotenzial betrachten. Während die ersten beiden Zugänge, die body politic und die Biopolitik, in Top-down-Perspektive verfahren und Körper als Herrschaftssymbolik oder als Ausbeutungssubjekt erachten, zeichnet sich im dritten Zugang der body politics eine Bottom-up-Blickrichtung ab (Schmincke 2019, 15f.). Dieser letzte Zugang ist der entscheidende Ansatzpunkt, um Körper im Modus der Gleichheit zu erkunden. Um sich dieser Gleichheit zwischen Körpern anzunähern, führt der Weg über die body politic und über die Biopolitik. Die symbolische Ordnung der mittelalterlichen body politic setzt sich nämlich unter anderen Vorzeichen in der Moderne fort. Sie versinnbildlicht, wie Körper durch symbolische Einschreibungen ungleich gemacht werden. Die aufkommenden Differenzdiskurse der Aufklärung dienen dazu, die verstärkte Verwertung bestimmter Körper zu begründen. Will man differentielle Ausbeutung an der Schnittstelle von symbolischer Einschreibung und materieller Zurichtung in den Blick bekommen, bedarf es der körpergeschichtlichen Rückschau, die unweigerlich vieles unerkundet lässt, doch einen groben Überblick verschaffen soll.[2]
35Um das weitverzweigte Verhältnis von Körpern, Politik und Ökonomie nachvollziehbar zu machen, schlage ich vier analytische Dimensionen vor: die Dimension der Repräsentation, der Ungleichmachung, der Produktivkraft und der Affektivität. Die erste Dimension der Repräsentation von Körpern zeichnet sich in der mittelalterlichen body politic ab und setzt sich bis in die Machtimaginarien der Gegenwart fort. Die zweite Dimension der Ungleichmachung entsteht im Zusammenspiel von symbolischer Differenzeinschreibung und materieller Ausbeutung. Die dritte Dimension der Produktivkraft von Körpern beschreibt, wie diese ausgebeutet und zum biopolitischen Zielobjekt werden. Die vierte Dimension der Affektivität verweist darauf, wie Ungleichheit in physischen und psychischen Wahrnehmungsweisen fortwirkt. Diese vierdimensionale Einteilung dient im folgenden körpergeschichtlichen Teil dazu, die mannigfaltigen Zusammenhänge von Körpern und Politik analytisch aufzufächern. In den anderen Teilen werden diese vier Analysedimensionen nicht mehr eigens angeführt, sondern in ihrem holistischen Zusammenspiel behandelt und zugunsten der drei Analyseaspekte relational, differentiell und praktisch aufgegeben.
Genealogische Annäherungen an die Gegenwart lohnen sich, um geschichtlich geronnene Zusammenhänge zwischen dem Physischen und dem Politischen besser zu begreifen. Zumal die Körpergeschichte bezeugt, wie stark Körperlichkeit selbst historischem Wandel unterworfen ist.[3] Bereits der Begriff Körper, der sich in der deutschen Sprache vom Leibbegriff abhebt, birgt eine besondere Auffassung von Körperlichkeit.[4] Er belegt die sich wandelnden 36Wahrnehmungsweisen, denn er etabliert sich erst im Diskursgeschehen der frühen Moderne, als er von unbelebten auf belebte Körper übertragen wird. In dieser Übertragungsbewegung zeigt sich ein verwissenschaftlichter Blick auf menschliche Körper als Untersuchungsobjekt, der paradigmatisch für die sich herausbildenden Humanwissenschaften wird. Dieses objektivierende Blickregime schlägt sich in den physischen Wahrnehmungsweisen nieder, was verdeutlich, wie wandelbar die körperliche und affektive Wahrnehmung ist. Wie sich Formen des Politischen verändern, so wandeln sich Wahrnehmungsweisen des Körpers. Diese sind bei weitem keine statischen Objekte. Verkörperungen verändern sich, weil sich das physische, sozial geprägte Eigenempfinden im Laufe der Geschichte umformt. Das jeweilige medizinische Wissen beeinflusst das intime Selbsterleben des Körpers. Beispielsweise nahm man in der Medizingeschichte in früheren Zeiten an, Organe würden wandern, man glaubte auch, die Gesundheit sei von Körpersäften bestimmt. Diese Vorstellungen beeinflussten wiederum die sinnlichen Selbstempfindungen der Patient:innen, die in ihrem Inneren die umherwandernden Organe oder aufsteigenden Körpersäfte zu spüren glaubten (vgl. Sarasin 1999). Wie medizinische Wissensdiskurse schreiben sich politische Bilder von Körpern in somatische und affektive Wahrnehmungsmuster ein. Daraus gehen subtile Spielweisen der Selbstunterwerfung hervor. Gleichermaßen birgt die sich wandelnde Wahrnehmung von Körpern emanzipatives Potenzial, das bezeugen die feministischen body politics. Um den radikalen Wandel von Körperpolitiken zu erahnen, führt der genealogische Weg über die Jahrhunderte hinweg zurück zur mittelalterlichen body politic.
37
Body Politic: mythische Körper und politische Metaphern
Somametaphorik als Weltorientierung
Der Körper ist buchstäblich die naheliegendste Metapher, um menschliches Miteinander zu versinnbildlichen. So verschieden Menschen sind, sind sie darin vereint, verkörperte Wesen zu sein. Ihre Wahrnehmung der Welt genauso wie ihr Denken entwickeln sich von ihrem Körper aus. Die Orientierungen, die sich aus dem körperlichen Sein erschließen, werden zu Richtungsangaben, die Menschen in Ordnungen einsortieren (Bourdieu 1997, 93-96). Schon die Unterscheidung von Oben und Unten, von Herrschaft und Unterwerfung, kommen von unserer körperlichen Konstitution als aufrecht gehende Wesen in der Welt. Sobald diese Körperorientierungen auf soziale Beziehungen übertragen werden, kennzeichnen sie in symbolischer Aufladung Macht und Ohnmacht, Beherrschung und Unterwerfung. Der Körper wird zur Vorlage für das Herrschaftsverhältnis. Deshalb ist wenig verwunderlich, dass Körpermetaphern scharenweise die politischen Vorstellungswelten bevölkern. Das Oberhaupt. Der Staatskörper. Der Gesellschaftskörper. Der Volkskörper. Die Körperschaft. Das Organigramm. Die Organisation. Die altbekannten Begriffe des politischen Lebens leiten sich aus unserer Physis ab. Dass die besagten sedimentierten Metaphern vorrangig dem Vokabular der europäischen Moderne angehören, sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass Körper quer durch Geschichten und Kulturen sinnbildhaft für politische Gemeinschaften einstehen, für Herrschaft und Souveränität sowie ihre Ordnungssysteme, die in »Kategorien des Körperlichen ausgedrückt, gedeutet und legitimiert« (Schmincke 2021a, 114) werden. Die »Politik hat sich schon immer des Körpers als dem Medium ihrer Repräsentation bemächtigt« (Diehl/Koch 2007, 7). Es wäre vermessen, die Entwicklungslinien von politischen Körpermetaphern in all ihren Wandlungswegen und Widersprüchlichkeiten nachzeichnen zu wollen. Die verschiedenen Verwendungsweisen in den jeweiligen soziokulturellen Kontexten machen einen geradlinigen Vergleich unmöglich (Musolff 2010, 36).
38Um immerhin einige Einblicke in die Dimension der Repräsentation zu verschaffen, lassen sich drei sich überschneidende körperpolitische Metaphernfelder markieren. Die erste Metapher, die in der Folge die anderen beiden Metaphern stiftet, beschreibt den Körper als gemeinschaftliche Einheit. Darauf aufbauend wird der soziale Körper in Begriffen von Krise, Kur und Krankheit konzipiert, hierin zeigt sich der Nahzusammenhang von Politik und Medizin, das zweite metaphorische Feld. Als drittes Feld verfestigt sich die mittelalterliche Metaphorik der body politic mitsamt der Figur des Doppelkörpers von gottgesandten Amtsträgern. Der soziale Körper, der kranke Körper, der sakrale Körper – diese drei metaphorischen Felder sind abzuschreiten, um sich der politischen Ästhetik von Körperlichkeit anzunähern, die affektiv auf Körper einwirkt und diese ungleich anordnet.
Der soziale Körper als Gemeinschaftsmetapher
Eine der ältesten politischen Metaphern präsentiert den Körper als politische Einheit, wobei der Bauch, das Herz oder der Kopf den Sitz der Autorität symbolisieren, der sich die einzelnen Glieder unterordnen. Eine »Metapher des sozialen Körpers, deren Wirkungsgeschichte sich von Platon und Paulus hin zur Biopolitik des 20.Jahrhunderts erstreckt« (Koschorke/Frank/Matala de Mazza/Lüdemann 2007, 10).[5] Das Bild des Körpers als Gemeinschaft findet sich in bekannten Begriffen, als Körperschaft, corporation oder eben im Begriff der body politic. Eines der frühesten bekannten Beispiele findet sich in einer Fabel des Äsop aus dem 6.Jahrhundert vor Christus, dort kommt dem Bauch die Autorität zu, die Körperglieder und Organe zu orchestrieren und als Einheit zu organisieren (Musolff 2021, 18-21).[6] In dieser symbolischen Komposition setzt 39sich der Körper aus Einzelgliedern zusammen, deren Einheit erst durch die Autorität eines Organs wie des Bauchs oder des Herzens gewährleistet wird. Sosehr Tätigkeiten der jeweiligen Körperpartien zum Funktionieren des Organismus beitragen, sie müssen sich dem Zentralorgan unterordnen. Ansonsten ist der Schaden groß, wie die Fabel von Äsop warnt: Indem die Einzelglieder gegen den Bauch rebellieren, gefährden sie sich selbst und den Gesamtkörper, der zu verhungern droht. Die Fabel dient folglich der Herrschaftslegitimation und richtet sich gegen einen möglichen Körperstreik. Während in Äsops Fabel der Bauch als Körpermitte das maßgebende Organ bildet, steigt in späteren Beispielen der body politic die Ordnung nach oben und beginnt beim Herzen oder noch höher beim Kopf. Von diesen frühen Anfängen an wandelt sich die Metapherngeschichte, einer dieser Wendemomente ereignet sich in der Antike, ein anderer im aufkommenden Christentum.
In der stoischen Philosophie, die sich von Platons Schriften ab dem 5.Jahrhundert vor der christlichen Zeitrechnung bis zu den Schriften der späten Stoiker wie Seneca im ersten Jahrhundert zieht, erscheint das Universum als Kosmos, der als Gesamtkörper Einzelkörper umfasst (vgl. Lee 2006, 29-46). In Platons Philosophie bildet das Universum eine lebendige Kreatur, komponiert aus einem körperlichen und sichtbaren Himmel, der mit der unsichtbaren Seele verwoben ist. Kosmos und Körper des Menschen setzen sich aus denselben Elementen zusammen (Lee 2006, 44). Auch die spätere stoische Philosophie im 1.Jahrhundert begreift Körperlichkeit als kosmologisches Organisationsmodell. Der Kosmos wird weniger metaphorisch als Körper ersonnen denn tatsächlich als solcher wahrgenommen und gedacht. Seneca und ebenso vor ihm bereits Cicero setzen den menschlichen Körper in Analogie mit universeller Menschlichkeit, wobei sie diese als einen existierenden, kosmologisch verbundenen Körpertypus erachten (Lee 2006, 46). Für die stoische Philosophie fallen Körper und Geist nicht in eins, doch diese Differenz ist nicht dualistisch verhärtet wie in der modernen, von Descartes geprägten Philosophie. Obwohl Körper und Geist gedanklich getrennt werden, gilt die Seele als somatisches Element (Lee 2006, 49). Ohne ausführlich auf die 40stoischen Körperkonzeptionen eingehen zu können, ist die Rolle des Atems, des Pneumas (πνεῦμα), bemerkenswert. Der Atem wird als Geisteselement, als Atemseele aufgefasst, die Körper erschafft und ergreift, eine Denklinie, die man auch antrifft als »Hauch, Lebenskraft, Seele, feuriger Stoff« und »lebensspendendes Prinzip der Individuen und des Kosmos« (Liatsi 2016, 37). Das Pneuma stiftet die Kohäsion des Kosmos, der zum Gesamtkörper wird, dessen einzelne Glieder durch das Pneuma vereinheitlicht werden (Lee 2006, 50). Gleichsam wirkt Pneuma differenzierend und definiert die einzelnen Glieder und Körper, diese bleiben jedoch aufgrund der vorgelagerten Relationalität kosmologisch verbunden (Lee 2006, 53). Dennoch wird das Gleichheitsversprechen, welches dem Gesamtkörper des Kosmos innewohnt, von der differenzierenden Kraft des Atems unterlaufen. Er haucht den Einzelkörpern jeweilige Eigenschaften ein, die ihren Rang in der Gesellschafts- und Naturordnung ausmachen. Während die frühe Stoa den Einklang mit der Natur betont, übernimmt die späte Stoa das Kosmosmodell, um über politische Gemeinschaften zu sprechen (Lee 2006, 90). Davon ausgehend, dass allen Menschen Vernunft innewohne, entwickeln stoische Denker ethische Pflichten, die aus der Einheit der Menschheit herrühren (Lee 2006, 101). Dieses körpermetaphorische Denken, das in der Römischen Republik und im Kaiserreich Cicero und Seneca als politisch einflussreiche Philosophen weiterentwickeln, findet seinen Platz in der christlichen Geistesgeschichte (Rollo‐Koster 2010, 134).
In der christlichen Körpergeschichte verwandelt sich das Pneuma in den Heiligen Geist, der als sakraler Atem alle Körper verbindet. In dieser Übertragung verschiebt sich die metaphorische Gewichtung der Organe. Während die antike Imagination aufbauend auf Äsops Fabel den Senat als Bauch und die Plebs als Körperglieder ausmacht, kommen in den christologischen Vorstellungswelten dem Kopf und dem Herzen die Rolle als Autoritätsorgane zu. Im Gegensatz zur kosmologischen Körperkonzeption der Stoa sucht Paulus, Apostel und Kirchengründer, nicht nach den Spuren einer universellen Menschheit, vielmehr verkündet er eine neue Menschheit, gestiftet durch das messianische Erscheinen Jesu (Lee 2006, 105). Für Paulus bildet die Kirche den sakralen Körper der entstehenden Glaubensgemeinschaft – ebenso wie der Sakralkörper Jesu, ein Aspekt, den ich weiter unten aufnehme. Angemerkt 41sei, dass weder Paulus noch die Menschen im frühen Mittelalter den Gemeinschaftskörper als reine Metapher betrachteten, statt als bloßes Sinnbild begriffen sie ihn als gegebenen, faktischen Körper.[7] Vom Standpunkt der Gegenwart mag das schwer verständlich erscheinen, weil zumindest die in westlichen Gesellschafter lebenden Menschen aufgrund der ideen- und körpergeschichtlichen Traditionen der europäischen Moderne kaum noch intellektuellen Zugang zu kosmologischen Körperkonzeptionen finden.
Im Mittelalter wird die body politic zum leitgebenden Sinnbild, um die organische Organisation der Ständeordnung zu beschreiben (vgl. Schmincke 2021a, 114f.). Fortan fungiert der Körper als Metapher für die Gemeinschaftsorganisation, die den einzelnen Gliedern ihre soziale Stellung zuweist. Diese Ordnung soll sich organisch zusammensetzen, gemäß der Körperkomposition aus Gliedern und Organen. Der Kopf als Oberhaupt oder das Herz als höher gestelltes Organ zeigen Autorität an. In Entsprechung dazu stellen die tiefer liegenden Körperpartien die niederste soziale Stellung dar: die Gruppe des Fußvolks, die in Lehnsherrschaft die Felder bestellen, deren Körper in der Schlacht als buchstäbliche Bauernopfer dienen (Rollo‐Koster 2010, 135).[8] Die