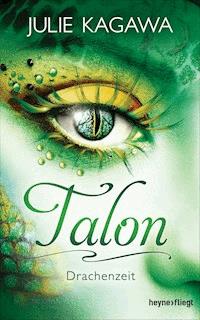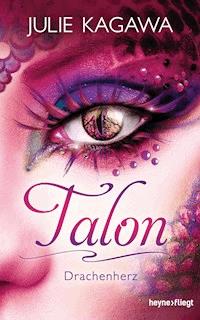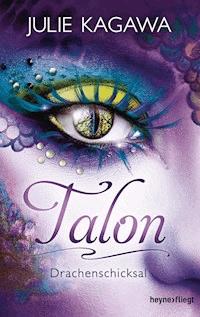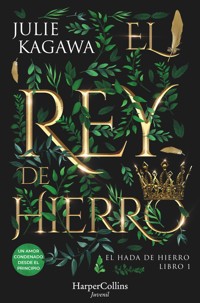9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Unsterblich
- Sprache: Deutsch
Im Herzen der Dunkelheit bist du auf dich allein gestellt
In einer Welt, in der die Menschen von den Vampiren wie Sklaven gehalten werden, hat die siebzehnjährige Allison die einzig richtige Entscheidung getroffen: Sie hat die Unsterblichkeit gewählt und genießt nun die Vorzüge eines sorgenfreien Lebens unter den Vampiren. Doch ihre Vergangenheit lässt sie nicht los, und als Allie an den Ort zurückkehrt, der einst ihre Heimat war, macht sie eine furchtbare Entdeckung: Die Rote Schwindsucht, die den Menschen vor Allies Geburt zum Verhängnis wurde, ist zurückgekehrt. Und diesmal sind auch die Vampire gefährdet, sich anzustecken. Nur einer kann vielleicht Abhilfe schaffen: Kanin, Allies »Schöpfer«. Unter den Vampiren gilt er jedoch als abtrünnig, und niemand weiß, wo er sich aufh ält. Wird es Allie rechtzeitiggelingen, ihn zu finden?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 643
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
JULIE KAGAWA
Unsterblich
TOR DER NACHT
Roman
Aus dem Amerikanischen von
Charlotte Lungstraß
Für Natashya, weil sie mich dazu ermutigt hat,
meine Lieblinge zu töten.
Und für Nick, für alles andere.
ERSTER TEIL – Jägerin
1
Sobald ich den Raum betrat, roch ich das Blut.
Mit mir fegte ein kalter Windstoß herein und ließ Schneeflocken um meinen schwarzen Mantel tanzen, die sich auf meinen Haaren und meiner Kleidung niederließen, während ich die Tür wieder zuschob. Drinnen war es eng und schmutzig, einige morsche Tische standen herum, und in den Ecken waren alte Metallfässer aufgestellt worden, aus denen dicker Qualm bis zur Decke aufstieg, wo er dichte Wolken bildete. Dort drehte sich träge ein uralter Ventilator, dessen Blätter entweder kaputt waren oder ganz fehlten, sodass er kaum dazu beitrug, die stickige Luft zu erfrischen.
Als ich durch die Tür trat, richteten sich sämtliche Blicke auf mich und ließen mich nicht mehr los. Harte, gefährliche, zerstörte Gesichter beobachteten aufmerksam, wie ich mir einen Weg zwischen den Tischen hindurch suchte; sie waren wie wilde Hunde, die Blut wittern. Ohne mein Publikum zu beachten, ging ich gelassen über die ächzenden Holzbohlen. Bei jedem Schritt spürte ich alte Nägel und Glasscherben unter meinen Sohlen. Ich musste nicht extra atmen, um zu wissen, dass die Luft nach Schweiß, Alkohol und menschlichen Ausdünstungen stank.
Und Blut. Sein Geruch hing in den Wänden und im Boden, es durchtränkte die modrigen Tische und klebte in dunklen Flecken auf den Holzdielen. Heiß und berauschend floss es durch die Adern jedes Einzelnen hier. Ich hörte, wie sich bei einigen der Herzschlag beschleunigte, während ich Richtung Bar ging, spürte, wie sich Lust und Gier in ihnen regten, aber auch leise Angst, ein leichtes Unbehagen. Zumindest ein paar von ihnen waren also noch nüchtern genug, um die Wahrheit zu erkennen.
Hinter dem Tresen stand ein angegrauter Riese, über dessen Kehle sich ein dickes Geflecht aus Narbengewebe zog. Es erstreckte sich vom Hals bis zum linken Mundwinkel, der dadurch in einer verzerrten Grimasse erstarrt war. Mit ausdrucksloser Miene beobachtete er, wie ich mich auf einem der schmutzigen Barhocker niederließ und mich mit beiden Armen auf den ziemlich ramponierten Tresen stützte. Kurz huschte sein Blick zu dem Schwertgriff, der hinter meinem Rücken aufragte, und eines seiner Lider zuckte.
»Tut mir leid, aber die Art von Drink, nach der Sie suchen, führen wir nicht«, sagte er leise und ließ die Hände unter die Bar gleiten. Mir war klar, dass sie nicht leer sein würden, wenn er sie wieder hervorzog. Wahrscheinlich ein Gewehr, überlegte ich. Oder vielleicht ein Baseballschläger. »Zumindest nicht frisch gezapft.«
Ohne aufzublicken, lächelte ich. »Sie wissen also, was ich bin.«
»War ja nicht schwer zu erraten. Wenn ein hübsches Mädchen sich an solche Orte wagt, hat es entweder Todessehnsucht oder ist bereits tot.« Er schnaubte abfällig und ließ den Blick über seine Gäste schweifen. Selbst jetzt spürte ich noch ihre verstohlenen Blicke im Rücken. »Ich weiß, was Sie vorhaben, und ich werde Sie nicht daran hindern. Diese Idioten wird niemand vermissen. Nehmen Sie sich, was Sie brauchen, aber demolieren Sie dabei nicht meine Bar, verstanden?«
»Eigentlich bin ich auf der Suche nach jemandem«, erklärte ich schnell, da ich wusste, dass mir nicht viel Zeit blieb. Die Hunde hinter mir regten sich bereits. »Einer wie ich, kahlköpfig, groß, total vernarbtes Gesicht.« Erst jetzt sah ich auf und begegnete seinem reglosen Blick. »Ist hier so jemand aufgetaucht?«
An seinem Unterkiefer zuckte ein Muskel. Der Puls unter dem schmierigen Hemd beschleunigte sich, und auf seiner Stirn bildeten sich kleine Schweißperlen. Eine Sekunde lang schien er versucht zu sein, das Gewehr oder was auch immer er unter dem Tresen versteckte hervorzuziehen. Ich setzte eine bewusst neutrale und möglichst harmlose Miene auf und behielt beide Hände auf der Bar.
»Sie haben ihn also gesehen«, half ich ihm vorsichtig auf die Sprünge. Der Mann schüttelte sich kurz, dann starrte er mich ausdruckslos an.
»Nein.« Die Antwort schien er sich mühsam abringen zu müssen. »Ich habe ihn nicht gesehen. Aber …« Mit einem schnellen Blick zu den Männern hinter mir schien er abschätzen zu wollen, wie viel Zeit wir noch hatten. Dann schüttelte er den Kopf. »Vor ungefähr einem Monat ist hier ein Fremder durchgekommen. Niemand hat gesehen, wie er kam, niemand hat gesehen, wie er ging. Aber wir haben entdeckt, was er zurückgelassen hat.«
»Zurückgelassen?«
»Rickson und seine Jungs. In ihrem eigenen Haus. Überall verteilt. Sie haben gesagt, es wären so viele Leichenteile gewesen, dass sie nicht einmal alle gefunden haben.«
Unwillkürlich biss ich mir auf die Lippe. »Hat jemand gesehen, wer das getan hat?«
»Ricksons Frau. Sie hat überlebt. Zumindest, bis sie sich drei Tage später das Hirn weggeblasen hat. Aber sie meinte, der Killer sei groß gewesen, ein bleicher Mann mit einer vernarbten Teufelsfratze.«
»War jemand bei ihm?«
Stirnrunzelnd schüttelte der Barkeeper den Kopf. »Nein, laut ihrer Aussage war er allein. Aber er hatte einen großen Sack dabei, sah wohl aus wie ein Leichensack. Mehr haben wir auch nicht aus ihr rausbekommen. Sie hat sich nicht besonders klar ausgedrückt, wenn Sie verstehen, was ich meine.«
Nickend lehnte ich mich zurück, obwohl mir bei dem Wort Leichensack ganz anders geworden war. Wenigstens komme ich immer näher. »Danke«, murmelte ich und rutschte vom Barhocker. »Ich gehe dann mal.«
Da spürte ich eine Hand auf meiner Schulter.
»Oh nein, du gehst bestimmt noch nicht, Kleines«, hauchte jemand. Heißer, stinkender Atem streifte mein Ohr. Dicke Finger schlossen sich um mein Handgelenk, so fest, dass ich blaue Flecken bekommen hätte, wenn das noch möglich gewesen wäre. »Verdammt kalt da draußen. Komm rüber und wärme uns ein bisschen.«
Ich musste mir ein Grinsen verkneifen. Na endlich. Hast ja ziemlich lange gebraucht.
Mein Blick wanderte zum Barkeeper. Der sah mich kurz an, dann wandte er sich demonstrativ ab und ging Richtung Hinterzimmer. Dem Mann neben mir schien das nicht aufzufallen, er ließ den Arm über meinen Rücken gleiten, packte mich an der Taille und wollte mich mit sich fortziehen. Als ich mich nicht rührte, runzelte er irritiert die Stirn, doch er war zu betrunken, um zu begreifen, was gerade passierte.
Ich wartete ab, bis der Barkeeper verschwunden und die Schwingtür hinter ihm zugefallen war, dann drehte ich mich zu dem Kerl um.
Der zog mich quasi mit den Augen aus, während der Alkoholgestank in wahren Wolken von ihm aufstieg. »Ganz recht, Kleines. Das kannst du alles haben.« Hinter ihm erhoben sich noch weitere Gäste von ihren Stühlen. Entweder wollten sie den Spaß nicht verpassen, oder sie waren der Meinung, dass sie mich gemeinsam schon überwältigen könnten. Die restlichen Männer verschanzten sich angespannt und wachsam hinter ihren Gläsern. Sie stanken nach Angst.
»Komm schon, du kleines Flittchen«, grunzte der Kerl neben mir. In seinem brutalen Gesicht spiegelte sich die Gier. »Los geht’s. Ich kann die ganze Nacht.«
Ich grinste breit. »Tatsächlich?«, erwiderte ich leise.
Dann stürzte ich mich brüllend auf ihn und schlug ihm meine Fangzähne in den Hals.
Als der Barkeeper zurückkam, war ich schon weg. Er würde die Körper derjenigen, die dumm genug zum Bleiben und Kämpfen gewesen waren, dort vorfinden, wo sie zu Boden gegangen waren – einige zerfetzt, aber die meisten noch lebendig. Ich hatte bekommen, was ich gesucht hatte. Der Hunger war gestillt, und es war besser, dass es hier in diesem Außenposten voll Krimineller passiert war als irgendwo anders. Besser solche Typen als eine unschuldige Familie oder irgendein altes Ehepaar, das sich in einer einsamen, verfallenen Hütte gegenseitig Wärme spendete. Ja, ich war ein Monster, das tötete und darauf aus war, Menschen das Leben zu nehmen. Dieser Tatsache konnte ich mich nicht entziehen, aber wenigstens konnte ich mir aussuchen, wessen Leben ich beendete.
Draußen schneite es inzwischen wieder. Die dicken Flocken hängten sich an meine Wimpern und Wangen und verfingen sich in meinen glatten schwarzen Haaren, doch ich spürte sie nicht. Jemandem, der bereits tot war, konnte die eisige Kälte nichts anhaben.
Ich schüttelte kurz mein Katana-Schwert, sodass sich auf dem Boden eine blutrote Linie ausbreitete. Anschließend schob ich die Waffe in die Scheide auf meinem Rücken und setzte mich in Bewegung. Meine Stiefel knirschten in dem gefrorenen Schlamm. Aus den Hütten aus Holz und Wellblech ringsum kam kein Laut, lediglich dunkler Rauch drang aus den Fenstern und den improvisierten Schornsteinen. Nachts war niemand draußen unterwegs: Die Menschen blieben alle in ihren Behausungen, drängten sich um ihre Stahlfässer und Flaschen und hielten die Kälte mit Feuer und Alkohol auf Abstand. So würde auch niemand den einsamen Teenager in dem langen schwarzen Mantel bemerken, der zwischen ihren Hütten herumschlich. Genau wie der andere Besucher war ich gekommen, hatte mir genommen, was ich brauchte, und verschwand nun wieder in der Dunkelheit. Und hinterließ ein Gemetzel.
Knapp hundert Meter weiter ragte eine dunkle Mauer aus rostigen Stahlplatten und Stacheldraht auf – eine unebene Konstruktion mit Lücken und Löchern, die immer wieder ausgebessert und dann irgendwann vergessen worden war. Eine schwächliche Barriere, um die Monster fernzuhalten, die jenseits der Mauer lauerten. Wenn das hier so weiterging, würde dieser kleine Außenposten über kurz oder lang von der Erdoberfläche verschwinden.
Nicht mein Problem.
Ich sprang auf das Dach einer Hütte, die sich gefährlich nah an die Stahlwand neigte, dann über die Mauer hinweg, und landete leichtfüßig auf der anderen Seite. Nachdem ich mich aufgerichtet hatte, spähte ich über die steinige Anhöhe hinweg zur Straße hinunter, auf der ich hergekommen war. Unter dem frischen Schnee war sie kaum noch auszumachen. Selbst meine Fußspuren, die aus östlicher Richtung kamen, waren unter der weißen Decke verschwunden.
Er war hier, überlegte ich, während mir der Wind ins Gesicht schlug, an meinen Haaren und dem Mantel zerrte. Vor knapp einem Monat. Ich komme immer näher. Langsam hole ich auf.
Ich ließ mich von der Klippe fallen, segelte mit wild flatterndem Mantel sechs Meter in die Tiefe und landete am Straßenrand. Mit einem leisen Ächzen federte ich den Aufprall ab. Als ich den rauen, löchrigen Beton betrat, spürte ich, wie er unter meinen Füßen zerbröckelte. Ich lief bis zu einer Stelle, an der sich die Straße teilte und in zwei unterschiedliche Richtungen weiterführte. Der eine Weg beschrieb eine weite Kurve und zog sich kreisförmig um den Außenposten herum, bevor er Richtung Süden führte. Der andere ging nach Osten und hielt auf die Sonne zu, die dort bald aufgehen würde.
Ich starrte erst in die eine Richtung, dann in die andere, und wartete ab. Und genau wie an jeder anderen Kreuzung, auf die ich bisher gestoßen war, kam es wieder: dieses leichte Ziehen, das mich dazu drängte, in nordöstlicher Richtung weiterzugehen. Es war mehr als eine Ahnung, stärker als ein Bauchgefühl. Auch wenn ich es mir nicht ganz erklären konnte, wusste ich so, welcher Weg mich zu meinem Schöpfer bringen würde. Blut spricht zu Blut. Die Toten, auf die ich während meiner Reise gestoßen war, wie etwa die glücklose Familie in dieser Siedlung, bestätigten das nur. Er bewegte sich schnell, aber ich holte ihn nach und nach ein, langsam aber stetig. Ewig konnte er sich nicht vor mir verstecken.
Ich bin auf dem Weg zu dir, Kanin.
Es blieben mir noch ein paar Stunden bis zum Morgengrauen. Bis dahin konnte ich noch eine ziemliche Strecke zurücklegen, also brach ich wieder auf und folgte der Straße zu meinem unbekannten Ziel. Auf der Jagd nach einem Schatten.
Immer in dem Wissen, dass uns die Zeit davonlief.
Den Rest der Nacht marschierte ich stur weiter, immer den eisigen Wind im Gesicht, der meine sowieso kalte Haut auch nicht weiter abkühlen konnte. Vor mir zog sich die stille, leere Straße dahin. Nichts rührte sich in der Dunkelheit. Ich kam an den Überresten unübersichtlicher Wohnviertel vorbei, deren Straßen verlassen und zugewuchert waren und deren Gebäude unter der Last des Schnees und des Alters zusammenzubrechen drohten. Seit der Seuche, durch die fast die gesamte Menschheit ausgelöscht worden war, und dem anschließenden Ausbruch des Verseuchtenvirus war von den meisten Städten nicht mehr geblieben als leere Hüllen. Hin und wieder war ich auf vereinzelte Siedlungen gestoßen, in denen die Menschen trotz der ständigen Bedrohung durch die Verseuchten oder mögliche Übergriffe ihrer eigenen Artgenossen in Freiheit lebten. Doch der Großteil der Bevölkerung fristete sein Dasein in den Vampirstädten, den großen, von Mauern umschlossenen Gebieten, in denen der Hofstaat im Austausch gegen Blut und Freiheit Nahrung und »Sicherheit« garantierte. In Wirklichkeit waren die Menschen in den Vampirstädten nichts anderes als Vieh, aber das war nun einmal der Preis, den die Vampire für ihren Schutz verlangten. Zumindest sollte man das glauben. Monster gab es auf beiden Seiten der Mauern, aber die Verseuchten ließen wenigstens keinen Zweifel daran, dass sie einen fressen wollten. In einer Vampirstadt wusste man im Prinzip nie, wie viel Zeit einem noch blieb, bis die Killer, die einem lächelnd den Kopf tätschelten, ihr wahres Gesicht zeigten.
Ich musste es wissen, immerhin war ich in einer solchen Stadt geboren worden.
Immer weiter folgte ich den Windungen der Straße durch die verschneiten Wälder, die nun ehemals weitläufige Städte und Vororte umschlossen. Irgendwann wurde der nachtschwarze Himmel grau, und Trägheit breitete sich in meinem Körper aus. Ein Stück abseits des Weges fand ich ein verwittertes Bauernhaus, das fast völlig von Dornbüschen und Unkraut überwuchert war. Sie drangen durch die Bodenbretter der Veranda, rankten sich über das Dach und hüllten die Mauern ein, doch das Haus schien ansonsten noch einigermaßen intakt zu sein. Vorsichtig schlich ich die Stufen zur Veranda hinauf, schob mit dem Fuß die Tür auf und ging hinein. Kleine Nager huschten in die dunklen Ecken, als mit mir eine Schneewolke hereinwehte und sich über den Boden verteilte. Ich betrachtete das spärliche Mobiliar, das zwar voller Staub und Spinnweben war, ansonsten aber seltsamerweise unberührt zu sein schien.
Vor mir an der Wand stand ein altes gelbes Sofa. An einer Seite war es angenagt, sodass die Polsterung herausquoll. In mir stiegen Erinnerungen an eine Szene in einem ganz ähnlichen Haus auf, ebenfalls leer und verlassen.
Für den Bruchteil einer Sekunde sah ich ihn dort sitzen, erschöpft zusammengesunken mit den Ellbogen auf den Knien. Seine hellen Haare schimmerten in der Dunkelheit. Ich spürte wieder seine Wärme auf meiner Haut, sah diese durchdringenden blauen Augen auf mich gerichtet, wenn er versuchte, aus mir schlau zu werden, fühlte, wie sich meine Brust schmerzhaft zusammenzog, als ich mich abwenden und ihn zurücklassen musste.
Stirnrunzelnd ließ ich mich auf das Sofa fallen und fuhr mir mit der Hand über die Augen, um die Erinnerungen zu vertreiben und die letzten Eisreste von meinen Wimpern zu streichen. Ich durfte jetzt nicht an ihn denken. Er war zusammen mit den anderen in Eden. Er war in Sicherheit – Kanin nicht.
Ich lehnte mich zurück und stützte den Kopf auf die Rückenlehne. Kanin. Mein Schöpfer, der Vampir, der mich verwandelt hatte, der mir das Leben gerettet und alles beigebracht hatte, was ich heute wusste. Nur auf ihn musste ich mich nun konzentrieren.
Allein beim Gedanken an meinen Schöpfer runzelte ich schon wieder die Stirn. Ich verdankte diesem Vampir mein Leben, eine Schuld, die ich unbedingt begleichen wollte, auch wenn ich ihn nie richtig verstehen würde. Kanin war von Anfang an ein großes Rätsel für mich gewesen, schon seit jener schicksalhaften Nacht, als ich bei strömendem Regen vor den Mauern meiner Heimatstadt von Verseuchten angegriffen worden war. Ich hatte im Sterben gelegen, als wie aus dem Nichts dieser Fremde auftauchte und anbot, mich zu retten. Er stellte mich vor die Wahl: sterben oder … zu einem Monster werden.
Logischerweise hatte ich mich für das Leben entschieden. Doch auch danach hatte Kanin mich nicht allein gelassen. Er war bei mir geblieben und hatte mir gezeigt, was es hieß, ein Vampir zu sein, hatte sichergestellt, dass ich genau wusste, wofür ich mich da entschieden hatte. Ohne ihn hätte ich diese ersten Wochen wahrscheinlich nicht überlebt.
Doch Kanin hatte so einige Geheimnisse, und eines Nachts holte uns das dunkelste von ihnen ein, und zwar in Gestalt von Sarren, einem wahnsinnigen Vampir auf Rachefeldzug. Der gefährliche, durchtriebene und vollkommen geisteskranke Sarren hatte uns in dem verborgenen Labor aufgespürt, das wir als Versteck benutzten, sodass wir gezwungen waren zu fliehen. In dem darauffolgenden Chaos wurden Kanin und ich getrennt, und mein Mentor verschwand ebenso unvermittelt, wie er aufgetaucht war. Seitdem hatte ich ihn nicht mehr gesehen.
Doch dann kamen die Träume.
Ich stand mit einem lauten Quietschen der Sofasprungfedern auf und ging durch einen muffigen Flur, bis ich das Zimmer ganz am Ende erreichte. Offenbar war es ein Schlafzimmer gewesen, und das Doppelbett in der Ecke stand sogar so weit vom Fenster entfernt, dass eventuelle Sonnenstrahlen es nicht erreichen konnten.
Nur um sicherzugehen hängte ich eine alte Decke vor das Fenster und tauchte den Raum so zusätzlich in tiefe Schatten. Draußen fielen immer noch winzige Flocken vom dunklen, wolkenverhangenen Himmel, doch falls es aufklaren sollte, wollte ich kein Risiko eingehen. Anschließend legte ich mich auf das Bett, mein Schwert immer in Reichweite, starrte an die Decke und wartete darauf, dass der Schlaf mich holen kam.
Vampire träumen nicht. Technisch gesehen sind wir tot, und wenn wir schlafen, sinken wir in die endlose Schwärze eines Leichnams. Meine »Träume« handelten immer von Kanin, der offenbar in Schwierigkeiten steckte. Dabei blickte ich durch seine Augen und spürte alles, was er empfand. Denn wenn man extremen Stress, Schmerz oder starke Emotionen durchlebt, spricht das Blut zum Blute, sodass ich fühlen konnte, was mein Schöpfer durchlitt – Höllenqualen. Sarren hatte ihn gefunden. Und nun nahm er Rache.
Beim Gedanken an den letzten Traum kniff ich unwillkürlich die Augen zusammen.
Nach all den Schreien ist meine Kehle wund.
Letzte Nacht hat er sich nicht mehr zurückgehalten. Zuvor hat er nur mit mir gespielt, lediglich einen kleinen Teil seiner kranken Grausamkeit gezeigt. Doch in der vergangenen Nacht kam der wahre Dämon zum Vorschein. Er wollte reden, wollte mich zum Reden bringen, doch diesen Gefallen habe ich ihm nicht getan. Dann hat er mich stattdessen zum Schreien gebracht. Irgendwann habe ich auf meinen Körper hinabgeblickt, der wie ein Stück zerfetztes Fleisch von der Decke hing, und mich gefragt, wie es sein kann, dass ich noch lebe. Niemals zuvor hatte ich mich so sehr nach dem Tod gesehnt wie in diesem Augenblick. Die Hölle konnte nicht schlimmer sein als das. Es ist ein Beweis für Sarrens Geschick – oder vielleicht auch nur für seinen Wahnsinn –, dass es ihm gelang, mich am Leben zu halten, während ich alles daransetzte, endlich zu sterben.
Heute Nacht ist er allerdings erstaunlich zurückhaltend. Wie in den unzähligen Nächten zuvor erwachte ich und hing noch immer an den Handgelenken gefesselt von der Decke. Gleichzeitig bereitete ich mich mental auf die Qualen vor, die bald kommen würden. Der Hunger tobt in mir wie ein lebendiges Wesen, er verzehrt mich und ist allein schon kaum zu ertragen. In letzter Zeit sehe ich überall Blut, es tropft von der Decke und quillt unter der Tür hindurch. Erlösung, die sich mir stets entzieht.
»Es hat keinen Zweck.«
Ein zischendes Flüstern in der Dunkelheit. Sarren steht einen guten Meter von mir entfernt und beobachtet mich ausdruckslos. Wie ein Netz ziehen sich die Narben über sein bleiches Gesicht. Letzte Nacht lag ein fiebriger Glanz in seinen Augen, während er mich beschimpfte, schrie und immer wieder forderte, ich solle seine Frage beantworten. Doch der tote, leere Gesichtsausdruck, mit dem er mich heute mustert, beunruhigt mich mehr als alles andere.
»Es hat keinen Zweck«, flüstert er wieder und schüttelt den Kopf. »Du bist hier, direkt vor mir, und doch spüre ich gar nichts.« Er gleitet heran, streicht mit seinen langen, knochigen Fingern über meinen Hals und sieht mich fragend an. Mir fehlt die Kraft, um zurückzuzucken. »Deine Schreie, welch glorreiches Lied. Jahrelang habe ich mir ausgemalt, wie sie wohl klingen würden. Dein Blut, dein Fleisch, deine Knochen – alles habe ich mir vorgestellt. Wie ich sie breche, sie koste.« Sein Finger wandert zu meiner Kehle. »Du warst ganz mein, ich konnte dich aufbrechen, abschälen, sehen, welch verdorbene Seele sich unter dieser Hülle aus Fleisch und Blut verbirgt. Es sollte ein prachtvolles Requiem werden.« Als er einen Schritt zurücktritt, wirkt er fast schon verzweifelt. »Aber ich sehe nichts. Und ich spüre … nichts. Warum?« Er wirbelt herum und geht zu dem Tisch hinüber, auf dem Dutzende scharfer Instrumente bereitliegen. Sie funkeln in der Dunkelheit. »Mache ich etwas falsch?«, murmelt er, während er mit der Fingerspitze über jedes einzelne von ihnen streicht. »Soll er nicht bezahlen für das, was er getan hat?«
Ich schließe die Augen. Was er getan hat. Sarren hat jedes Recht, mich zu hassen. Was ich ihm angetan habe, was ich zu verantworten habe – ich verdiene jede Folter, der er mich aussetzen wird. Doch dadurch wird es keine Wiedergutmachung geben. Es wird nicht aufhalten, was ich in Gang gesetzt habe.
Als hätte er meine Gedanken gelesen, dreht Sarren sich zu mir um, und plötzlich kehrt das Funkeln in seine Augen zurück. Seine brennende Intensität verrät den Wahnsinn und die Genialität dahinter, und zum ersten Mal durchdringt eine leise Angst die betäubenden Schmerzen.
»Nein«, haucht er gedehnt, fast schon benommen, so als hätte er nun alles begriffen. »Nein, jetzt verstehe ich. Ich erkenne, was ich tun muss. Nicht du bist der Ursprung dieser Verderbtheit. Du warst lediglich ihr Vorbote. Die ganze Welt strotzt vor Fäulnis, Verfall und Dreck. Doch das werden wir in Ordnung bringen, alter Freund. Oh ja, wir werden das zurechtrücken. Und zwar gemeinsam.«
Seine Hand wandert einmal über den gesamten Tisch, bevor er in der hintersten Ecke nach etwas greift. Dieser Gegenstand funkelt nicht wie die anderen – kein auf Hochglanz poliertes Metall. Er ist lang, aus Holz und endet in einer grob zugeschnitzten Spitze.
Ich fange an zu zittern, sämtliche Instinkte befehlen mir zurückzuweichen, möglichst viel Abstand zwischen mich und diese hölzerne Spitze zu bringen. Aber ich kann mich nicht bewegen, und Sarren kommt langsam auf mich zu, den Pflock wie ein Kruzifix vor sich ausgestreckt. Er lächelt wieder, ein dämonisches Grinsen verzerrt das zerstörte Gesicht und lässt seine Fangzähne aufblitzen.
»Noch kann ich dich nicht töten«, verkündet er und tippt mit der Spitze des Holzpflocks gegen meine Brust, direkt über meinem Herzen. »Nein, noch nicht. Das würde das Ende verderben, und ich habe so ein wundervolles Lied vor Augen. Oh ja, es wird grandios werden. Und du … du wirst das Instrument sein, auf dem ich diese Symphonie komponiere.« Er macht einen Schritt nach vorn und schiebt dabei die Pflockspitze in meinen Brustkorb, ganz langsam. Während sie meine Haut durchstößt, dreht er sie genüsslich. Ich werfe den Kopf zurück, beiße aber die Zähne zusammen, um nicht zu schreien. Sarren fährt fort: »Nicht doch, alter Freund. Der Tod ist immer noch zu gut für dich. Wir legen dich jetzt nur für eine Weile schlafen.« Immer tiefer gleitet der Pflock in mein Fleisch, zerteilt die Muskeln und schabt über mein Brustbein, näher und näher an mein Herz heran. Das Holz verwandelt sich in eine Feuerzunge und verbrennt mich von innen heraus. Mein Körper verfällt in Krämpfe und stellt langsam den Dienst ein. Am Rand meines Gesichtsfeldes lauert die Dunkelheit – die Tiefenstarre zerrt an mir, das letzte Mittel zur Selbsterhaltung. Sarren lächelt.
»Schlaf nur, alter Freund«, flüstert er. Sein vernarbtes Gesicht verschwimmt, als die Dunkelheit mir die Sicht raubt. »Aber nicht lange. Ich habe etwas ganz Besonderes geplant.« Sein hohles Kichern verfolgt mich in die Schwärze hinein. »Das wirst du nicht verpassen wollen.«
An diesem Punkt war die Vision abgebrochen. Und seitdem hatte ich keine Träume mehr gehabt.
Schwerfällig verlagerte ich mein Gewicht, zog das Schwert an die Brust und dachte nach. Ich hatte Sarren bis zu einem Ort verfolgt, an dem er mit Sicherheit gewesen war: einem heruntergekommenen Haus in einem verlassenen Vorort, wo mich eine lange Treppe in den Keller hinuntergeführt hatte. Sobald ich die Tür geöffnet hatte, hatte mich schlagartig der Geruch von Kanins Blut überfallen. Es war einfach überall gewesen: an den Wänden, an den Ketten, die von der Decke hingen, an den Instrumenten auf dem Tisch. Direkt unter den Metallfesseln war der Boden dunkel verschmiert gewesen. Fast hätte sich mir der Magen umgedreht. Es schien völlig ausgeschlossen zu sein, dass Kanin das überlebt hatte, dass überhaupt irgendetwas lebend aus diesem makabren Verlies entkommen könnte. Doch ich musste daran glauben, dass er noch am Leben und Sarren noch nicht mit ihm fertig war.
Diese Ahnung hatte sich bestätigt, als ich mich weiter umsah und in einem Schrank im Erdgeschoss die steifen, halb verwesten Leichen einiger Menschen entdeckte, die nachlässig dort hineingeworfen worden waren. Sie waren vollkommen blutleer, die Hälse zeigten nicht nur Bisswunden, sondern waren völlig zerfetzt, außerdem stand auf einem Tisch ein rot verklebter Krug. Sarren hatte Kanin gefüttert, damit er zwischen den einzelnen Sitzungen heilen konnte. Während ich den Schrank mit den Leichen wieder schloss, packten mich Mitgefühl und Sorge um meinen Mentor. Kanin hatte Fehler gemacht, aber so etwas verdiente niemand. Ich musste ihn vor Sarrens krankem Irrsinn retten, bevor dieser meinen Schöpfer endgültig in den Wahnsinn trieb.
Durch die löchrige Decke am Fenster drang graues Licht, was mich noch träger werden ließ. Halt durch, Kanin, dachte ich müde. Ich werde dich finden, das schwöre ich. Ich hole schon auf.
Doch wenn ich ehrlich war, machte mir der Gedanke, Sarren wieder gegenüberzustehen und dieses leere, hohle Grinsen und seinen fiebrigen Blick zu sehen, mehr Angst, als ich zugeben wollte. Wieder tauchte vor mir das Gesicht auf, das ich durch Kanins Augen gesehen hatte. Während des Traums war es mir nicht aufgefallen, dass sich ein milchiger Film über dem linken Auge befunden hatte, sodass es weiß und trüb wirkte. Es war geblendet worden, und das erst vor Kurzem. Das wusste ich so genau, weil das Taschenmesser, das sich bei unserer letzten Begegnung in dieses Auge gebohrt hatte, meines gewesen war.
Daher wusste ich, dass Sarren mich ebenfalls nicht vergessen hatte.
2
Vor vier Monaten habe ich Eden verlassen.
Genauer gesagt hat man mich gezwungen zu gehen – ähnlich wie bei Adam und Eva, als sie aus dem berühmten Garten geworfen wurden, allerdings war ich mit einer kleinen Pilgergruppe vor den Toren erschienen, um dann abgewiesen zu werden. Eden war eine Stadt unter menschlicher Kontrolle, vollkommen einzigartig, ein ummauertes Paradies, dessen arglose Bewohner nicht von Monstern oder Dämonen gejagt wurden. Und ich war die Art Monster, die sie am meisten fürchteten. Für mich gab es dort keinen Platz.
Dabei wäre ich ohnehin nicht geblieben. Ich musste mein Versprechen einlösen. Musste ihn finden und ihm helfen, bevor seine Zeit ablief.
Also hatte ich Eden verlassen und mich von den Menschen getrennt, die ich auf dem Weg dorthin beschützt hatte. Die Gruppe, die ich zurückließ, war kleiner als jene, der ich mich ursprünglich angeschlossen hatte. Unsere Reise war hart und gefährlich gewesen, und wir hatten unterwegs einige Opfer zu beklagen. Doch ich freute mich für alle, die es geschafft hatten. Jetzt waren sie in Sicherheit. Sie mussten sich keine Gedanken mehr um Hunger oder Kälte machen, wurden nicht mehr von Banditen verfolgt oder von Vampiren gejagt. Und sie mussten keine Angst mehr vor den Verseuchten haben, den wilden, hirnlosen Kreaturen, die nach Einbruch der Dunkelheit das Land unsicher machten und alles töteten, was ihnen über den Weg lief. Nein, Menschen, die es bis nach Eden schafften, fanden dort eine sichere Zuflucht. Ich freute mich wirklich für sie.
Obwohl es da einen gab … den ich nur schweren Herzens zurückgelassen hatte.
Am nächsten Abend hatten sich die Wolken verzogen, und der Himmel war mit Sternen übersät. Der kalte Mond war halb voll und leuchtete mir den Weg. Außer dem Wind und dem Knirschen meiner Stiefel im Schnee waren keine Geräusche zu hören. Wie immer, wenn ich allein durch die stille, öde Landschaft wanderte, drifteten meine Gedanken in eine Richtung ab, die mir gar nicht gefiel. Ich dachte an mein altes Leben als Mensch, als ich noch einfach Allie, die Straßengöre, gewesen war, Allie aus dem Saum, und mit meiner alten Gang ein karges Dasein gefristet hatte. Ständig waren wir halb verhungert gewesen, waren Gefahr gelaufen, entdeckt oder auf hundert verschiedene Arten getötet zu werden, und das alles nur, damit wir von uns sagen konnten, wir wären »frei«. Bis wir das Schicksal eines Nachts zu sehr herausgefordert und mit unserem Leben dafür bezahlt hatten.
New Covington. So hieß die Vampirstadt, in der ich geboren worden, aufgewachsen und schließlich gestorben war. In den siebzehn Jahren meines Lebens hatte ich nichts anderes gekannt. Von der Welt jenseits der Großen Mauer, mit der man die Verseuchten abhielt, hatte ich keine Ahnung gehabt, genauso wenig von der Inneren Stadt, wo die Vampire in ihren finsteren, glänzenden Türmen hockten und auf uns herabblickten. Mein gesamtes Leben hatte sich im Saum abgespielt, dem äußeren Stadtgebiet von New Covington, in dem das menschliche Vieh lebte, eingepfercht hinter Zäunen und gebrandmarkt durch Tattoos. Die Spielregeln waren simpel: Trug man ein Brandzeichen – und war damit bei den Meistern registriert –, dann bekam man Essen und eine gewisse Versorgung, doch der Nachteil war, dass man zu ihrem Eigentum wurde. Wie eine Ware. Und es bedeutete, dass man regelmäßig Blut spenden musste. Als Unregistrierter war man sich selbst überlassen, und das in einer Stadt, in der es außer dem, was die Meister verteilten, weder Nahrung noch sonst etwas gab, was man zum Leben brauchte. Dafür konnten die Vampire einem aber immerhin nicht das Blut abzapfen, solange sie einen nicht persönlich erwischten.
Natürlich drohte dann aber immer auch der Hungertod.
Als ich noch ein Mensch war, hatte ich jeden Tag gegen den Hunger angekämpft. Mein Leben hatte sich fast ausschließlich um die Frage gedreht, wo ich etwas zu essen auftreiben könnte. Unsere kleine Gruppe hatte aus vier Leuten bestanden: mir, Lucas, Rat und Stick. Keiner von uns war registriert gewesen – Straßenkids, die sich als Bettler und Diebe durchschlugen, zusammen in einer verlassenen Schule hausten und gerade so über die Runden kamen. Bis zu jener Gewitternacht, in der wir uns hinter die Große Mauer gewagt hatten, um auf die Jagd nach Nahrung zu gehen … und dort selbst zu Gejagten wurden. Es war dumm gewesen, den Schutz von New Covington zu verlassen, aber ich hatte sie dazu gedrängt, und für meine Sturheit zahlten wir einen hohen Preis. Lucas und Rat waren getötet worden, und mich hatte ein Rudel Verseuchter umzingelt und in Stücke gerissen. Mein Leben hätte in dieser Nacht dort im Regen enden sollen.
Und in gewisser Weise hatte es das wohl auch. In dieser Nacht starb ich in Kanins Armen. Und jetzt, wo ich ein Monster war, konnte ich niemals zu diesem vertrauten Leben zurückkehren. Ich hatte einmal versucht, einen Freund aus meinem alten Leben zu kontaktieren, den Jungen namens Stick, um den ich mich jahrelang gekümmert hatte. Doch sobald Stick erkannt hatte, was aus mir geworden war, hatte er angefangen zu schreien und war panisch vor mir weggelaufen. Damit hatte er das bestätigt, was Kanin mir die ganze Zeit gepredigt hatte: Es gab kein Zurück mehr. Weder nach New Covington noch in mein altes Leben oder zu irgendetwas anderem, was mit meiner ehemaligen Menschlichkeit zu tun hatte. Kanin hatte recht gehabt. Wie immer.
Ich musste oft an ihn denken, an all die Nächte, die wir in dem geheimen Labor unter der Vampirstadt verbracht hatten, wo ich geboren worden war. An seine Lektionen, durch die er mir beigebracht hatte, was es hieß, ein Vampir zu sein, und wie man jagte, kämpfte und tötete. An die Menschen, die ich zu meiner Beute gemacht hatte, an ihre Schreie, an das warme Blut in meinem Mund, so berauschend und schrecklich. Und an Kanin selbst, der mir unmissverständlich klar gemacht hatte, was ich nun war – ein Vampir und ein Dämon –, aber auch, dass mein Weg nicht vorgezeichnet war, dass ich eine Wahl hatte.
Du bist ein Monster. Seine Stimme erklang so deutlich in meinem Kopf, als würde er direkt neben mir stehen und sein eindringlicher Blick mich durchbohren. Du wirst immer ein Monster sein, daran führt kein Weg mehr vorbei. Doch es ist allein deine Entscheidung, welche Art von Monster du sein wirst. Genau an diese Lektion klammerte ich mich, diese Tatsache würde ich niemals vergessen, das hatte ich mir geschworen.
Aber Kanin hatte noch eine andere strikte Regel, die mir zunächst nicht so klar im Gedächtnis geblieben war. Sie betraf die Menschen und eventuelle Bindungen zu ihnen …
Meine verräterischen Gedanken wanderten zu einem schlanken Jungen mit struppigen blonden Haaren und ernsten blauen Augen. Ich erinnerte mich an sein Lächeln, dieses schiefe Grinsen, das nur für mich bestimmt war. An seine Berührungen, die Hitze, die von ihm ausging, wann immer wir uns nahe kamen. Daran, wie seine Finger über meine Haut glitten, an seine warmen Lippen, die sich auf meine drückten …
Ich schüttelte den Kopf. Ezekiel Crosse war ein Mensch. Ich war ein Vampir. Ganz egal, was ich für ihn empfand, ganz egal, wie stark meine Gefühle waren, ich würde den Wunsch, ihn zu küssen, nie von dem Drang trennen können, ihm die Reißzähne in den Hals zu schlagen. Was ein weiterer Grund dafür war, dass ich Eden ohne ein Abschiedswort verlassen und niemandem gesagt hatte, wohin ich ging. Es war unmöglich für mich, in Zekes Nähe zu sein, ohne dabei sein Leben aufs Spiel zu setzen. Letzten Endes würde ich ihn töten.
Da war es besser, allein zu sein. Vampire waren Raubtiere. Der Hunger war unser ständiger Begleiter, jene Gier nach menschlichem Blut, die uns jederzeit überwältigen konnte. Verlor man sich in diesem Hunger, starben die Menschen um einen herum. Ich hatte diese Lektion auf die harte Tour gelernt, eine Erfahrung, die ich nicht wiederholen wollte. Die Angst ließ mich nie los – Angst davor, die Kontrolle zu verlieren. Davor, dass der Hunger mich wieder überwältigen könnte und ich, wenn ich wieder ich selbst war, feststellen müsste, dass ich jemanden getötet hatte, den ich kannte. Selbst meine auserwählten Opfer – Banditen, Gangster, Plünderer und Mörder – waren doch immer noch Menschen. Lebewesen, die ich tötete, um mich zu ernähren. Und um mich davon abzuhalten, andere anzugreifen. Natürlich hatte ich die Wahl, welche Menschen ich jagte, doch letzten Endes musste ich irgendjemanden aussuchen. Auch das kleinere von zwei Übeln war noch schlimm genug.
Und Zeke war zu gut, um mit in diese Finsternis gerissen zu werden.
Ich zwang mich, an etwas anderes zu denken, bevor die Erinnerungen an Zeke zu schmerzhaft wurden. Um mich abzulenken, konzentrierte ich mich auf das Ziehen in meinem Inneren, diesen seltsamen Drang, den ich selbst jetzt noch nicht so ganz verstand. In wachem Zustand spürte ich ihn kaum, nur im Schlaf konnte ich Kanins Gedanken wahrnehmen und durch seine Augen sehen. Zumindest bis zu dieser letzten Vision, als Sarren Kanin den Holzpflock in die Brust getrieben und ihn so in die Tiefenstarre geschickt hatte.
Jetzt hatte ich keinen Zugang mehr zu dem, was mit Kanin geschah. Aber wenn ich mich konzentrierte, wusste ich immer, in welche Richtung ich mich wenden musste, um zu meinem Schöpfer zu gelangen. Auch jetzt befreite ich mein Bewusstsein von allen anderen Gedanken und suchte nach Kanin.
Das Ziehen war noch da, es schickte mich nach Osten, aber … irgendetwas stimmte nicht. Keine Gefahr, keine Bedrohung, doch in meinem Bauch machte sich ein merkwürdiges Kribbeln breit, wie dieses nagende Gefühl, wenn man weiß, dass man etwas vergessen hat, sich aber einfach nicht daran erinnern kann, was es war. Bis zur Morgendämmerung dauerte es noch einige Stunden, ich lief also nicht Gefahr, unter freiem Himmel vom Licht überrascht zu werden. Es gab auch nichts, was ich irgendwo hätte liegen lassen können, ich hatte nur mein Schwert, und das war sicher an meinem Rücken festgeschnallt. Warum fühlte ich mich also so unwohl?
Wenige Minuten später begriff ich es.
Das Ziehen in mir, diese merkwürdige aber unfehlbare Gewissheit, war dabei, sich in zwei unterschiedliche Richtungen aufzuspalten. Abrupt blieb ich mitten auf der Straße stehen und überlegte, ob mich mein Gefühl vielleicht trog. Aber das war es nicht. In mir drängte immer noch ein starkes Ziehen Richtung Osten, aber jetzt war da noch ein schwächerer Impuls, der mich nach Norden schicken wollte.
Verwirrt runzelte ich die Stirn. Zwei Richtungen. Was konnte das bedeuten? Und wohin sollte ich mich nun wenden? Das Ziehen aus Osten war stärker, das aus dem Norden war kaum zu spüren, aber definitiv da. Auch wenn es unmöglich schien, stand ich plötzlich an einem Scheideweg. Und ich hatte keine Ahnung, welche Abzweigung ich nehmen sollte.
Hat Kanin sich irgendwie befreit? Flieht er jetzt Richtung Norden, und ich folge nur noch Sarren? Scheint ziemlich unwahrscheinlich, dass Sarren derjenige sein könnte, der auf der Flucht ist. Je mehr ich grübelte, umso tiefer wurden die Sorgenfalten auf meiner Stirn, denn das ungute Gefühl verstärkte sich nur. Ist das Sarren? Würde ich denn überhaupt etwas spüren, wenn es nur um ihn geht? Wir teilen nicht das gleiche Blut, sind, soweit ich weiß, in keinster Weise miteinander verbunden. Was ist hier los?
Vollkommen verwirrt stand ich auf der Straße und versuchte zu entscheiden, was ich nun tun, welche Richtung ich einschlagen sollte. Diese Geschichte mit den vampirischen Blutsbanden war Neuland für mich, deshalb hatte ich keine Ahnung, warum ich plötzlich zwei Fährten spüren konnte statt einer. Vielleicht hatte Sarren sich von Kanin genährt? War es möglich, dass Sarren doch mit mir und meinem Schöpfer verwandt war, dass vor Jahrhunderten eine Verbindung geknüpft worden war?
Ein absolutes Rätsel, das ich aber nicht lösen konnte. Letzten Endes wandte ich mich nach Osten. Da dieses zweite Gefühl mich stetig weiter in die andere Richtung schickte, nagten Unsicherheit und Zweifel an mir, aber ich konnte schließlich nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Ich musste mich für eine Route entscheiden und ihr weiter folgen. Also wählte ich die stärkere der beiden Zugleinen, und falls sie mich direkt in die Arme eines wütenden, psychotischen Vampirs trieb, der mir die Haut vom Fleisch schälen wollte, würde ich damit dann irgendwie klarkommen müssen.
Als ich am nächsten Abend aufwachte, hatte sich Drang Nummer zwei vollständig nach Westen verlagert. Ich ignorierte ihn genauso wie meine Zweifel und ging weiter nach Osten. Zwei weitere Nächte wanderte ich durch endlose Wälder und verfallene Ortschaften, immer die dunkle Straße entlang, auf der sich höchstens ab und zu ein paar Tiere blicken ließen. Ich sah Rehe, aber auch Waschbären, Opossums und sogar einen Berglöwen, der seine Beute durch die Bäume und Ruinen verlassener Häuser jagte. Die Tiere beäugten mich zwar misstrauisch, kamen mir aber nicht zu nahe, also ließ ich sie ebenfalls in Ruhe. Der Hunger regte sich momentan nicht, außerdem trug Tierblut nicht dazu bei, das Monster in meinem Inneren zu besänftigen – auch das hatte ich auf die harte Tour gelernt.
Schnee und Wälder nahmen kein Ende, die Straße wurde fast erstickt von den wuchernden Pflanzen ringsum, die sogar den Teer aufbrachen und durch die entstandenen Ritzen wuchsen. Doch irgendwann verbreiterte sie sich, und es tauchten verlassene Autowracks am Straßenrand auf. Je weiter ich kam, desto mehr rostige Blechkisten standen im Schnee. Offenbar näherte ich mich einer Stadt, was meine Instinkte in Alarmbereitschaft versetzte. Die meisten verlassenen Ortschaften waren genau das: verfallen und leer, einstürzende Ruinen und überwucherte Straßen. Doch die Großstädte, in denen früher einmal Tausende Menschen auf engstem Raum gelebt hatten, wurden nun von einer anderen Spezies beherrscht.
Immer breiter wurde die Straße, sie glich nun fast einer Autobahn, die trotzig den gierigen Wald zurückdrängte. Inzwischen waren die Wracks so zahlreich, dass sie den Weg in ein Labyrinth aus rostigem Metall und Glas verwandelten, allerdings nur auf der Fahrspur, die stadtauswärts führte. Ich wanderte auf der leeren Fahrbahn an der endlosen Schlange kaputter und zertrümmerter Autos entlang und vermied jeden Blick in ihr Inneres, auch wenn manche Dinge unmöglich zu übersehen waren. Am Steuer eines maroden Wagens hing ein Skelett, schon halb unter dem Schnee begraben, der durch die zerbrochene Windschutzscheibe wehte. Unter einem verkohlten, umgekippten Laster lag ein zweites. Tausende Menschen, die alle gleichzeitig versucht hatten, die Stadt zu verlassen. Waren sie vor der Seuche geflohen oder vor dem Wahnsinn, der auf sie folgte?
Mein Weg führte mich durch großzügig angelegte Boulevards, die mit einer dicken Schnee- und Eisschicht bedeckt waren. Irgendwann verließ ich die verstopfte Hauptstraße und bog in die leeren Seitenstraßen ab, da ich mir dort leichter einen Weg bahnen konnte.
Nachdem ich eine windige Brücke überquert hatte, die sich über einen trüb-grauen Fluss spannte, stieß ich auf ein riesiges Marmorgebäude, das fast gar nicht überwuchert war und seltsam unberührt wirkte. Aus Neugier, und weil es sowieso in der Richtung lag, in die das Ziehen mich trieb, ging ich darauf zu und wanderte anschließend daran entlang. Das Dach war zur Hälfte eingestürzt, und einige der mächtigen Säulen ringsum waren zerbrochen und umgefallen. Eine komplette Ecke fehlte, an ihrer Stelle lag nur noch ein Schutthaufen. Ich ging hinein und sah mich wachsam um.
Obwohl der Innenraum riesig war, war er fast leer. Anscheinend lebte hier nichts außer der Eule, die unter der hohen, gewölbten Decke flatterte, als ich eintrat. An den Wänden zogen sich Säulen entlang, dahinter entdeckte ich Worte, die an beiden Seiten direkt in die Wände geritzt, jetzt aber so gesprungen und brüchig waren, dass ich sie nicht mehr entziffern konnte.
An der hinteren Wand ragte eine Statue von unfassbarer Größe auf. Die gigantische Männergestalt saß auf einer Art marmornem Stuhl, beide Arme auf die Lehnen gestützt. Eine Hand fehlte, und die steinernen Gesichtszüge waren von feinen Rissen durchzogen, doch ansonsten war sie noch erstaunlich gut erhalten. Auf dem Marmorstuhl klebte verschmierte Farbe, und es waren Obszönitäten darauf gekritzelt, die an der Wand noch weitergingen, außerdem war eine Ecke der Statue geschwärzt, als hätte jemand versucht, sie anzuzünden. Doch trotz dieser Schäden wirkte der Mann auf dem Stuhl noch immer irgendwie nobel. Sein großes, zerfurchtes Gesicht blickte auf mich herab, er schien mich direkt anzusehen – ein gruseliges Gefühl, dem steinernen Blick dieses Riesen ausgesetzt zu sein. Während ich rückwärts Richtung Ausgang schlich, schienen mich die leeren Augen zu verfolgen. Trotzdem hatte er ein freundliches Gesicht, das nicht in unsere Zeit passen wollte. Ich fragte mich, wer er wohl gewesen war, dass man ihn auf diese Art unsterblich gemacht hatte. Über die Zeit davor wusste ich so gut wie nichts; riesige Statuen und Gebäude aus Marmor, die offenbar keinerlei Zweck dienten. Alles sehr seltsam.
Draußen blieb ich kurz stehen, um mich zu orientieren. Vor den Eingangsstufen des Gebäudes breitete sich ein maroder Betonplatz aus. In einem flachen Wasserbecken waren Blätter und Zweige in Eis eingeschlossen, an seinem Rand lag ein umgekipptes Autowrack.
Und dann entdeckte ich etwas, das alles Bisherige an Merkwürdigkeit übertraf: Direkt gegenüber erhob sich ein hoher, weißer Turm in den Nachthimmel. Er war schmal und lief nach oben hin spitz zu. Wie eine bleiche Nadel stach er in die Wolken hinauf, wirkte dabei aber, als könnte ihn schon der kleinste Windhauch umwerfen.
Und das innere Ziehen trieb mich direkt darauf zu.
Ich rannte die Stufen hinunter und an dem Wasserbecken vorbei. Meine Stiefel landeten platschend in Schlick, Unkraut und Schneematsch. Jenseits der Betonfläche wurde der Boden zu feuchtem Sumpfland, in dem sich niedrige Büsche, Ranken und eisige Tümpel ablösten. Während ich mich dem seltsamen Turm näherte, erkannte ich, dass das Ziehen in meinem Inneren, dem ich seit Monaten gefolgt war, jetzt stärker war als je zuvor. Doch es ging nicht direkt von dem Turm aus, sondern von einem großen weißen Gebäude, das hinter den Bäumen jenseits des Turms hervorblitzte.
Dass meine Beute so nah war, stärkte meine Entschlossenheit, und ich schob mich weiter durch das Unterholz.
Dann hielt ich inne.
Einige Hundert Meter hinter dem Turm, noch jenseits der maroden Straße mit den rostigen Wracks und eines weiteren Sumpfs, ragte ein mit Stacheldraht versehener Zaun auf und zog sich wie eine Narbe über den Horizont. Er war fast vier Meter hoch und bestand unter der Drahtkrone aus schwarzen Eisenstäben; ein vertrauter Anblick. Während meiner Reise quer durch das Land hatte ich eine Menge Mauern gesehen, aus Beton, Holz, Stahl und Stein. Sie waren einfach überall, umgaben jede Siedlung, von der kleinsten Farm bis zu großen Städten. Und sie wurden alle aus nur einem Grund errichtet, der sich gerade direkt vor mir befand und mich daran hinderte, heute Nacht noch weiterzukommen.
Entlang des Zauns hatte sich eine Horde dürrer, ausgemergelter Kreaturen versammelt, die zischend und fauchend die Zähne fletschten. Ihre Bewegungen waren ruckartig, fast spastisch, einige liefen auf allen vieren, gebeugt und irgendwie widernatürlich. Ihre Kleidung – wenn sie welche trugen – bestand nur noch aus Fetzen, ihre Haare waren zerzaust und verklebt. Kalkweiße Haut spannte sich über ihre Knochen, und die Augen in den eingefallenen, kantigen Gesichtern reflektierten die Seelenlosigkeit im Inneren dieser Wesen: ausdruckslose, tote weiße Spiegel.
Verseuchte. Mit einem leisen Knurren zog ich mich in den Schatten eines Baumes zurück. Noch hatten sie mich nicht entdeckt. Während ich hinter dem Stamm Deckung suchte und die rastlose Horde beobachtete, fiel mir etwas Merkwürdiges auf: Die Verseuchten rannten weder gegen den Zaun an, noch versuchten sie hinüberzuklettern, obwohl sie sich leicht an ihm hätten hochziehen können. Stattdessen drückten sie sich einen guten Meter vor dem Zaun herum, ohne die Eisenstangen zu berühren.
Das machte mich noch neugieriger. Ich spähte zwischen den Verseuchten hindurch hinter den Zaun und ballte so fest die Fäuste, dass sich meine Fingernägel in die Handflächen gruben.
Hinter der stählernen Barriere stand zwischen allerlei Grünzeug ein niedriges weißes Gebäude, das nur wenig höher war als das Tor im Zaun. Es hatte einen halbrunden Eingangsbereich, der mit ebenfalls weißen Säulen ausgestattet war. Hinter den Fenstern machte ich schwaches, flackerndes Licht aus.
In diesem Moment wusste ich es.
Er ist da drin. Hätte mein Herz noch geschlagen, hätte es nun laut in meiner Brust gedröhnt. Ich war so dicht dran. Aber wen würde ich dort vorfinden? Auf wen würde ich stoßen, wenn ich ihn endlich eingeholt hätte? Würde ich meinem Schöpfer gegenüberstehen, und wäre er überrascht, mich zu sehen? Würde er wütend darüber sein, dass ich ihn aufgespürt hatte? Oder würde ich einen gefährlichen Vampir vorfinden, in schrecklichem Wahnsinn gefangen und nur darauf aus, mich zu Tode zu foltern?
Das werde ich wohl bald herausfinden.
Der Wind drehte, sodass mich der grauenhafte Verwesungsgestank der Verseuchten mit voller Wucht traf. Angewidert rümpfte ich die Nase. Die würden nicht zulassen, dass ich einfach hinübermarschierte und an die Tür klopfte, die wahrscheinlich dem ansässigen Vampirprinzen gehörte. Und gegen eine derartig große Horde konnte ich nicht kämpfen. Mit einer Handvoll von diesen wilden Kreaturen wurde ich fertig, aber sich mit so vielen von ihnen anzulegen, grenzte an Selbstmord. Einmal hatte gereicht, vielen Dank auch. Vor den Toren von Eden hatte ich es mit einer Gruppe dieser Größenordnung zu tun bekommen, was ich nur dank eines tiefen Sees in der Nähe überlebt hatte; Verseuchte fürchteten tiefes Wasser. Vampir hin oder her, auch ich konnte ab einer gewissen zahlenmäßigen Überlegenheit überwältigt und zerfetzt werden.
Stirnrunzelnd überlegte ich mir eine Strategie. Ich musste irgendwie unbemerkt an den Verseuchten vorbeikommen. Der Zaun war nur vier Meter hoch, vielleicht konnte ich ja darüberspringen?
In diesem Moment kreischte einer der Verseuchten und versetzte einem seiner Kumpane, der ihn anscheinend geschubst hatte, einen heftigen Stoß. Taumelnd stolperte dieser Richtung Zaun, streckte fauchend eine Hand aus, um sich abzustützen, und berührte dabei eine der Eisenstangen.
Ein greller Blitz, explosionsartiger Funkenflug, dann schrie der Verseuchte und hing zuckend an dem Metall fest. Sein Körper zitterte und krampfte, was die Übrigen hastig zurückweichen ließ. Wenig später verwandelte sich der Rauch, der von seiner verkohlten Haut aufstieg, in offenes Feuer, und das Monster wurde von innen heraus verbrannt.
Okay, diesen Zaun werde ich auf keinen Fall anfassen.
Wieder knurrte ich. Bis zum Sonnenaufgang dauerte es nicht mehr lange, bald würde ich mich zurückziehen und Schutz vor dem Licht suchen müssen. Was auch bedeutete, dass ich jegliche Versuche, hinter diesen Zaun zu gelangen, auf die nächste Nacht verschieben musste. Dabei war ich so dicht dran! Es war zum Verrücktwerden: Mein Ziel lag nur wenige Meter vor mir, und alles, was mich von ihm trennte, waren eine Horde Verseuchter und diese elektrisch aufgeladene Metallkonstruktion.
Moment mal. Bald würde die Sonne aufgehen. Logischerweise würden die Verseuchten also bald schlafen müssen. Sie vertrugen das Tageslicht genauso wenig wie die Vampire und würden sich unter der Erde verstecken, um den heißen Sonnenstrahlen zu entgehen.
Was ich normalerweise ebenfalls tun würde.
Aber das hier waren besondere Umstände. Außerdem war ich nicht irgendein Vampir. Dafür hatte Kanin mich zu gut ausgebildet.
Um so tun zu können, als wäre ich ein Mensch, hatte ich mir antrainiert, nach Sonnenaufgang wach zu bleiben. Obwohl das extrem schwierig war und sämtlichen Vampirinstinkten widersprach, konnte ich wach und aktiv bleiben, wenn es notwendig war. Zumindest für kurze Zeit. Die Verseuchten hingegen waren reine Instinktwesen und würden nicht einmal versuchen, sich diesen Trieben zu widersetzen. Sie würden unter der Erde verschwinden, und war die Bedrohung durch sie erst einmal gebannt, würde der Strom im Zaun wahrscheinlich abgeschaltet werden. Es gab eigentlich keinen Grund, ihn tagsüber anzulassen, vor allem da das Benzin – oder was auch immer den Zaun antrieb – sicherlich knapp war. Wenn ich es also schaffte, mich lange genug wach zu halten, würden die Verseuchten verschwinden und der Zaun deaktiviert werden. Dann hatte ich freie Bahn zu dem Haus und jedem, der sich darin aufhielt. Dafür musste ich nur mit der Sonne klarkommen.
Besonders klug war es wohl nicht, meine Mission bei Tageslicht fortzusetzen. Ich wäre langsam, meine Reaktionen träge. Doch falls Sarren sich in diesem Gebäude befand, war er dann ebenfalls beeinträchtigt. Vielleicht schlief er ja sogar und rechnete nicht damit, dass Kanins rachsüchtige Tochter ihn hier aufspürte. Dann könnte ich ihn überrumpeln … falls es mir gelang, wach zu bleiben.
Konzentriert suchte ich das Gelände ab und prägte mir ein, wo die Schatten am tiefsten waren und die Bäume möglichst dicht zusammenstanden. Klugerweise war das Gebiet direkt am Zaun von Bäumen und Sträuchern befreit worden. Indirektes Licht konnte uns nichts anhaben, trotzdem war es unangenehm, im Schatten zu sitzen und zu wissen, dass die Sonne nur ein wenig weiterwandern oder ein Windstoß die Blätter verschieben musste, um einem jede Menge Schmerzen zu bereiten.
Als der Himmel immer heller wurde und sich die ersten Strahlen über den Horizont schoben, verschwand die Horde nach und nach. Sie verließen ihren Posten am Zaun und schlurften davon, um sich im weichen Schlamm einzugraben, bis ihre bleichen Körper ganz mit Erde und Wasser bedeckt waren. Ziemlich schnell leerte sich das Gebiet am Zaun, bis schließlich kein einziger Verseuchter mehr zu sehen war.
Ich lehnte mich an einen dicken Eichenstamm und kämpfte gegen den Drang an, den bösartigen Monstern unter die Erde zu folgen. Es war immer noch unsagbar schwierig, bei Bewusstsein zu bleiben, während die Sonne in den Himmel hinaufwanderte. Meine Gedanken wurden schwammig, mein Körper schwer und träge. Doch meine Übungen, im Freien zu bleiben, während unser größter Feind den Kopf über die Bäume streckte, zahlten sich aus. So stand ich immer noch aufrecht, als der letzte sture Verseuchte unter der Erde verschwand. Trotzdem wartete ich weiter, bis die Sonne auf Höhe der Baumkronen war, damit genug Zeit blieb, um den Zaun abzuschalten. Schließlich wäre es voll tragischer Ironie, wenn ich erst den Verseuchten und dann der Sonne entginge, um letztlich vor lauter Ungeduld auf einem verdammten Elektrozaun gegrillt zu werden. Ungefähr zwanzig Minuten, nachdem die Horde verschwunden war, verstummte das leise Summen, das von dem Metall ausgegangen war. Der Zaun war abgeschaltet.
Nun kam der gefährlichste Teil.
Ich zog mir den Mantel über den Kopf und zerrte die Ärmel so weit herunter, dass sie meine Hände bedeckten. Direktes Sonnenlicht auf der Haut würde sie erst verkohlen, bis sie irgendwann aufbrach und in Flammen aufging. Bedeckte ich die Haut, konnte ich mir etwas Zeit verschaffen.
Trotzdem würde es kein Spaß werden.
Meine Vampirinstinkte flehten mich an, es sein zu lassen, als ich unter den Bäumen hervortrat und mich die ersten, schwachen Strahlen trafen. Mit ängstlich gesenktem Kopf hastete ich über die Wiese, immer von Baum zu Baum, jeden Schattenfleck nutzend. Das Stück direkt vor dem Zaun war am gefährlichsten – keine Bäume, keine Deckung, nur kurz geschnittenes Gras und die Sonne, die auf meinen Rücken brannte. Mit zusammengebissenen Zähnen zog ich die Schultern hoch und lief weiter.
Kurz bevor ich das eiserne Hindernis erreichte, hob ich ein Stück Metallschrott auf und warf es mit voller Kraft. In hohem Bogen flog es gegen die Eisenstangen, es klirrte leise, dann fiel das Wurfgeschoss zu Boden. Keine Funken, kein Lichtblitz, kein Rauch. Viel Ahnung hatte ich nicht von Elektrozäunen, aber ich hielt das für ein gutes Zeichen.
Hoffentlich ist er auch wirklich abgeschaltet.
Mit einem Sprung erreichte ich die obere Zaunkante. Kurz packte mich Angst, als sich meine Finger um die Eisenstangen schlossen. Zum Glück blieb das Metall kalt und still, sodass ich das Hindernis eine halbe Sekunde später überwunden hatte und geduckt auf der anderen Seite landete.
In dem kurzen Moment, den ich brauchte, um über den Zaun zu klettern, rutschte mir der Mantel vom Kopf. So verflog die Erleichterung darüber, ohne gegrillt worden zu sein auf der Innenseite des Zauns zu landen, sehr schnell, als sich ein brennender Schmerz auf meinem Gesicht und meinen Händen ausbreitete. Mit einem gequälten Stöhnen zerrte ich den Mantel wieder hoch und flüchtete mich unter den nächsten Baum. Dort hockte ich mich hin und untersuchte meine Hände. Entsetzt zuckte ich zusammen. Schon nach wenigen Sekunden in der Sonne waren sie rot und taten höllisch weh.
Ich muss sofort da rein.
Möglichst tief geduckt lief ich über die verschneite Wiese. Je näher ich dem Gebäude kam, desto schutzloser fühlte ich mich. Falls irgendjemand die schweren Vorhänge an den riesigen Fenstern zurückzog, würde man mich garantiert entdecken. Doch es blieb alles dunkel und still, während ich die halbrunde Außenmauer erreichte und durch eine Art Torbogen hechtete. Endlich raus aus dem Licht!
Okay, und was nun?
Das schwache Ziehen in meinem Inneren, diese subtile Gewissheit, war jetzt stärker als je zuvor. Vorsichtig schlich ich die Eingangsstufen hinauf und spähte durch eines der Fenster. Dahinter lag ein seltsamer, runder Raum, der erstaunlich gut erhalten war. In der Mitte stand ein Tisch mit mehreren Stühlen, die zum Glück nicht besetzt waren. Jenseits des Raums tat sich ein leerer Korridor auf, von dem noch mehr Zimmer abgingen.
Ich unterdrückte ein Stöhnen. In einem derart großen Haus einen bewusstlosen Vampir zu finden, würde eine echte Herausforderung werden. Aber ich konnte jetzt nicht aufgeben.
Zu meinem größten Erstaunen waren die Fensterscheiben alle noch unversehrt, doch der Rahmen vor mir war nicht verriegelt. Ich schob mich durch das Fenster, landete leichtfüßig auf dem Holzboden im Inneren und sah mich wachsam um. Dabei wurde mir klar, dass hier Menschen leben mussten, und zwar nicht gerade wenige. Ich konnte sie riechen, in der Luft hing der Geruch von warmen Körpern und Blut. Kurz fragte ich mich, warum mich dieser Duft nicht umgehauen hatte, sobald ich durch das Fenster gekommen war. Falls Sarren hier war, würde er doch sicher das reinste Blutbad veranstalten.
Doch während ich durch das riesige Haus schlich, begegnete mir kein einziger Mensch, weder tot noch lebendig, was mir ziemliches Kopfzerbrechen bereitete. Insbesondere, da die Räumlichkeiten ganz offensichtlich sorgfältig gepflegt wurden. Hier war nichts kaputt. Wände und Boden waren sauber, es lag kein Schrott herum, die Möbel waren zwar alt, aber stabil und sorgsam arrangiert. Entweder verfügte der Prinz, der hier lebte, über eine Menge Diener, oder er hatte einen Putzfimmel.
Ich durchsuchte Dutzende leerer Räume, spähte in jede dunkle Ecke, achtete angespannt auf jede Bewegung. Aber das Haus blieb dunkel und still, auch als ich eine breite Treppe hinaufschlich und durch einen unglaublich langen Korridor ging, an dessen Ende mich eine dicke Holztür erwartete.
Hier muss es sein.
Vorsichtig zog ich mein Schwert aus der Scheide, damit das Metall nicht verräterisch schabte. Bis jetzt war alles viel zu einfach gewesen. Wer auch immer jenseits dieser Tür lauerte, wusste, dass ich kam. Falls Sarren mich erwartete, wollte ich ebenfalls vorbereitet sein. Und wenn Kanin dort drin war, würde ich nicht gehen, bevor ich ihn heil hier rausgeschafft hatte.
Schließlich packte ich die Klinke, drückte sie runter und riss die Tür auf.
Am anderen Ende des Zimmers stand jemand und wartete auf mich, genau wie ich es befürchtet hatte. Er trug einen schwarzen Ledermantel und hatte die Arme vor der Brust verschränkt. Anscheinend hatte er keine Waffe in der Hand. Das dicke dunkle Haar ging ihm bis zur Schulter, und als sich unsere Blicke trafen, verzog sich das blasse, attraktive Gesicht zu einem bösartigen Grinsen.
»Hallo, Schwesterchen«, begrüßte mich Jackal. Seine goldenen Augen funkelten im Halbdunkel. »Wurde auch Zeit, dass du endlich auftauchst.«
3
»Jackal«, hauchte ich entsetzt, als der große, schlanke Vampir gelassen auf mich zukam. Bei unserer letzten Begegnung war er der selbst ernannte Prinz einer überfluteten Stadt voller Banditen gewesen, deren Bewohner ebenso gefährlich und skrupellos gewesen waren wie er selbst. Er hatte sich alle Mühe gegeben, die Menschen gefangen zu nehmen, mit denen ich unterwegs gewesen war. Drei Jahre lang hatte er die Straßen nach ihnen abgesucht und seine Männer das Land durchkämmen lassen. Und sobald Jackal sie erwischt hatte, war er sich nicht zu schade gewesen, einen nach dem anderen zu opfern, um das zu bekommen, was er wollte. Zeke und mir war es zwar gelungen, unsere Gruppe aus den Fängen dieses Irren zu befreien, doch dabei hatten einige von ihnen ihr Leben verloren, und noch heute verfolgte mich das schmerzhafte Gefühl des Versagens, weil ich sie nicht hatte retten können.
Warum war Jackal hier? Als ich ihn das letzte Mal gesehen hatte, wurde er aus einem Fenster im dreißigsten Stock gestoßen, nachdem er mir – das wusste ich noch ganz genau – einen Holzpflock in den Bauch gerammt hatte. Meine Erinnerungen an den König der Banditen waren nicht gerade die besten, und mir war klar, dass Jackal auch nicht sonderlich begeistert von mir war.
Dann begriff ich, was das bedeuten musste, und ich starrte ihn entsetzt an. Kanin war unser Schöpfer, denn er hatte uns beide verwandelt. Der Banditenkönig war mein »Bruder im Blute«, und Blut sprach zu Blut. Kein Wunder, dass ich in zwei Richtungen gezerrt worden war. Wenn Jackal hier war, musste es seine Gegenwart gewesen sein, die mich angezogen hatte. Nicht Kanin, nicht Sarren. Ich hatte mich für die falsche Fährte entschieden.
Ich umklammerte mein Schwert so verzweifelt, dass sich der Griff in meine Handfläche grub. Wäre Jackal nicht in Hörweite gewesen, hätte ich frustriert gefaucht. Wer wusste schon, wie weit Sarren seinen Vorsprung inzwischen ausgebaut hatte? Die monatelange Suche, die Anstrengungen, ihn einzuholen und meinen Schöpfer zu finden, alles umsonst! Er befand sich noch immer in der Gewalt des Psychovamps, und inzwischen konnten sie schon am anderen Ende der Welt sein.
Während ich hier stand, eingesperrt in einem Haus mit meinem Bruder, der mich höchstwahrscheinlich umbringen wollte.
»Ich habe dich bereits erwartet, Schwesterchen.« Lächelnd und mit funkelnden Reißzähnen kam Jackal auf mich zu. Sein Mantel bauschte sich, sodass ich kurz den Glanz von Metall sehen konnte. »Hast dir ja ganz schön Zeit gelassen. Da befiehlt der Prinz von Old D.C. extra sämtlichen Wachen und Dienstboten, sich im Keller zu verstecken und dich passieren zu lassen, da es ja sein könnte, dass du hungrig bist, und was machst du? Schleichst durch das Haus wie irgendein dahergelaufener Einbrecher. Hast du dich nicht gewundert, dass dir niemand begegnet ist?«
Jetzt fauchte ich doch und fletschte dabei die Zähne. »Was machst du hier, Jackal?«