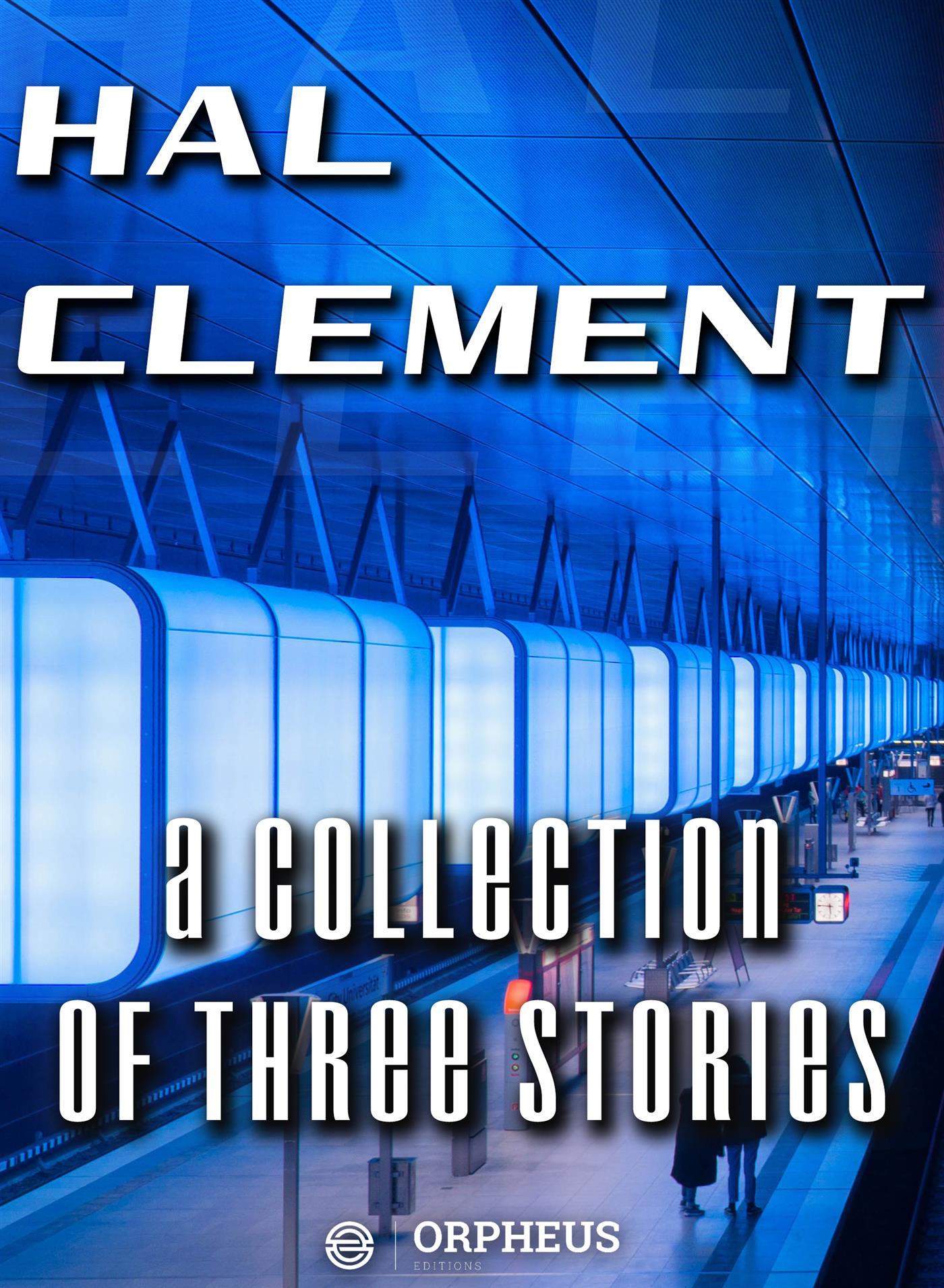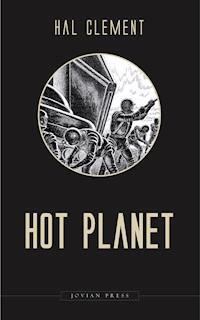3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Unterwasserrätsel
In der Zukunft gibt es keine Landesregierungen mehr – die Menschen werden vom Power Board beherrscht, denn Energie ist knapp geworden. Das Board wacht seit der großen Energiekrise streng über die Rationierung des kostbarsten irdischen Guts. Als drei Ingenieure des Power Boards im Südpazifik verschwinden, wird ihr Freund und Kollege mit den riskanten Nachforschungen beauftragt. Er begibt sich in die Tiefen des Meeres – und macht dort eine unglaubliche Entdeckung, die alles, woran er glaubt, infrage stellt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 258
Ähnliche
HAL CLEMENT
UNTERNEHMEN
TIEFSEE
Roman
Das Buch
In der Zukunft gibt es keine Landesregierungen mehr – die Menschen werden vom Power Board beherrscht, denn Energie ist knapp geworden. Das Board wacht seit der großen Energiekrise streng über die Rationierung des kostbarsten irdischen Guts. Als drei Ingenieure des Power Boards im Südpazifik verschwinden, wird ihr Freund und Kollege mit den riskanten Nachforschungen beauftragt. Er begibt sich in die Tiefen des Meeres – und macht dort eine unglaubliche Entdeckung, die alles, woran er glaubt, infrage stellt …
Der Autor
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Titel der Originalausgabe
OCEAN ON TOP
Aus dem Amerikanischen von Dr. Ingrid Rothmann
Überarbeitete Neuausgabe
© Copyright 1973 by Harry C. Stubbs
Copyright © 2017 der deutschsprachigen Ausgabe by
Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: Das Illustrat, München
I
Ich habe noch nie einen Psychiater konsultiert und verspüre auch keine große Neigung dazu, doch in jenem Augenblick wäre mir wohler gewesen, wenn einer sich in der Nähe befunden hätte, mit dem ich hätte reden können. Zwar war es beileibe nicht so, dass ich das Gefühl gehabt hätte, ich würde überschnappen. Keineswegs. Aber wenn man etwas Tiefsinniges zu sagen hat, dann möchte man es gebührend gewürdigt wissen, und nur ein Fachmann hätte die Bemerkung würdigen können, die ich in jenem Augenblick machen wollte.
Es gibt eine Bezeichnung für Menschen, die es nicht ertragen können, im Freien zu stehen und von Menschenmengen angestarrt zu werden. Weiter gibt es eine Bezeichnung für solche, die das große Zittern überkommt, wenn sie in engem Raum eingesperrt sind. Das sind ziemlich häufig auftretende psychische Gebrechen, und doch möchte ich wetten, dass noch nie zuvor jemand an Agoraphobie und Klaustrophobie gleichzeitig gelitten hat.
Mit einem Namen wie dem meinigen habe ich natürlich stets das Auge der Öffentlichkeit gemieden und für gewöhnlich auch der Versuchung widerstanden, in Gesellschaft mit klugen Reden zu brillieren. Und doch wünschte ich in jenem Augenblick, es wäre jemand dagewesen, der meine Gefühlsdiagnose hören könnte.
Oder vielleicht wünschte ich mir nur, es wäre überhaupt jemand bei mir gewesen.
Von dem Unwetter hörte ich nichts mehr. Die Pugnose war fast genau an der beabsichtigten Stelle zu Bruch gegangen. Sie war genau dort in die Schlechtwetterzone geraten, wo die meteorologische Abteilung es vorausgesagt hatte, und der Treibstoff war dann innerhalb von fünf Minuten ausgegangen – das hätte sogar ich voraussagen können. Man konnte sich getrost darauf verlassen, dass die Bosse der Aufsichtsbehörde nicht ein Quäntchen Energie mehr als nötig mit ihr untergehen ließen. Gut, ein wenig Batteriestrom war noch da, und ich hatte einen Loran-Check laufen, bis die Pugnose so nahe als beabsichtigt an den Punkt X herangetrieben war. Es stellte sich heraus, dass dieser etwa eine halbe Meile entfernt war. Als ich merkte, dass sie sich der Schlüsselstellung näherte, ließ ich den Zünder hochgehen, und die arme kleine Pugnose brach mittschiffs auseinander.
Zwar war sie niemals für einen anderen Zweck bestimmt gewesen, und ich hatte mich keineswegs in sie verliebt, wie es manchen vielleicht passiert wäre. Dennoch – bei diesem Anblick war mir nicht wohl. Mir kam es wie eine Verschwendung vor. Nun ja, viele Gedanken konnte ich nicht darauf verwenden. Ich verkroch mich in den Tank, machte ihn dicht und ließ der Natur ihren Lauf. In diesem Augenblick befanden der Tank und ich uns, wenn man den statischen Druckmessinstrumenten trauen durfte, in einer Tiefe von achthundert Fuß.
Hier unten herrschte absolute Stille. Ich wusste, dass das Wasser vorüberströmte, weil wir pro Sekunde um zwei Fuß sanken, aber zu hören war da nichts. Alles was an dem Kahn nicht niet- und nagelfest gewesen war, war längst weg. Was unsinkbar war, trieb über den Pazifik verstreut dahin, und was versank, war mir auf dem Weg zum Grunde des Ozeans voraus. Wäre nun etwas Festes gegen mein spezielles Stück Wrack gepoltert, so hätte es mich gleichermaßen beunruhigt und in Erstaunen versetzt. Die Stille war an sich ein gutes Zeichen, bereitete mir aber Unbehagen.
Ich war einmal draußen im Weltraum gewesen – wegen einer Abfalluntersuchung auf einer der Fusions-Forschungs-Stationen der Aufsichtsbehörde –, und da hatte ich schon einmal das totale Fehlen von Geräuschen erlebt. Schon damals hatte ich es nicht gemocht. Ich hatte dabei immer den Eindruck, das Universum zeige mir absichtlich die kalte Schulter, bis dann endlich der Zeitpunkt gekommen wäre, meine Überreste wegzufegen. Auch jetzt mochte ich es nicht, obwohl das Gefühl anders war – diesmal war mir, als würde mich jemand sorgfältig beobachten, um zu sehen, was ich vorhätte, und als versuche dieser Jemand zu einem Entschluss zu gelangen, was da zu tun sei. In diesem Fall wäre mir ein Psychiater natürlich keine große Hilfe gewesen, denn es bestand immerhin eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es stimmte.
Bert Whelstrahl war vor einem Jahr in dieser Wasserwüste verschollen. Joey Elfven, der fähigste Ingenieur und Unterwasserexperte der Welt, war zehn Monate darauf in derselben Gegend spurlos verschwunden. Mit beiden war ich befreundet gewesen, und ihr Verschwinden machte mir Kummer.
Vor sechs Wochen war nun Marie Wladetzki ihnen gefolgt. Das war für mich noch viel schlimmer. Sie war natürlich keine offizielle Ermittlerin – die Aufsichtsbehörde, wie sie von ihrem gegenwärtigen Chef repräsentiert wird, dessen Namen ich hier nicht erwähne, hält Frauen für nicht objektiv genug –, aber das hieß nicht, dass Marie nicht auch Neugierde entwickeln konnte. Dazu kam, dass sie an Joey so sehr interessiert war, wie ich an ihr. Da Marie aus ihrer Haut nicht herauskonnte, war sie, ohne gegen einen einzigen Buchstaben des Gesetzes zu verstoßen, von Papeete mit einem Unterseeboot der Aufsichtsbehörde einfach losgebraust, doch hatte sie im Grunde genommen gegen alle verstoßen. Sie hatte ihr Ziel nicht genannt und hatte als letztes ihren Standort zwischen Pitcairn und Oejo angegeben, tausend Meilen von der Stelle entfernt, wo ich jetzt mit den Trümmern der Pugnose in die Tiefe sank. Keiner, der sie kannte, hatte die geringsten Zweifel, wo man zuerst nachschauen müsse.
Der Boss war so menschenfreundlich, mich mit der Suche zu betrauen. Und genau das war es, was ich selbst wollte – mir ein U-Boot schnappen und nachsehen, was passiert war. Doch mein Verstand gewann die Oberhand. Berts Verschwinden konnte man vielleicht noch einem Unfall zuschreiben, obwohl für das Gebiet um die Osterinseln genügend Verdachtsmomente vorlagen. Joeys Verschwinden an einer Stelle, die kaum ein Dutzend Meilen entfernt war, hätte möglicherweise ein Zufall sein können – die See ist allemal für Überraschungen gut. Nach Maries Verschwinden aber hätte nur mehr ein ausgemachter Dummkopf sich offen in das Gebiet gewagt.
Daher befand ich mich nun tausend Fuß unter der Oberfläche des Pazifik und etliche tausend Fuß über dem Meeresgrund, als Teil eines Schiffswracks getarnt.
Ich wusste nicht genau, wie viel Wasser noch unter mir war. Meine letzte Peilung oben an der Oberfläche war sehr genau ausgefallen, und meine Kenntnis der Bodenkonturen nördlich von Rapanui war ausgezeichnet, und doch konnte ich nicht mit Sicherheit feststellen, ob ich senkrecht in die Tiefe sank. Die Strömungen in Inselnähe sind nämlich mitnichten so sanft und gleichmäßig, wie es die kleinen Pfeile auf den Pazifikkarten mit kleinem Maßstab andeuten wollen.
Natürlich hätte ich es mit Echolotungen versuchen können. Um dieser Versuchung zu begegnen, hatte ich außer Flutlichtern keine strahlenden Instrumente an Bord des Tanks. Und ich hatte nicht mal die Absicht, diese einzuschalten, ehe ich nicht Sicherheit hatte, dass ich allein war. Sehen ohne gesehen zu werden, hieß meine gegenwärtige Taktik. Und diese Sicherheit würde, wenn überhaupt, erst sehr viel später kommen, wenn ich den Grund erreicht und mich eine angemessen lange Zeit mit Horchen begnügt hatte.
In der Zwischenzeit behielt ich den Druckanzeiger im Auge, der mir verriet, wie viel Wasser sich über mir türmte, und die Sensoren, die meldeten, ob jemand in meiner Umgebung Sonareinrichtungen benutzte. Ich war mir gar nicht sicher, ob ich mir eine Reaktion ihrerseits wünschte oder nicht. Wenn man reagierte, dann würde es einen Fortschritt bedeuten. Ich würde endlich wissen, dass da unten jemand war, der dort nicht hätte sein dürfen – aber es würde sich vielleicht um jene Art Fortschritt handeln, den die anderen drei mitgemacht hatten. Allzu viel Sorgen brauchte ich mir nicht zu machen, denn fünfzehn oder zwanzig Fuß zerquetschter Schiffsrumpf würden auf jedem Sonarskop als das erscheinen, was sie waren, und der darin befindliche Tank mit voller Absicht nicht. Aber natürlich gibt es Sonarleute, die sich nicht so ohne weiteres hinters Licht führen lassen.
Ich hätte natürlich auch hinausblicken können. Der Tank hatte Bullaugen, von denen zwei in jene Richtung hinaussahen, wo sich das Heck der Pugnose zu befinden pflegte. Phosphoreszierende Flecken trieben nach oben, Lichtstreifen, nicht hell genug, um ihre Farbe klar festzustellen, trieben minutenlang vor einem Fenster, als wären sie die Positionslichter von etwas, das neugierig hereinzulugen versuchte. Ich war versucht –, nicht sehr stark, aber immerhin versucht – meine Lichter ein oder zweimal einzuschalten, um zu sehen, was das für Erscheinungen waren.
Das Wrack sank unter Drehungen ab. Man hatte mir versichert, dass dies nicht der Fall sein würde – man hätte ausreichend Ballast eingeplant, so dass der Bug ständig nach unten zeigen und der Tank oben bleiben würde, wenn ich auf dem Meeresgrund auftraf – doch war niemand da, bei dem ich mich hätte beklagen können. Es sah auch ganz so aus, als könnte ich dagegen nichts unternehmen. Ich fragte mich schon, was ich erreichen würde, wenn der Tank im Grundschlamm landete oder gar auf hartem Felsboden und das Wrack über sich hatte. Das Ding war alles in allem nicht sehr manövrierfähig. Wenn ich zuviel zusätzliches Gewicht mitbrachte, würde der Wegwerfballast vielleicht nicht ausreichen, mir zurück zur Oberfläche zu verhelfen.
Mit Gewichtsverlagerung allein konnte ich das Trudeln nicht abstellen. Der Innendurchmesser des Tanks betrug nur an die sechs Fuß, und den Großteil dieses Volumens nahmen die eingebauten Apparaturen ein.
Manche meiner Freunde hatten die Neigung gezeigt, ihre Probleme durch Nichtstun und Warten bis zum letztmöglichen Augenblick zu lösen. Ich habe die meisten überlebt. Kaum hatte ich das Trudeln bemerkt, brauchte ich nur fünf Sekunden und hatte im Geist alle möglichen Aktionen überflogen. Ich könnte mich jetzt gleich vom Wrack losmachen und die fast vollkommen runde Form des Tanks jedem, mit einem guten Sonar ausgerüsteten, Beobachter vor Augen führen, obgleich ich bis jetzt niemanden bemerkt hatte. Ich konnte Licht einschalten, damit ich den Boden vor dem Aufprall begutachten konnte, und mich hoffentlich noch rechtzeitig losmachen, wenn nötig. Auch das hätte sich mit dem Tarn-Plan nicht vertragen. Ich konnte aber auch dasitzen und hoffen, dass ich trotz des Trudelns in der richtigen Stellung landete – das heißt also, die Hände in den Schoß legen. Das bedeutete, dass ich mit den Naturgesetzen um mein Leben kämpfen musste, und die sind schwerer zu bezwingen als die meisten menschlichen Gegner.
Die ersten zwei Möglichkeiten bedeuten – nun ja, vielleicht waren Bert und Joey und Marie noch am Leben. Ich streckte die Hand nach dem Lichtschalter aus.
Doch ich berührte ihn nicht, denn ganz plötzlich konnte ich den Grund sehen.
Zumindest sah es nach Grund aus. Es lag rechts von mir – ich konnte oben und unten immer noch unterscheiden – und sah flach aus. Und sichtbar war es auch.
II
Natürlich glaubte ich es nicht. Ich bin ein sehr konservativer Mensch, der es gern mag, wenn auch die Dichtungen realistisch sind, und das da war ein dicker Brocken. Als Junge musste ich mit der Lektüre von Die Maracot-Tiefe Schluss machen, weil darin ein leuchtender Meeresboden beschrieben wurde. Ich wusste, dass Conan Doyle niemals unten gewesen war und das Licht nur der Handlung wegen brauchte und ohnehin keiner großen Folgerichtigkeit huldigte, und doch wollte ich mich damit nicht abfinden. Ich wusste, er hatte unrecht wie jeder andere – denn der Meeresboden ist nicht hell.
Nur war er es jetzt.
Das trudelnde Wrack schwang sich aufwärts, weg vom Licht, und ich hatte nun Zeit zu entscheiden, ob ich meinen Augen trauen sollte oder nicht. Ich konnte noch immer Instrumente ablesen. Der Druckmesser gab eine direkte Tiefe von 4880 Fuß an. Eine hastige, im Geiste vorgenommene Korrektur vom Band des Thermographen ergab zweihundert mehr. Ja, ich hätte in Bodennähe sein sollen, irgendwo auf den Nordhängen des Gebirges, dessen Gipfel Rapanui darstellen.
Ich vollführte eine Drehung und sah nun wieder hinunter. Ob ich nun meinen Augen trauen wollte oder nicht, sie zeigten mir beharrlich, dass es in dieser Richtung Licht gab. Es war ein sanftes gelb-grünes Leuchten – genau das Licht, das man verwendet, wenn man Unterwasserszenen filmen will. Erst wirkte es einheitlich und ebenmäßig. Dann aber, ein paar Umdrehungen weiter und zweihundert Fuß tiefer, zeigte es ein bestimmtes Schema. Es waren Vierecke, deren Ecken ein wenig heller waren als alles übrige. Es bedeckte nicht den ganzen Grund. Der Rand lag fast genau unter mir, und es erstreckte sich in die Richtung, die ich für Norden hielt. Mein Kompass reagierte nämlich auf das Trudeln nicht allzu günstig. In der anderen Richtung lag die normale, tröstliche und furchteinflößende Finsternis – das war Wirklichkeit genug.
Nun passierten zwei Dinge fast gleichzeitig. Mir wurde klar, dass ich ganz nahe am Rand des beleuchteten Bereiches niedergehen würde, und ebenso klar wurde mir, um was es sich bei diesem beleuchteten Gebiet handelte. Und die zweite Erkenntnis, die überwältigte mich. Sekundenlang war ich so wütend und angewidert, dass ich keinen klaren Gedanken fassen konnte. Und als Folge davon hätte ich diese Geschichte fast nicht erzählt.
Das Licht war künstlich. Ob sie es glauben oder nicht.
Mir ist klar, dass ein normaler Mensch sich das nur schwer vorstellen kann. Kostbare Watt zur Beleuchtung der Außenwelt sind eine schlimme Sache, manchmal aber traurige Notwendigkeit. Aber Energievergeudung zur Beleuchtung des Meeresbodens – nun, wie gesagt, sekundenlang war ich zu wütend, um einen klaren Gedanken fassen zu können. Mein Job hatte mich mit Menschen zusammengebracht, die mit Energie unachtsam umgingen, die Energie stahlen, und sogar mit Menschen, die sie missbrauchten. Das hier aber war eine brandneue Dimension! Inzwischen war ich noch tiefer gesunken und konnte eine weite Lichtfläche sehen, die sich nach Norden, Osten und Westen erstreckte, bis sie in der Ferne verschwamm. Eine Riesenfläche, beleuchtet von Dingen, die ein paar Yards über dem ebenen Boden hingen, von Dingen, die nur als schwarze Flecken in der Mitte eines etwas helleren Feldes sichtbar waren. Wer hinter dieser Sache steckte, hatte immerhin einen gewissen Sinn für Sparsamkeit. Er benutzte Reflektoren.
Dann hatte ich meine Wut bezwungen, oder aber meine Angst hatte dies für mich besorgt. Mir wurde schlagartig klar, dass ich mich nur mehr in geringem Abstand über den Lichtern befand. Ich würde nicht inmitten der Lichter niedergehen, sondern ein Stück weiter südlich davon. Und ich konnte nicht sagen, sicher niedergehen, denn meine Kombination von Pugnose-Bug und Sicherheitstank drehte sich so langsam, dass ich voraussehen konnte, in welcher Stellung sie auf dem Boden auftreffen würde. Es sah ganz danach aus, als würde das offene Heckende nach unten zu liegen kommen.
Ganz abgesehen von der Tatsache, dass ich unter dem Wrack hervor nichts sehen konnte, bestand daneben die Wahrscheinlichkeit, dass ich auch nichts würde tun können – beispielsweise zurück an die Oberfläche gelangen. Da fasste ich nach den Schalthebeln.
Da der ganze Plan auf Tarnung beruhte, wurde der Abtrennvorgang mittels Federdruck und nicht durch ein Wegsprengen eingeleitet. Ich wartete, bis die Drehung den Schiffsrumpf zwischen mich und das Licht manövriert hatte, und drückte den Knopf. Der Schubs war ganz sanft, und ich fragte mich blitzartig, ob ich nicht in ein noch größeres Schlamassel geraten würde als vermutet. Und dann kam Licht durch Fenster herein, die durch den Schiffsrumpf verdeckt waren, und meine Sorgen hatten ein Ende. Die Federn hatten den Tank von dem beleuchteten Gebiet weggestoßen. Ich sah, wie sich der Bug der Pugnose dunkel vor dem helleren Hintergrund abzeichnete. Der Trennvorgang hatte unser Sinken ganz leicht verlangsamt, das Wrack sank dabei etwas schneller als ich. Na, jetzt war wenigstens etwas wie geplant abgelaufen. Das Wrack würde als erstes auf dem Boden aufschlagen, und es bestand keine Gefahr mehr, dass ich darunter wie in einer Falle gefangen wurde.
Natürlich hatte ich nicht erwartet zu sehen, dass es richtig aufprallte. Was ich aber zu sehen bekam, als es auf dem Boden auftraf, das hatte ich schon gar nicht erwartet.
Flache Stücke des Meeresbodens sind meist eher weich und schlammig. Man mag es Radiolarschlamm oder Strahlentierchenschlick nennen, es ist jedenfalls Schlamm. In seichtem Gewässer trifft man auf Korallenbänke und Sand und anderes festes Zeug, an Abhängen gar auf soliden Fels. Dort aber, wo es eben ist, erwartet man eine Mischung zwischen gewöhnlichem Schlamm und den oberen Schichten eines stehenden Tümpels. Wenn darauf nun etwas Hartes und Schweres auftrifft, sanft auftrifft, steht nicht zu erwarten, dass der Boden Widerstand leistet. Es setzt einen vielleicht manchmal in Erstaunen, aber man rechnet keinesfalls damit, dass etwas vom Meeresboden abprallt.
Die Pugnose prallte nicht richtig ab, wie ich zugeben muss, doch verhielt sie sich nicht ordnungsgemäß. Sie traf die beleuchtete Oberfläche dreißig oder vierzig Yards vom Rand entfernt und etwa doppelt so weit von mir entfernt. Ich konnte es deutlich sehen. Sie traf wie erwartet auf und sank wie erwartet ein. Es gab kein Schlammgewirbel – kein Anzeichen des Zeitlupenspritzens, das normalerweise entsteht, wenn etwas im Schlick landet. Stattdessen verschwand der Bugteil fast ganz in der weichen Schicht, während darum herum ein Wellenring entstand und sich vom Aufprallpunkt aus ausbreitete. Dann ging das Wrack sanft wieder hoch, bis es halb aus dem Schlamm war, tauchte wieder unter, und das alles in Zeitlupe. So schnellte es drei- oder viermal auf und nieder, bis es zur Ruhe kam. Und jeder Aufprall schickte ein Wellengekräusel von der Aufschlagstelle aus.
Bis der Schiffsrumpf endgültig zur Ruhe kam, hatte sich auch mein Tank beruhigt. Ich spürte, wie er auf etwas Hartes auftraf – Fels, dafür hätte ich meinen Kopf verwettet. Und dann fing er ganz, ganz sachte an, auf das Licht zuzurollen. Ich konnte den Untergrund, auf dem ich mich befand, nicht deutlich sehen, doch handelte es sich augenscheinlich um einen festgrundigen Abhang, der mich in den nächsten zwei bis drei Minuten neben der Pugnose landen lassen würde, wenn ich dagegen nichts unternahm. Ein Glück, dass ich etwas tun konnte.
Der Tank besaß sogenannte Beine, sechs Fuß lange teleskopartige Metallruten, die sich mittels Federn verlängern und durch Solenoide wieder einziehen ließen. Ich hoffte noch immer, ohne die Anwendung von Magneten auszukommen, doch es sah so aus, als wären die Beine in Ordnung. Ich ließ vier davon vorschnellen – dorthin, wo ich vernünftige Richtungen vermutete. Meine Schätzungen erwiesen sich als ausreichend zutreffend, und das Rollen hörte auf. Zum ersten Mal hatte ich nun eine ruhige Aussichtsplattform. Ich konzentrierte mich natürlich jetzt auf den Bereich, den ich einsehen konnte.
Ich befand mich unter dem Niveau der Lichter selbst. Es sah aus, als hingen sie an Schnüren in Abständen von etwa zwanzig Yards, wobei die Schnüre ebenfalls in diesen Abständen angebracht waren. Das alles war bloße Vermutung, da ich die Aufhängevorrichtung ja nicht sehen konnte. Ihre Regelmäßigkeit untermauerte die Vermutung, während die Tatsache, dass das Wrack genau auf eine Schnur zwischen zweien der Lichter aufgetroffen war, eigentlich dagegensprach. Es überraschte mich keineswegs, dass auf der ebenen Fläche, die sie beleuchteten, nichts zu sehen war – weder Gewächse noch irgendeine Bewegung, obwohl es mich auch nicht überrascht hätte, ein paar verstreute Spuren oder Löcher zu sehen.
Wenigstens wäre ich nicht überrascht gewesen, wenn ich nicht die Landung der Pugnose mitangesehen hätte. Damit aber war sonnenklar, dass es nicht der Meeresboden war, was ich sah. Es ähnelte eher einer Gummidecke, die wie ein Zeltdach über alles gespannt war, was mehr als etwas zehn Fuß hangabwärts von mir lag. Das Wrack hatte das Material eingedellt, aber nicht durchlöchert. Das Zeug war stark genug, um das verhältnismäßig geringe Unterwassergewicht von Metall und Plastik auszuhalten.
Das könnte nützlich sein, überlegte ich. Ich hatte keine Ahnung, warum jene unter dem Zelt alles Darüberliegende beleuchten wollten, falls aber das Material nicht völlig undurchsichtig war, würde man den Schatten und die Delle kaum übersehen können. Die Leute würden nachschauen und würden für mich leicht zu sehen sein, ohne dass ich meine eigene Beleuchtung einschalten und mich verraten musste. Ich brauchte nur einen einzigen deutlichen Blick auf die menschlichen Wesen, die sich unerlaubt hier auf dem Grunde des Pazifiks aufhielten. Das, in Verbindung mit dem Ausmaß der Energieverschwendung, die ich bereits weiterberichten konnte, mehr brauchte es zu meinem Bericht nicht – eine Kontrollexpedition größeren Umfangs würde das Ihrige tun. Niemand erwartete von mir, dass ich eine Menschengruppe festnahm, groß genug, um eine Einrichtung wie diese hier zu schaffen, und ich verspürte nicht den geringsten Ehrgeiz dazu. Rundheraus gesagt, der Tank war zu unbeweglich, um als Polizeifahrzeug zu dienen. Ich war nicht mal in der Lage, eine vorüberschwimmende Krabbe festzunehmen. Ich wollte nicht mehr erreichen, als einen gründlichen Blick auf ein Arbeits-U-Boot oder einen Druckanzug oder gar einen werkelnden ferngesteuerten Roboter – alles was anzeigte, dass die Einrichtung hier aktiv geführt wurde –, ein gründlicher Blick, und ich war bereit und würde Ballast abwerfen.
Zuviel Hast würde ich dabei natürlich nicht an den Tag legen, und das aus zwei guten Gründen. Ein Sonarmann mit seinem Unterwasserortungsgerät würde einen sinkenden Gegenstand verständlicherweise als Trümmerstück eines Schiffswracks abtun oder sogar als toten Wal. Sehr viel Neugierde würde er wohl nicht zeigen. Doch stand nicht zu erwarten, dass er gegenüber einem aufsteigenden Objekt die gleiche Gleichgültigkeit an den Tag legte. Ich musste mir ein wenig Zeit lassen und die Gefahr, die mir von Sonargeräten drohte, erst abschätzen. Es war hübsch, aber nicht endgültig, dass ich bis jetzt nichts bemerkt hatte.
Den zweiten Grund, der sich der Hast in den Weg stellte, kannte ich noch nicht, und sollte ihn erst nach mehreren Stunden kennenlernen.
Ich bin kein Präzisionsfanatiker, der ständig auf die Uhr schaut. Ich wusste, dass ich es in dem Tank noch lange aushalten konnte, und wollte es gar nicht so genau wissen, wie viel von der vorgesehenen Zeit ich verbraucht hatte. Als nämlich der zweite Grund auftaute, kam ich gar nicht auf die Idee, die genaue Zeit festzustellen, und hinterher war ich mehrere Stunden lang von so banalen Dingen wie Uhren total abgelenkt.
Daher kann ich nicht genau sagen, wie lange ich einfach in meinem Tank dasaß und wartete, dass etwas passierte. Es waren sicher mehrere Stunden, dafür stehe ich ein. Lange genug jedenfalls, dass mich Langeweile überkam und ich Krämpfe kriegte, wütend wurde und schon halb der Überzeugung zuneigte, dass sich in meiner Nähe niemand unter dem Zelt befand. Der Gedanke, dass es sich um jemanden handeln könnte, der sich keinen Deut um Schiffsteile in seiner Decke scherte, schien so weit hergeholt, dass er keiner weiteren Überlegung wert war. Falls jemand das Wrack gesehen hatte, hätte er etwas unternommen.
Nichts war bisher geschehen. Daher befand sich niemand in Sichtweite. Und wenn sich niemand in der Nähe befand, konnte ich selbst einen Blick aus der Nähe wagen. Vielleicht glückte mir sogar ein Blick darunter.
Gefährliche Gedankengänge, alter Junge. Lass dir die verschwendeten Kilowatt bloß nicht so zu Kopf steigen. Du bist ein unbeteiligter Beobachter. Wenn du ohne Informationen zurückkommst, ist alles, was du unternimmst, reine Vergeudung – und Vergeudung ist für die Aufsichtsbehörde natürlich das lästerlichste Schimpfwort.
Trotzdem – es stellte für mich eine Versuchung dar. Nirgendwo eine Bewegung, keine Anzeichen für menschliches Leben – bis auf Lichter und das Zeltdach, und sehr wenig Anzeichen für andere Lebensformen. Kein Geräusch. Nichts vom Sonarfrequenzmonitor. Sollte ich mich sachte bis an den Rand des Stoffes hinunterrollen lassen und das Zeug eingehender studieren?
Die treffendste Antwort darauf war die Feststellung, dass dies die Handlungsweise eines unverbesserlichen Idioten gewesen wäre. Und während die Zeit auf diese Weise verrann, kam auch mir ein- oder zweimal der Gedanke, dass schon allein die Tatsache meines Hierseins nicht die schmeichelhaftesten Schlüsse auf meine Intelligenz zuließ. Wenn ich mich schon wie ein Dummkopf benehmen musste, dann schon wie ein richtiger. Ich weiß nicht, woher derartige Überlegungen stammen. Vielleicht sollte ich wirklich einen Psychiater konsultieren.
Ich weiß jetzt nicht mehr, wie knapp daran ich war nachzugeben. Ich weiß nur, dass ich dreimal beinahe die Tankbeine eingezogen hätte und mir es jedes Mal anders überlegte.
Das erste Mal hinderte mich etwas daran, das sich bewegte, und sich als ansehnlicher Hai entpuppte. Es war das erste größere Lebewesen, das mir hier unten auf dem Meeresgrund begegnete, und ich verschob meine Gedanken wenigstens kurzfristig auf eine andere Ebene. Die nächsten beiden Male, als ich den Tank in Bewegung setzen wollte, ließ mich die Erinnerung an den Hai innehalten. Er war nämlich verschwunden – hatte er etwas gehört, das ich nicht hören konnte, etwas das ihn verscheucht hatte? Ich hatte außen keine Instrumente für das Aufspüren unhörbarer oder hörbarer Frequenzen. Ich hatte lediglichSonarrezeptoren.
Ich weiß, das alles lässt mich nicht eben als Genie erscheinen, nicht mal als einigermaßen befähigten Operator. Ich wünschte, mir wäre mehr Zeit zur Veröffentlichung meiner Lebenserinnerungen geblieben, ehe ich diese Geschichte berichten musste. Um meine Entscheidung einigermaßen zu rechtfertigen, muss man mir die Chance einräumen, mich als vernunftbegabten, reifen Menschen vorzustellen. Im Augenblick fällt mir zu meiner Rechtfertigung nicht mehr ein als die Redensart »Jeder wie er kann«. Und wer könnte sicher sein, welche Wendung seine Gedanken nähmen, wenn er praktisch hilflos in einer Plastikblase von sechs Fuß Durchmesser eine Meile unter der Oberfläche des Ozeans säße? Auf wen dies zutrifft, der möge mit seiner Kritik warten, bis ich fertig bin.
Der zweite Grund, weswegen ich meinen Ballast nicht überstürzt abwarf, sollte sich nämlich sogleich zeigen. Meine Aufmerksamkeit konzentrierte sich noch immer auf das Wrack. Ich sah es zunächst gar nicht herankommen. Beim ersten flüchtigen Blick aus dem Augenwinkel hielt ich es gar nur für einen weiteren Hai. Dann aber wurde mir klar, dass es sich um eine menschliche Gestalt handelte und ich damit meinen Beweis hatte. Famos. Nichts wie an die Oberfläche, wenn die Gestalt erst verschwunden ist.
Nein, geht nicht. Was ich brauchte, war ein überzeugender Beweis. Und wenn meine eigenen Augen mich nicht zu überzeugen vermochten, war es höchst unwahrscheinlich, dass meine Worte jemanden anderen überzeugen konnten. Was ich da sah, war ein Mensch, was an sich stimmte. Ein Poly-Phasen-Anzug, vier Zoll dick, an den Gliedmaßen ebenso ausgerüstet, kann dem Wasserdruck von eineinviertel Tonnen pro Quadratzoll, der in einer Meile Tiefe herrscht, gut standhalten. Eine solche Taucherrüstung lässt den Träger auch noch einigermaßen menschenähnlich aussehen und gestattet ihm immerhin eine, wenn auch unbeholfen wirkende Fortbewegung.
Diese Rüstung hier aber gestattete ihm keine wie immer gearteten Schwimmbewegungen, es sei denn er befände sich in einem Quecksilberozean. Und diese ganz unübersehbar menschliche Gestalt schwamm!
Sie tauchte in einiger Entfernung zu meiner Linken auf, ganz plötzlich, als wäre sie aus der oben herrschenden Dunkelheit heruntergestoßen. Sie schwamm auf mich und das Wrack zu, hatte es aber dabei nicht eilig. Als die Gestalt näher herankam, konnte ich Einzelheiten deutlicher unterscheiden. Und am deutlichsten war die Tatsache – noch deutlicher als die Tatsache, dass es sich um eine Frau handelte –, dass sie keine Taucherrüstung trug. Sie trug stattdessen einen Kaltwasser-Coverall vom Typ Scuba-Suit. Daran war nichts auffallend bis auf den runden, durchsichtigen Helm, den sie statt der Atemmaske aufgesetzt hatte. Den Ballast trug sie in Ringen da und dort an Leib und Gliedern anstatt am Gürtel. Ich wiederhole – tatsächlich musste ich es mir selbst wiederholte Male vorsagen –, dass ihr Anzug kein Druck-Anzug war. Ihre Schwimmbewegungen zeigten klar an, dass der Anzug so flexibel war wie menschliche Haut, genauso wie ein Scuba-Anzug sein soll.
Meinen Tank schien sie nicht zu bemerken. Für mich eine große Erleichterung. Sie bemerkte auch das Wrack erst, als sie sich ihm bereits bis auf zwanzig Yards genähert hatte. Bis dahin war sie nämlich ganz gemächlich am Rand des Zeltdaches entlanggeschwommen, wie auf einem Nachmittagsspaziergang. Dann aber wechselte sie jäh die Richtung und hielt direkt auf den Bug der Pugnose zu.
Das wollte mir nicht in den Kopf. Unglaublich, dass niemand gezielt nach dem Wrack suchte und dass jemand durch puren Zufall darauf stieß! Ich hätte eigentlich ein ganzes Arbeitskommando erwartet, das von den Menschen unter dem Zeltdach ausgeschickt würde.
Nun ja, bei der ganzen Sache war dies nicht die erste Überraschung. Hör jetzt auf mit den Arbeitshypothesen, Freund, dafür fehlen dir die Fakten! Beschränke dich aufs Beobachten. (Ich nenne mich selbst nicht mal beim Namen).
Also verlegte ich mich aufs Zuschauen. Ich sah, wie sie den eingedrückten Bug umrundete, hineinschwamm, dann wieder heraus und schließlich darüber hinwegglitt. Dann werkelte sie mit einem Gegenstand herum, der sich als Lampe entpuppte, die an ihrem Gürtel gehangen hatte. Sie schwamm noch einmal hinein. Das bereitete mir nicht wenig Sorge. Die Tarnung des Tanks war nicht so, dass sie einer näheren Inspektion standgehalten hätte. Die Kammern, die Fortbewegungsfedern …
Da kam sie wieder heraus, ohne sichtbare Anzeichen der Erregung, und in diesem Augenblick, da dämmerte mir etwas. Ein sehr geringfügiger Punkt verglichen mit dem, was ich bereits gesehen hatte – zumindest schien er beim ersten Hinsehen geringfügig. Und als ich länger darüber nachdachte, wuchs er sich immer mehr zu einem Rätsel aus.
Ihr Unterwasseranzug war wie gesagt ganz gewöhnlich, bis auf Helm und Ballast. Diese Alltäglichkeit beinhaltete einen kleinen Tank zwischen den Schultern, dessen oberes Ende am Helm anstieß und vermutlich damit in Verbindung stand, obwohl ich keine Verbindungsröhre sehen konnte. Das alles war noch einleuchtend. Was mich daran aber störte, war die Tatsache, dass ich keine Luftbläschen sehen konnte.