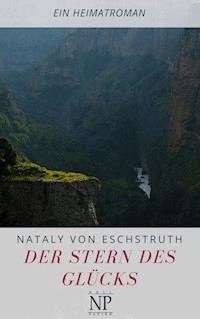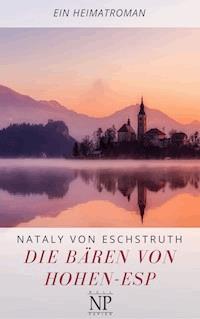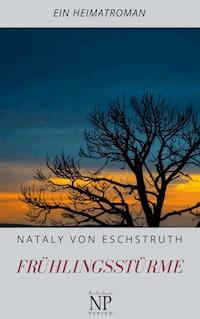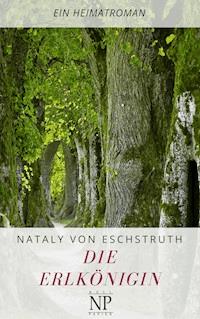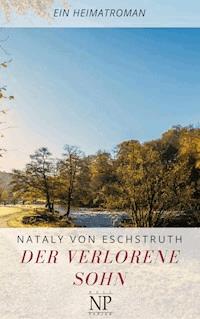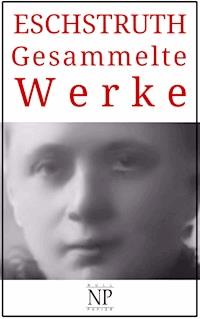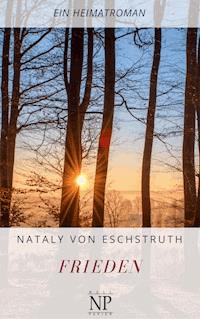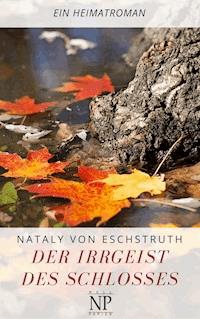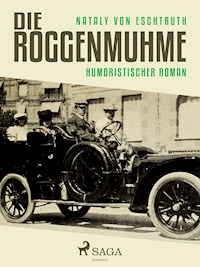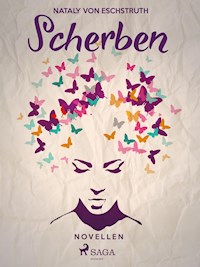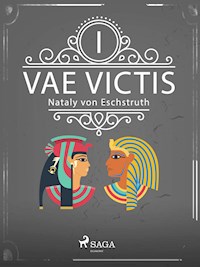Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Bonaventura von Völkern hat Ellinor von Heym geheiratet. Berauscht von ihrem Reichtum beginnt für ihn diese neue Lebensphase und so ist er allzu gern bereit zu übersehen, dass sie für ihn nichts empfindet. Doch bald schon wird aus Langeweile Verachtung. Als Ellinor sich auf eine Ägyptenreise einem Syrischen Grafen an den Hals wirft, kommen bei Bonaventura erste Zweifel auf. Als er dann noch durch Ellinors Bruder erfährt, dass Malva von Kettenau in der Heimat nur Bonaventura geliebt hatte, hält es diesen nicht mehr in Ägypten und er reist in die Heimat. Doch Malva macht ihm deutlich, dass er nicht so einfach den einmal eingeschlagenen Weg aufgeben soll. Von diesem Moment an überschlagen sich die Ereignisse.Nataly (Natalie) Auguste Karline Amalie Hermine von Eschstruth (1860–1939; (Ehename: Nataly von Knobelsdorff-Brenkenhoff) war eine deutsche Schriftstellerin und eine der beliebtesten Erzählerinnen des Wilhelminischen Zeitalters. Sie schildert in ihren Unterhaltungsromanen in eingängiger Form vor allem das Leben der höfischen Gesellschaft, wie sie es aus eigener Anschauung kannte. Sie entstammte einer hessischen Familie und war die Tochter des königlich preußischen Majors Hermann von Eschstruth (1829–1900) und der Amalie Freiin Schenck zu Schweinsberg (1836–1914). 1875 durchlief sie eine Ausbildung in einem Mädchenpensionat in Neuchâtel in der Schweiz und bereiste später die wichtigsten europäischen Hauptstädte. Von Eschstruth schrieb Frauenromane, die in der Schicht der wilhelminischen Adelsgesellschaft oder bei hohen Hofbeamten spielen und erzählt dort fiktiv-biographische Geschichten. Das Umfeld der Romane ihrer Hauptschaffensperiode in den 1880er und 1890er Jahren vermittelt heute einen Eindruck von alltäglichen und historischen Details; vom Unterhaltungswert haben von Eschstruths Bücher nichts eingebüßt.weniger anzeigen-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 254
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nataly von Eschstruth
Vae Victis II
Roman
Saga
Vae Victis - Band II
German
© 1911 Nataly von Eschstruth
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711448267
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
Vierzehntes Kapitel.
Wie in einem Rausch war Bonaventura die Zeit vergangen.
Obwohl des Winters strenges Regiment noch anhielt, waren es doch Tage voll Sonnenschein und Eisgeglitzer, welche über die Kälte hinwegtäuschten, eine Kälte, welche man höchstens voll Behagen empfand, wenn man, in die molligsten Pelze gehüllt, durch den verschneiten Park wanderte, die Damhirsche und Rehe an den Futterplätzen zu schauen oder die Naturschönheit der Anlagen zu bewundern. In den eleganten Salons und Gemächern von Schloss, Villen und Landhäusern, welche auf das komfortabelste hergerichtet waren, die Neuvermählten auf ihrer Rundreise zu beherbergen, war es warm und bequem, und für Völkern gab es ununterbrochen so viel des Neuen und Interessanten zu schauen, dass ihm der Kopf schwirrte, alles das zu fassen, was ihm nun so plötzlich zu eigen gehörte.
Aber dieses Studium war ausserordentlich schön und anregend und liess ihn jetzt erst zu dem vollen Genuss seiner neuen Lebenslage kommen.
Wie reich Ellinor war, sah er erst jetzt im ganzen Umfang, wenigstens ward es ihm nun erst klar, was sich ein Besitzer von so vielen Millionen alles leisten und gewähren kann!
Und dabei frei zu sein!
Kein Vorgesetzter, kein Dienst, kein Kommando selbst zu Spiel und Tanz —! Er konnte tun und lassen, was ihm beliebte, denn die kleinen Wünsche und Anordnungen seiner Gattin waren gar nicht zu rechnen, im Gegenteil, sie amüsierten ihn, weil sie stets nur ihre beiderseitige Zerstreuung im Sinne hatten. —
Je nun, und einer Dame in jeder Weise Ritterdienste zu tun und sich ihr bei den kleinen Vorkommnissen des täglichen Lebens zu fügen, lag derart von Kindesbeinen an in seiner Natur, dass es ihm selber höchst unfair vorgekommen wäre, diese selbstverständliche Courtoisie zu verletzen.
Wie wenig verlangte Ellinor!
Ihr Interesse für ihn und seine Angelegenheiten ging nicht über das Allernotwendigste hinaus. Sie sorgte in denkbar bester Weise für ihn, sie gab ihm voll feinen Taktes die richtige Stellung und Würde des Hausherrn, ohne sich dabei im mindesten von ihm abhängig zu machen.
Er konnte durchaus so leben, wie es ihm zusagte; Ellinor richtete sich dann sehr geschickt mit ihren Liebhabereien so ein, dass sie die seinen nicht durchkreuzten, sondern wie zwei verschiedenfarbige Seidenfäden in einem Stickmuster nebeneinander her liefen, keiner den andern verdrängend oder dominierend, jeder den eignen Kurs nehmend und doch für das Auge des Beschauers harmonisch und sympathisch wirkend. —
Die Reise brachte so viel Unruhe und Abwechslung mit sich, dass ein seelisches Sichnähertreten der jungen Ehegatten kaum möglich war. Es ward auch von keinem gesucht, im Gegenteil, Bonaventura war beinahe ängstlich bemüht, jedem ernsteren und tieferen Gespräch aus dem Wege zu gehen, und wenn seine Gemahlin in ihrer rücksichtslosen Weise ihre philosophischen Gedanken und Ansichten äusserte, so fand er es für viel bequemer und richtiger, stets damit einverstanden zu sein.
Dadurch ward jeder Disput vermieden; etwaige Differenzen wurden in der Knospe erstickt, und Ellinor lächelte sehr zufrieden, dass ihr Mann nicht zu den Narren gehörte, abgeschmackte Trumpfe auszuspielen, wo es doch kein Übertrumpfen gibt. —
Über solch ein freundliches Wohlwollen stieg jedoch das Barometer ihrer Gefühle für Bonaventura nicht.
Sie war und blieb kühl bis ans Herz hinan, ohne Zärtlichkeit zu geben oder zu verlangen, im Gegenteil, mit der Erfüllung ihres eitlen Wunsches kam ein gewisses Phlegma über sie, welches ihr Wesen und ihre Persönlichkeit noch langweiliger machte, als es vordem schon war.
Sie verhehlte sich die Gefahr, welche für sie selber darin lag, nicht.
„Schon jetzt ist es mir manchmal zumute, wie einem Menschen, welcher zu viel des Guten genossen und sich dabei den Magen verdorben hat!“ schrieb sie voll Selbstironie in ihr Tagebuch; „ich fürchte, nach dem Gabelbissen Bonaventura, auf welchen ich zuvor einen wahren Heisshunger hatte, wird nun eine Übersättigung eintreten. Die Reaktion, welche stets und überall kommt. Ich werde in einen Mittagsschlaf verfallen, welcher länger dauert, als nur ein Viertelstündchen, und wenn ich erwache, werde ich abermals Hunger verspüren — aber nach etwas anderem. — ‚Alle Tage Feldhühner!‘ sagt der Franzose und schaudert dabei. — Auch der brave, wohlerzogene, fügsame Bonaventura gleicht einem Feldhuhn — etwas nüchtern und fad, bei aller Feinheit seiner Art doch nur die sehr schön servierte Platte für einen reellen Appetit — das Pikante, Prickelnde, Anregende, wie es auch der Frauengaumen in Katerstimmung verlangt — das fehlt ihm. — Schade darum. — Aber immerhin! Man wechselt das Menü und und nascht so lange Cayenne und Paprika, bis man einmal wieder mit Feldhühnern fürlieb nimmt!“ —
Und diese Vorahnung schien sich nur allzubald, bereits während der kurzen Hochzeitsreise zu betätigen.
Die junge Baronin lag nach dem Diner mit jedem Tag apathischer im Schaukelstuhl und rauchte eine Zigarette nach der andern, während ihr Gatte das gleiche tat. —
Sie schwiegen dazu; — manchmal küsste Bonaventura die träge kleine Hand mit den wundervollen Brillantringen.
Sie langweilten sich — erst unmerklich, dann immer empfindlicher.
Endlich unterdrückte Ellinor ein Gähnen.
„Wir haben nun drei Wochen lang die Einsamkeit dieser ländlichen Huldigungsreise genossen,“ sagte sie; „du hast meinen Besitz kennen gelernt und weisst Bescheid, wenn von diesem oder jenem die Rede ist, lieber Bonaventura. Ich denke, nun kehren wir in die Residenz zurück!“
„Gewiss, mein Liebling! Drei Wochen ist ja vollkommen genügend für ein enfin seul!“
Sie lachte ein wenig: „Gewiss, wir haben den Anforderungen der Idealisten genügt und gingen in trauter Einsamkeit in den Wogen des Glücks und Alleinseins unter. — Nach der gut absolvierten ersten Nummer dieses Eheprogramms können wir wieder zur Tagesordnung übergehen. — Also reisen wir zurück.“
„Gott sei Dank, das Kofferpacken hat jetzt für mich seine Schrecken verloren.“
„Bist du mit Brand zufrieden?“
„Durchaus; er ist sehr aufmerksam und gewandt.“
„Ich wusste es; darum sicherte ich ihn mir für deine Bedienung!“
„Du bist ein Engel an Güte!“
„Engel!“ — nun lachte sie etwas lauter auf: „Es gibt deren nach Ansicht der frommen Leute verschiedene, auch böse. — Tante Geldern, welche sich so viele Mühe gab, meine arme Seele zu retten, warnte mich einmal in sehr schönem Vergleich! Sie fürchtete, ich könne an der Fackel der Wissenschaft, mit welcher Häckel der Welt so grell in die Augen leuchtet, meine schönen, weissen Schwingen verbrennen — dann wären sie nicht mehr imstande, mich in den Himmel zu tragen.“
„Der Sturz eines Engels! La chute d’un ange!“ versuchte Völkern harmlos zu scherzen.
Sie zuckte mit undefinierbarem Blick die Achseln. „Auch sinnbildlich gemeint? Je nun! Ich bin vollkommen schwindelfrei und riskiere selbst den gewagtesten Flug über das Niveau des Erlaubten, ohne vor einem Halsbruch zu zittern!“
Abermals versuchte er dem Gespräch eine scherzhafte Wendung zu geben.
„Selbstredend per Aeroplan? — Welches System wählst du: Blériot, Farman, Grade, Eulner, Antoinette oder Wright? Man hat ja jetzt eine famose Auswahl!“
Ellinor zerbiss das vergoldete Mundstück ihrer Zigarette wie in nervösem Spiel.
„Danke — zu meinen Höhenflügen brauche ich keine fremde Hilfe — die unternehme ich nach eignem System!“ —
„Hut ab! — Wer wird auch andere Meister anerkennen, wenn man jede Dimension so meisterlich beherrscht, wie du!“
Wollte er sich mokieren, wie Rolf-Valerian stets seine kleinen Piken für sie bereit hatte?
Nein! Mit demselben ehrlichen und offenen Gesicht wie stets schlürfte der Sprecher lachend den starken Kaffee und krönte ihn mit einem Schluck Benediktiner.
„Namentlich die vierte!“ stimmte sie heiter ein. „Die guten und bösen Geister haben einen derartigen Respekt vor mir, dass sich keiner blicken liess, als ich scherzeshalber einmal der Séance eines vielgenannten Spiritisten beiwohnte!“
„Ah — das tatest du? Wie interessant! Und es geschah nichts Aussergewöhnliches?“
„Nein, einen Heidenspektakel abgerechnet, welcher von einem unterirdischen Orchester gut in Szene gesetzt war. — Etwas Reelles zu sehen oder zu fühlen gab es natürlich nicht.“
Bonaventura sah plötzlich sehr nachdenklich aus. „Und doch sind so viele Menschen fest und steif von der Existenz unsichtbarer Wesen überzeugt,“ sagte er langsam; „sogar der Pfarrer, welcher mich konfirmierte, antwortete auf meine diesbezügliche Frage: ‚Selbstredend glaube ich an alle Geister, von welchen in der Bibel die Rede ist — gute und böse. — Wer ihre Existenz ableugnen will, straft die ganze Bibel Lügen, denn die Begegnung des gekreuzigten Erlösers nach seinem Tode mit den Jüngern ist nichts anderes als eine Geistererscheinung!‘“
Baronin Völkern lachte scharf auf: „O, du naives Kind!“ sagte sie voll mitleidigen Spottes und klopfte ihn dabei auf die Wange, wie einem Baby. „Das hat der Herr Pastor gesagt? Ja, sieh mal, wenn diese Herren schon selber an ihrem Dogma rütteln wollten, so schnitten sie sich höchst eigenhändig den Lebensfaden durch und brächten sich um ein gutes, sicheres Brot, welches viele eifrige Gläubige so dick mit Wurst und Schinken belegen! — Schon aus lauter Egoismus und Klugheit muss sich der Herr Pfarrer vor dem schwarzen Mann und polternden Popanz fürchten, damit auch seine brave Lämmerherde nicht das Zittern verlernt! Es ist dieselbe Sache mit den Pastoren wie mit den Fürsten! Diese predigen Hölle und Fegefeuer, Himmel und Gericht, damit ihre Gemeinde ja nicht zusammenschmilzt, und die andern impfen den kleinen Buben schon in der Klippschule den Patriotismus ein, damit sie begeisterte Soldaten und Hurraschreier grossziehen, wenn das liebe Vaterland um irgendeiner Bagatelle willen mit Blut begossen werden muss!“
Zum erstenmal wollte das Blut des verabschiedeten Offiziers heiss und leidenschaftlich emporwallen. Aber er würgte die sehr heftige Antwort herunter und sagte sich: „Es sind ja Weiberhände, welche dein Allerheiligstes antasten, mit denen kannst du nicht abrechnen, wie mit derben Männerfäusten.“ — Auch hatte er sich fest vorgenommen, es nie zu einem Streit zwischen Ellinor und sich kommen zu lassen.
So füllte er sich den kleinen Goldbecher abermals voll Likör und trank ihn langsam, wie ein Beruhigungsmittel aus.
„Aber Liebchen! Das klingt ja ganz sozialdemokratisch!“ rief er anscheinend sehr amüsiert.
Seine Gattin lehnte den Kopf mit sehr ernstem Gesicht gegen das japanische Seidenkissen zurück.
„Gewiss, ich bin auch Sozialdemokratin!“
„Potz Wetter!“
Ihr kalter Blick schien förmlich zu erstarren. „Wundert dich das?“
„Ehrlich gestanden, ja!“
„Und warum?“
„Weil sonst den Besitzern von Millionen und Grossgrundbesitz unsere sicheren, behaglichen Zustände unter dem kaiserlichen Zepter angenehmer sein dürften, als die Anarchie!“
Die junge Frau zuckte die Achseln. „Eine solche egoistische Kirchturmpolitik treibe ich nicht. Ebenso wie Staat und Kirche stets Hand in Hand gehen werden, ebenso sagen wir Freidenker, welche rücksichtslos gegen alles Front machen, was die geistige und kulturelle Entwicklung von Mensch und Volk hemmt: ‚Ni Dieu, ni maître!‘ und erkennen weder einen Gott noch Herrn an, weil beide nur unnatürliche und despotische Gewalten verkörpern, welche jeder freien Entfaltung den Hemmschuh anlegen!“
Völkern wurde es immer unbehaglicher; er bot alle Energie auf, um ruhig zu bleiben. „Bekenntnisse einer schönen Seele!“ scherzte er abermals; „ich verstehe nicht, wie du dich mit solchen in einer Hofgesellschaft wohl fühlen kannst!“
„Ich ziehe ja auch jeden Tag ein Kleid an, von welchem ich mir sage, dass sein Schnitt mordsgarstig, geschmacklos und höchst unbequem ist, wie jede Modenarrheit — aber man fügt sich der Tyrannei, weil sie eben Mode ist! Und ebenso marschiert man nachgiebig in der grossen, gesellschaftlichen Herde mit, weil es momentan noch Mode ist, den Kurs zu nehmen, welchen der Leithammel einschlägt!“
„Sehr richtig! Und über den Kurs fällt mir wieder das Kursbuch und unsere soeben projektierte Abreise ein! — Du bleibst also bei deinem Wunsche, in die Residenz zurückzukehren?“
„Sobald wie möglich; dieser traute Herd zur Winterszeit ist derart, dass selbst der unmusikalischste Mensch ein Klagelied anstimmen könnte!“
Bonaventura atmete auf. Er nahm abermals ihre zierliche, magere Hand und drückte sie in der seinen.
„Herr Walther von der Vogelweide und sein Schüler Stolzing sangen Liebeslieder!“
„Sie lebten vor mehreren Jahrhunderten!“
„Ellinor!“
Sie lachte abermals, nahm seinen Kopf in beide Hände und hauchte einen kühlen Kuss auf seine Wange.
„Gut, gut, dear boy! Dort steht der Flügel! ‚Sing mir dein Lied im Dämmerschein‘ und lass mich unsere schrecklich prosaische Jetztzeit vergessen!“
Die amerikanische Villa warf durch die rotseidenen Fenstervorhänge wieder ihre Purpurlichter auf die weissverschneiten Parkwege und verriet es durch das unruhig in ihr pulsierende Leben, dass das junge Paar von der Hochzeitsreise heimgekehrt sei. Mit geteilten Gefühlen hatte die Dienerschaft sie kommen sehen.
Die Trauung ohne kirchliche Feier war selbstverständlich bis zur Erschöpfung besprochen. Die noch guten und rechtschaffenen Elemente unter dem grossen Tross der Haushaltung hatten voll Empörung solch ein gotteslästerliches Beginnen getadelt, die Leichtsinnigen und Schlechtbeanlagten fanden es ausgezeichnet, gerade das, was ihnen in den Kram passte, denn sie kalkulierten sehr logisch: „Wenn die Herrschaft weder an Gott glaubt, noch seine Strafe und Vergeltung fürchtet, wenn sie selber Gut und Böse nicht anerkennen und nur das tun, was ihnen behagt, so können sie von ihrer Umgebung unmöglich Gewissensbisse verlangen, wenn dieselbe ebenso denkt und sich die weitgehensten Freiheiten auf dem Gebiet von „mein und dein“ gestattet! Warum noch ehrlich, treu, sparsam oder moralisch sein, wenn solche Tugenden gar nicht anerkannt werden?
Gibt es keinen Gott — so gibt es auch keinen Richter und kein Gewissen — man muss sich nur mit einer irdischen Behörde abzufinden verstehen und sorgsam das einzig wahre und praktische alte Gebot halten: „Lass dich nicht erwischen!“
Diese Philosophie war gut, und man amüsierte sich weidlich darüber, weil die Herrschaft mit ihren eignen Waffen geschlagen ward. Wie behaglich war es nun, die Millionäre nach der Möglichkeit zu beschwindeln!
Einer arbeitete dem andern in die Hand, und die anfänglich Guten wurden durch das tägliche Beispiel bald schlecht.
Da ward ein Samen ausgestreut, welcher bald üble Frucht trug, denn auf abschüssiger Bahn geht es rapid bergab, und wer anfangs aus Eigennutz und Schlauheit gottlos schien, der ward es bald voll und ganz aus Überzeugung, denn was könnte dem Laster wohl besseren Vorschub leisten, als die bequeme Versicherung: „Erlaubt ist, was gefällt.“ —
Ein Glas Tinte in einem Eimer voll Milch schwärzt dessen ganzen Inhalt, und ein böses Beispiel im Hause verdirbt zumeist alle Seelen, welche darin sind, um so leichter und schneller, wenn jeder gute Einfluss ausgeschieden war, wie es mit der Abreise der Gräfin Geldern geschah. —
Bonaventura bekümmerte sich prinzipiell nicht um häusliche Angelegenheiten, erstens, weil er nichts davon verstand und sie sehr langweilig fand, und zweitens, weil Ellinor ihm erklärt hatte, dass das Regiment in Haus und Hof in ihren Händen ruhe.
Er war der letzte, welcher es ihr streitig machte. Voll lebhaften Interesses hatte er die prunkvollen Gemächer, welche ihm seine Gattin als Reich des „Hausherrn“ zuwies, bezogen, und noch einmal überkam es ihn wie ein Märchentraum, wenn er sich mit all den einzelnen Kostbarkeiten vertraut machte. Der Reiz der Neuheit übte seinen Zauber, und er lechzte nach dem Triumph, seine ehemaligen Kameraden in diesen Sesam zu führen!
Welch ein Besichtigen, Staunen, Neiden wird das geben!
Wie schön ist es, die gönnerhafte Rolle des reichen Mannes zu spielen!
Wie wird es ihm auch eine aufrichtige Freude sein, von seinen grossen Mitteln abzugeben und diesem und jenem armen Bürschchen, welches von Kaisers Zulage lebt, einmal mit einem braunen Lappen unter die Arme zu greifen, wenn Not an Mann geht!
Völkern war stets eine sehr vornehm denkende Natur und ein guter, hilfsbereiter Kamerad gewesen; er wird es jetzt doppelt sein, wenn er sich dadurch noch den Genuss verschafft, als Wohltäter bewundert und verehrt zu werden.
Das junge Paar fuhr tagelang seine Visiten, und wenn Bonaventura Kameraden begegnete, so lud er sie in liebenswürdigster und gastfreiester Weise ein, in der amerikanischen Villa zu verkehren, als seien sie jeden Tag eingeladen. —
Es fiel ihm auf, dass die Herren zumeist etwas steif und förmlich dankten, dass sich etliche sogleich mit Vorarbeiten zur Kriegsakademie oder sonstigen Kommandos entschuldigten, welche ihre Geselligkeit begreiflicherweise sehr beschränke!
Mit mitleidigstem Lächeln begriff Bonaventura dies nur allzugut.
Aber seltsamerweise vergingen eine Reihe von Tagen und abermals Tagen, bis eine erste Equipage vorfuhr und der Diener in der amerikanischen Villa die Karten abwarf, ohne seine Herrschaft zu melden.
Und langsam, sehr langsam erfolgten die weiteren Gegenvisiten.
Auch die Hofchargen gaben nur Karten ab, ebenso viele Offiziersfamilien.
Einige Ausnahmen machten auch hier die Regel; Menschen, welche keinerlei Rücksicht zu nehmen hatten und solche, welche sich um jeden Preis amüsieren wollen, liessen sich melden und schickten Einladungen.
Völkern fiel diese allgemeine Zurückhaltung auf, und zum erstenmal machte er es sich klar, dass das Gold wohl doch nicht eine derartige Allgewalt besass und alle Nacken in den Staub beugte, wie er angenommen.
Man hatte Ellinor und ihm die Ziviltrauung sehr übel genommen.
Fraglos mit Fug und Recht; nur hatte er nicht geglaubt, dass man dies so deutlich markieren werde.
Ein Gefühl von Ärger und Scham trieb ihm anfänglich das Blut in die Stirn; aber seine Gattin lachte ironisch und sagte achselzuckend: „Die guten, frommen Leute wollen uns strafen und denken, es geht nicht ohne sie! Nun wollen wir sehen, wer zuerst die Segel streicht! Sowie es die nächste grosse Wohltätigkeitsveranstaltung gibt, zu welcher man Geld braucht und die reichen Leute zur Ader gelassen werden, wird man fraglos den Weg zu uns finden. Schade, dass Rolf-Valerian abgereist ist — die Mütter mit heiratsfähigen Töchtern pflegen in der Regel ein sehr gewichtiges Wort mitzusprechen!“
„Nun — er kommt ja bald wieder!“ nickte Bonaventura mit glimmendem Blick, „und ich denke, dann lassen wir uns erst eine ganze Weile suchen, ehe man uns finden wird!“
„Selbstredend! Was verlieren wir in einer Welt, in der man sich langweilt? Ich fand all die letzten Feste, voll steifer Knixe, lorgnettierender alter Exzellenzen und der ständigen gefüllten Pute, furchtbar! — Das lohnte ja kaum das Anziehen. Es gibt auch eine Grenze für die Wohlerzogenheit. Ich habe einen geradezu brennenden Durst, einmal etwas anderes aus dem Becher des Vergnügens zu nippen, wie Harzer Sauerbrunnen!!“ —
Völkern dehnte mit aufblitzendem Blick die Arme.
„Wie hast du so recht! Man ist ja ein Narr, wenn man sich als freier Mensch noch von der ‚Amme Gewohnheit‘ gängeln lässt! Ich möchte aufbegehren und der ganzen steifbeinigen Gesellschaft mit dem Herrn Oberhofprediger an der Spitze einmal zeigen, dass man sie nicht braucht, um das Leben schön zu finden!“
„Ganz meine Ansicht! Wir sind keine Kinder mehr, welche erzogen werden müssen! Menschen, die uns Opposition machen, lassen wir laufen und tun nun gerade erst recht, just das, was wir für gut befinden! Die Residenz ist ja so gross! Du wirst schon Unterhaltung finden. Ich für meine Person fahre heute abend in den Zirkus!“
„Gut! Ich sehe mir die Folies caprice an!“
Sie lachte: „Viel Vergnügen!“ —
„Danke!“
Zum erstenmal ging jedes seinen eignen Weg.
Bonaventura voll Trotz und Ingrimm, Ellinor sehr gelassen und amüsiert, ohne sich im mindesten darum zu kümmern, was die lieben Nächsten dazu sagen.
Etliche Tage später, nachdem sie den schönen Hindudompteur genügend durch das Opernglas gemustert hatte, überraschte die Baronin ihren Gatten durch die heitere Mitteilung, dass sie heute abend vierzehn der ersten Zirkuskünstler zum Diner eingeladen habe.
Bonaventura sah zuerst etwas betroffen aus. Dann zuckte er gleichmütig die Achseln.
„Warum nicht? Es gibt wohl viele Mäzene der Kunst in einer Grossstadt!“
Die Künstler kamen, und man amüsierte sich wundervoll. — Namentlich zum Schluss des Diners, als der überreiche, feurige Wein seine Schuldigkeit getan, kam eine grossartige Stimmung.
Ellinor sass neben dem Dompteur und vergass ihr Phlegma vollkommen.
Er war wirklich sehr schön; aber er wurde erst langsam, sehr langsam gesprächig. Er ass sehr wenig, trank auch mässig, rauchte aber nach Tisch voll wahrer Leidenschaft.
Sein Blick sprach mehr als Worte; er war der deutschen Sprache nicht mächtig, und europäische Sitten waren ihm fremd. — Trotz seines etwas schwermütigen und träumerischen Wesens war er interessant, und Frau von Völkern hatte noch nie so viel und so lebhaft englisch geplaudert, wie an diesem Abend. —
Bonaventuras Heiterkeit war etwas nervös. Anfänglich kam es ihm höchst seltsam vor, in Gegenwart seiner jungen Frau und in seiner Häuslichkeit, welche er nach dem Vorbild seines so ehrenhaften Vaters doch wie ein Heiligtum erachten sollte, mit nicht allzu korrekten Zirkuskünstlerinnen zu flirten; da aber Ellinor sich sehr ungeniert von dem flotten Jockeireiter und dem interessanten Indier anschwärmen liess, sah er keinen Grund ein, sich auf den Tugendhelden aufzuspielen!
Blumen, welche auf einem Sumpf wachsen, sind die giftigsten, und für einen Feinschmecker ist dasjenige Fleisch der grösste Leckerbissen, welches etwas Hautgout hat.
Bonaventura war kein Fremdling auf dem heissen Boden der Grossstadt — dass er ein verhältnismässig solider Mann geblieben, verdankte er seiner vortrefflichen Erziehung, deren moralische Tendenz ihm in Fleisch und Blut übergegangen war; auch bedurfte er zu seiner eignen Bequemlichkeit und seinen luxuriösen Liebhabereien seine immerhin bescheidenen Einkünfte selber, und als dieselben in den letzten Jahren so bedenklich zusammenschmolzen, blieben ihm nicht die genügenden Mittel, kostspielige Beziehungen zu unterhalten oder das Leben in derart vollen Zügen zu geniessen, wie es die Grostssadt so verführerisch bot! —
Nun war das mit einem Schlage anders geworden.
Hätte er einen festen, moralischen Halt in seiner Ehe gefunden, und wäre Ellinors Einfluss ein ebenso segensreicher gewesen, wie ehemals derjenige seiner Mutter, so hätten wohl seine Eitelkeit und Prunksucht recht aussergewöhnliche Blüten getrieben, ohne doch den so guten Kern seines innersten Menschen ankränkeln zu lassen.
Das aber, was seine junge Gemahlin tat, war, ihm das denkbar schlechteste Beispiel zu geben, ihn durch ihre Gottlosigkeit in übelster Weise zu beeinflussen und einen Samen in sein so leicht empfängliches Herz zu streuen, welcher nur als Unkraut aufsprossen konnte.
Dazu kam die schiefe Stellung, welche er plötzlich in der Gesellschaft einnahm, die Enttäuschung, die Triumphe des Goldes nicht in dem Kreise, welchem er angehörte, derart feiern zu können, wie es ihm seine Selbstüberhebung vorgegaukelt.
Er ärgerte sich, er trotzte, er ward mehr und und mehr in Empfindungen hineingedrängt, welche sehr bald auf falsche Wege führen. Warum und für wen noch Rücksichten nehmen? Warum als Tugendheld sein Leben vertrauern, wenn ringsum die Freude lockt und glüht? Warum an reicher Tafel fasten, wenn ihm so voll eingeschenkt wird und er Geld, viel Geld hat, um seine Sinne zu berauschen? Ja, berauschen! Das war das rechte Wort! Wie Fieberdurst glühte es plötzlich in seinen Adern, immer brennender und begehrlicher, je mehr sich die Tore schlossen, welche in die „heiligen Hallen“ der exklusiven Geselligkeit führten.
Die Saison war vorüber — ein Tete-a-tete mit seiner Gemahlin war für beide kein Genuss mehr — sie hatten jeglichen Reiz für einander verloren und lebten in recht ungestörter, äusserlich bestharmonischer Ehe — modernsten Musters.
„Sie sagt ‚Monsieur!‘
Er sagt ‚Madame!‘
Ganz nach Pariser Art!“
Und jedes amüsierte sich auf seine Fasson.
Da schmeichelten die glitzernden, gleissnerischen Wogen des grossstädtischen Sündenpfuhls um die Füsse des jungen Mannes, da stiegen sie höher und höher an ihm empor bis zu seinem Herzen, welches im Fiebertraum der Lust nur allzuschnell Ellinors Sprache lallte — keinen Gott und keinen Herrn! —
Höher und höher ... bis es nur noch des letzten, unheilvollen Aufbrausens bedurfte, um über seinem Haupt zusammenzuschlagen.
Vae victis! —
Der Winter war vergangen — der Sommer war nicht auf den Gütern, sondern in den elegantesten Bädern verlebt, welche den Ruf haben, sehr schick, sehr teuer und sehr amüsant zu sein. —
Erst im Herbst kehrte man nach der Residenz zurück, und die amerikanische Villa erblickte dasselbe Leben und Treiben, wie in dem vergangenen Jahr, als die gute Gesellschaft immer spärlicher in den fürstlichen Räumen vertreten war und das Kunstmäzenatentum ein immer durchsichtigeres Deckmäntelchen für die extravaganten Gelüste und Passionen des jungen Paares wurde!
In dem Getreibe einer Grossstadt bleibt manches unbemerkt und geht vieles in dem Trubel und Strudel der Menge unter, bis die einzelnen Gerüchte dennoch durchsickern, bis Frau Fama doch plötzlich auf verbotenen Wegen nachschleicht und dann die Lärmtrompete an die Lippen setzt, um jählings auf Markt und Gassen bekannt zu machen, was man zuvor nur als geheimnisvolles: „Man sagt“ — von Lippe zu Lippe raunte! —
Herr und Frau von Völkern standen immer isolierter auf ihrer goldenen Höhe. —
Ihr spöttisches Lachen und sein ingrimmiges Zürnen, welches anfänglich die „Spiessbürger“ und „Mucker“ geisselte, verstummte, und das Scherzen und die tolle Fröhlichkeit ihres so köstlichen Auslebens klang mehr und mehr gewaltsam, wie bei einem Trunkenen, welcher die erschlaffenden Lebensgeister noch einmal mit doppelt starken Dosen von Alkohol aufpeitscht, ehe sie vollends in sich zusammensinken. —
Sowohl die amerikanische Villa wie das so viel durchärgerte Leben in der Residenz hatten ihren Reiz verloren.
Auch der zweite Sommer ward durch weite Reisen in das Ausland ausgefüllt, und im Spätherbst kehrte man nur noch einmal für ganz kurze Zeit nach Paris zurück, um für eine Winterkampagne in Ägypten zu rüsten.
Fünfzehntes Kapitel.
Die Sonne war in wunderbarer Klarheit untergegangen und löste mit dem letzten Scheidegruss eine Farbenpracht aus, wie sie nur in Märchenträumen oder dem Orient zu finden sind.
Der Himmel flammte in Lichtgluten, welche vom grellen Schwefelgelb bis in das feurigste Orange spielten, durchblitzt von Purpurstreifen, welche, gleich dem königlichen Banner des Tages, zur letzten Huldigung für den Scheidenden gehisst waren! —
Nach Osten lagerte noch das tiefe Azurblau über dem Horizont, sich in köstlichem Farbenspiel abtönend, bis das Feuermeer des Sonnenuntergangs die Regenbogenskala verschlang und wabernde Lohe über die wehenden Schleier der Lichtgöttin triumphierte. — Aus dem Niltal stieg es zart und duftig wie ein Hauch empor.
Die graziösen Blätterkronen der Palmen schimmerten violett und taubengrau; breite, blendende Reflexe lagen auf den langsam rollenden Wogen des Flusses, und in dem eleganten Luxor blitzten die ersten Lichter auf, begann das interessante und internationale Leben der grossen Hotels.
Auf den Terrassen des Savoyhotels trank man nach dem Diner den Kaffee und träumte, in den bequemen Sesseln liegend, ein Märchen aus Tausend und einer Nacht, dessen Mittelpunkt jedoch das hochmoderne Abendland mit all seinem verschwenderischen Luxus, seinen Errungenschaften der Neuzeit und seinen lebensfrohen Menschen bildete, welche es per Dampfer und Extrazug hinausgetrieben, die Wunder des Südens mit eignen Augen zu schauen. In dem Garten mit all seiner tropischen Pflanzenpracht huschten die schlanken, braunen Gestalten der Ägypter, welche, zum Teil sehr malerisch kostümiert, ihre Verkaufsartikel feilboten oder träge hingelehnt, einer Bestellung für Reittier oder Wagen warteten. —
An einem kleinen Tisch, auf welchem die eleganten Mokkatassen dufteten und erlesene Liköre in farbigen Kelchgläschen glühten, hatte eine kleine Gesellschaft Platz genommen. Baronin von Völkern, in einer Toilette, welche der Poesie dieser Umgebung und dem Geschmack der Trägerin alle Ehre machte, war an dem Arm ihres schönen Gemahls über die Terrasse geschwebt, um sich lässig in einen der niederen Sessel gleiten zu lassen — Mattfarben blauer Crêpe de Chine floss wie ein Spinngewebe in weichsten Falten an der überschlanken Direktoirfigur nieder und verlor sich in langer Schleppe, von deren Saum eine schwere Silberstickerei emporstieg und sich über das ganze Vorderteil des Kleides emporrankte.
Schalartig gebundene Schärpen, durch breite Silberfranzen beschwert, schlangen sich, über der Brust kreuzend, um die kurze Taille und rieselten lang auf die Schleppe hernieder; Sträusse von frischen, weissen Hyazinthen dufteten sehr stark an dem Ausschnitt der tief dekolletierten Taille, und um den Hals wand sich ein vielreihiges Perlenhalsband, durch die erlesensten Brillantspangen zusammengehalten.
So wenig hübsch auch das Gesicht der jungen Frau war, und so unsympathisch es durch seinen Ausdruck sentimentaler Arroganz ward, wirkte die ganze Erscheinung dennoch verblüffend schick und reizte die abenteurlustige Männerwelt, dieser Dame, welche durchaus nicht abgeneigt schien, Romane zu erleben, die Schleppe zu tragen.
Bonaventura war nicht im mindesten eifersüchtig, nicht einmal auf den so hochinteressanten und eigenartigen Syrier, den Grafen Nicodemo Cassarate, dessen Anblick bereits seine extravagante Gattin in einen wahren Taumel der Begeisterung versetzte. Sie brachte die Lorgnette gar nicht von den Augen, wenn der eigenartige Mann in dem Speisesaal oder auf der Terrasse erschien, bis sich der so stark Provozierte schliesslich mit einem wunderlichen kleinen Lächeln Herrn von Völkern vorstellte mit der lakonischen Bitte: „Führen Sie mich zu madame la baronne.“
Dies geschah selbstverständlich sofort.
Seit jener Stunde war Graf Nicodemo Cassarate der tägliche Begleiter Ellinors — ja, man hätte sagen können, ihr Verehrer, wenn dieser Titel für den wunderlichen Herrn gepasst hätte. —
Richtiger war es, die Baronin seine Verehrerin zu nennen, deren schmachtende Bewunderung der interessante Mann so nachsichtig huldvoll, beinahe resigniert erduldete, wie der Mond sich anbellen lassen muss, weil er es leider nicht verbieten kann. —
Graf Nicodemo war kein schöner Mann in des Wortes eigentlichster Bedeutung, aber er war eigenartig, so ganz aussergewöhnlich und hinreissend originell, dass er selbst die schönsten Engländer und Franzosen, welche in Luxor für unwiderstehlich galten, fraglos in den Schatten stellte.
Ein schmales, fleischloses, sehr scharfgeschnittenes Gesicht, mit kühn gebogener Nase und zwei tiefliegenden Schwarzaugen, welche in unbändiger Leidenschaft wie ein Höllenbrand glühten — grosse, spitze, blendend weisse Raubtierzähne, welche unter dem dunklen, kleinen Schnurrbart blinkten, als schliche ihr Besitzer einem Opfer nach — dazu ein tief gebräunter Teint und eine grosse, schlanke, biegsame Gestalt, der man die zähe, fast eiserne Muskelkraft wie einer Offenbarung ansah — dies war Graf Nicodemo.
Ein syrischer Wolf! —
Eine jener kometenartigen Erscheinungen, von denen niemand recht weiss, woher sie kommen und wohin sie gehen — von denen man dies und jenes Geheimnisvolle munkelt, wie der Goldstreif, welcher hinter ihnen herrauscht, erworben ist, wie dies oder jenes Kapitel aus ihrem Vorleben so dunkel ist — wie sensible Seelen bei dem Anblick der langen, schmalen Hände mit den wohlgepflegten Krallennägeln den Atem so ängstlich anhalten, als fühlten sie diese Hände plötzlich würgend an ihrem Halse. —
Wo seine Familie herstammte?
Man wusste es nicht und fragte nicht danach.
Wo sein Wohnsitz war? — Ob er überhaupt ein home hatte oder nur ruhelos die Welt auf seinem wundervollen Auto durchraste? —
„Nie sollst du mich befragen!“ stand es voll drohender Abwehr in den finsteren Augen.
Ein syrischer Wolf!
Die Wüste ist so gross, es versteckt sich so viel Raubzeug darin — wer spürt ihm nach!
Den Hof machte Graf Nicodemo nicht.
Er beugte den erzenen Nacken vor keinem Weib, auch vor dem schönsten nicht.
Er befahl, und sie lag zu seinen Füssen und gehorchte. — Wie eine zwingende, unheimliche Gewalt lag es in seinem Blick, und wehe der verwöhnten, kleinen Mädchenhand, welche in koketter Laune mit diesem wilden Feuer spielen will — es verzehrt sie selbst.
Man erzählt sich, dass der Graf den vergangenen Winter in Kairo verlebte.
Eine sehr hübsche, anspruchsvolle Dollarprinzessin, die Witwe eines Amerikaners, kaprizierte sich darauf, den „syrischen Wolf“ zu zähmen und ihn mit den Rosenketten der Liebe zu binden!
Und dieweil sie sich einbildete, den Stolzen mit tausend feinen Maschen der Koketterie zu umstricken, war sie es selber, die sich unrettbar in diesen Fädchen fing, die selber in wahnwitziger, unheimlicher Leidenschaft erglühte, so dass sie das Leben ohne ihn nicht mehr ertrug.