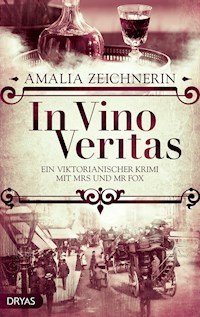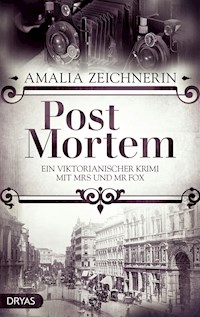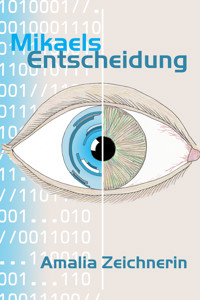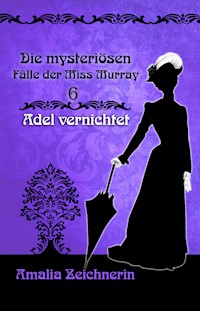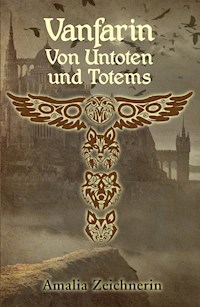
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Eine Untoten-Armee bedroht das Reich Vanfarin. Der Schamane Talahko und der Krieger Brynjar stammen aus verfeindeten Völkern, doch ein Auftrag ihrer Totemtiere bringt sie dazu, gemeinsam in einer von den Untoten eingenommenen Festung nach Gefangenen zu suchen. Später finden sie weitere Verbündete, darunter eine Ogrra-Kriegerin, einen Gelehrten und eine Elfenmagierin. Doch was wird aus ihrer Heimat und der Welt der Totemtiere, wenn ihre Feinde siegen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Table of Contents
Titelei
Inhaltswarnungen
Landkarte
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Dramatis personae
Glossar
Nachwort
Danksagung
Impressum
Amalia Zeichnerin
Vanfarin
Von Untoten und Totems
High Fantasy Roman
© Amalia Zeichnerin 2018
Inhaltswarnungen zu diesem Roman
Gewalt gegen Tiere und Menschen, Krieg, Tod, Untote, Leichen, Andeutungen von Kannibalismus
Prolog
„Ihr verdammten Narren! Ich werde es euch allen zeigen!“ Ungehört verhallte seine Stimme im Kerker. Es war eine Zeit des Krieges. Die Länder Vanfarin und Settinbris standen in Flammen. Der Tyrann, Vanfarins König, hatte Settinbris erobern wollen. Tausende fielen im Kampf, und wer nicht fiel, wurde von den Feinden in Ketten gelegt. Und so war es auch ihm ergangen. Seine Familie, seine Frau hatten in diesem Krieg ein kaltes Grab in der Fremde gefunden.
Ein Gefangener war er, lehnte sich auf gegen seine Peiniger, wieder und wieder, doch er fand keine Gnade. Da verhärtete er sein Herz und sann auf ewige, glühende Rache. Er würde nicht untergehen in diesem dunklen Kerker, das schwor er sich bei allen Göttern, die ihn verlassen hatten.
Er schmiedete seine Rache über viele Monde und Winter hinweg, in jenen Stunden im finsteren Gefängnis. All diesen Narren würde er es zeigen, denn eines Tages würde er triumphieren. Er konnte nicht ahnen, dass es dreißig lange Jahre dauern sollte ...
Kapitel 1
Betäubender Lärm aus Schmerzensschreien, heiserem Gebrüll, klirrenden Waffen und stampfenden Füßen drang zu ihm herüber, zusammen mit den dumpfen Geräuschen von Schilden, die gegeneinander prallten. Ein grün-blaues Banner lag halb zerrissen im Dreck. Ein anderes schwankte weiter vorn zwischen den Kriegern, weiß und blau hob es sich ab vor dem grauen Himmel, doch auch rostfarbene Blutspritzer klebten daran.
Schon seit Stunden hatte Talahko den metallischen Geruch von Blut in der Nase und war selbst mittlerweile blutverschmiert, versuchte jedoch, die grauenvollen Bilder nicht zu sehr an sich heranzulassen.
Die Frontlinie der Schlacht in der Ebene von Dalathrién war noch in ausreichender Entfernung, so dass er sich zumindest im Moment nicht um seine Sicherheit sorgen musste. Doch das konnte sich schon innerhalb von Minuten ändern. Talahko strich sich eine Strähne seiner schwarzen Haare aus der Stirn und wandte sich wieder der Verwundeten zu, die vor ihm lag. Ein Riss klaffte in ihrer Lederrüstung. Die Wunde war nicht tief, zum Glück. Im Lazarett wäre sie dennoch genäht worden. Talahko sah auf und rief einem der Heilerschützer zu: „Wie sieht‘s da vorn aus?”
„Die Frontlinie hält noch”, erwiderte der gerüstete Mann, welcher einen Anderthalbhänder und einen großen Schild trug.
Talahko nickte ihm knapp zu und reinigte die Wunde der Kriegerin mit hochprozentigem Getreidebrand, den er in einem Wasserschlauch mit sich führte.
„Habt Ihr Probleme mit naturmagischen Heilungen?”, fragte er. Immer wieder gab es Patienten, die aufgrund ihres Glaubens oder bestimmter Eigenschaften Heilungen dieser Art nicht vertrugen oder einfach ablehnten.
Mit einem ächzenden Laut schüttelte die dunkelblonde Kriegerin den Kopf, das Gesicht nass von Schweiß und Blut. „Mir ist alles recht, bringt mich nur wieder auf die Beine!“
Talahko atmete einmal tief durch. Bei der nun folgenden magischen Heilung verwendete er die lange Adlerfeder, die er am Gürtel trug, als Fokus. Er strich damit durch die Luft, direkt über der Wunde. Golden leuchtete die Feder auf – unsichtbar für alle, die keine Magie in sich trugen. Ein Pulsieren lief durch das zarte Gebilde, als die magischen Kräfte es erfassten.
Talahko sang ein Lied der Heilung, welches ihm Okahandi, sein Lehrmeister und Schamane seines Dorfes, beigebracht hatte. Rau schallte seine Stimme über das Feld, denn schon lange war er heiser. Doch die uralten heiligen Kräfte strömten noch immer durch ihn hindurch. Talahko war nur der Überbringer dieser Botschaft; nicht er selbst, sondern das magische Wirken der Natur war es, das dafür sorgte, dass sich die Wunde der Kriegerin allmählich schloss.
„Wenn es irgendwie geht, schont Euch noch etwas. Verhindert vor allem, dass Euch jemand auf den Brustkorb schlägt, denn die Wunde ist zwar geschlossen, aber noch empfindlich. Sie könnte wieder aufplatzen. Morgen seid Ihr wieder voll einsatzfähig.”
Die Kriegerin setzte sich auf. „Ich danke Euch.”
Talahko half ihr wieder auf die Füße.
„Mögen Eure Götter mit Euch sein”, sagte er zum Abschied.
Die Kriegerin nickte ihm zu und wankte von dannen.
Mehrere Lazaretthelfer bewegten sich kreuz und quer durch die Schlachtreihen, um Verletzte herauszuschleppen, die nicht mehr selbst laufen konnten. Zum Teil hatten die Helfer Tragen aus grobem Tuch dabei, die stabil genug waren, um sogar voll gerüstete Krieger zumindest eine kurze Strecke lang zu transportieren.
Da, ein hochgewachsener Krieger mit einem Pfeil in der Brust. Das Geschoss war zwischen Lederrüstung und Metallteilen durchgeschlagen. Der Mann taumelte aus der Schlachtreihe, sackte zusammen und ließ sich auf den Rücken fallen. Mit wenigen Schritten hatte Talahko ihn erreicht.
Verdammt! Ein braunes Abzeichen mit einem dunklen Elchgeweih an seinem Gürtel. Ein Norður. Ein großer Stamm aus dem Norden, der mit seinen eigenen Leuten schon seit langer Zeit verfeindet war. In wie so vielen Streitigkeiten zwischen Völkern ging es dabei um Land. Vor Jahren hatten Norður-Krieger seinen Vater getötet, zusammen mit vielen anderen aus seinem Stamm.
Der Kodex des Bundes der Heiler hielt ihn dazu an, jeden Patienten zu behandeln, der auf seiner Seite kämpfte, unabhängig von dessen Rang, Geschlecht oder Volkszugehörigkeit. Allerdings ließ sich der Kodex durchaus großzügig auslegen. Er schrieb keineswegs bis ins Kleinste vor, wie man einen Patienten genau zu behandeln hatte. Hauptsache, man behielt dessen Heilung im Auge. Doch der genaue Weg zu dieser Heilung war jedem Heiler letztendlich selbst überlassen.
Talahko fühlte sich dem Kodex verpflichtet. Er hatte schon mehr als einen Mann der Norður versorgt – wenn auch oft mit Widerwillen – und so wandte er sich jetzt auch diesem Krieger zu.
Allerdings kostete es ihn einige Überwindung. Das Gesicht, die rotblonden Haare und die Bartstoppeln waren so sehr mit Schlamm und Blut verschmutzt, dass es schwer zu sagen war, wie der Kerl darunter aussah.
„Ich werde Euch helfen”, sagte er knapp. Als er ihn berührte, um die Rüstung zu öffnen, zuckte Talahko zurück, denn ein seltsames Kribbeln rann über seine Hand.
Eine fremde Präsenz umgab den Mann. Lag es daran, dass ihre Völker verfeindet waren? Die Tätowierungen an seinem eigenen Hals wiesen ihn selbst klar als Tamahya aus, ebenso wie seine dunklere Haut und die schwarzen Haare. Was bei den Göttern ist das? Talahko begann zu zittern. Seltsam! Aber nein, unmöglich, es konnte nicht daran liegen, dass der Kerl ein Norður war. Er hatte doch schon andere Krieger dieses Volkes behandelt. Keiner von denen hatte solch eine Präsenz ausgestrahlt.
Keine Zeit für lange Überlegungen! Mit dem dünnen Messer schnitt er die Wunde auf, um den Pfeil herauszuholen. Verdammt, die Hände zitterten – das war schlecht. Nur einmal war dies bisher vorgekommen, nach einer Nacht ohne Schlaf, die er im Feldlazarett durchgearbeitet hatte. Aber heute war es anders. Sicher lag es an dieser seltsamen Präsenz. Talahko spreizte einen Moment lang seine Finger, um das Zittern zu unterdrücken. Das half ein wenig.
Pfeile waren tückisch; es gab alle möglichen Arten, die schlimmsten davon jene mit Widerhaken, die man nur schwer wieder aus einer Wunde entfernen konnte. Diese Sorte kam ihm bekannt vor, vermutlich besaß sie eine Knochenspitze, wie sie beim Feind ziemlich verbreitet war.
Talahko sah kurz in Richtung Frontlinie. Er hatte keine Pfeilsonde dabei, deshalb schnitt er die Wunde so weit auf, bis er die Pfeilspitze mit einer Zange erreichen konnte. Der Krieger stöhnte auf, ein dumpfes Geräusch, welches er offensichtlich unterdrücken wollte. Die grünen Augen weiteten sich durch den plötzlichen Schmerz.
„Es dauert nicht mehr lange”, sagte Talahko zu dem Verletzten. Mit der Zange musste er tief in die Wunde greifen, bis er schließlich auch die Pfeilspitze zu fassen bekam. Ein tiefer Ruck, und das tödliche Geschoss war draußen.
Allerdings machte ihm die unerklärliche Präsenz weiterhin Sorgen. Plötzlich nahm er einen Geruch wahr, der nicht auf dieses Schlachtfeld zu gehören schien. Er schmeckte die herben, erdigen Aromen eines Waldes und … etwas Animalisches. Fell. Ein bitterer und zugleich warmer Geruch, welcher von dem Krieger ausging. Dieser überlagerte sogar die metallische Süße des Blutes, das abgewetzte Leder, den Schweiß und Schlamm.Natürlich … es kann nicht anders sein. Okahandi, sein Lehrmeister, hatte es ihm beigebracht. Jedes Wesen unserer Welt hat ein Totemtier. Auch dieser Norður. Dessen Totemtier wollte sich bei ihm bemerkbar machen, erkannte den Schamanen in ihm. Deshalb also nahm er den sonderbaren Geruch und diese besondere Präsenz wahr. Aber welches Totemtier war es? Eines, das im Wald lebte. Ein Tier mit Fell. Was die Auswahl nicht gerade eingrenzte …
„Was ist jetzt?”, riss ihn der Krieger mit ächzender Stimme aus seinen Überlegungen.
Er musste sich zusammenreißen, seine Arbeit machen! Rasch! „Habt Ihr Probleme mit naturmagischen Heilungen?” Eigentlich hatten das die Norður-Krieger so gut wie nie, so viel war ihm mittlerweile bekannt.
Der Krieger schüttelte den Kopf. Ob der Kerl selbst etwas von seinem Totemtier ahnte? Weiter hinten hörte er wieder den Ruf nach einem Heiler.
Keine Zeit für lange Fragen! Also begann er einfach mit der magischen Heilung, wie schon bei der Kriegerin zuvor. Dabei hielt er die Augen geschlossen, um sich ganz auf die heilenden Kräfte zu konzentrieren, während er die Adlerfeder über der Wunde kreisen ließ. Der Norður sog scharf die Luft ein, blieb aber ansonsten still. Am Ende begutachtete Talahko sein Werk. Die Wunde hatte sich geschlossen, nur eine wulstige rote Linie war noch zu erkennen. Eine Narbe würde bleiben, denn auch die magischen Heilkünste hatten ihre Grenzen.
„Ich bin fertig”, sagte er. „Achtet darauf, dass Euch niemand auf die Wunde schlägt und ruht Euch … ”
Er zuckte zusammen, denn der Krieger setzte sich hastig auf und griff nach seinem blutbesudelten Schwert.
„Was habt Ihr denn vor? Ihr wollt doch nicht etwa …”
Der Mann unterbrach ihn. „Danke. Aber ich muss wieder in die Schlacht”, sagte er in der Sprache der Norður. Seine Stimme klang mindestens so heiser und rau wie seine eigene, aber letzteres lag wohl auch an den oft ruppig klingenden Lauten des Norðurisk.
„Ihr müsst Euch noch ausruhen. Das war eine schwere Verletzung.”
Der Norður gab einen knurrenden Laut von sich. „Die Ihr noch schwerer gemacht habt vor Eurem Zauber”, erwiderte der Krieger, während er sich schon zum Gehen wandte. „Da vorn kämpfen Gefährten von mir. Ich kann sie nicht im Stich lassen!” Ohne auf eine Antwort zu warten, hastete er von dannen.
„Tut, was Ihr nicht lassen könnt”, rief er dem Norður nach. Ob dieser es noch gehört hatte? Vermutlich nicht. Kopfschüttelnd blickte er ihm nach, ehe er sich dem nächsten Verletzten zuwandte. Sollte ihm egal sein, wenn dieser Krieger hier den Tod finden sollte … Talahko hasste das Volk der Norður.
In der Mittleren Welt lagen graue Schleier über der Ebene von Dalathrién, wie sie von den Elfen genannt wurde. Wie Nebelschwaden waberten diese Dunstschleier umher und hüllten auch die Versammlung der Totemtiere in ihre eisigen Gewänder.
„Brüder und Schwestern, hört mich an!”, rief der Adler Kinjan. Er saß auf dem Ast eines dürren Baumes, blickte auf all die versammelten Tiere: Bären, Füchse, Wölfe, Schlangen, Pferde, Hunde, Hasen, Otter, Berglöwen und viele andere. Im Baum saßen Eulen, Falken, Raben, Krähen, Elstern, Sperlinge, Spechte und noch andere Vögel dicht an dicht, außerdem schwirrten Schmetterlinge, Libellen und andere geflügelte Insekten herum.
Einige der Tiere hatten struppiges Fell, viele waren abgemagert, und selbst die Flügel der sonst bunten Schmetterlinge wirkten blasser, als hätte ihnen jemand die Farben herausgesaugt. Auch die Landschaft wirkte blass unter all dem Grau. Die wenigen Grasbüschel, die hier und dort wuchsen, waren kaum noch mehr als dürre Stängel.
„Unsere Welt ist in Gefahr und es wird schlimmer und schlimmer”, begann der Adler. „Jene Seuche, die Menschen und andere Zweibeiner befällt, greift immer mehr um sich. Sie verwandelt die Wesen in Kreaturen zwischen Leben und Tod. Und mit jeder Verwandlung wird ein weiteres Wesen von seinem Totemtier abgeschnitten! Ich sehe in eure Reihen und ich sehe dort viele, die ihre Schützlinge schon verloren haben. Ist es nicht so?”
Zustimmende Laute waren die Antwort – Knurren, Bellen, Wiehern oder auch Gezwitscher und heisere Rufe von den Raben. Das Flattern von Flügeln, scharrende Geräusche von Pfoten und Tatzen.
„Ich habe alles versucht, um meinen Schützling wiederzufinden, aber ich kann ihn in seiner Welt nicht mehr sehen und in unserer hier schon gar nicht”, sagte ein Berglöwe, dessen einst silbrig schimmerndes Fell stumpf und grau geworden war. Er war hager, glich mehr einem Skelett als einem Raubtier.
„Mit einem Mal konnte ich seine Präsenz nicht mehr spüren und dieses Schicksal mag noch so viele andere treffen. Deshalb bitte ich jeden einzelnen von euch, der noch Verbindung zu seinem Schützling hat: Nehmt Kontakt auf mit ihnen. Manch einer von ihnen weiß nicht einmal, dass es euch gibt. Ihr wacht dennoch über sie, seid unsichtbare Begleiter. Ich bitte euch inständig, geht einen Schritt weiter. Sucht das Gespräch mit ihnen, seien es Elfen, Zwerge, Menschen, Mischwesen oder Ogrra oder noch andere. Vielleicht könnt ihr sie in ihren Träumen erreichen. Sie brauchen uns, mehr denn je! Denn ihre Welt liegt im Sterben und unsere auch. Vor rund einem Jahreslauf hat es begonnen. Damals verließen die Krähen die Hauptstadt Vanfarins. Den Überlieferungen der Menschen nach ist dies ein Zeichen dafür, dass im Land dunkle Zeiten anbrechen. Und genau so ist es gekommen. Die Kreaturen, die zwischen Tod und Leben stehen… sie bringen etwas Finsteres mit sich, etwas Unbekanntes. Den Tod bringen sie über unsere Welten. Wir müssen etwas tun, bevor es zu spät ist!”
„Hört, hört!”, rief ein Marder.
Der Löwe Wengonyama schüttelte seine Mähne. „Ich sage: Wenn die zweibeinigen Wesen nicht zu uns kommen, müssen wir zu ihnen gehen!”
„Wohl gesprochen”, erwiderte der Adler Kinjan.
Bald zerstreute sich die Versammlung der Totemtiere wieder; in kleinen Gruppen trotteten die Vierbeiner davon, in Schwärmen flatterten die Vögel fort von dem Baum. Sie sprachen weiter darüber, was sie für die Zweibeiner tun konnten.
Talahko befand sich in der Ebene von Dalathrién, doch jetzt gab es hier weder Krieger noch eine Schlacht.
Die Landschaft wirkte friedlich; auf dem trockenen hellen Boden wuchsen mehrere rote Blumen zwischen einzelnen dürren Sträuchern. Die vertrauten hellen Laute des Adlers erklangen über ihm. Mit einer Hand schirmte er seine Augen ab und blickte nach oben. Einen Moment lang kreiste der Vogel am Himmel, ehe er auf einem Felsen landete. Der Adler leuchtete leicht golden von innen heraus.
„Ich danke dir, dass du gekommen bist, Kinjan.” Er verbeugte sich vor dem Gefiederten.
Dieser Greifvogel war sein Totemtier, der ihn schon seit anderthalb Jahren begleitete. Oft stand er ihm mit Rat zur Seite und war für ihn zu einem Freund geworden, auch wenn er sich anfangs vor ihm gefürchtet hatte. Außerdem war Talahko davon überzeugt, dass der Gefiederte ihn beschützte, selbst wenn er davon gar nichts merkte. Mehr als einmal hatte sein Lehrmeister erklärt, dass das Totem eines Schamanen diesem immer hilfreich zur Seite stand.
Äußerlich glich Kinjan mit seinen braunen Federn einem Steinadler. Nur das goldene Leuchten verriet, dass er mehr war als ein gewöhnliches Tier. Prüfend betrachtete er Talahko aus seinen dunklen, scharfen Augen. Es musste etwas Bedeutsames sein, wenn das Totemtier ihn in seinen Träumen aufsuchte. Doch er wartete, bis Kinjan sprechen würde, denn das war respektvoller, als ihn auszufragen.
„Ein Totem hat einen seiner Schützlinge zu dir geschickt, gestern in der Schlacht”, erklärte Kinjan.
Der Adler bewegte seinen Schnabel nicht, doch Talahko hörte dessen Stimme in seinem Kopf, klar und deutlich. Gestern hatte er eine ganze Reihe an Kriegerinnen und Kriegern geheilt. Meinte Kinjan etwa einen von diesen?
„Ein Krieger vom Volk der Norður, der nichts von seiner Bestimmung ahnt. Aber du wirst etwas gemerkt haben in seiner Anwesenheit, denn sein Totem hat sich dir durch ihn gezeigt.”
Talahko begriff mit einem Mal, wen er meinte: Den rotblonden Mann mit der Pfeilverletzung, der trotz allem seinen Kampfgefährten beistehen wollte.
„Ja, ich habe eine Präsenz bei einem der Krieger gespürt. Welches Totem ist es?”
„Das darf ich dir nicht sagen. Du wirst es selbst herausfinden müssen, zusammen mit dem Krieger.”
„Aber … er ist ein Norður. Und ich weiß weder seinen Namen, noch wo ich ihn finden kann.”
„Das spielt keine Rolle”, erwiderte der Adler. „Finde ihn. Das ist mein Auftrag für dich. Sage ihm, dass ein Totem auf ihn wartet. Und du wirst mit ihm eine schamanische Reise machen, damit er sein Totem findet.”
„Wirst du mir dabei helfen?” fragte Talahko.
„Nein, diesmal nicht. Das Totem des Kriegers hat mir gesagt, das sei allein eure Aufgabe. Aber ich habe Vertrauen in dich. Ihr werdet es gemeinsam schaffen, ganz gewiss. Möge der Große Geist dich behüten.”
Nach diesen Worten stieß Kinjan einen seiner gellenden Rufe aus und flog davon.
Talahko blickte ihm ratlos nach. Schon öfter hatte sein Totem ihm Aufgaben gestellt, doch bisher war keine so bizarr wie diese gewesen. Wie sollte er diesen Krieger wiederfinden? Ganz davon zu schweigen, dass er auf die Gesellschaft eines Norður lieber verzichtet hätte.
Kapitel 2
Gemeinsam mit den anderen Gelehrten, die aus dem ganzen Land zusammengekommen waren, saß Hadaschi in der improvisierten Bibliothek, die sich in einem großen rechteckigen Zelt befand. Sie alle waren hier, um mehr überdie Untoten herauszufinden, die Vanfarin mittlerweile überrollten. Seit rund einem Jahr befand sich das Land im Dauerkrieg mit diesen unheimlichen Gegnern.
Bisher hatte niemand herausfinden können, ob diese Wesen unabhängig agierten oder von einer geheimen Macht im Hintergrund gelenkt wurden. Hadaschi war extra aus der Landeshauptstadt Semvansin angereist, um sich hier mit den anderen Gelehrten auszutauschen. Ein bunter Haufen hatte sich an diesem trüben Tag versammelt: Heiler und Heilkundler, Alchemisten, Historiker, Naturkundler, aber auch Militärstrategen des Heeres. Noch hatten sie Zeit, die Gelehrten versammelten sich gerade erst.
„Geht es Euch nicht gut?”, erkundige sich die Elfe mit dem kastanienfarbenenHaar, die rechts von ihm saß. Ihrer Robe und den Symbolen darauf nach zu urteilen vermutlich eine Magierin, doch mit Elfenmagie war er nicht vertraut.
Hadaschis nicht mehr vorhandener rechter Arm schmerzte, er verzog das Gesicht. Ein Schmerz, der eigentlich nicht sein durfte und doch immer wieder auftauchte. Wie sehr hasste er die grobe Prothese, die den Arm ersetzte.
„Wisst Ihr”, begann er, „vor drei Wintern war ich auf Reisen und zu Fuß unterwegs. Ein Fuhrwerk eines Bauern kam mir entgegen. Auf der Straße tauchte plötzlich eine Schlange auf, gewiss kennt Ihr sie, eine der giftigen Regenvipern. Die Pferde drehten durch, trampelten über mich hinweg.”
Fahrig holte er Luft, als die Erinnerung an diesen grauenvollen Moment zurückkehrte – wie er stürzte, die Hufe der wild gewordenen Tiere über sich. Nein, er musste diese Gefühle abstellen, er durfte hier in dieser Versammlung sein Gesicht nicht verlieren.
Er zwang sich zu einem unverbindlichen Lächeln. „Die Pferde, schwere Kaltblüter, haben mir den Arm zerquetscht. Der Bauer hat mich zum nächsten Heiler gebracht, doch der war meilenweit entfernt und beherrschte keinerlei magische Heilkünste, die meinen Arm vielleicht hätteretten können. Stattdessen nahm er ihn mir ab. Er sagte, ich wäre sonst wohl an Wundbrand gestorben und er hätte keine anderen Möglichkeiten mehr gesehen. Die Knochen waren allesamt zertrümmert und mein Fleisch kaum mehr als ein blutige Masse.”
„Das tut mir leid für Euch,” sagte die Elfe mit einem mitfühlenden Lächeln.
„Sehr freundlich von Euch. Immerhin bin ich mit dem Leben davon gekommen und habe das hier.” Er deutete auf die Prothese. „Doch ich habe gelegentlich Schmerzen in dem Arm, als sei er noch da. Aber verzeiht, ich vergaß meine Manieren. Mein Name ist Hadaschi Hikaru.”
„Sehr erfreut, ich bin Taobh Gheal den Domhan. Aber Gheal reicht.”
Ihr Name klang ungewohnt in seinen Ohren, wie es Elfennamen oft taten. Sie hatte ihn Ta-oob Giel den Doumhän ausgesprochen.
„Ich versuche es mir zu merken. Ihr seid gewiss eine Magierin?”
„Ja. Dank den Kräften der Natur wurde mir dieses Talent zuteil. Was ist Euer Metier?”
„Ich bin Alchemist. In gewisser Weise arbeite ich ebenfalls mit den Kräften der Natur, nur anders als Ihr. Aber ich beschäftige mich auch mit anderen Wissensbereichen. Ich lese sehr viel.”
„Es gibt Weisheit, die sich in den Zeilen von Schriftrollen findet, und es gibt Weisheit, die man persönlich erfahren muss … ”, sagte sie in einem nachdenklichen Tonfall.
„Oh ja, da gebe ich Euch recht. Wie vieles ist Versuch und Irrtum in der Alchemie?” Er lachte. „Dennoch, man kann vieles aus Schriftrollen und Büchern lernen, sowie aus den Erfahrungen und Berichten anderer.”
„Gewiss. Auch wenn ich gestehen muss, dass ich die persönliche, praktische Erfahrung allem gelehrten Wissen vorziehe.”
„Für Euch ist es anders, Ihr seid Magierin … ”
„Aber auch Ihr braucht doch die praktische Erfahrung, wenn Ihr Tränke braut oder Salben und andere Dinge herstellt?”
„In der Tat. Und jede Menge Geduld.” Geduld, die er nicht mehr besaß, seit er seinen Arm verloren hatte.
Dieser schreckliche Unfall und der damit verbundene Verlust hielt ihm täglich schmerzlich vor Augen, wie leicht man sein Leben verlieren konnte. Es hatte ihn bitter werden lassen. So bitter, dass er damit seinen damaligen Lebensgefährten Dai vertrieben hatte. Die Erinnerung an ihn schmerzte noch immer. Seit damals hatte er Dai nicht mehr gesehen.
Hadaschi wechselte lieber das Thema, bevor er noch sentimental wurde. Es war besser, sich ganz auf den Anlass der Versammlung zu konzentrieren. „Habt Ihr, oder Gelehrte eures Volkes, eine Theorie zu dem Ursprung der Untoten, Gheal?”
„Nein, immer noch nicht, nur ein Haufen vager Ideen. Nichts, was einer genaueren Betrachtung und gelehrten Beweisführung standhielte. Deshalb erhoffe ich mir, hier das eine oder andere zu hören, was vielleicht Licht in dieses Dunkel, in unsere Unwissenheit, bringen mag.”
„Euer Optimismus ehrt Euch.” Er musterte sie kurz. Sie sah jung aus, aber taten das nicht alle Elfen? Immerhin lebten sie um einiges länger als Menschen. An ihrer rechten Wange bemerkte er eine alte Brandnarbe. Gheals Alter war schwer zu schätzen, wenn man es auf Menschenjahre umrechnen wollte. Und danach zu fragen, war gewiss unhöflich. Hadaschi war sich nicht sicher. Er kannte keine Elfen persönlich, war mit ihren Gebräuchen nicht vertraut.
Er sah sich um. Mehrere Gelehrte aus der Hauptstadt Semvansin hatten sich hier versammelt. Die Akademia Semvansiniana war weithin berühmt und bekannt für ihr umfangreiches Wissen, welches in ihrer Bibliothek gesammelt wurde, und für die klugen Köpfe, die dort forschten.
Er selbst hatte dort zwei Jahre lang studiert, stammte aber eigentlich aus dem Nachbarreich, welches noch weiter südlich lag. Sein geliebtes Hatainé. Wie sehr er es vermisste. Die Sprache, die Sitten, die Speisen. Zwar gab es auch in Semvansin ausgewanderte Hatainésier und entsprechend mangelte es auch nicht an Gaststätten, welche die Speisen seiner Heimat anboten. Aber viele hatten sich so sehr an den Geschmack der Vanfariner angepasst, dass ihnen das gewisse Etwas fehlte. Wenn das alles hier vorbei war, wenn diese Untotenplage endlich beendet war, würde er endlich zurück in seine Heimat reisen und vielleicht endlich wieder …
Ein Mann in Offiziersuniform kam herein, klopfte laut auf den Tisch und riss Hadaschi aus seinen Gedanken. Die Gespräche verstummten.
„Danke. Ich bin Offizier Faolan. Ich bitte um Bericht, ob es neue Erkenntnisse in Bezug auf die Untoten gibt.” Der noch junge Offizier mit den dunkelblonden Haaren formulierte es zwar höflich, doch seine Bitte war ein Befehl, so viel war klar.
Der grauhaarige Gelehrte Belendio, den Hadaschi durch seine Studienzeit an der Akademie kannte, erhob sich. „Ich spreche hier für uns alle. Leider gibt es keine neuen Erkenntnisse. Die magischen Untersuchungen der arkanen Magier haben nichts erbracht. Auch die Magie der Elfen”, bei diesen Worten streifte sein Blick die Elfenmagierin, die neben Hadaschi saß, „konnte uns in Bezug auf die Untoten nicht weiterbringen.”
Offizier Faolan nickte. „Einige der Unteroffiziere und Hauptleute haben mehrere der Untoten verhört”, erklärte er.
Er schob sich eine Haarsträhne aus der Stirn. „So wie wir es schon seit Monaten versuchen. Es ist zwecklos. Die Untoten schweigen beharrlich und egal, wie man ihnen droht, sie bleiben vollkommen gleichgültig.”
Was Faolan Drohungen nannte, war vermutlich Folter, doch das sprach Hadaschi lieber nicht laut aus. Offiziell waren Folterungen in Vanfarin schon seit Jahrzehnten verboten. Aber wer mochte schon wissen, was in den Zelten der Militärangehörigen vor sich ging, wenn sie Feinde verhörten?
„Sie scheinen keinerlei Furcht zu kennen”, fuhr der Offizier fort. „Und sie geben nichts preis, weder über sich noch über ihre Befehle, falls sie denn welche haben.”
Er wandte sich die Magistra Severina, eine schmale, ältere Frau in einem hellgrünen Gewand. „Und die körperlichen Untersuchungen? Was könnt Ihr mir darüber sagen?”
„Die Heiler und Anatomiekundigen haben mehrere Untote nach deren finalen Tod auf dem Schlachtfeld aufgeschnitten“, erklärte sie. „Wir haben ihre Organe vermessen, gewogen, ihr Blut untersucht, das noch immer vorhanden ist, wenn auch in geringeren Mengen als bei einem lebenden Wesen. Wir gehen davon aus, dass das Blut weiterhin durch den Körper fließt. Diese Theorie ist bereits vor einigen Wochen entstanden, als wir ähnliche Untersuchungen gemacht haben. Eine weitere Theorie, die es schon seit einiger Zeit gibt, konnte bestätigt werden: Die Untoten erinnern an Sterbende, die an einer schweren Krankheit dahinsiechen. Deutlich wird dies an dem Zerfall ihrer Haut und Augen.”
Die Magistra räusperte sich. „Leider ist uns weiterhin ein Rätsel, warum die Untoten sich trotz dieser Einschränkungen so rasch bewegen können und noch größtenteils Herr ihrer Sinne sind. Wir haben uns auch ihre Gehirne angesehen. Dort ist ebenfalls Zerfall erkennbar, wenn auch nur schwach, und sie scheinen weniger durchblutet zu werden als die Gehirne von Lebenden. Allerdings sind diese Untersuchungen schwierig, denn bei lebendigen Zwergen, Ogrra, Elfen und Menschen sowie Mischwesen gibt es ja schon teilweise einiges an körperlichen Unterschieden, und so scheint es auch bei den Untoten der Fall zu sein.
Bei allen konnten wir feststellen, dass ihre Haut und ihre Kleidung nicht nur mit Staub, sondern auch mit Sand bedeckt waren. Aber das ist ja hier in Dalathrién nichts ungewöhnliches, da der Boden an vielen Orten recht sandig ist.”
„Ich danke Euch, Magistra Severina. Gibt es noch weitere Erkenntnisse?”, fragte Faolan in die Runde.
Ein unbehagliches Schweigen war die Antwort.
Ein weiterer Mann meldete sich zu Wort. Seine Ohren waren ein wenig spitz, doch er hatte nicht die typischen Gesichtszüge eines Elfen. Vielleicht ein Mischwesen, vermutete Hadaschi.
„Herr, einige der Gelehrten diskutieren mittlerweile noch über eine andere Frage … ”, begann er. Seine Stimme war voll und füllte ohne Mühe das gesamte Zelt.
„Welche Frage?”
„Wie ist es mit den moralischen Grundsätzen, die in diesem Land herrschen, vereinbar, dass wir die lebenden Toten endgültig töten, obwohl sie einst offensichtlich lebende Wesen und Bürger dieses Landes waren?”
„Ist das nicht eher eine Frage für das Kriegsrecht?”, entgegnete der Offizier. „Die Untoten töten schließlich die Lebenden.”
„Das ist richtig, doch es wurde ja öffentlich bekanntgegeben, dass die Untoten auf Sicht getötet werden dürfen. Wie Vogelfreie, egal, ob man sie in einer Schlacht antrifft oder in zivilen Bereichen.”
„Wie meint Ihr das? Geht Ihr davon aus, dass es auch friedliche Untote gibt? Mir ist davon nichts bekannt. Hat es solche Fälle gegeben?”
Der Halbelf schüttelte den Kopf. „Das kann ich Euch leider nicht beantworten. Doch in den Gesetzen Vanfarins steht klar zu lesen, dass jeder Bürger des Landes ein Anrecht auf Schutz des eigenen Lebens hat. Ein Schutz, der unter anderem durch die Armee und durch die Gardisten in den Städten und Gemeinden gewährleistet werden soll und der nur bei einzelnen Bürgern in gewissen Fällen verwirkt wird.”
„Seid Ihr ein Rechtsgelehrter?”, hakte Offizier Faolan nach.
„In der Tat, das bin ich. Und als solchem stellt sich mir die Frage: welche Rechte haben die Untoten? Gelten sie weiterhin als Bürger Vanfarins oder ist ihnen der Status von Bürgern aberkannt, da sie einen Bürgerkrieg begonnen haben? So könnte man jedenfalls argumentieren.”
Faolan rieb sich über die Schläfen.
Ein anderer Gelehrter schüttelte den Kopf. „Die Gesetze können gar nicht so schnell geändert werden, wie sich die Verhältnisse in Vanfarin verändert haben. Vor einem Jahr herrschte hier noch Frieden.”
Eine menschliche Frau meldete sich zu Wort. Sie trug das goldgelbe Ornat einer Priesterin, die offensichtlich dem Sonnengott des Südens diente. Dessen Symbol, eine Sonne mit zwölf Strahlen war darauf gestickt; ein Strahl für jede Stunde des Tages.
Faolan erteilte ihr mit einer Geste das Wort.
„In diesem Zusammenhang müssten wir aber auch darüber sprechen, was denn überhaupt Leben ist. Ein Untoter mag sich zwar noch bewegen und Überreste seines Geistes und seiner Sinne haben, doch er weilt nicht mehr vollends unter den Lebenden, scheut vielleicht gar das Sonnenlicht”, sagte sie ruhig. „Insofern kann man das Leben eines Untoten wohl kaum schützen, wenn man das Gesetz wörtlich auslegt. Weil es bei einem Untoten kaum noch etwas Lebendiges zu beschützen gibt.”
Der Offizier antwortete nicht gleich. Er sah von einem zum anderen und machte auf Hadaschi einen etwas ratlosen Eindruck. „Bitte, diskutiert diese Frage weiter. Sie ist in jedem Fall in diesem Zusammenhang wichtig. Falls ihr zu einer Einigung diesbezüglich gelangt, teilt es mir bitte mit. Bis dahin danke ich Euch zunächst für Euren Bericht. Ich werde dies weitergeben an meine Vorgesetzten. Und ich bitte darum, dass Ihr weiterforscht, auch wenn es Euch sinnlos erscheinen mag. Vielleicht findet Ihr noch neue Ansätze oder andere Ideen.”
Hadaschi stimmte ihm insgeheim zu. Irgendetwas mussten sie übersehen oder nicht bedacht haben … Aber auch die Frage, was denn genau Leben sei, beschäftigte ihn nun. Hatten die Untoten noch ein Anrecht auf Leben, oder nicht?
Kapitel 3
Der ständige Regen der letzten Tage hatte den Boden in klebrigen Schlamm verwandelt. Kleidung und Schuhe von der dunklen, schmierigen Masse fernzuhalten, war so gut wie unmöglich. Die Kleider der Heilerinnen hatten mittlerweile alle feuchte Schmutzsäume und viele Schuhe waren kaum noch als solche zu erkennen. Aber auch mit Beinkleidern, wie er sie trug, entkam man dem stinkenden Matsch kaum.
Fransen aus weichem, hellen Leder zierten Talahkos Hosen, dazu trug er ein passendes Oberteil mit langen Ärmeln, die er mit einigen gewebten Perlenbändern verziert hatte – die traditionelle Kleidung seines Volkes. Zu seinem Glück gab es im Lazarett des Bundes Heilung für Alle keine Kleidungsvorschriften. Die Heiler wurden lediglich dazu angehalten, lange Schürzen zu tragen, um sich bei der Arbeit vor Blut und giftigen Substanzen zu schützen.
Zu gern hätte er seine Stiefel ausgezogen und wäre barfuß gelaufen, doch die zunehmende Kälte des Herbstes kroch ihm zu sehr in die Glieder. Das ging nicht nur ihm so; im Lazarett husteten mittlerweile nicht nur viele Patienten, sondern auch mehrere der Heiler.
An diesem Morgen nieselte es zwar nur leicht, aber die winzigen Tröpfchen sorgten auf Dauer natürlich ebenfalls für Feuchtigkeit. Talahko war für den Lazarettdienst eingeteilt worden, und obwohl das nicht minder anstrengend war, als im Feld zu heilen, war er an diesem Tag froh darüber. Auf dem Schlachtfeld hätte er durch noch mehr Schlamm kriechen müssen, als es hier der Fall war.
Im Lazarett war die Lage den Umständen entsprechend ruhig. Zwar waren fast alle Betten belegt, doch zumindest im Moment kamen keine neue Patienten herein. Gemeinsam mit einer Heilerschülerin kümmerte er sich um mehrere Verwundete, außerdem weichte er benutzte Verbände in einer Waschlauge ein und reinigte die Heilerbestecke. Diese Reinigungsdienste gehörten mit zur Ausbildung.
Im hinteren Bereich eines der Lazarettzelte saßen zwei der Heiler und unterhielten sich leise. Talahko vermutete, dass sie eine kurze Pause machten und sich mit einem Becher Tee aufwärmten. Der Bund Heilung für Alle arbeitete im gesamten Land, mit Heilerinnen und Heilern aus allen Völkern, darunter auch die Elfen aus dem Westen und die Tamahya.
Viele der Heiler kamen auch aus der Hauptstadt im Süden, Semvansin. Die Norður wiederum lebten sehr autark und blieben eher unter sich. Die meisten ihrer Siedlungen hatten eigenen Heiler und auch eigene Heilmethoden. Vielleicht war es deshalb nicht verwunderlich, dass zumindest in diesem Lazarett kein einziger Norður arbeitete. Talahko war das mehr als recht, denn seit dem, was vor zehn Wintern geschehen war, trug er eine unauslöschliche Wut gegen dieses Volk in sich.
Am Nachmittag wurde es chaotisch im Lazarett: In rascher Folge brachten die Helfer neue Verwundete herein. Manche trugen sie, andere wurden gestützt. Alles war dabei, was auf dem Schlachtfeld geschehen konnte – Kopfverletzungen, Pfeilverletzungen bis hin zu abgetrennten Gliedmaßen. Von der Untotenseuche sah er auf Anhieb nichts. Talahko musste einen Anflug von Übelkeit unterdrücken, als er einen Krieger sah, dem eine Hand abgeschlagen worden war. Obwohl er schon lange in der Heilerausbildung war und schon einiges gesehen hatte, kam es immer wieder vor, dass ihm doch ein grausiger Anblick den Atem verschlug.
Wenig später bekam er eine Gänsehaut, doch dies lag nicht an den Verwundeten um sie herum. Trotz der Hektik im Lazarett, dem Stöhnen und Schreien der schmerzerfüllten Verletzten spürte er deutlich jene sonderbare Präsenz – noch ehe er den Krieger sah, von dem dieser Eindruck ausging. Er durchquerte das große Zelt, wich einem Heilerschüler aus und näherte sich jener seltsamen Energie.
Wie er vermutet hatte – der Norður-Krieger mit den rotblonden Haaren. Er lag auf einer der Lazarettliegen, die aus zusammenklappbaren Holzgestellen und reißfesten Liegeflächen bestanden. Diesmal hatte es ihn schlimmer erwischt, doch der Heiler Siochain war bereits bei ihm und versorgte ihn.
Eine Verletzung im Bauchbereich, eine tiefe Schnittwunde, die wohl bereits im Feld notdürftig zugenäht worden war, um ein Verbluten zu verhindern. Siochain schob das blutgetränkte Leinenhemd des Verwundeten hoch. Zum Glück mussten sie ihn nicht auch noch aus einer Rüstung schälen, das hatten offenbar bereits die Heiler im Feld übernommen.
Als Siochain ihn sah, sagte er: „Geh mir zur Hand, Talahko. Ich muss die Wunde wieder aufschneiden und auswaschen, sonst wird er womöglich an dem Dreck darin sterben. Ich brauche den Alkohol zum Reinigen.”
Talahko holte das Gewünschte, einen starken Getreidebrand. Mit einer dünnen Pinzette zog Siochain vorsichtig die Fäden aus dem Fleisch. Sofort blutete die Wunde erneut. „Nimm ein Tuch und drück hier etwas dagegen.” Er deutete auf ein Stück Haut unterhalb der Wunde.
„Zum Glück hat die Waffe ihm nicht die Gedärme oder die Bauchwand durchschlagen, sonst wäre er wahrscheinlich nicht mehr unter den Lebenden oder würde bald sterben. Ich habe schon ein-, zweimal zerfetzte Gedärme genäht, aber das ist meistens ein ziemliches Glücksspiel und oft überleben es die Patienten leider nicht. Zumal in einem Feldlazarett nicht gerade optimale Bedingungen herrschen. Aber man hat ja auch nicht immer die Möglichkeit, magisch zu heilen und manchmal geht ja sogar das nicht gut aus”, erklärte der Heiler, während er mit der Pinzette Fremdkörper aus der Wunde entfernte und sie mit dem Getreidebrand auswusch.
Der Elf mit den feingeschnittenen Gesichtszügen arbeitete trotz des Lärms im Lazarett mit einer Ruhe und Konzentration, als könne ihn überhaupt nichts aus der Fassung bringen. Talahko bewunderte dies. Er ging davon aus, dass er selbst wohl auch in vielen Jahren nicht solch eine Ruhe ausstrahlen würde, zumindest nicht bei der Arbeit als Heiler.
„Nun bist du dran. Zeige mir, was du gelernt hast und nähe die Wunde zu. Ich weiß ja, dass du naturmagische Heilungen wirken kannst, aber manchmal ist nicht die Zeit oder der Ort dafür, nicht wahr?”
„Deswegen bin ich hier, um zu lernen”, erwiderte Talahko und griff nach Nadel und Faden. Trotzdem, es war ihm unangenehm, ausgerechnet einen Norður zu versorgen. In seiner Fantasie nähte er dem Kerl ein hässliches Muster in den Bauch, doch dann riss er sich zusammen. Was für lächerliche, kindische Anwandlungen für einen Heiler, noch dazu bei dem Bund der Heiler. Schließlich wurde bei Heilung für Alle jeder ohne Ansehen der Person, des Geschlechts oder der Volkszugehörigkeit behandelt. Also nähte er so ordentlich und gründlich, wie es ging und vergaß darüber sogar, dass er einen Mann von jenem gehassten Volk unter den Fingern hatte.
Anschließend wies Siochain ihn an, bei dem noch immer bewusstlosen Krieger zu bleiben und zu schauen, ob er wieder zu sich kam.
„Falls er nicht bald aufwacht, sagt mir Bescheid, Talahko. Ich werde dann noch einmal sehen, was ich für ihn tun kann.”
„Ja, Siochain.”
Der Elf richtete sich auf und wandte sich dem nächsten Patienten zu. Mit einem feuchten Tuch wischte Talahkodem Krieger das verdreckte Gesicht ab. Unter dem Schmutz kam ein Gesicht mit Sommersprossen und kantigen Zügen hervor. In Talahkos eigenem Volk waren Sommersprossen und eine solch helle Haut nicht zu finden; auf ihn wirkte es fremdartig. Allerdings hatte der Krieger auch eine Narbe im Gesicht, die sich von der Schläfe bis zur Stirn zog. Das wiederum kannte er von so manchem Krieger aus seinem eigenen Volk. Diese waren sogar stolz auf ihre Narben, da sie deutlich sichtbar von ihren Kämpfen erzählten. Ob Narben wohl bei den Norður auch als Auszeichnung galten?
Zum Glück war der Krieger offenbar so zäh, wie er aussah, denn wenig später kam er wieder zu sich. Bei Talahkos Anblick wurden seine Augen einen Moment lang schmal. Talahko war kein Hasenfuß, dennoch zuckte er zurück vor dem Mann, wegen jener fremdartigen Präsenz, die ihn noch immer umgab.
Sein Herz klopfte ihm in der Brust wie eine Trommel. Dann erinnerte er sich an den Auftrag des Adlers. Er durfte sein Totemtier nicht enttäuschen.
Mit heiserer Stimme verlangte der Krieger nach „Vaten.”
Talahko war mittlerweile so nervös und auf der Hut, dass er einen Moment brauchte, um das Wort innerlich zu übersetzen. Der Kerl wollte Wasser. Etwas zu trinken. Er nickte ihm zu, stand auf und besorgte einen Becher Wasser. Der Krieger war allerdings noch zu schwach, um sich aufzurichten, deshalb hielt Talahko ihm widerwillig den Becher an die Lippen, damit er trinken konnte.
„Wie heißt Ihr?” fragte er auf Vanfas, der offiziellen Landesprache. „Ich bin Talahko.”
„Warum willst du meinen Namen wissen?”, fragte der Krieger auf Norðurisk. Entweder beherrschte er Vanfas nur schlecht – das war diesen Barbaren zuzutrauen – oder er beleidigte ihn absichtlich, indem er demonstrativ seine eigene Sprache verwendete. Die Talahko vor langer Zeit gelernt hatte, weil sein Vater der Ansicht gewesen war, dass es besser sei, seine Feinde zu verstehen.
„Ich bin doch nur ein Patient unter vielen”, sagte der Norður jetzt mit jener rauen Stimme, die Talahko schon auf dem Schlachtfeld aufgefallen war. „Noch dazu aus einem Stamm, der mit deinem wohl verfeindet ist, ist es nicht so? Du bist doch ein Tamahya.”
„Hört mir zu.” Seine eigene Stimme klang ihm heiser in den Ohren. Warum hatte Kinjan ihm nur diesen vermaledeiten Auftrag gegeben? Ausgerechnet ein Norður! Ein tiefes Durchatmen, ehe er zu sprechen begann. „Ich habe ein Anliegen an Euch. Es mag Euch seltsam erscheinen, aber lasst mich zu Ende sprechen.”
„Ich habe ja keine andere Wahl. Der Heiler sagte, ich müsse mich noch mindestens bis zum Abend ausruhen, sonst könne er für nichts garantieren. Aber hör auf, mich zu ihrzen, ich bin weder ein Offizier noch ein Adliger oder sonst jemand von hohem Rang. Ich bin nur ein einfacher Krieger.”
Talahko sah zum Eingang des Lazarettzeltes. Zumindest im Moment warteten dort keine neuen Patienten auf eine freie Liege.
„Also gut. Bleibt … bleib am besten noch einen Moment liegen. Was ich Euch … was ich dir zu sagen habe, dauert nicht lang.”
„Dann sag es schon.”
„In meiner Heimat habe ich eine schamanische Ausbildung machen dürfen, die auch noch nicht vorbei ist. Und ich habe ein Totemtier gefunden. Oder vielleicht hat es mich gefunden. Hast du Kenntnisse von … schamanischen Dingen?”
Fragend hob der Krieger eine Augenbraue. „Warum ist das von Bedeutung für dich? Ich weiß, dass es so etwas gibt, aber etwas Genaueres habe ich darüber nicht erfahren. Die Schamanin meines Heimatdorfes ist vor einigen Jahren durch einen Unfall zu Tode gekommen, ohne einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin ausbilden zu können.”
Das erklärt vielleicht, warum er nichts von seinem Totemtier ahnt...
„Du wunderst dich sicher, warum ich das frage. Es ist so: Mein Totem erschien mir gestern Nacht im Traum. Es sagte mir, du bist, wohl ohne es zu wissen, ebenfalls mit einem Totemtier verbunden. Dein Totem hat mit dem meinen gesprochen und mir den Auftrag erteilt, dich davon in Kenntnis zu setzen.”
„Was für ein Totemtier soll das sein?” fragte der Norður, während eine steile, waagerechte Falte zwischen seinen Augenbrauen erschien.
„Das weiß ich nicht.” Bloß nichts von der feindseligen Präsenz erzählen, die er bei ihm wahrnahm … „Mein Totem darf es mir nicht sagen. Doch wir beide sollen es gemeinsam herausfinden. Wir sollen dein Totem gemeinsam suchen.”
Das Gesicht des Mannes verfinsterte sich noch mehr. „Wie soll das gehen?”
Einer der älteren Heiler kam auf sie zu, ehe Talahko antworten konnte. „Kann der Patient aufstehen? Dann macht die Liege frei. Ich habe gerade erfahren, dass wir gleich wieder Verwundete hereinbekommen.”
Talahko nickte rasch und half dem Krieger, der ihm immer noch nicht seinen Namen verraten hatte, aufzustehen.
„Es geht schon”, sagte der Norður und richtete sich auf. „Wo sind meine Waffen?” fragte er.
„Ich trage sie für dich.” Das war nichts besonderes, Talahko machte es oft. So griff er auch jetzt nach dem Schwert und Schild, die seitlich an der Zeltwand lehnten. Danach führte er den Krieger nach draußen, vorbei an einigen Lazaretthelfern und Verletzten. „Folge mir. In dem Zelt dort vorn kannst du etwas essen. Es wird dir helfen, wieder zu Kräften zu kommen.” Er selbst fühlte sich ebenfalls hungrig.
Die Lazarettküche versorgte sowohl Patienten, wenn es nötig war, wie auch die Heiler und ihre Lehrlinge oder Schüler. Talahko bat den Krieger, am Tisch Platz zu nehmen, nachdem er seine Waffen in einer offenen Kiste am Eingang deponiert hatte, sodass diese nicht im Weg lagen. Vielleicht war es gut, neben ihm eine kurze Essenspause einzulegen und ihre Angelegenheit weiter zu besprechen, damit er das hinter sich bringen konnte. Anschließend würde er wieder seinen Dienst im Lazarett aufnehmen.
Der Krieger setzte sich schwerfällig hin, kein Wunder angesichts seiner jüngsten Verletzungen.
„Warte hier, ich hole uns etwas zu essen”, sagte Talahko.
„Danke.”
Er ging zu dem Tisch hinüber, an dem die Küchenmägde eine kräftige, dampfende Suppe in Schüsseln austeilten. Die erfahrenen Heiler im Lazarett wurden nicht müde zu betonen, wie wichtig Pausen und Nahrung für jeden einzelnen von ihnen waren. Es hatte schon Heilschüler gegeben, die bis zur Erschöpfung gearbeitet hatten und ohnmächtig zusammen gebrochen waren. Solche Vorfälle wurden dann gern als Beispiele zur Warnung genannt.
Talahko bekam zwei Löffel und Schüsseln mit Suppe ausgehändigt. Er bugsierte dies allesquer durch das Zelt und setzte sich zu dem Krieger. Bis auf sie beide war dieser Tisch gerade leer. Besser so – was er zu sagen hatte, war nicht für jedermanns Ohren bestimmt. Der Norður begann nun allerdings kommentarlos, die Suppe in sich hineinzuschaufeln, in der typischen Manier von Kriegern, die nicht wussten, wie lange sie Zeit vor dem nächsten Angriff hatten.
Talahko begann ebenfalls, seine Suppe zu essen, ließ sich aber mehr Zeit, zumal das Gemisch aus Fleischbrocken, Gemüse und Brühe sehr heiß war. Sollte sich der Norður doch die Zunge verbrennen.
Erst als er aufgegessen hatte, fragte der Kerl: „Also, wie soll das gehen, diese Totemsuche?”
„Mit einer schamanischen Reise. Weißt du, was das ist?”
Sein Gegenüber schüttelte den Kopf. „Ich habe Verpflichtungen, keine Zeit für eine Reise.”
„Das ist keine Reise im üblichen Sinne. Man reist nur mit dem Geist gewissermaßen, während der Körper an Ort und Stelle bleibt.”
„Ist das gefährlich?”, fragte der Norður mit einem Stirnrunzeln. Er klang skeptisch.
„Nein, meistens nicht. Es sei denn, man trifft auf feindselige Kreaturen. Aber es gibt den einen oder anderen Schutz dagegen.”
„Wie soll ich das verstehen?”
„Wenn dein Geist auf einer solchen Reise angegriffen wird, kann sich das unter Umständen auch auf deinen Körper schädlich auswirken.”
„Na, das fehlte mir gerade noch. Ich habe schon genug mit realen Kämpfen zu tun. Wozu brauche ich denn überhaupt so ein Totemtier? Kann es nicht einfach da bleiben, wo es herkommt und mich in Ruhe lassen?”
Talahko unterdrückte ein Seufzen. „Ein Totemtier ist ein sehr hilfreiches Geschöpf. Es kann dich beschützen, dir Rat schenken und Kraft geben in schweren Zeiten.”
Der Krieger gab einen knurrenden Laut von sich. „Ich brauche weder einen Beschützer, noch jemanden, der mir Kraft gibt. Und wenn ich einen Rat brauche, frage ich meine Gefährten.”
„Bist du dir da so sicher? Schau dich doch nur einmal an, wie schwer du heute verwundet worden bist.”
Jetzt wurde die Miene seines Gegenübers finster. Er schob sich eine rotblonde Strähne aus dem Gesicht und sah Talahko direkt an. „So, du behauptest also, mit einem Totem wäre mir das nicht passiert?”
„Das würde ich so nicht sagen. Auch ein Totem kann nicht verhindern, dass jemand verletzt wird. Aber vielleicht hätte es die Schwere deiner Verletzung vermindern können. Vor allem, wenn du vor dem Kampf ein Kraftritual gemacht hättest, welches dein Totem ehrt.”
Der Krieger fuhr sich über die Bartstoppeln an seinem Kinn. „Also, ganz ehrlich, ich kann mit diesen ganzen schamanischen Dingen nicht viel anfangen.”
„Es gibt noch etwas, was du wissen solltest. Mit einem Totemtier verbunden zu sein, ist eine Ehre, die nicht jedem zuteil wird. Zwar ist es so, dass fast jeder Mensch ein Krafttier, einen Schutzgeist oder ein Totem hat, aber nur bei einigen zeigen sich diese Geister auch. Nur wenige Leute können mit ihnen überhaupt in Kontakt treten, das geht nicht ohne weiteres. Außerdem ist es ungewöhnlich, dass sich ein Totem an ein anderes wendet, um sich mit seinem eigenen Schützling bekannt zu machen.” Talahko sprach jetzt noch eindringlicher. „Es ist deine Bestimmung, verstehst du das? Wer weiß, vielleicht hat dein Totemtier noch Großes mit dir vor. Denn oftmals stellen uns die Totems auch Aufgaben.”
„Ich soll mich von einem Tier herumkommandieren lassen?” Jetzt klang der Norður beinahe belustigt. „Es reicht mir schon, dass mir alle möglichen Feldherren Befehle erteilen.”
„Ein Totem ist viel mehr als ein Tier. Es ist ein mächtiger Geist”, entgegnete Talahko mit fester Stimme.
„Ich muss darüber nachdenken. Ich kann das jetzt nicht einfach so entscheiden.”
„Wie du wünschst. Aber überlege nicht zu lange. Du findest mich hier im Lazarett. Oder wenn es Nago Tahanka, der Große Geist, will, wieder auf dem Schlachtfeld.