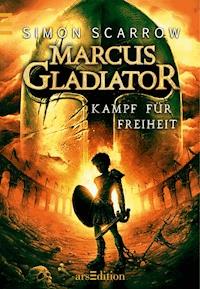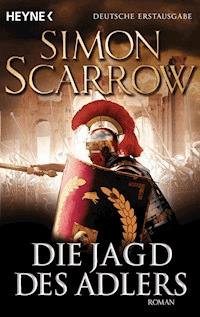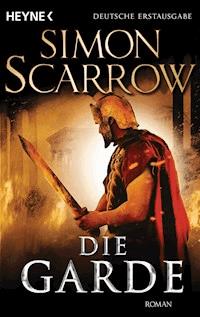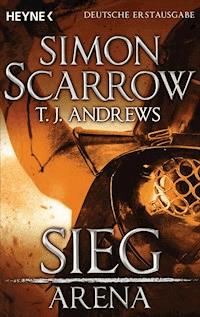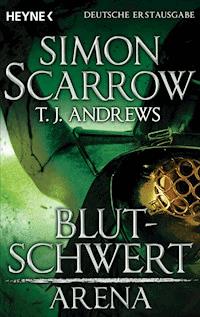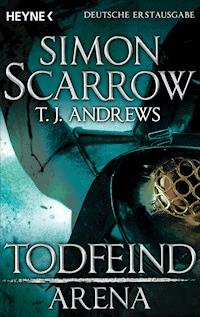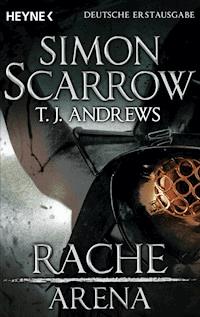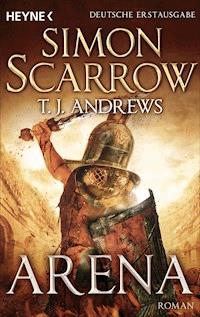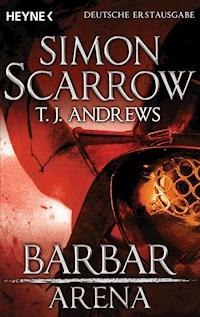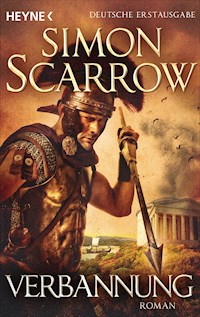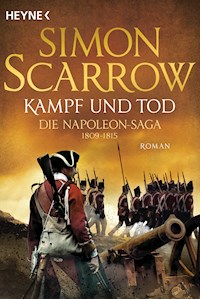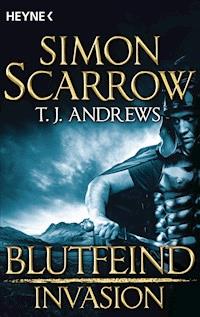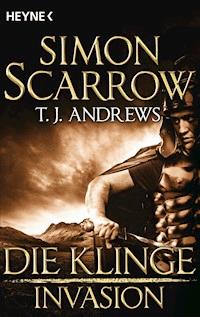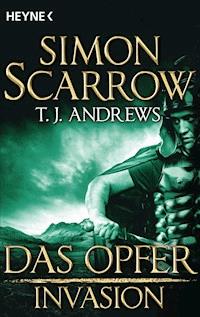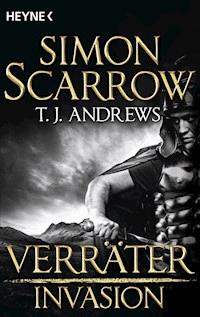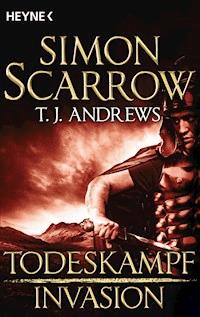9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Spannende Ermittlungen im Schatten des 2. Weltkriegs - die Berlin-Krimis von Bestseller-Autor Simon Scarrow Berlin im Winter 1939. Der Zweite Weltkrieg hat begonnen. Immer weiter schränkt das Nazi-Regime die Freiheit der Bevölkerung ein. Doch in der Hauptstadt wird der sich ankündigende Schrecken der Kriegsjahre von einer tiefgreifenden Angst überschattet. In den kalten Stunden der Verdunkelung, die die diktatorische Regierung zum Schutz gegen Fliegerangriffe ausspricht, zieht ein brutaler Mörder durch die Metropole. »Düster, spannend und authentisch.« ― Passauer Neue Presse Als die Leiche einer jungen Frau gefunden wird, gerät Kriminalinspektor Horst Schenke unter erbarmungslosen Druck. Seine Weigerung, in die Nazipartei einzutreten, bringt ihn in große Gefahr – und als eine zweite Frau ermordet wird, entdeckt Schenke eine Spur, die bis ins Zentrum der Macht führt. Seine Stunden scheinen gezählt ... »Ein packendes historisches Panorama und ein Ermittler, der in finsteren Zeiten für Gerechtigkeit kämpft!« Anthony Horowitz Der erste Fall für Kriminalinspektor Horst Schenke. Alle Bücher der Reihe: -Verdunkelung -Nachtkommando Krimis mit Tiefgang: Historische Genauigkeit, detailreiche Schauplätze und eine dichte Atmosphäre zeichnen ein präzises Bild Berlins in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg. Anspruchsvolle Kriminalfälle und vielschichtige Figuren: Die Kriminalromane von Simon Scarrow überzeugen durch Raffinesse und Spannung und sprechen Leser an, die Wert auf intelligente Unterhaltung legen. Fesselnder historischer Roman: Das perfekte Geschenk für Männer, die neben Spannung auch historische und gesellschaftliche Hintergründe schätzen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Thriller gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Verdunkelung« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
Aus dem Englischen von Kristof Kurz
© Simon Scarrow, 2021
Titel der englischen Originalausgabe: »Blackout« bei Headline Publishing, London 2021
© Piper Verlag GmbH, München 2022
Karte: TimPetersDesign.co.uk
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: zero-media.net, München, nach einem Entwurf von Patrick Insole
Covermotiv: Donald Jean/Arcangel; Shutterstock (Markov Oleksiy; New Africa); Visual Studies Workshop/Getty Images
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Widmung
Berlin
Befehlsstruktur
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
Nachbemerkung zu den Diensträngen von Polizei und SS
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Für meinen Sohn Nick. Du warst und bist mein ganzer Stolz. In Liebe, Dad
Prolog
Berlin, 19. Dezember 1939
Die Weihnachtsfeier hatte gerade angefangen, als Gerda Korzeny und ihr Begleiter um halb acht eintrafen. Der Schnee lag so hoch auf den Straßen, dass sie ihre Stiefel abklopfen mussten, bevor sie die Eingangshalle betraten und dem Dienstmädchen ihre Mäntel und Pelzmützen reichten. Gerda zog die Stiefel aus und stellte sie neben die Tür, dann nahm sie ein Paar Abendschuhe mit Barockabsatz aus einer mitgebrachten Tasche und schlüpfte hinein. Sie betrachtete sich in einem Wandspiegel, strich ihr Abendkleid glatt und richtete mit den Fingerspitzen vorsichtig ihr brünettes Haar. Als sie bemerkte, dass ihr Begleiter hinter ihr schmunzelte, zog sie einen Schmollmund.
»Schon besser«, sagte sie. »Jetzt fühle ich mich wieder wie ein richtiger Mensch.«
Er nahm sie grinsend am Arm und stellte sich neben sie. In der akkurat gebügelten Uniform mit den glänzenden schwarzen Stiefeln gab er eine beeindruckende Figur ab.
»Was für ein hübsches Paar«, sagte er und kratzte sich mit einem behandschuhten Finger das Kinn. »Zu schade, dass wir nicht verheiratet sind. Jedenfalls nicht miteinander.« Sein Lächeln verblasste. Dann führte er sie in den großen Saal. Wenigstens die Hälfte der Gäste war bereits eingetroffen. Über einhundert Mitglieder der vornehmsten Kreise Berlins standen in Trauben unter dem funkelnden Kronleuchter, der den riesigen Saal mit seinem Licht erfüllte. Kellner in weißen Jacketts und beschürzte Kellnerinnen trugen Tabletts mit Champagnergläsern von Gruppe zu Gruppe.
Gespräche und Gelächter hallten von den hohen Wänden wider. Gerda sah sich in der Menge nach vertrauten Gesichtern um. Sie entdeckte einige ehemalige Kollegen aus ihrer Zeit als UFA-Star, darunter auch Emil Jannings, den beleibten Schauspieler mit hoher Stirn, der gerade wiehernd lachte, sowie mehrere Regisseure, Produzenten, Drehbuchschreiber und Komponisten. Leider waren viele von denen, die sie näher gekannt hatte, schon längst emigriert. Die meisten nach Hollywood, einige in europäische Länder, in denen sie nicht befürchten mussten, wegen ihrer politischen Einstellung oder Religionszugehörigkeit von der dortigen Regierung schikaniert zu werden.
Zu den Gästen zählten neben den Filmschaffenden auch Künstler und Schriftsteller, bekannte Sportler und ihre vermögenden Gönner wie beispielsweise der rennsportbegeisterte Graf Harstein, der früher ein leidenschaftlicher Anhänger der Silberpfeile gewesen war und den Rennstall finanziell unterstützt hatte. Dazwischen waren zahlreiche Uniformen von Heer, Marine und Luftwaffe sowie der Partei zu sehen. Ein Vertreter der letzteren Gruppe – ein SS-Offizier – bedachte Gerda mit einem kühlen Blick.
Sie drehte sich zu ihrem Begleiter um. »Mein Gott, dieser schmierige Fegelein ist auch hier. Tu mir einen Gefallen, und halt ihn mir vom Leibe.«
»Weshalb?«
»Weil er ein widerlicher Heuchler ist, mein lieber Oberst Karl Dorner. Er bringt es fertig, mich für meine Affäre zurechtzuweisen und im selben Atemzug zu versuchen, mich zu verführen. Bitte sei so nett, und sorge dafür, dass er mich heute Abend nicht belästigt.«
»Und wie soll ich das anstellen?«
»Wenn er mir unverschämt kommt, gebietet dir der Anstand, ihn in seine Schranken zu verweisen.«
»Ich weiß nicht, ob es besonders klug für einen Armeeoffizier wäre, sich mit einem Vertrauten Himmlers zu prügeln.«
»Es wäre doch vielmehr so, dass ein Kavalier einem impertinenten Emporkömmling eine Lektion erteilte.«
»Früher wäre ich deiner Bitte mit Freuden nachgekommen«, sagte Dorner. »Doch inzwischen beherrschen die Emporkömmlinge dieses Land und lassen keine Gelegenheit aus, alle anderen ständig an diese Tatsache zu erinnern. Aber ich werde ihn beschäftigen, so gut ich kann.«
Gerda lächelte. »Nur eine Stunde, dann können wir von mir aus wieder gehen. Ein Bekannter hat mir den Schlüssel zu seiner Wohnung überlassen. Er kommt vor Neujahr nicht nach Berlin zurück, wir haben also den Rest der Nacht ganz für uns.«
Der Offizier nahm lächelnd ihre Hand und küsste sie. »Ich kann es kaum erwarten.« Sie zitterte unter seiner Berührung.
»Wärst du denn nicht gerne jede Nacht mit mir zusammen, mein Schatz?«, fragte sie so leise, dass nur er es hören konnte. »Haben wir dieses Glück nicht verdient?«
Er seufzte. »Darüber haben wir doch schon gesprochen. Du weißt doch, dass ich es mir noch nicht leisten kann, mich von meiner Frau scheiden zu lassen. Und wenn du diesen Trottel, mit dem du verheiratet bist, jetzt verlässt, wirst du keinen roten Heller von ihm bekommen. Wovon sollen wir dann leben?«
Sie sah ihm in die Augen. »Aber wir haben uns. Reicht dir das denn nicht?«
»Nein, das reicht mir nicht. Und dir erst recht nicht. Nicht bei deinen Ansprüchen. Warum belassen wir nicht alles so, wie es ist, und erfreuen uns an dem, was wir haben?«
»Aber ich will mehr als nur den gelegentlichen gemeinsamen Nachmittag oder Abend. Ich will dich. Für dich bin ich nicht mehr als ein guter Fick. Stimmt doch, oder?«
Er erstarrte, dann lächelte er kalt. »Womöglich noch nicht einmal das. Aber zumindest leicht zu haben.«
»Scheißkerl.« Sie löste sich von ihm. »Glaubst du, dass du der einzige Mann bist, der mich begehrt? Dann pass nur auf.« Sie knipste ein strahlendes Lächeln an und ging auf eine Traube von Filmleuten zu. »Leni!«, rief sie.
Eine Frau im Hosenanzug mit schulterlangen Haaren und maskulinen Gesichtszügen erwiderte das Lächeln und breitete die Arme aus, um sie willkommen zu heißen. Sie gaben sich Küsse auf die Wangen, dann begrüßte Gerda die anderen, die sie kannte, und ließ sich diejenigen vorstellen, die sie nicht kannte.
Dorner beobachtete sie einen Augenblick lang vom Rand des Saales aus, dann ging er zu zwei Offizieren hinüber, die vor der breiten Treppe standen, die zur Galerie über dem großen Saal führte.
Er nickte den beiden Männern zu. Bei einem handelte es sich um seinen Adjutanten, der ebenso wie Dorner bei der Abwehr – dem militärischen Nachrichtendienst – tätig war. Der andere, General von Tresckow, trug den roten Kragenspiegel des Generalstabs. Obwohl er noch keine vierzig war, lichtete sich das Haar des ansonsten gut aussehenden Mannes bereits.
»Guten Abend, Herr General.« Dorner deutete eine Verbeugung an.
»Freut mich, Sie wiederzusehen, Dorner«, sagte von Tresckow. »Sagen Sie mal – die Dame, mit der Sie hier sind … die kommt mir irgendwie bekannt vor.«
»Gut möglich, Herr General. Sie ist Schauspielerin. Oder war es zumindest. Gerda hat sich vor ein paar Jahren aus dem Filmgeschäft zurückgezogen.«
»Ach, die Gerda! Ich dachte, sie wäre blond.«
»War sie damals auch. Brünett ist ihre Naturhaarfarbe.«
Der General blickte auf die Menschentraube, die sich, wie magnetisch von ihrem Charme angezogen, um Gerda gebildet hatte. »Ein Prachtweib, ganz gleich, ob blond oder brünett. Sie Glücklicher!«
»Ja, ich Glücklicher.« Dorner hob sein Glas, nahm einen Schluck und stellte sich so hin, dass er seinem Vorgesetzten die Sicht auf Gerda versperrte. »Also, Herr General, was hat der Generalstab nach Polen denn für die Westfront geplant?«
Von Tresckow hob den Zeigefinger. »Ich darf selbstverständlich keine Einzelheiten preisgeben, mein Lieber«. Der General lachte. »Sagen wir nur so viel: Wenn die Zeit reif ist, werden unsere französischen und britischen Freunde eine gehörige Überraschung erleben …«
Der General setzte zu einem Loblied auf die Überlegenheit der deutschen Waffentechnik und Militärtaktik an, doch Dorner konnte sich kaum darauf konzentrieren. Immer wieder kehrten seine Gedanken zu Gerda zurück. Dass er stets in ihr warmes Bett schlüpfen konnte, wenn es seine Bedürfnisse verlangten, war ihm nicht genug. Er war ein eifersüchtiger Mann und konnte die Vorstellung, sie mit einem anderen zu teilen, nicht ertragen. Sie waren zwar beide verheiratet, doch sie hatte ihm versichert, dass sie nicht länger mit ihrem Mann – einem Anwalt und hochrangigen Nazi – schlief. Dorner selbst hatte in jungen Jahren eine Bauerntochter geheiratet, deren Familie große Ländereien im Harz besaß. Bedauerlicherweise war sie eine sterbenslangweilige Person – ganz besonders im Vergleich mit einem ehemaligen Filmstar wie Gerda. Und so stand er vor dem Dilemma, sich zwischen den Annehmlichkeiten, die der Reichtum seiner Frau mit sich brachte, und Gerdas Weltgewandtheit entscheiden zu müssen. Und dabei wollte er doch beides.
Weitere Gäste trafen ein, und es wurde immer voller, sodass er bald Schwierigkeiten hatte, sich über den Gesprächslärm hinweg verständlich zu machen. Aus einem Grammofon auf der Galerie tönte das muntere Lied einer vorerst von der Partei tolerierten Künstlerin, die früher Chansons gesungen hatte. Endlich hatte der General seinen Vortrag beendet und ging los, um sich noch etwas zu trinken zu holen.
Dorners Adjutant verdrehte die Augen. »Ich dachte schon, der hört nie auf. Der Mann hat keine Ahnung vom Sinn und Zweck gesellschaftlicher Zusammenkünfte. Wer hat ihn überhaupt eingeladen?«
»Keine Ahnung, Schumacher. Aber ich habe nicht vor, mich noch länger von ihm langweilen zu lassen. Entschuldigen Sie mich bei ihm, wenn er zurückkommt? Ich muss jemanden sprechen.«
»Ihre Freundin Gerda etwa? An Ihrer Stelle würde ich damit nicht zu lange warten.«
Schumacher deutete mit dem Kinn an seinem Vorgesetzten vorbei.
Dorner drehte sich um. Sein Blick fiel auf das gegenüberliegende Ende des Saales, wo mehrere Paare zur Musik tanzten. Auch Gerda war darunter. Sie hatte die Arme um einen schlanken, jungen Mann im Samtjackett geschlungen. Ihre Körper schmiegten sich aneinander. Sie sah Dorner über die Schulter ihres Tanzpartners hinweg an und gab diesem einen Kuss auf den Hals. Er zog sie noch näher an sich, und seine Hand glitt von ihrer Schulter zur Hüfte hinunter.
»Diese verdammte …«, knurrte Dorner, drückte dem Adjutanten das Glas in die Hand und bahnte sich einen Weg durch die Menge auf sie zu. Wütend zerrte er sie aus dem Griff des Mannes, packte Gerda bei den Armen und beugte sich vor, um ihr etwas ins Ohr zu flüstern. Ihr Tanzpartner stand unschlüssig in zwei Schritten Entfernung da. Als sich das Paar weiter stritt, ohne ihn zu beachten, kehrte er zu den anderen Gästen aus der Filmbranche zurück, die inzwischen eine größere Gruppe bildeten. Einen Augenblick später riss sich Gerda von Dorner los und marschierte zum Ausgang. Dorner sah ihr hinterher, dann folgte er ihr.
Zur gleichen Zeit erschien von Tresckow mit einer Champagnerflasche in der einen und einem Glas in der anderen Hand am Fuße der Treppe. »Oh, wo ist Dorner denn hin? Ich war ja noch gar nicht fertig.«
»Ich glaube, er ist bereits im Aufbruch begriffen, Herr General.« Schumacher deutete mit seinem Glas in Richtung Eingangsbereich. Die beiden Männer beobachteten Gerda dabei, wie sie in ihren Mantel schlüpfte und die Stiefel wieder anzog. Dorner redete dabei mit ernster Miene auf sie ein. Er wollte ihre Hand nehmen, doch sie schüttelte ihn ab und ging zur Tür. Dorner ballte die Hände zu Fäusten, ließ sich Mantel und Hut geben und lief ihr hinterher. Ein Lakai schloss die Tür hinter ihnen.
»Was hatte das denn zu bedeuten?«, fragte von Tresckow.
»Das weiß ich auch nicht so genau, Herr General.« Schumacher hob sein Glas und trank. »Sieht aber ganz so aus, als ob es heute Nacht noch Ärger gibt …«
Sobald sie Dorner aus dem Gebäude stürmen sah, beschleunigte Gerda ihre Schritte. Die Stiefel knirschten auf dem dünnen Neuschnee, der mittlerweile gefallen war. Jetzt war der Himmel klar, und die Sterne leuchteten kalt vor der samtigen Schwärze.
»Warte!«, rief er. »Wo willst du denn hin? Gerda!«
Sie hörte seine schnellen Schritte hinter sich. Als sie das Ende der Straße erreichte, hatte er sie eingeholt, ergriff ihren Arm und drehte sie zu sich herum. Er sah sie wütend an, den Mund zu einer dünnen Linie zusammengepresst. »Wie kannst du es wagen, mich so zu demütigen?«, zischte er mit leiser, zornerfüllter Stimme.
Sie roch den Weinbrand in seinem Atem. »Wie ich es wagen kann?« Sie lachte bitter. »Für wen zum Teufel hältst du dich? Ich habe dir mein Herz zu Füßen gelegt. Dir angeboten, alles für dich aufzugeben, weil ich dachte, dass du dasselbe empfindest.«
»Ich habe dir überhaupt nichts versprochen. Niemals.«
Sie sah ihn an und schüttelte traurig den Kopf. »Karl, wie die meisten Männer, deren Bekanntschaft ich gemacht habe, bist du nichts weiter als ein Lügner und ein Ehebrecher. Du hast mich verführt und mich Pläne für eine Zukunft schmieden lassen, die du nie mit mir teilen wolltest. Ich verachte dich.«
Er schlug so schnell zu, dass sie völlig überrumpelt war. Sein Handrücken knallte so heftig gegen ihre Wange, dass ihr Kopf zurückflog. Weiße Sterne tanzten Gerda vor den Augen. Sie taumelte und schmeckte Blut.
»Du Arschloch …«
Dorner erstarrte, offenbar erschüttert darüber, dass er die Beherrschung verloren hatte. Er verzog das Gesicht und schüttelte den Kopf. »Gerda … vergib mir.«
»Bleib mir vom Leib!«, rief sie und trat ein paar Schritte zurück. Dann zeigte sie auf ihn. »Es ist vorbei. Mit uns beiden ist es zu Ende, hörst du?«
»Aber nein, mein Schatz. Nichts ist vorbei.« Er ging mit einem gequälten Lächeln auf sie zu und breitete die Arme aus. »Es tut mir so leid. Bitte verzeih mir.«
»Niemals! Wenn du noch näher kommst, schreie ich um Hilfe. Das ist mein Ernst. Die Leute sollen ruhig wissen, dass du mich angegriffen hast. Dass du mich belästigt hast.«
Er hielt erschrocken inne. »Das wagst du nicht.«
»Willst du es darauf ankommen lassen?«, erwiderte sie trotzig. »Dann wird ganz Berlin erfahren, was für einer du wirklich bist.«
»Lass das doch. Bitte.«
Gerda sah ihn voller Verachtung an, trat noch ein paar Schritte zurück, drehte sich um und rauschte in Richtung der U-Bahn-Haltestelle Papestraße davon. Jetzt konnte sie auf direktem Weg nach Hause fahren, ohne auf Dorners Pläne Rücksicht nehmen zu müssen. Ihr Herz raste, ihre eine Wange brannte. Wenn von dem Schlag ein Bluterguss zurückblieb, musste sie sich eine Erklärung für ihren Mann ausdenken, bevor sie nach Hause kam. Immerhin war es sein Vorrecht, ihr blaue Flecken zu verpassen, dachte sie bitter. Und davon machte er auch des Öfteren Gebrauch.
Sie hörte ihren Liebhaber nicht länger hinter sich. Keine verzweifelten Bitten mehr, doch stehen zu bleiben und sich das Ganze noch einmal zu überlegen. Mit jedem Schritt wuchs ihre Wut darüber, dass Dorner nicht Manns genug war, um sie zu kämpfen. Noch während ihres Streits hatte sie die vage Hoffnung gehegt, er werde versuchen, sie umzustimmen. In Wahrheit wollte sie mit ihm zusammen sein, mit niemandem außer ihm. Aber nur, wenn er das auch wollte. Deshalb hatte sie versucht, ihn auf der Feier eifersüchtig zu machen.
Gerda folgte der breiten Straße zur Haltestelle. Die Nacht war bitterkalt, und nur wenige Passanten waren unterwegs; dunkle, tief in ihren Mänteln eingemummte Gestalten, die sich deutlich vor dem grauen Schimmer von Schnee und Eis abzeichneten. Als sie die Haltestelle erreichte, sah sie rotes Zigarettenglimmen im Schatten eines Bogengangs, der in eine Einkaufspassage führte. Instinktiv machte sie einen weiten Bogen um den Raucher.
»Wie viel?«, fragte eine heisere Stimme.
Sie ignorierte den Mann geflissentlich und ging schneller. Bis zur Haltestelle waren es noch beinahe hundert Meter. Mit wachsender Panik bemerkte sie, dass weit und breit niemand zu sehen war, und verfluchte Dorner, weil er ihr nicht gefolgt war.
Dann hörte sie hinter sich ein leises Husten, warf einen Blick über die Schulter und sah das schwache Glühen der Zigarettenspitze. Der Mann hatte den Bogengang verlassen und folgte ihr. Sie ging noch schneller, doch er holte auf. Voller Angst rannte sie los. Am Eingang des Bahnhofs sah Gerda einen Uniformierten.
»He!«, rief sie und wedelte mit dem Arm. »Sie da!«
Der Uniformierte kam ihr über die Straße hinweg entgegen. Es war ein Schaffner. »Was gibt’s denn, gute Frau?«
»Der Mann da.« Sie deutete hinter sich, doch es war niemand mehr zu sehen. Selbst die verräterische Zigarettenglut war verschwunden.
»Welcher Mann?«
»Gerade eben war er noch hier. Er ist mir gefolgt.«
»Ich sehe niemanden.« Der Schaffner starrte sie an. »Sind Sie sich sicher, dass Sie ihn wirklich gesehen haben?«, fragte er.
»Ich …« Gerda holte tief Luft. »Ach, egal. Nicht so wichtig.«
»Machen Sie sich keine Gedanken, gute Frau.« Er kicherte. »In so einer finsteren Nacht wie heute sehen viele Leute Gespenster. Das kenne ich.«
»Ich habe mir den Mann nicht eingebildet«, empörte sie sich. »Wenn Sie gestatten.« Sie rauschte an ihm vorbei zur Haltestelle, betrat den Bahnsteig für die Züge Richtung Anhalter Bahnhof und ging in den Wartesaal. Der Raum war angenehm warm, im gusseisernen Ofen lagen glimmende Kohlen. Außer ihr befanden sich nur ein dicker Mann in Arbeitskleidung und eine dürre, verhärmte Frau im Wartesaal. Seine Gattin, vermutete sie und nickte den beiden stumm zu. Gerda warf alle paar Sekunden einen Blick auf den Bahnsteig, aber von dem Mann, der ihr gefolgt war, war nichts mehr zu sehen.
Zehn Minuten später fuhr der Zug ein, und sie verließen den Wartesaal. Das Ehepaar stieg in den vorletzten Waggon, Gerda selbst setzte sich mit dem Rücken zur Tür in den letzten. Mehrere Türen wurden geschlossen, ein Pfiff ertönte, und der Zug fuhr ruckartig an. Während sie den Bahnhof verließen und durch die nächtlichen, verdunkelten Vororte ratterten, machte es sich Gerda auf ihrem Sitz bequem, schob die Jalousien vor dem Fenster beiseite und spähte durch den Spalt in die Finsternis. Sie war immer noch wütend auf Dorner und schwor sich, ihn entweder zurückzugewinnen oder sich für ihren verletzten Stolz zu rächen.
1. Kapitel
20. Dezember 1939
Der Mann und die Frau, beide etwa Ende vierzig, saßen auf Stühlen vor dem Ofen im Wohnzimmer. Sie waren seit mehreren Tagen tot. Der matte Perlenglanz ihrer blassen Gesichter erinnerte an Marmor. Beide trugen lediglich schmutzige Unterwäsche, die übrige Kleidung lag um die einfachen Holzstühle herum verstreut. Im Ofen befand sich nur noch Asche, das Gusseisen war eiskalt. Als der erste Polizeibeamte vor Ort die Tür der Wohnung eingetreten hatte, war es dort bereits eiskalt gewesen. Und als man dann vermutete, dass sich giftiges Gas im Raum befinden könnte, hatte man hastig das Fenster aufgerissen, wodurch es in der kleinen Wohnung noch kälter geworden war.
Wachtmeister Kittel stand neben dem Ofen. Er fror, obwohl er den Mantel zugeknöpft hatte und Handschuhe sowie einen Schal trug, und versuchte, sich zu wärmen, indem er mit den Stiefeln auf der Stelle stapfte. Ungeduldig sah er alle paar Minuten auf seine Taschenuhr. Von der Straße drang durch die dicke Schneedecke gedämpfter Verkehrslärm zu ihm herauf. Kittel hörte das Ticken einer Uhr auf einem schmalen Regalbrett neben dem Ofen sowie die Gespräche der anderen Mieter, die sich im Treppenhaus und auf dem Absatz vor der Wohnung versammelt hatten. Er seufzte so tief, dass eine Atemwolke vor seinem Mund erschien, dann kehrte er in den engen Flur zurück. Das Türschloss war aus dem splittrigen Holz gebrochen. Zwei Polizisten standen vor der Wohnung. Dahinter waren die neugierigen Gesichter mehrerer Schaulustiger zu erkennen.
»Denicke! Schaffen Sie mir diese verdammten Gaffer vom Hals. Hier gibt es nichts zu sehen.« Er wollte sich wieder umdrehen, hielt aber inne. »Nein, Augenblick. Die Pförtnerin bleibt hier. Und die anderen sollen gefälligst nach Hause gehen und sich aufwärmen.«
Der eine Polizist nickte. »Haben Sie schon was von der Kripo gehört?«, fragte sein Vorgesetzter ihn, noch bevor er die Nachbarn wegschicken konnte.
»Nein, Herr Wachtmeister.«
»Hm«, knurrte Kittel mürrisch und wandte sich dem anderen Polizeibeamten zu. »Gehen Sie nach unten, und halten Sie nach dem Inspektor Ausschau. Sobald er hier ist, bringen Sie ihn sofort nach oben, bevor wir alle uns hier noch den Tod holen.«
Denicke zog den Schlagstock und trieb die kleine Menge zurück. Sein Kollege drängte sich durch die Menschen auf dem Treppenabsatz und ging die vier Stockwerke bis zum Erdgeschoss hinunter. Kittel sah sich mit so bedrohlicher Miene auf dem Absatz um, dass die Schaulustigen sich eilig umdrehten und in ihre Wohnungen zurückkehrten. Keiner wagte es, stehen zu bleiben, geschweige denn Kittel in die Augen zu sehen. Sie hatten gehörig Bammel vor der Obrigkeit, wie er zu seiner Befriedigung feststellte. Dieser Krieg war nur mit einem Staat zu gewinnen, dessen Macht unangefochten war.
Im Gegensatz zum letzten Mal, sinnierte der Wachtmeister. Er hatte die letzten Jahre des Großen Krieges in der Armee gedient. Als er nach Berlin zurückgekehrt war, hatte dort politisches Chaos geherrscht. Die Roten hatten auf den Straßen die Revolution gefordert, doch die Frontheimkehrer hatten diesem Unsinn schnell ein Ende bereitet. Kittel war Mitglied eines jener Freikorps gewesen, die die Kommunisten mit Kugeln und Fäusten zur Räson gebracht und die Ordnung in der Hauptstadt wiederhergestellt hatten. Diesmal würde es keine Revolution geben – immerhin war dieser Krieg so gut wie vorüber. Polen war zerschlagen, und es war nur eine Frage der Zeit, bis Frankreich und England die Sinnlosigkeit eines Konflikts erkennen würden, dessen Ursache nicht mehr existierte: Polen war von der Landkarte verschwunden, aufgeteilt zwischen Deutschland und seinem russischen Vertragspartner. Sollten sich die Franzosen und Engländer dennoch zum Weiterkämpfen entscheiden, war der Sieg des Vaterlands hingegen alles andere als gewiss.
Kittel zuckte schicksalsergeben mit den Schultern und rieb sich die Hände. Zu welchem Ergebnis die europäischen Machthaber auch kamen: Momentan befand sich Deutschland im Krieg, und es war die Pflicht eines jeden Staatsbediensteten, die Disziplin aufrechtzuerhalten.
Er kehrte ins Wohnzimmer zurück und sah sich in der bescheidenen, für die armen Arbeiterfamilien Pankows so typischen Behausung um. Eine winzige Küche, ein Bad mit Toilette und kleiner Blechwanne. Das Schlafzimmer war gerade groß genug für die beiden ordentlich gemachten Betten. Auf dem Regal neben der Uhr befand sich eine Fotografie im Silberrahmen, auf der das sitzende Ehepaar und zwei hinter ihm stehende junge Männer in Uniform zu sehen waren. Alle vier trugen, wie für solche Familienporträts üblich, einen feierlich-ernsten Gesichtsausdruck zur Schau.
Einen Augenblick lang wurde dem Wachtmeister das Herz schwer, als er an die beiden Soldaten dachte, die bald ein Telegramm mit der traurigen Nachricht erhalten würden. Sie überlebten Kugeln, Schrapnelle und Bomben, während ihre Eltern in der eigenen Wohnung gestorben waren – diese Zeiten entbehrten nicht einer gewissen Ironie.
Neben dem allgegenwärtigen Porträt des Führers mit in die Hüfte gestemmter Hand und unergründlichem, starrem Blick hing nur noch eine weitere gerahmte Fotografie in der Wohnung. Sie zeigte eine einfache Blockhütte vor schneebedeckten Bergen.
Kittel hörte, wie ein Auto vorfuhr. Er ging zum geöffneten Fenster und blickte auf Dach und Motorhaube eines der schwarzen, für Offiziere reservierten Wagen aus dem Polizeifuhrpark hinunter. Die Beifahrertür ging auf, und ein Mann in dunkelgrauem Mantel und mit schwarzem Filzhut stieg aus und trat auf den inzwischen von Gaffern geräumten Bürgersteig. Er beugte sich vor und wechselte ein paar Worte mit dem Fahrer, dann hob er den Kopf. Ihre Blicke trafen sich, und Kittel sah direkt in ein schmales Gesicht. Dann näherte sich der vor der Tür postierte Beamte, woraufhin der Neuankömmling den Kopf wieder senkte, um den Hitlergruß zu erwidern, und sich zum Hauseingang führen ließ. Beide Männer verschwanden aus Kittels Blickfeld.
Der Kriminalinspektor brauchte für die vier Stockwerke länger als gedacht. Als er auf den Treppenabsatz trat, bemerkte Kittel, dass er leicht humpelte und schwer atmete. Wie die anderen Beamten trug auch er einen dicken Mantel, einen Schal, den Hut und Handschuhe. Ohne große Vorrede zeigte er die Dienstmarke vor, die an einer Kette um seinen Hals hing. Auf der einen Seite war ein von einem Kranz aus Eichenlaub umgebener Adler über einem Hakenkreuz abgebildet, auf der anderen war unter dem Wort »KRIMINALPOLIZEI« die Dienstnummer eingraviert.
»Kriminalinspektor Schenke, Bezirk Pankow«, sagte der Mann und nickte knapp. Der Wachtmeister erwiderte den Gruß und musterte den Neuankömmling. Der Inspektor hatte breite Schultern, war ansonsten jedoch eher schlank, soweit es unter dem Mantel zu erkennen war. Allein aufgrund des schmalen Gesichts war sein Alter unmöglich genauer als irgendwo zwischen Mitte zwanzig bis etwa vierzig einzuschätzen.
»Wachtmeister Kittel, Dienststelle Heinersdorf.«
»Hätten Sie sich nicht einen wärmeren Tag aussuchen können?« Schenke lächelte dünn, um Kittel zu verstehen zu geben, dass er durchaus Sinn für Humor hatte. »Aber darauf kann man bei diesem Wetter ja vergeblich hoffen.«
Der Winter war ungewöhnlich heftig über Berlin hereingebrochen. Vor einer Woche hatte die Temperatur den Gefrierpunkt erreicht und fiel seither ständig, und darüber hinaus hatte ein schwerer Sturm zwanzig Zentimeter Schnee auf die Straßen geweht. In den Zeitungen war bereits von einem der härtesten Winter seit Jahrzehnten die Rede. Die Kälte wäre unter normalen Umständen schon schlimm genug, dachte Schenke, stellte jedoch bei der kriegsbedingten Lebensmittelrationierung, Kohleknappheit und der nach Sonnenuntergang gültigen Verdunkelungsverordnung ein nicht zu unterschätzendes Problem dar.
Vom späten Nachmittag bis zum folgenden Sonnenaufgang herrschte absolute Finsternis auf den Straßen Berlins. Die Menschen mussten sich ihren Weg buchstäblich ertasten. Ein nicht nur unangenehmer, sondern mitunter sogar lebensgefährlicher Zustand, da man ständig Gefahr lief, von einem Fahrzeug erfasst zu werden, über den Randstein zu stolpern oder eine Treppe hinunterzufallen. Andere dagegen profitierten vom Schutz der Dunkelheit. Die Prostituierten beispielsweise hatten es bedeutend einfacher, der Aufmerksamkeit und damit den Schikanen von Polizei und Hitlerjugend zu entgehen. Die finstere Nacht begünstigte aber auch weitaus schlimmere Aktivitäten. Seit Beginn des Krieges vor vier Monaten war die Anzahl der Raubüberfälle, Morde und allgemeinen Gewaltdelikte merklich gestiegen. Nacht für Nacht verwandelte sich Berlin in einen dunklen, gefährlichen Ort, und wer sich auf die Straße traute, lebte in ständiger Angst davor, an der nächsten Ecke oder vor dem nächsten dunklen Hauseingang überfallen zu werden.
»Also, worum geht’s? Ich weiß nur, dass hier mehrere Leichen gefunden wurden.«
»Es sind zwei, Herr Inspektor. Rudolf und Maria Oberg. Bitte hier entlang.« Kittel machte Platz, damit Schenke ins Wohnzimmer treten konnte. Die beiden Männer stellten sich neben den Ofen und betrachteten die Leichen. Schenke musterte erst die eine, dann die andere und schließlich die Kleidung auf dem Boden und den Rest des kleinen Wohnzimmers.
»Was wissen wir bisher?«
Der Wachtmeister nahm sein Notizbuch heraus. Er hatte Mühe, es mit den behandschuhten Fingern zu öffnen. »Gestern machte ein Nachbar, der außerdem in derselben Schicht wie Oberg bei Siemens arbeitet, auf dem Revier Meldung, dass sein Kollege seit letzter Woche nicht mehr zur Arbeit erschienen sei. Übrigens ist dieser Nachbar der Ehemann der Pförtnerin. Ich habe ihr gesagt, dass sie draußen warten soll. Sie hat gestern hier geklopft, und als sie keine Antwort erhielt, hat sie ihren Mann zu uns geschickt. Und der Chef hat uns dann befohlen, mal nach dem Rechten zu sehen. Es war abgeschlossen, und da auf unser Klopfen niemand geantwortet hat, habe ich Befehl gegeben, die Tür einzutreten. Wir haben die Obergs so vorgefunden, auf ihren Stühlen.«
Schenke beugte sich vor, um die Leichen genauer in Augenschein zu nehmen. »Und dann haben Sie die Kripo gerufen? Weshalb?«
Kittel hob eine Augenbraue und deutete auf die auf dem Boden verstreuten Kleidungsstücke. »Also wenn das keine verdächtigen Umstände sind, Herr Inspektor, dann weiß ich auch nicht. Wer zieht sich denn bei diesen Temperaturen bis auf die Unterwäsche aus?«
»Schon gut. War das Fenster geöffnet, als Sie den Raum betreten haben?«
»Nein. Es war angelehnt und im Rahmen festgefroren. Ich musste fest dagegendrücken, um es aufzubekommen. Zuerst dachte ich, dass den beiden vielleicht Rauch oder irgendwelche giftigen Dämpfe aus dem Ofen zum Verhängnis geworden sind. Seit Winteranfang wurde uns eine ganze Reihe solcher Todesfälle gemeldet.«
Schenke sah ihn prüfend an. »Aber …?«
»Aber ihre Haut ist blass, und man kann Erfrierungen an Fingern und Füßen erkennen, Herr Inspektor. Wenn sie erstickt wären, hätten sie rote Wangen.«
»In der Tat.« Der Inspektor ging zwischen den beiden Stühlen in die Hocke und untersuchte zunächst die Frau. Ihr dunkles Haar war zu einem Dutt gebunden. Sie war auf dem Stuhl in sich zusammengesackt, sodass sich Falten unter ihrem Kinn gebildet hatten. Ihre Augen waren geschlossen, was ihr einen friedlichen Eindruck verlieh. Fast so, als würde sie schlafen. Ihr Mann dagegen saß kerzengerade da. Seine dünnen Arme waren eng um die nackten Knie geschlungen, sein Gesicht – zurückgezogene Lippen, zusammengekniffene Augen – war zu einer Grimasse verzerrt. Um seinen Schädel zog sich ein grauer Haarkranz. Auf seinem Hinterkopf konnte man eine Schnittwunde und eine getrocknete Blutspur sehen.
»Erstickt sind sie also nicht. Was ist Ihrer Meinung nach dann hier passiert, Kittel?«
Kittel trat unbehaglich von einem Fuß auf den anderen.
Schenke bemerkte, dass er ihn in Verlegenheit gebracht hatte. Das war nicht seine Absicht gewesen – andererseits gehörte es zu den Pflichten eines Polizisten, alle Eventualitäten in Erwägung zu ziehen, und seien sie auch noch so heikel. »Raus mit der Sprache, Mann.«
»Vielleicht war es ein Einbruch. In Berlin gibt es ja immer noch ein paar Zigeuner. Und Sie wissen ja, wie die sind. Ungeziefer. Im alten Siemens-Güterbahnhof hat sich eine Bande eingenistet. Wir haben ständig Ärger mit diesem diebischen Abschaum. Seit der Verdunkelungsverordnung gibt es jede Menge Einbrüche und Raubüberfälle, Herr Inspektor.«
»Wohl wahr«, sagte Schenke. Heydrich persönlich hatte der Kriminalpolizei die Anweisung erteilt, bei der Aufklärung dieser Einbruchsserie zu helfen. Der Chef des neu gebildeten Reichssicherheitshauptamts wollte dem Volk unbedingt beweisen, dass das Regime in der Lage war, Recht und Ordnung effizient und schonungslos durchzusetzen. »Sie glauben also, dass die Einbrecher das Paar ermordet und so drapiert haben. Und weshalb mussten die Opfer Ihrer Meinung nach die Kleidung ablegen?«
»Das auszusprechen ist mir unangenehm, Herr Inspektor.«
»Wirklich? Nun, wenn unsere Einbrecher nicht nur das wenige erbeuten wollten, was sich in dieser Wohnung von Wert befindet, sondern noch abseitigere Motive gehabt hatten, würde man doch erwarten, die Frau ohne Kleidung vorzufinden, nicht wahr? Aber nicht auch noch den Mann.«
Kittel nickte.
Der Inspektor nahm seinen Hut ab und strich sich das dünne, braune Haar glatt. Jetzt konnte Kittel sein Alter etwas besser einschätzen – etwa Anfang dreißig? Sein Haar war nicht kurz geschoren wie bei den Angehörigen von Armee oder SS, sondern ordentlich in normaler Länge geschnitten. Schenke hatte eine breite Stirn, wodurch seine dunklen Augen tiefer in den Höhlen zu liegen schienen, als es tatsächlich der Fall war. Eine schmale Nase führte zu dem leicht mürrisch verzogenen Mund. Der Inspektor setzte sich den Hut wieder auf und deutete auf die Toten. »Bei einem Lustverbrechen ist nicht immer nur die Frau das Opfer, Herr Wachtmeister. Wir dürfen nichts ausschließen.«
»Wenn Sie das sagen, Herr Inspektor.«
Schenke verschränkte die Arme und dachte einen Augenblick lang nach. »Wir haben zwei Leichen in Unterwäsche, der Mann hat eine Kopfwunde.«
»Die er sich höchstwahrscheinlich bei einer tätlichen Auseinandersetzung mit den Zigeunern zugezogen hat. Oder wer auch immer hier eingebrochen ist.«
»Gut möglich«, pflichtete Schenke ihm bei. »Obwohl die Verletzung wohl kaum tödlich war. Wahrscheinlich hat sie ihn noch nicht einmal außer Gefecht gesetzt. Die Kopfhaut ist aufgerissen, aber es sind kaum Blutergüsse zu erkennen. Sehen Sie?« Er betrachtete die Wunde eingehend, dann sah er sich um und deutete auf den Boden unter dem Regal mit der Uhr und dem silbergerahmten Familienporträt. »Hier sind ein paar Blutstropfen.«
Er ging näher heran, untersuchte die abgewetzte Ecke des Regalbretts und bemerkte einen dunklen Fleck. Schenke hob ein Hemd vom Boden auf und rieb über das Holz. Der Stoff war dunkelrot verfärbt. »Auch hier ist Blut.« Er richtete sich wieder auf. »Mal sehen, ob die Pförtnerin etwas Erhellendes beizutragen hat. Führen Sie sie herein.«
»Aber Herr Inspektor …« Kittel zögerte. »Dann sieht die Frau ja den Tatort.«
»Noch wissen wir nicht, ob es überhaupt ein Tatort ist. Das könnte sich erst durch die Aussage der Pförtnerin entscheiden.«
Während Kittel den Raum verließ, ging der Inspektor zum Fenster und betrachtete den Riegel. Er war alt und abgenutzt, die zugehörige Öse hing locker im Rahmen. Schenke schaffte es erst beim dritten Versuch, das Fenster zu schließen. Dann starrte er durch das verschmierte Glas in den grauen Himmel, in den schwarze Rauchsäulen aus den Schornsteinen derjenigen aufstiegen, die noch Kohlevorräte hatten. Die Dächer und Straßen unter dem Dunst waren von einer dicken Schneeschicht bedeckt. Ein Anblick, der ihm Freude bereitet hätte, wären da nicht der Krieg und die beiden Leichen im Zimmer hinter ihm gewesen.
»Frau Glück, Herr Inspektor.«
Schenke entfernte sich vom Fenster, sodass das Tageslicht auf die beiden Toten fiel. Die schon etwas ältere Frau schlug eine Hand vor den Mund. »Himmel hilf!«
Schenke beobachtete ihre Reaktion genau und kam zu dem Schluss, dass ihr Entsetzen nicht gespielt war. Er stellte sich hinter den Leichnam des Mannes. »Für manche kommt wohl sogar diese Hilfe zu spät …«, sagte er. »Sie sind die Pförtnerin dieses Wohnhauses?«
Die Frau konnte den Blick aus ihren schreckgeweiteten Augen nicht von den Leichen lösen. Sie zitterte, und der Inspektor vermochte nicht zu sagen, ob es an der Kälte oder am Schock lag. Vermutlich beides, dachte er.
»Frau Glück?« Er hob leicht die Stimme. Die Frau riss sich vom Anblick der Toten los und nickte. »Wie gut kannten Sie die Obergs? Waren Sie mit ihnen befreundet? Oder haben Sie sich nur im Treppenhaus gegrüßt?«
Sie schluckte. »Wir haben hin und wieder miteinander geplaudert. Ich beobachte selbstverständlich sehr genau, wer hier ein und aus geht. Mein Mann ist der Blockwart in der Straße hier. Es ist unsere Aufgabe, die Leute im Auge zu behalten.«
»Natürlich.« Schenke hatte ständig mit rangniedrigen Parteifunktionären zu tun. Sie waren eine nützliche Informationsquelle, aber in der Regel auch sehr neugierig. Und sie neigten dazu, ihre begrenzte Macht zu missbrauchen, um ungeliebte Nachbarn zu drangsalieren. Seine instinktive Abneigung gegen solche Schnüffler rührte wohl nicht zuletzt daher, dass Schenke ständig Probleme mit seinem eigenen Blockwart hatte – einem Ingenieur im öffentlichen Dienst, der erst vor zwei Jahren der Partei beigetreten war und nun versuchte, dieses Versäumnis durch eine besonders fanatische Hingabe an die nationalsozialistische Ideologie auszugleichen. Obwohl Schenke das Blockwartsystem verachtete, musste er doch zugeben, dass es zur Informationsbeschaffung durchaus seine Vorteile hatte. »Ihr Mann und Herr Oberg waren Kollegen?«
»Ja … oder besser gesagt: Herr Oberg hat für meinen Mann gearbeitet.« Sie stellte sich etwas gerader hin. »Mein Mann ist nämlich Schichtführer, müssen Sie wissen. Deshalb ist ihm auch aufgefallen, dass einer seiner Männer gefehlt hat.«
»Und trotzdem hat er sich mehrere Tage Zeit gelassen, bevor er das gemeldet hat. Ein Versäumnis, das möglicherweise zwei Menschenleben gekostet hat.«
Sie öffnete den Mund, um zu protestieren, verstummte aber, als sie in die zornig funkelnden dunklen Augen des Inspektors blickte, und ließ den Kopf hängen. »Mein Mann ist sehr beschäftigt und kann sich nicht um jeden Einzelnen kümmern. Er hat Verpflichtungen.«
»Aber genau das ist doch seine Pflicht als Blockwart.« Schenke atmete langsam ein und wartete, während es der Frau sichtlich immer unbehaglicher zumute wurde. »Na, wollen wir hoffen, dass Herr Glück seine Schutzbefohlenen in Zukunft etwas gründlicher im Auge behält. Hatten die Obergs Streit mit ihren Nachbarn? Oder mit sonst jemandem in der Nachbarschaft? Hat womöglich jemand einen Groll gegen sie gehegt?«
»Nicht dass ich wüsste. Die Obergs blieben mehr oder weniger für sich. Sie sind vor fünfzehn Jahren mit ihren Söhnen hier eingezogen. Das waren so nette Jungen. Immer höflich und zuvorkommend. Die werden sicher am Boden zerstört sein.«
»Ja, das kann ich mir vorstellen.« Schenke verschränkte die Hände hinter dem Rücken. »Das wäre fürs Erste alles. Wir melden uns, wenn wir noch Fragen haben. Ich bedanke mich für Ihre Hilfe, Frau Glück.«
Wachtmeister Kittel wartete, bis ihre Schritte auf der Treppe zu hören waren. »Herr Inspektor, hätten wir nicht noch mehr aus ihr herausbekommen können?«
»Was denn zum Beispiel? Wenn jemand Verdächtiges das Gebäude betreten hätte, hätte sie uns das doch brühwarm erzählt. Ich kenne solche Leute. Wahrscheinlich weiß sie über jeden in der Straße hier Bescheid, so neugierig, wie sie ist. Aber ich bin mir sicher, dass sie uns nicht mehr weiterhelfen kann. Außerdem hat hier kein Verbrechen stattgefunden.«
Kittel hob die buschigen Augenbrauen und deutete auf die Leiche des Mannes. »Aber Herr Inspektor, wenn sie nicht an irgendwelchen Gasen erstickt sind, woran sind sie denn dann gestorben? Sie wurden ermordet, meine ich. Das ist das Werk eines kranken, degenerierten Perversen. Deshalb habe ich auch die Kripo verständigt. Und deshalb sind Sie hier.« Er lächelte höhnisch. »Ihr von der Kriminalpolizei seid doch angeblich solche Schlaumeier. Wenn Sie kein Verbrechen sehen, obwohl Sie die Beweise direkt vor der Nase haben, was für einen Nutzen haben Sie dann überhaupt für die Polizei? Oder für das Reich?«
Schenke zwang sich dazu, ruhig zu bleiben. Die meisten Kriminalbeamten hielten sich nach wie vor für Fachleute, die über der Politik standen – eine Haltung, die vielen ihrer von der Partei und ihrem Führer überzeugten Kollegen sauer aufstieß. Seitdem sie die Macht übernommen hatten, ließen die Nationalsozialisten nichts unversucht, alle Beamten zu entfernen, die der herrschenden Ideologie skeptisch gegenüberstanden. Allerdings verfügten gerade die Kriminalpolizisten über langjährige Erfahrung, weshalb sie nicht so leicht ersetzt werden konnten. Doch aller Sachverstand hatte selbst den ehemaligen Polizeivizepräsidenten Dr. Bernard Weiß nicht retten können. Die Tatsache, dass er Jude war, hatte schwerer gewogen als seine fachliche Brillanz oder seine vielen Erfolge bei der Verbrechensbekämpfung.
Und nun wurde Schenke ganz direkt von einem überzeugten Nationalsozialisten herausgefordert. Von einem Mann, der verächtlich auf jeden Intellektuellen herabschaute und Befriedigung gewann, wenn deren hohe Ideale vom neuen Regime in den Staub getreten wurden. Schenke verzichtete darauf, sich auf eine politische Diskussion einzulassen, und machte stattdessen seinen Dienstrang geltend.
»Herr Wachtmeister, vergessen Sie nicht, wen Sie vor sich haben. Ich bin Ihr Vorgesetzter. Das haben Sie zu respektieren. Ich dulde keine Aufmüpfigkeit. Und ich sage, dass hier kein Verbrechen stattgefunden hat.« Er drehte sich zu den Leichen um. »Sie haben recht mit der Annahme, dass die beiden nicht an giftigen Dämpfen erstickt sind. Ansonsten haben Sie sich in so gut wie jedem Punkt geirrt. Das war kein Einbruch, nichts weist darauf hin, dass die Wohnung nach Wertsachen durchsucht wurde. Das Erste, was ein Dieb mitgenommen hätte, wäre der Fotorahmen gewesen. Nein, nicht den des Führerbilds. Den silbernen neben der Uhr. Es wurden keine Spuren eines gewaltsamen Eindringens festgestellt.«
Kittel schnaubte. »Aber die Kopfverletzung …«
»… rührt von einem Sturz her. Herr Oberg war vor seinem Tod im Delirium. Womöglich ist er hingefallen, als er sich die Kleidung vom Leib gerissen hat.«
»Das ist doch völliger Blödsinn, Herr Inspektor. Wer würde sich bei den Temperaturen denn ausziehen?«
»Jemand, der an Unterkühlung stirbt.« Schenke sah mit mitleidiger Miene von einem Leichnam zum nächsten. »Sie sind erfroren. Hier ist nirgendwo Heizmaterial. Wahrscheinlich war ihnen schon vor Tagen die Kohle ausgegangen. Sehen Sie sich den Fensterriegel hier an. Der ist völlig hinüber. Vermutlich schließt er schon seit geraumer Zeit nicht richtig. Möglich, dass Oberg bereits verwirrt vor Kälte war, als er zum Fenster gegangen ist. Es kann vorkommen, dass einen Erfrierenden ein plötzliches Hitzegefühl überkommt, sodass er sich die Kleidung vom Leib reißt. Was das Ende natürlich nur beschleunigt. Wenn es weiter so kalt bleibt, werden wir noch mehrere solcher Fälle zu Gesicht bekommen.« Er nickte. »Das waren weder Diebe noch Zigeuner, Herr Wachtmeister. Die beiden sind erfroren und fallen demnach nicht in die Zuständigkeit der Kripo. Schreiben Sie Ihren Bericht, und denken Sie das nächste Mal erst nach, bevor Sie uns rufen.« Er nickte Kittel zum Abschied zu.
Der Polizist trat beiseite, um ihn durchzulassen, und hob den Arm. »Heil …«
Doch Schenke war bereits aus dem Zimmer geeilt, um den von der Partei vorgeschriebenen Gruß zu vermeiden, den er schon immer für billig und theatralisch gehalten hatte – wie so vieles im Nationalsozialismus reine Effekthascherei, um die Anhänger zu beeindrucken.
Verärgert ging er die Treppe hinunter. Wenn er wieder an seinem Schreibtisch auf dem Revier saß, würde er insgesamt zwei Stunden auf diese Angelegenheit verschwendet haben – Zeit, die er lieber in die laufende Ermittlung gegen einen Essensmarkenfälscherring investiert hätte. Und alles nur, weil der Wachtmeister nach einem neuen Vorwand suchte, um gegen die in seinem Bezirk verbliebenen Zigeuner vorzugehen.
Er kam an der offen stehenden Tür zur Wohnung der Pförtnerin im Erdgeschoss vorbei. Frau Glück stand an der Schwelle. Er tippte mit zwei Fingern gegen die Hutkrempe und trat auf die helle Straße hinaus.
Obwohl der Himmel bedeckt war, leuchtete der Schnee so hell, dass Schenke die Augen zusammenkneifen musste. Der Fahrer hatte den Motor laufen lassen, obwohl dies gegen die Treibstoffsparverordnungen verstieß. Da die Wärme im Wagen höchst willkommen war, sagte Schenke nichts dazu, als er auf dem Beifahrersitz Platz nahm. Während der Fahrer den Gang einlegte, warf der Inspektor noch einen letzten Blick auf die graue Fassade der Mietskaserne. Die Pförtnerin hatte ihre Wohnung verlassen und stand in der Haustür. Ihre Blicke trafen sich. Schenke war sich nicht ganz sicher, glaubte aber, so etwas wie Reue in ihrer Miene zu erkennen. Ihre Schuldgefühle waren durchaus berechtigt: Jeder Berliner hatte während dieses strengen Winters die Pflicht, auf den anderen zu achten, jetzt und in den kommenden kalten Tagen. Schenke hoffte, dass Frau Glück und ihr Gatte zumindest ihre Lektion gelernt hatten und künftig besser auf ihre Nachbarn aufpassen würden, so nutzlos dieser Einsatz auch sonst gewesen sein mochte.
»Zurück zum Revier, Herr Inspektor?«
»Ja. Aber fahren Sie langsam. Die Straßen sind völlig vereist.« Er war ganz und gar nicht erpicht darauf, das nächste Opfer dieses harten Winters zu werden. Ganz und gar nicht.
2. Kapitel
Als Chef der bescheidenen Kriminalpolizeidienststelle Pankow hatte Schenke weniger als zehn Mann unter seinem Kommando, wovon vier noch in der Ausbildung waren oder die vor der Anstellung vorgeschriebene Probezeit absolvierten. Zu seiner Einheit zählten außerdem zwei Beamtinnen, zu deren Aufgaben es unter anderem gehörte, bei Ermittlungen mit Kindern oder eingeschüchterten Frauen das Wort zu führen. In Friedenszeiten hätten ihm weitere sechs Ermittler zugestanden, doch diese Männer waren zum Kriegsdienst eingezogen worden. Die Büros der Kriminalpolizei befanden sich im obersten Stock des Reviers, mit Blick auf die Garagen, Werkstätten, Lagerräume und den kleinen Barackentrakt im Innenhof des Polizeireviers. Schenke stieg mit schmerzverzerrtem Gesicht die drei Etagen hinauf. Vor sechs Jahren hatte er bei einem Autorennen einen Unfall gehabt und war nur knapp mit dem Leben davongekommen. Seitdem war sein Knie steif und schmerzte, besonders in den kalten, feuchten Wintermonaten. Zwar konnte er ohne Schwierigkeiten normal gehen, aber jede Treppe oder ein Sprint von mehr als hundert Metern führte unweigerlich zu stechenden Schmerzen im Kniegelenk.
Darüber hinaus hatte man ihn wegen der Verletzung ausgemustert, was er als Schande empfand, da viele seiner Kollegen eingezogen worden waren, um Deutschland im Kampf gegen die Polen zu dienen. Doch gewiss herrschte bald wieder Frieden auf dem Kontinent, die Männer würden auf ihre Posten zurückkehren, und Schenke müsste nicht länger mit dem Makel leben, nicht aktiv für das Reich kämpfen zu können.
Er blieb am oberen Ende der Treppe stehen und sah sich um. Sobald er sicher war, dass ihn niemand beobachtete, beugte er sich vor und massierte die Muskeln um das Knie herum, bis sie etwas weniger steif waren und der Schmerz nachließ. Dann richtete er sich auf und marschierte in das Büro der Kriminalpolizei. An den Längsseiten des zehn mal vier Meter großen Raums waren paarweise Schreibtische aufgestellt. Die Glasscheiben der Fensterfront auf der gegenüberliegenden Seite waren mit Kondenswassertropfen und Eisblumen bedeckt. An einer Längswand waren mehrere Anschlagbretter angebracht. Weniger als die halbe Belegschaft saß an ihren Schreibtischen, der Rest war im Einsatz. In anderen Abteilungen wären die anwesenden Beamten wohl aufgesprungen, sobald ein Vorgesetzter den Raum betrat, doch hier handelte es sich um erfahrene Kriminalpolizisten in Zivil, die wenig Wert auf derlei Formalitäten legten, sondern sich lieber auf ihre Arbeit konzentrierten.
Sein Stellvertreter, Kriminalassistent Hauser – ein Veteran mit beinahe dreißig Jahren Polizeidienst auf dem Buckel –, drehte sich auf seinem Stuhl zu Schenke um. Man sah dem bulligen Mann immer noch an, dass er während seiner Zeit im Heer geboxt hatte. Sein Haar war so kurz geschoren, dass es wirkte, als hätte man ihm Pfeffer auf den Schädel gestreut.
»Haben Sie einen neuen Fall für uns, Herr Inspektor?«
»Gott sei Dank nicht.« Schenke schüttelte den Kopf. »Es waren keine verdächtigen Umstände zu erkennen. Mehr oder weniger völlige Zeitverschwendung, würde ich sagen.«
»Mehr oder weniger?«
»Immerhin hatte ich die Gelegenheit, einem unserer uniformierten Kollegen klarzumachen, dass er uns nur in begründeten Fällen hinzuzuziehen hat.«
Hauser grinste. Die Beziehung zwischen der Kriminalpolizei und der OrPo genannten Ordnungspolizei, zu der auch die einfachen Wachtmeister gehörten, war traditionell angespannt.
Schenke zog den Mantel aus und hängte ihn sich über den Arm. Den Hut behielt er auf und den Schal an. »Hat das Labor irgendwas über die Essensmarken herausgefunden, die wir in diesem Lagerhaus gefunden haben?«
»Ja.« Hauser drehte sich zu seinem Schreibtisch um und nahm einen gelbbraunen Aktendeckel in die Hand. »Das kam, während Sie weg waren. Ich konnte mir bisher nur die Zusammenfassung durchlesen. Aber allein die ist schon sehr aufschlussreich.«
»Bringen Sie mir den Bericht ins Büro. Ich werde ihn mir bei einer Tasse Kaffee ansehen.« Schenke sah sich im Raum nach dem jüngsten Mitglied seiner Einheit um. Sein Blick fiel auf einen dicklichen Jungspund mit zurückgekämmtem blonden Haar.
»Brandt!«
»Ja, Herr Inspektor?«
»Kaffee für mich und Hauser. Zack, zack.«
Brandt nickte und lief aus dem Büro in Richtung der Teeküche am Ende des Flurs.
»Wieso haben Sie es immer auf den armen Jungen abgesehen? Lassen Sie das doch eine der Frauen machen«, maulte Hauser.
»Er kommt frisch aus Charlottenburg und muss sich seine Sporen erst noch verdienen. Wie Sie und ich damals auch.«
Schenke sah zu den Schreibtischen hinüber, an dem seine beiden Beamtinnen saßen. Die stämmige Frieda Echs war Mitte vierzig und trug ihr braunes Haar in einer geradezu maskulinen Kurzhaarfrisur. Die zehn Jahre jüngere Rosa Mayer, die ihr gegenübersaß, war blond und hatte das fein geschnittene Antlitz eines Filmstars. Viele Kollegen hatten schon versucht, mit ihr anzubandeln, doch sie hatte ausnahmslos jeden abblitzen lassen, indem sie einen Verehrer vorschob, der in Reichsführer Himmlers Privatbüro arbeitete. Ob das nun der Wahrheit entsprach oder nicht – jedenfalls wagte es keiner, ihr mehr als ein Mal Avancen zu machen.
»Außerdem haben sich Frieda und Rosa ihren Platz in unserer kleinen Welt hier in Pankow redlich verdient. Solange Brandt noch in der Probezeit ist, kocht er auch Kaffee.«
Hauser zuckte mit den breiten Schultern und fuhr sich mit einer großen Hand über den Kopf. »So war das damals aber nicht.«
»Der Fortschritt ist eben nicht aufzuhalten, mein Freund. Na los, sehen wir uns den Bericht an.« Schenke ging voraus in den verglasten Bürowürfel am anderen Ende des Raums. Auf dem Weg nickte er den an ihren Tischen sitzenden Beamten zu. Schenke öffnete die Tür, an deren Rahmen ein poliertes Messingschild mit seinem Dienstgrad und seinem Namen in Frakturschrift geschraubt war. Vor der Wand gegenüber der Fensterfront standen ein Bücherregal und ein Aktenschrank. Dazwischen befand sich sein Schreibtisch, ein verschrammtes, von Gebrauchsspuren gezeichnetes Überbleibsel aus dem vorigen Jahrhundert. Bei seinem Dienstantritt hatte man Schenke angeboten, ihn zu ersetzen, doch er hatte abgelehnt. Der alte, robuste Tisch zeugte von Tradition und Pflichtbewusstsein – ein irgendwie beruhigender und Ehrfurcht gebietender Gedanke. Allerdings war das Möbel auch so groß, dass kaum noch Platz für die beiden Gästestühle zur Rechten der Tür blieb.
Von der Wand hinter dem Schreibtisch starrte ein Porträt des Führers in einem glänzenden schwarzen Rahmen durch den Raum. Im Gegensatz zum Schreibtisch war die Fotografie nicht Teil der Büroausstattung seines Vorgängers gewesen, sondern kurz nach Schenkes Ankunft angebracht worden – auf Anordnung des Bezirkskommandanten, eines dicken Mannes, der seinen Posten weniger seiner Fachkompetenz, sondern in erster Linie seiner fanatischen Hingabe an die Partei zu verdanken hatte. Schenke wagte es nicht, das Porträt abzuhängen, bemühte sich jedoch nach Kräften, es zu ignorieren. Er gab sich mit der Genugtuung zufrieden, bei der Arbeit dem Führer den Rücken zuzukehren.
Schenke hängte seinen Mantel an einen Haken, zog die Lederhandschuhe aus, setzte sich auf seinen Stuhl und bedeutete Hauser, ebenfalls Platz zu nehmen. »Also, was hat das Labor herausgefunden?«
Hauser legte den Aktendeckel auf den Tisch und schob ihn seinem Vorgesetzten zu. Schenke öffnete ihn, überflog die Zusammenfassung und blätterte durch die folgenden Seiten. Als er am Ende des Berichts angekommen war, drang ein Geräusch von der Tür zu ihm. Er blickte auf. Brandt stand mit zwei dampfenden Tassen in den Händen vor der Glasscheibe.
»Herein!«
Der angehende Polizeibeamte runzelte hilflos die Stirn, dann öffnete ihm Hauser kichernd die Tür. Brandt stellte mit rotem Kopf die Tassen ab, verließ das Büro wieder und schloss die Tür hinter sich.
»Eigenständiges Handeln ist zugegebenermaßen nicht seine Stärke«, sagte Hauser. »Da müsste schon ein kleines Wunder geschehen, dass er zugelassen wird.«
»Allerdings.« Schenke, der mit den Gedanken noch bei dem Bericht der Spurensicherung war, griff nach seinem Kaffee. »Offenbar ist unser Freund Leopold Kopinski geschäftstüchtiger als gedacht. Der Tintenpigment- und Papieranalyse zufolge stammen die gefälschten Essensmarken, die wir bei ihm gefunden haben, aus derselben Quelle wie die anderen, die überall in der Stadt kursieren.« Er öffnete den Aktendeckel wieder, nahm mehrere Proben heraus und hielt sie zur genaueren Betrachtung in die Höhe. Es handelte sich um einen kleinen, perforierten blauen Streifen mit Marken für Fleisch und einen lilafarbenen für Süßigkeiten und Nüsse – die wertvollsten der an die Berliner Bevölkerung ausgegebenen Lebensmittelgutscheine. »Die sind gut … sehr gut sogar.« Er griff in seine Jacketttasche, holte seine eigene Lebensmittelkarte heraus und verglich die Abschnitte mit den Fälschungen. »Wenn ich es nicht wüsste, hätte ich sie wohl kaum als Fälschungen erkannt.« Er sah Hauser an. »Sollen wir ein paar mitnehmen und versuchen, sie einzulösen?«
Der Kriminalassistent verzog das Gesicht. »Nur zu, wenn Sie die nächsten paar Monate in einer Zelle am Alex verbringen wollen. Vielleicht wandern Sie auch gleich ins Lager wie der Fälscher, den die Kripo Karlshorst hochgenommen hat. Ich jedenfalls möchte diesen Winter auf keinen Fall in einer zugigen Baracke verbringen. Na gut, andererseits haben seine Fälschungen auch ausgesehen, als hätte sie sein Kind mit Buntstiften gemalt. Kopinskis Marken sind da um Längen besser. Darauf würde so gut wie jeder hereinfallen.«
»Was mich zu der Frage führt, ob sie Kopinski überhaupt selbst gemacht oder von einer anderen Berliner Organisation gekauft hat. Wenn das sein Werk ist und er ein Geständnis ablegt, können wir das Übel an der Wurzel packen, bevor die Marken noch weitere Verbreitung erfahren.«
»Zuerst mal müssen wir Kopinski finden«, gab Hauser zu bedenken. »Nach der Razzia ist er untergetaucht.«
»Er kann sich nicht ewig verstecken.« Schenke nahm einen Schluck und verzog das Gesicht; der Kaffee war immer noch viel zu heiß. »Sie wissen ja, wie das ist. Früher oder später wird ihn jemand verpfeifen, entweder für Geld oder weil es die Gestapo aus ihm herausprügelt. Und sobald wir Kopinski gefasst haben, wissen wir auch, wie viele Marken bereits im Umlauf sind.«
»Und wenn er sie nicht selbst gefälscht hat?«, fragte Hauser. »Dann könnte es so ziemlich jede kriminelle Organisation gewesen sein, die die Mittel hat, Marken im großen Stil zu drucken. Was, wenn die gar nicht aus Berlin sind? Vielleicht ist es ja eine Bande aus Hamburg? Sollte Kopinski nicht dahinterstecken, dann kriegen wir – beziehungsweise unser geschätzter Chef – so richtig Ärger. Himmler wird Nebe deswegen eine ordentliche Standpauke halten.«
Die neuen Machthaber bemühten sich nach Kräften, die Missstände der Nachkriegszeit zu beseitigen. Kriminalität wurde gnadenlos bekämpft. Außerdem würde es das Regime nicht dulden, dass die soeben eingeführte Lebensmittelrationierung zur Blamage geriet, weil das Bezugsmarkensystem durch Fälschungen kaputt gemacht wurde. Kopinskis Schicksal war bereits besiegelt, ganz egal, ob er nun die Marken gefälscht hatte oder nicht. Bei einer raschen, öffentlichkeitswirksamen Gerichtsverhandlung würde man ihm Verbrechen gegen das deutsche Volk vorwerfen und ihn schuldig sprechen. Und da sich Deutschland im Krieg befand, war die Todesstrafe unvermeidlich – nicht zuletzt als warnendes Beispiel für andere Kriminelle. Stammten die Fälschungen jedoch aus einer anderen Quelle, würde Reichsführer Himmler persönlich von Nebe und seinen Ermittlern verlangen, die Verantwortlichen zu fassen und diesem Skandal ein Ende zu bereiten. Um dies zu vermeiden, schien es Schenke ratsam, so früh wie möglich und aus eigenem Antrieb in Aktion zu treten.
»Also gut. Hauser, Sie setzen sich mit den einzelnen Dezernaten in Verbindung. Arbeiten Sie sich von Berlin aus in Richtung der anderen Großstädte vor, und fragen Sie die jeweiligen Kripodienststellen, ob ihnen qualitativ hochwertige Fälschungen untergekommen sind. Falls ja, sollen sie uns sofort Muster schicken. So bekommen wir immerhin eine Ahnung davon, wie groß unser Problem ist, damit Nebe Himmler so früh wie möglich in Kenntnis setzen kann.«
Hauser grinste verschmitzt. »Es kann schließlich nicht schaden, wenn wir diejenigen sind, die ihm die Einzelheiten liefern, stimmt’s?«
Schenke grinste zurück. »Wird auch langsam Zeit, dass die Arbeit der Kripo Pankow gewürdigt wird. Ich habe es satt, dass wir wie Aussätzige behandelt werden.« Schenke hatte etwas zu frei von der Leber weg gesprochen und bereute es sofort.
In der darauffolgenden unangenehmen Gesprächspause beobachtete er Hauser genau. Sein Kriminalassistent war Parteimitglied, hatte aber im Gegensatz zu vielen Kollegen auf einen SS-Rang verzichtet. Auch deshalb, weil sein Vorgesetzter kein ausgesprochener Nazi war. Nicht, dass Schenke eine starke Abneigung gegen das Regime gehegt hätte. Solange es ihm bei seiner Arbeit nicht in die Quere kam, war es ihm herzlich egal. Schenke war nach seinem Universitätsabschluss 1934 zur Kriminalpolizei gegangen. Eine unübliche Berufswahl für jemanden aus so gutem Hause – Schenke stammte aus einer Adelsfamilie. Nichtsdestoweniger verfolgte er seinen Beruf mit Leidenschaft und schätzte die moralische Eindeutigkeit, die mit der Kriminalitätsbekämpfung einherging. Politiker kamen und gingen, Kriminelle dagegen gab es immer. Zumindest hatte er das lange Zeit geglaubt.
Wie so viele Deutsche hatte er Hitler und seine Schergen zunächst für aufgeblasene Lügner gehalten. Er hatte sich geweigert, sie ernst zu nehmen – selbst dann noch, als ihr Einfluss wucherte wie Schimmel in einer Petrischale. Bis es zu spät gewesen war. Seit Hitler nach seiner Ernennung zum Reichskanzler die Macht an sich gerissen hatte, legte sich die Partei wie eine Würgeschlange um alle Lebensbereiche und zog sich immer stärker zusammen. Auch der Kripo war es nicht anders ergangen als allen anderen deutschen Institutionen. Sie befand sich fest in der Hand der Partei, und Schenke konnte nichts dagegen tun. Doch womöglich war der Verlust der Freiheit auch der Preis, den man für eine stabile gesellschaftliche Ordnung, den Wiederaufbau Deutschlands und die Rückkehr zur einstigen Größe bezahlen musste. Solange Schenke seine Arbeit machen durfte, hatte er auch eine moralische Rechtfertigung für sich und seine Handlungen. Wo andere einknickten, hielt er standhaft an den wahren Werten des Polizeidienstes fest. Und er glaubte – hoffte –, dass der Einfluss der Partei im Laufe der Zeit nachlassen und in Deutschland wieder moderatere Kräfte die Oberhand gewinnen würden. Dann wäre auch sein Gewissenskonflikt beendet.
Diesen Standpunkt vertrat er selbstverständlich nur im engen Kreise seiner Familie und vor guten Freunden. Hier im Büro behielt er seine Meinung für sich und teilte sie noch nicht einmal mit Hauser, den er als Kollegen respektierte. In Deutschland war Vertrauen ein Gut, das mit jedem Tag knapper wurde. Schenke hatte erlebt, wie sich Nachbarn, ja sogar Kinder und Eltern gegenseitig bespitzelten und anschwärzten und dafür von der Partei belohnt wurden. Die einzige Treue, die das Regime duldete, war die zu Führer, Partei und Vaterland. Jede andere Form von Loyalität war suspekt. Womöglich würde selbst Hauser, mit dem er nun schon seit vier Jahren zusammenarbeitete, irgendwann gezwungen werden, sich zwischen der Partei und seinen Freunden und Kameraden wie beispielsweise Schenke zu entscheiden.
»Dann hängen Sie sich mal an die Strippe und telefonieren die anderen Bezirke ab«, sagte Schenke.
»Jawohl, Herr Inspektor. Gleich nach dem Mittagessen.« Hauser stand ruckartig auf, öffnete die Tür, verließ das kleine Büro, nahm seinen Mantel und verschwand in Richtung Kantine.
Schenke stieß einen leisen Seufzer der Erleichterung aus. Dabei bemerkte er eine kleine Atemwolke vor seinem Mund. Sein Körper wurde allmählich steif vor Kälte. Er ging zum Heizkörper unter dem Fenster und legte die Hand darauf. Er war fast kalt. Schenke drehte den Regler bis zum Anschlag auf und lehnte sich gegen die verkratzten Stahlrippen, während das heiße Wasser durch die Rohre gurgelte und sich das Metall mit einem leisen Klingeln ausdehnte. Mit dem Ärmel rieb er ein kleines kreisförmiges Loch in die Eisblumen am Fenster und blickte auf den Innenhof und die Dächer der Wohnhäuser und Geschäfte dahinter. Es schneite wieder. Helle Punkte taumelten vom grauen Himmel, legten sich auf die weiße Schneeschicht, die bereits die Dächer und Straßen bedeckte, und begruben auch das frisch gefegte Pflaster des Innenhofs unter sich.
»Scheiße …«, murmelte er, als ihm einfiel, dass er heute Abend zum Essen im Hotel Adlon im Herzen Berlins verabredet war. Obwohl dies eine Gelegenheit war, Zeit mit Karin zu verbringen, graute ihm davor. Er machte ihr den Hof, seit er sie vor vier Monaten auf einem von Nebe veranstalteten Polizeiempfang kennengelernt hatte – einem jener typischen gesellschaftlichen Anlässe Berlins, bei dem hochrangige Polizeibeamte, führende Wirtschaftsvertreter und Anwälte um die Aufmerksamkeit der Parteibonzen kämpften, während sich weiß livrierte Kellner mit Tabletts voller Getränke und Häppchen durch die Menge drängten. Schenke pflegte solche Veranstaltungen stets so früh zu verlassen, wie es die Etikette erlaubte. Was nicht ohne Risiko war, denn sich regelmäßig zeitig zu verabschieden trug einem schnell den Ruf eines Eigenbrötlers ein – oder schlimmer noch, den eines ungeselligen Sonderlings, der solche Anlässe verabscheute.
An jenem Abend vor vier Monaten hatte er sich wieder einmal davongeschlichen und gerade zur Garderobe gehen wollen, als Karin mit einem Champagnerglas in der Hand auf ihn zugekommen war: eine schlanke Frau in einem dünnen, Pailletten-funkelnden Kleid, die er auf Ende zwanzig schätzte. Ihr Haar war wie das der amerikanischen Filmschauspielerin Louise Brooks zu einem kurzen Bob mit akkuratem, schnurgeradem Pony geschnitten. »Sie sind der Rennfahrer, nicht wahr?«, fragte sie unverblümt, nachdem sie ihn von oben bis unten gemustert hatte.
»Nicht mehr«, antwortete er höflich. »Inzwischen bin ich nur noch ein einfacher Polizist. Außerdem war ich nicht der, sondern nur ein Rennfahrer.«
Sie lächelte. »Sie sind zu bescheiden. Ich war eine große Bewunderin der Silberpfeile, und Sie waren einer der Besten. Bis …« Sie legte den Kopf schief und schürzte leicht die Lippen.
»Bis zu dem Unfall auf dem Nürburgring«, vollendete Schenke den Satz.
»Richtig. Ich war an jenem Tag dort. Sie waren auf dem Weg zum Sieg, als es passierte.«
Schlagartig holte ihn die Erinnerung ein. Der Rausch der Geschwindigkeit, den Triumph vor Augen. Das Dröhnen des Motors, die Vibrationen der Reifen auf der Rennstrecke. Dann plötzlich ein Kaleidoskop aus vorbeirauschenden Bäumen, der Himmel, der Asphalt – und schließlich nur noch Dunkelheit, gefolgt von höllischen Schmerzen. Die langwierige, sich über Monate hinziehende Genesung. Er verscheuchte diese Gedanken aus seinem Kopf. »Tja, was soll ich sagen? Manchmal will man den Sieg ein bisschen zu sehr, riskiert ein bisschen zu viel und verliert schließlich«, bemerkte er trocken.
»Aber manchmal gewinnt man auch.« Sie deutete mit ihrem Glas auf das Porträt des Führers, das am anderen Ende des Saales hing. Schenke bemerkte, dass sie seine Reaktion beobachtete, und nickte unverbindlich, ohne auf die Bemerkung einzugehen.
»Ich würde ja gerne noch bleiben und über meine Rennfahrerzeit plaudern, aber bedauerlicherweise ruft morgen wieder die Arbeit.« Als er sich zu dem Garderobier umdrehen wollte, streckte sie den Arm aus und berührte seine Schulter.
»Sie haben mich noch gar nicht nach meinem Namen gefragt, Herr Schenke.«
»Ich bitte um Vergebung, Fräulein …«