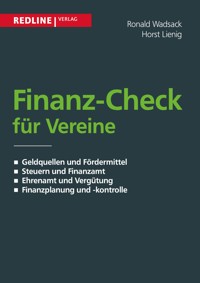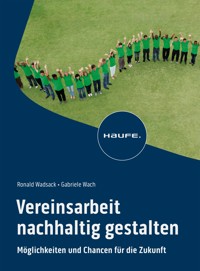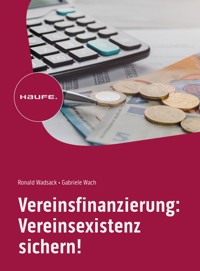
29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Haufe Lexware
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Haufe Fachbuch
- Sprache: Deutsch
Für die Existenz und Zukunftsfähigkeit von Vereinen ist ihre finanzielle Stabilität von entscheidender Bedeutung. Mitgliedsbeiträge allein reichen jedoch schon lange nicht mehr aus, um den Vereinsbetrieb zu sichern. Zuwendungen, Projekte, Fundraising, aber auch Sponsoring sind weitere wichtige Finanzierungsquellen. Genauso sind die Ausgaben im Blick zu halten. Ronald Wadsack und Gabriele Wach bieten einen umfassenden Einblick in das Thema Vereinsfinanzierung. Sie zeigen, wie es gelingt, finanzielle Mittel zu erschließen, zu planen und zu steuern, um die Existenz des Vereins zu sichern. Mit konkreten Praxisbeispielen aus den Bereichen Sport, Musik, Freiwillige Feuerwehr, Umwelt und Soziales. Inhalte: - Überblick über die Geldströme in Vereinen - Finanzmanagement im Verein - Risiko- und Krisenmanagement im Verein - Übersicht Einnahmemöglichkeiten: Vereinsbeitragssystem, Stiftungen, Fördermittel, Spenden, Crowdfunding, Sponsoring u. a. - Ausgaben: der finanzielle Antrieb für den Verein - Übersicht zu Einnahmen und Ausgaben in den Steuerbereichen der Gemeinnützigkeit Die digitale und kostenfreie Ergänzung zu Ihrem Buch auf myBook+: - Zugriff auf ergänzende Materialien und Inhalte - E-Book direkt online lesen im Browser - Persönliche Fachbibliothek mit Ihren Büchern Jetzt nutzen auf mybookplus.de.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 240
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
InhaltsverzeichnisHinweis zum UrheberrechtmyBook+ImpressumAbbildungsverzeichnisTabellenverzeichnisZum Einstieg 1 Elemente und Aufbau des Buches1.1 Wer uns beim Thema »Vereinsfinanzierung« durch das Buch begleitet1.2 Der Aufbau des Buches 2 Ein erster Einblick: Geldströme im Verein2.1 »Geld regiert die Welt« – und auch den Verein2.2 Vereinsressourcen – die Grundlagen der Vereinsexistenz2.2.1 Grundkonzept der Vereinsressourcen2.2.2 Finanzmittel2.2.3 Infrastruktur, Material und Rechte 2.2.4 Mitglieder2.2.5 Mitarbeiter:innen2.2.6 Legitimations- und Netzwerkkapital 2.3 Vereinsressourcen und Finanzen2.4 Finanzströme im Verein – eine erste Übersicht2.5 Schatzmeisters Arbeit – eine anspruchsvolle Aufgabe 2.6 Der Umgang mit Finanzen erfordert Aufmerksamkeit und Verantwortung3 Finanzmanagement im Verein – das Handwerkszeug3.1 Finanzplanung3.1.1 Grundlagen der Finanzplanung3.1.2 Budgetierung3.1.2.1 Budgetierung – Grundverständnis für die Vereinsarbeit3.1.2.2 Budgetierung für die Abteilungen bzw. Vereinsbereiche3.1.2.3 Budgetierung – Einzelprojekte3.1.2.4 Finanzierung einer Geschäftsführung für den Verein3.1.3 Investitionsplanung3.1.3.1 Grundlagen der Vereinsinvestition3.1.3.2 Die Finanzplanung für die Investition 3.2 Liquiditätsmanagement3.3 Kostenanalyse – Kostenrechnung3.3.1 Kostenanalyse – die Grundlagen3.3.2 Kostenentstehung identifizieren3.3.3 Kostenzuordnung 3.3.4 Kostenoptimierung – Kostenmanagement 3.4 Controlling3.5 Risikomanagement3.5.1 Entscheidungen bewerten und Risiken früh erkennen3.5.2 Risikobewertung 3.5.3 Risikovorbeugung3.6 Krisen- bzw. Sanierungsmanagement3.6.1 Krise akzeptieren 3.6.2 Analyse des Vereins und Lösungssuche3.6.3 Erarbeitung eines Rettungskonzepts4 Einnahmen – die (trügerische) Hoffnung auf den Goldesel?4.1 Übersicht – die Vielfalt der Einnahmemöglichkeiten4.2 Beiträge4.2.1 Das Vereinsbeitragssystem – Grundlagen4.2.2 Beitragserhöhung als strategische Aufgabe4.3 Fundraising 4.3.1 Fundraising im Überblick4.3.2 Spenden 4.3.2.1 Spendenmarkt und Spendenarten4.3.2.2 Spendensammeln erfordert gutes Marketing4.3.3 Crowdfunding 4.3.4 Fördervereine 4.3.4.1 Das Grundkonzept von Fördervereinen4.3.4.2 Gründungs- und Arbeitsphase von Fördervereinen4.3.5 Grundlagen für die Antragstellung bei Stiftungen und für öffentliche Fördermittel 4.3.5.1 Der Prozess der Antragstellung4.3.5.2 Das Projekt vom Ende her denken4.3.6 Stiftungen 4.3.6.1 Stiftungen als Unterstützer in der Gesellschaft4.3.6.2 Stiftungen finden und Antrag stellen4.3.6.3 Gründung einer eigenen Stiftung4.3.7 Öffentliche Fördermittel 4.3.7.1 Zuwendungsarten und Situation der Zuwendungslandschaft4.3.7.2 Übersicht über öffentliche Fördermittel4.3.8 Weitere Fundraisingquellen4.4 Erwirtschaftung inkl. Sponsoring4.4.1 Erwirtschaftung 4.4.2 Sponsoring 4.4.2.1 Sponsoring als Leistungsbeziehung zwischen Verein und Sponsor4.4.2.2 Sponsoringangebot und -zusammenarbeit4.5 Kredite als »Glücksfall«?5 Ausgaben – der finanzielle Antrieb für den Verein5.1 Übersicht5.2 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter5.2.1 Mitarbeitsformen aus wirtschaftlicher Sicht5.2.2 Achtung: Ehrenamtliche Mitarbeit ist nicht kostenlos! 5.3 Vereinsanlagen (Gebäude, Gelände)5.4 Materialien und Geräte für den Vereinsbetrieb5.5 Laufende Kosten für den Vereinsbetrieb 5.6 Outsourcing – Chancen und Risiken für Vereine5.6.1 Auslöser für Outsourcing-Überlegungen5.6.2 Partnersuche und -auswahl5.6.3 Entwicklung der Zusammenarbeit6 Anhang6.1 Anhang 1: Übersicht zu Einnahmen und Ausgaben in den Steuerbereichen der Gemeinnützigkeit6.2 Anhang 2: Kostenrechnung6.2.1 Grundformen der Kostenrechnung6.2.2 Vollkostenrechnung im Überblick6.2.2.1 Schritt 1: Kostenartenrechnung6.2.2.2 Schritt 2: Kostenstellenrechnung6.2.2.3 Schritt 3: Kostenträgerrechnung6.2.3 Kurzer Einblick in die einstufige Deckungsbeitragsrechnung6.2.3.1 Kostenrechnung und Vereinszukunft6.3 Anhang 3: Balanced Scorecard6.4 Anhang 4: Beispiel Stellenausschreibung Schatzmeister:in7 LiteraturIhre Online-Inhalte zum Buch: Exklusiv für Buchkäuferinnen und Buchkäufer!StichwortverzeichnisBuchnavigation
InhaltsubersichtCoverTextanfangImpressumHinweis zum Urheberrecht
Alle Inhalte dieses eBooks sind urheberrechtlich geschützt.
Bitte respektieren Sie die Rechte der Autorinnen und Autoren, indem sie keine ungenehmigten Kopien in Umlauf bringen.
Dafür vielen Dank!
myBook+
Ihr Portal für alle Online-Materialien zum Buch!
Arbeitshilfen, die über ein normales Buch hinaus eine digitale Dimension eröffnen. Je nach Thema Vorlagen, Informationsgrafiken, Tutorials, Videos oder speziell entwickelte Rechner – all das bietet Ihnen die Plattform myBook+.
Ein neues Leseerlebnis
Lesen Sie Ihr Buch online im Browser – geräteunabhängig und ohne Download!
Und so einfach geht’s:
Gehen Sie auf https://mybookplus.de, registrieren Sie sich und geben Sie Ihren Buchcode ein, um auf die Online-Materialien Ihres Buches zu gelangen
Ihren individuellen Buchcode finden Sie am Buchende
Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit myBook+ !
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Print:
ISBN 978-3-648-17641-2
Bestell-Nr. 13133-0001
ePub:
ISBN 978-3-648-17642-9
Bestell-Nr. 13133-0100
ePDF:
ISBN 978-3-648-17643-6
Bestell-Nr. 13133-0150
Ronald Wadsack/Gabriele Wach
Vereinsfinanzierung: Vereinsexistenz sichern!
1. Auflage, September 2024
© 2024 Haufe-Lexware GmbH & Co. KG
Munzinger Str. 9, 79111 Freiburg
www.haufe.de | [email protected]
Bildnachweis (Cover): © Tobias Schwarz, iStock
Produktmanagement: Annette Ziegler
Bildnachweis (Innenteil): wiederkehrende Grafik: © pyty, Adobe Stock
Lektorat: Ursula Thum, Text+Design Jutta Cram, Augsburg
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere die der Vervielfältigung, des auszugsweisen Nachdrucks, der Übersetzung und der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, vorbehalten. Alle Angaben/Daten nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.
Sofern diese Publikation ein ergänzendes Online-Angebot beinhaltet, stehen die Inhalte für 12 Monate nach Einstellen bzw. Abverkauf des Buches, mindestens aber für zwei Jahre nach Erscheinen des Buches, online zur Verfügung. Ein Anspruch auf Nutzung darüber hinaus besteht nicht.
Sollte dieses Buch bzw. das Online-Angebot Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte und die Verfügbarkeit keine Haftung. Wir machen uns diese Inhalte nicht zu eigen und verweisen lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung.
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Einflüsse auf die Vereinsfinanzierung (Grafik: Wach)
Abb. 2: Ressourcenmodell für Vereine (Quelle: Wadsack)
Abb. 3: Einnahme- und Ausgabemöglichkeiten im Verein
Abb. 4: Wichtige Regeln bei der Finanzplanung (Grafik: Wach)
Abb. 5: Verlauf der Budgetausschöpfung
Abb. 6: Investition als Prozess in der Vereinsarbeit (Grafik: Wadsack)
Abb. 7: Schematische Stufen für den Planungsprozess einer Vereins-Baumaßnahme (Quelle: Bielzer & Wadsack 2011, 65)
Abb. 8: Beispiel für eine einfache Kostenzuordnung
Abb. 9: Beispielhafte Mitgliederentwicklung und Trendentwicklung in einem Verein, jeweils per 01.01. des Jahres (Grafik: Wadsack)
Abb. 10: Stufen und Merkmale der Krisenentwicklung (Quelle: Wadsack 2023, angelehnt an Schlebusch et al. 2004)
Abb. 11: Vereinsbeitragssystem
Abb. 12: Preise aus dem Lebensumfeld als Vergleichsgrößen (Stand März 2024, Preisunterschiede nach Region und Anbieter)
Abb. 13: Fundraising-Pyramide (modifiziert und aktualisiert nach: Burens 1995, 66)
Abb. 14: Verteilung des privaten Geldspendenvolumens nach Spendenzweck in Deutschland; Spendenzwecke nach Selbsteinschätzung der Spender – Anteile an den Einnahmen in %; Jan. bis Sept. 2022 vs. Jan. bis Sept. 2023 (Quelle der Daten: Corcoran/Consumer Panel GfK)
Abb. 15: Fundraising-Zielgruppen aus Vereinssicht
Abb. 16: So funktioniert Crowdfunding (Crowdfunding.de, https://www.crowdfunding.de/was-ist-crowdfunding/; 23.02.2024)
Abb. 17: Übersicht: Schritte einer Crowdfunding-Aktion (Grafik: Wach)
Abb. 18: Gründungs- und Förderverein, ArbeitsphaseArbeitsphase eines Fördervereins (Abbildung Wadsack)
Abb. 19: Planungskonzept für Projektanträge
Abb. 20: Betätigungsfelder von Stiftungen (Quelle: Bundesverband Deutscher Stiftungen; Stand 01.05.2023)
Abb. 21: Vorgehensweise zur Antragstellung bei einer Stiftung (Grafik: Wach)
Abb. 22: Förderorganisationen in Deutschland
Abb. 23: Einfache Sponsoring-Pyramide (Grafik: Wach)
Abb. 24: Vorgehensweise Sponsoring-Prozess (Grafik: Wach)
Abb. 25: Kosten der Vereinsarbeit – Beispiele (Abbildung Wadsack; IT – Informationstechnologie)
Abb. 26: Einnahmen und Ausgaben, aufgeschlüsselt nach den Steuerbereichen der Gemeinnützigkeit
Abb. 27: Ablauf einer Vollkostenrechnung
Abb. 28: Beispiel Vereinsabrechnungsbogen (Quelle: https://lsv-sh.vibss.de/fileadmin/schleswig-holstein/LSV_IP_Kostenrechnung_und_Beitragsgestaltung_im_Sportverein_2013-01-30.pdf; 22.02.2024)
Abb. 29: Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge der BSC für eine Nonprofit-Organisation (Quelle: Lange & Lampe 2002, leicht modifiziert) (Grafik: Wach)
Abb. 30: Die vier Perspektiven der Balanced Scorecard (Grafik: Wach)
Abb. 31: Balanced Scorecard für einen Kreissportbund (Quelle: Wadsack & Roberg 2005, 17)
Tabellenverzeichnis
Tab. 1: Übersicht zu den Kapiteln des Handbuchs »Vereinsfinanzierung«
Tab. 2: Übersicht zu der Verbindung der Vereinsressourcen mit den Finanzen (Beispiele)
Arbeitshilfe 1: Erkennen der grundlegenden Finanzwirkung der Vereinsressourcen
Tab. 3: Vorschlag für den Einsatz der Finanzmanagementinstrumente (X: Nützlichkeit wahrscheinlich, 0: Nützlichkeit prüfen)
Arbeitshilfe 2: Vereinfachte Anlage einer Haushaltsplanung
Arbeitshilfe 3: Mittelfristige Finanzplanung, Grundsystematik
Arbeitshilfe 4: Grundsystematik eines Budgetierungsprozesses
Arbeitshilfe 5: Basiskonzept Budgetierung Einzelprojekte
Tab. 4: Finanzierungsmöglichkeiten einer neuen Stelle »Geschäftsführung«
Arbeitshilfe 6: Finanzierungsoptionen Geschäftsführung
Tab. 5: Beispiele der Ressourcennutzung für Investitionsprojekte
Tab. 6: Ermittlung des Investitionsbedarfs
Tab. 7: Ermittlung der Investitionsfinanzierung
Tab. 8: Ermittlung der Belastung für den Verein
Tab. 9: Schema einer Liquiditätsrechnung
Tab. 10: Schema einer Kostenanalyse
Tab. 11: Beispiele für die Verteilung von Kosten ohne direkte Zuordnung
Tab. 12: Kennzahlen für das Vereinscontrolling (Beispiele)
Tab. 13: Beispiele von Risikofaktoren im Zuge der Vereinsarbeit
Tab. 14: Beispiele für »schwache Signale«
Arbeitshilfe 7: Unterstützung bei der Risikobetrachtung
Tab. 15: Anteil der Beiträge am Vereinsbudget
Tab. 16: Vereinfachte Risikobetrachtung für Vereinsangebote
Tab. 17: Ansätze der Vereinsanalyse zur Krisenbewältigung
Tab. 18: Arbeitsschritte zur Entwicklung eines Notfallplans
Tab. 19: Handlungsoptionen zur Krisenbewältigung bei Einnahmen und Ausgaben
Tab. 20: Zuverlässigkeit der Finanzierungsoptionen (++ sehr hoch, + hoch, 0 mittel, – schwach)
Arbeitshilfe 8: Begründungen für eine Beitragserhöhung im Verein
Beispiel zum Verbleib des Vereinsbeitrags. Quelle der Vorlage: https://www.sportbund-rheinland.de/fileadmin/sportbund/_downloadcenter/Mitgliedsbeitrag_im_Verein/Argumentationshilfe_Vereinsbeitrag.pdf; hier zusammengefasst und neutralisiert
Tab. 21: Beispiele für Crowdfunding-Plattformen (Stand: März 2024)
Arbeitshilfe 9: Arbeitsschritte für eine Crowdfunding-Aktion
Tab. 22: Vor- und Nachteile einer Crowdfunding-Aktion
Arbeitshilfe 10: Fördervereinsprüfung
Tab. 23: Grundlegende Ausgangspunkte für die Projektentwicklung
Tab. 24: Stiftungsformen
Arbeitshilfe 11: Prüfung der geplanten Projektzusammenarbeit mit einer Förderorganisation
Arbeitshilfe 12: Prüfung der geplanten Zusammenarbeit mit einer Förderorganisation für eine Anschaffung
Tab. 25: Übersicht zu Arten und Begriffen der Förderung mit öffentlichen Mitteln
Tab. 26: Übersicht zu einer Auswahl von Sonderorganisationen
Arbeitshilfe 13: Bewertung einer Maßnahme zur Erwirtschaftung von Einnahmen
Sponsoringpakete der Fußballabteilung des VfL Ostelsheim (Quelle: https://www.vfl-ostelsheim.de/fussball-1/sponsoren/; 05.05.2024)
Tab. 27: Übersicht zu Mitarbeitsformen im Verein und den damit verbundenen finanziellen Belastungen für den Verein (eigene Tabelle; TVöD – Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)
Arbeitshilfe 14: Laufende Kosten Vereinsbetrieb
Arbeitshilfe 15: Erste Prüfung der Outsourcing-Möglichkeiten im Verein
Arbeitshilfe 16: Bewertungsliste für Angebote
Tab. 29: Typische Einzel- und Gemeinkosten im Verein
Tab. 30: Beispielvorlage Vereinsabrechnungsbogen
Tab. 31: Grundformen der Deckungsbeitragsrechnung
Tab. 32: Ermittlung Kostendeckung
Tab. 33: Messgrößen-Beispiel für das Ziel »Ausbau des ideellen Bereichs und Gewinnung und Förderung von Ehrenamtlichen und Mitgliedern« (Quelle: Lange & Lampe 2002, leicht modifiziert)
Tab. 34: Beispielhafte Darstellung von Zielen in Verbindung mit Kennzahlen, Ist- und Soll-Werten und Maßnahmen
Tab. 35: Phasen zur Einführung einer Balanced Scorecard (in Anlehnung an Horvath & Partners, 2007, S. 73–84)
Zum Einstieg
Finanzen sind für Vereine schon immer ein Thema. Zu Beginn im 18. bzw. 19. Jahrhundert waren die Finanzierung aus Beiträgen und die Unterstützung durch Mäzene die Grundlage der wirtschaftlichen Lebensfähigkeit. Im 20. Jahrhundert und noch einmal verstärkt in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben sich für Vereine neue Möglichkeiten der Finanzierung eröffnet. Das Spektrum ist deutlich breiter geworden, Möglichkeiten wie Sponsoring, Crowdfunding oder Zuwendungen aus öffentlichen Kassen sind hinzugekommen. Sie erfordern spezifische Kompetenzen. Nicht jeder Verein kann in gleichem Maße davon profitieren. Je nach Tätigkeitsgebiet des Vereins und öffentlicher Bekanntheit ergeben sich hier verschiedene Möglichkeiten.
Für die Finanzierung eines Vereins sind besonders folgende Fähigkeiten gefragt:
Finanzquellen zu finden,
Finanzquellen zu erschließen,
die Vereinsfinanzen zu planen und zu steuern und
die verfügbaren finanziellen Mittel sparsam, aber wirkungsvoll einzusetzen.
Dass dabei die rechtlichen Regeln zu Buchhaltung bzw. Rechnungslegung, Mitbestimmung der Mitglieder und Gemeinnützigkeit einzuhalten sind, versteht sich von selbst. Sie sollen hier nicht im Mittelpunkt stehen. Es geht auch nicht darum, waghalsige Aktionen mit den Vereinsfinanzen durchzuführen oder etwa mit dem Gedanken, »etwas Gutes zu tun«, rechtlich fragwürdige Finanzierungsaktionen zu starten. Es gilt, den Spagat zwischen finanziell guter Ausstattung des Vereins und Erhalt der Vereinsidentität zu schaffen und sich nicht für die Erzielung von Einnahmen von den Grundwerten und Zielen des Vereins »zu entfremden« oder »die Seele des Vereins zu verkaufen«.
In der heutigen Zeit (wir befinden uns im Frühjahr 2024) zeichnen sich einige Entwicklungen ab, welche die Finanzierung von Vereinen zu einer besonderen Herausforderung machen:
Öffentliche Kassen von der Bundesebene über die Bundesländer bis zu den Kommunen stehen vor der Herausforderung zu sparen, auch Vereine bleiben davon nicht unberührt.
Kleinere Gewerbe- und Handelsbetriebe verschwinden aus Innenstädten oder dem ländlichen Raum, sie waren und sind oft ein wichtiger Partner für örtliche Vereine.
Größere und große Wirtschaftsunternehmen fahren Sparkurse und stellen dabei alle Ausgabenpositionen auf den Prüfstand, auch Spenden, Sponsoring und Corporate-Social-Responsibility(CSR)-Projekte.
Die Menschen vor Ort müssen mit Preissteigerungen zurechtkommen und genauer auf ihre Ausgaben schauen.
Genauso haben auch die Vereine mit steigenden Preisen und höheren Kosten z. B. bei der Bezahlung von Mitarbeiter:innen oder von Energie zu kämpfen.
Auf der anderen Seite stehen die Rahmenbedingungen der Vereine und ihre finanzielle Sicherheit:
Die finanzielle Stabilität ist für die Existenz- und Zukunftsfähigkeit von Vereinen ausschlaggebend, genau wie für Unternehmen und andere Organisationen.
Mitgliedsbeiträge sind die Basis, aber für viele Vereine reichen sie schon lange nicht mehr, um den Vereinsbetrieb zu sichern. Zuwendungen für den Vereinsbetrieb oder Projekte, Fundraising, die Erwirtschaftung von Einnahmen auch durch Sponsoring sind weitere Finanzquellen.
Jede Finanzierungsform hat ihre speziellen Bedingungen für die erfolgreiche Beschaffung und Nutzung.
Neben der Einhaltung von (steuer)rechtlichen Regeln sind für die Beschaffung von Finanzmitteln und die Bewirtschaftung spezielle Kompetenzen erforderlich.
Zudem muss die Steuerung des finanziellen Geschehens im Verein gelingen, um keine finanziellen Mittel zu vergeuden und nicht Misswirtschaft zu betreiben und letztlich in die Insolvenz zu geraten.
Unter Berücksichtigung dieser Rahmenbedingungen wurde das vorliegende Buch zusammengestellt – es soll so hilfreich wie möglich für die Vereinsarbeit sein und kann in unterschiedlichen Formen genutzt werden:
Das Buch eignet sich als Nachschlagewerk, wenn es darum geht, sich über spezielle Themenbereiche der Vereinsfinanzen zu informieren.
Es kann zum »Schmökern« genutzt werden, also für einen eher ungezielten Blick, um Anregungen für die Möglichkeiten zur Finanzierung der Vereinsarbeit zu gewinnen.
Und es kann komplett durchgelesen werden, um sich grundlegend mit dem Thema Verein und Finanzen als Führungsaufgabe vertraut zu machen.
Auf jeden Fall wünschen wir allen Leser:innen viel Erfolg für die Arbeit im Verein.
Salzgitter/Sickte, März 2024
Ronald Wadsack, Gabriele Wach
1 Elemente und Aufbau des Buches
1.1 Wer uns beim Thema »Vereinsfinanzierung« durch das Buch begleitet
Um die verschiedenen Blickwinkel und die Unterschiedlichkeit von Vereinen immer wieder in den Blick zu rücken, kommen im Buch immer wieder zwei Vereinsvertreterinnen und zwei Vereinsvertreter zu Wort. Sie begleiten uns durch diesen Band.
»Vereinsfinanzierung« hieß der Workshop einer regionalen Akademie. Dort haben sich unsere fiktiven Vereinsvertreter:innen vor einigen Monaten getroffen und bei der Gelegenheit festgestellt, dass sie sich alle mit dem Thema »Finanzen« befassen. Und alle waren sich einig: Das ist kein einfaches Thema!
Wir stellen Ihnen die Vereinsvertreter:innen vor:
Dilara: Geschäftsführerin in einem Sportverein mit mehreren Sportarten im Angebot, 1.254 Mitglieder. Der Verein hat insgesamt sieben Abteilungen.
Konrad: Vorsitzender in einem Gesangsverein, 153 Mitglieder, verschiedene Gruppen nach Alter und Musikrichtung. Es gibt ein eigenes kleines Vereinsheim, v. a. für die Übungsstunden.
Jan: Vorsitzender eines Vereins für die örtliche Kinder- und Jugendarbeit mit Schwerpunkt Integration, 73 Mitglieder und viele betreute Kinder und Jugendliche ohne Mitgliedschaft.
Laura: Stellvertretende Vorsitzende eines Naturschutzvereins, 285 Mitglieder. Bildung für unterschiedliche Zielgruppen ist der Kern der Arbeit. Dem Verein gehört eine einfache Hütte in einem Naturschutzgebiet für Workshops, Fortbildungen und andere Vereinstreffen.
Aus der Praxis unserer Vereinsvertreter:innen
Jan: Hallo zusammen! Schön, dass wir uns nach so langer Zeit wieder einmal treffen. Wir haben bei uns angefangen, die IT-Infrastruktur zu erweitern. Es läuft ganz gut. Wie sieht es denn so bei euch aus?
Dilara: Ja, bei uns läuft es eigentlich auch ganz gut. Aber unser Vorstand macht sich Sorgen über die finanziellen Belastungen. Da müssen wir wohl unsere Einnahmemöglichkeiten und die verschiedenen Finanzquellen genauer auf Steigerungsmöglichkeiten überprüfen. Vielleicht müssen wir sogar über eine Beitragserhöhung nachdenken. Gleichzeitig schauen wir kritisch auf unsere Kosten für den Vereinsbetrieb, um möglicherweise ein wenig einzusparen. Das Geld liegt ja nicht auf der Straße – überall wird gespart.
Konrad: Bei uns machen sich auch schon erste Preissteigerungen bemerkbar. Allein die Kosten für die Energie. Das schlägt sogar in unserem kleinen Vereinsheim so richtig zu Buche, auch wenn wir schon einiges an Einsparmaßnahmen beschlossen haben.
Laura: Da können wir uns momentan relativ beruhigt zurücklehnen. Wir werden seit Jahrzehnten von einem engagierten Ehepaar mit größeren Spenden bedacht. Und weil wir das Geld ordentlich verwendet und nicht verjubelt haben, wollen sie uns im Testament berücksichtigen. Unsere Vereinshütte ist nicht beheizt, deshalb trifft uns das Energiethema nicht ganz so arg.
Jan: Einen Verein im Testament zu berücksichtigen erfordert sicher ein ganz besonderes Vertrauensverhältnis zwischen dem Spender und dem Verein. Bei uns ist das nicht so einfach. Als kleiner Verein steht uns immer mal wieder finanziell das Wasser bis zum Hals. Wir hangeln uns mit einer ganzen Reihe von Projektanträgen und den Geldern daraus über die Zeit. Der Aufwand dafür ist aber enorm!
1.2 Der Aufbau des Buches
Der Aufbau dieses Buches zielt darauf ab, das Augenmerk auf die Finanzen im Verein zu lenken, auch wenn den Mitgliedern eines Vereins andere Themen vermutlich mehr am Herzen liegen, weil das Vereinsziel doch eher auf gesellschaftliche Themen gerichtet ist. In unserer Gesellschaft ist die Lebensfähigkeit von Organisationen ganz eng mit dem Thema und vor allem dem Vorhandensein von Geld verbunden. Kreativität bei der Ausschöpfung von Finanzierungsmöglichkeiten, sparsamer Umgang mit den verfügbaren Finanzen und damit auch ein Beitrag zur ökonomischen Nachhaltigkeit sind einige wichtige Punkte. Letztendlich geht es darum, die Leistungsfähigkeit des Vereins in seinem Tätigkeitsfeld abzusichern, aber auch Hinweise zu erhalten, wenn diese Lebensfähigkeit in Gefahr gerät, um möglichst frühzeitig gegenzusteuern.
Auf den Punkt
Ausreichendes Geld ist in unserer Gesellschaft der Schlüssel für die Lebensfähigkeit von Vereinen.
Tabelle 1 enthält eine knappe Übersicht zu den einzelnen Kapiteln des vorliegenden Buches. Ohne ein Grundverständnis der Vereinsfinanzen gelingt die Übertragung auf die Vereinsarbeit nicht (Kapitel 2). Mit diesem Wissen kann man genauer hinschauen, welche Möglichkeiten für den eigenen Verein bestehen.
Kapitel 1
Elemente und Aufbau des Buches
Kapitel 2
Ein erster Einblick: Geldströme im Verein
Kapitel 3
Finanzmanagement im Verein – das Handwerkszeug
Welche Finanzaspekte für Vereine werden in diesem Band angesprochen?
Welche grundlegenden Zusammenhänge bestehen zwischen der Vereinsarbeit und den Finanzen?
Welche Instrumente des Finanzmanagements sind für Vereine wichtig?
Kapitel 4
Einnahmen – die (trügerische) Hoffnung auf den Goldesel?
Kapitel 5
Ausgaben – der finanzielle Antrieb für den Verein
Kapitel 6
Anhang
Welche Einnahmemöglichkeiten für Vereine bestehen und wie kann man sie erschließen?
Welche typischen Ausgabepositionen gibt es für Vereine und worauf ist zu achten?
Ergänzungen und Vertiefungen zu den einzelnen Inhalten des Buches.
Kapitel 7
Literatur
Liste der im Buch genutzten Quellen
Tab. 1: Übersicht zu den Kapiteln des Handbuchs »Vereinsfinanzierung«
Die einzelnen Beiträge werden immer wieder durch Arbeitshilfen ergänzt, die unmittelbar in der Vereinsarbeit eingesetzt werden können. Sie finden die Arbeitshilfen auch auf dem Online-Portal.
Nicht nur unsere vier Begleiter:innen in diesem Buch zeigen, mit welch unterschiedlichen Vereinen man es zu tun haben kann. Es gibt ja noch viel mehr, wenn man etwa an die Freiwillige Feuerwehr, Wohlfahrtsverbände, Tafel-Vereine oder Hilfsvereine für soziale Fragen denkt. Und auch diese Aufzählung ist wiederum nur eine kleine Auswahl. Immerhin gab es nach Angaben der Organisation »Zivilgesellschaft in Zahlen« (ZiviZ; Schubert u. a. 2022) mehr als 615.000 eingetragene Vereine in Deutschland. Sieht man sich die Vereinslandschaft an, können zwei grundlegende Vereinstypen unterschieden werden:
Vereine mit Leistungen in erster Linie für die eigenen Mitglieder (z. B. Sportvereine)
Vereine mit Leistungen in erster Linie für externe Leistungsempfänger:innen, wie Nutzer, Kundinnen, Gäste (z. B. Tafel-Vereine)
In der Praxis finden sich selbstverständlich Mischformen, wenn z. B. ein v. a. auf Mitglieder ausgerichteter Verein zusätzlich Kurse für Nichtmitglieder gegen Bezahlung anbietet. Die entsprechende Ausrichtung des Vereins hat dann auch Auswirkungen auf die jeweiligen Finanzierungsmöglichkeiten und -bedürfnisse.
Häufig gelten das Finden und Nutzen neuer Finanzquellen als Königsdisziplin. Wir starten jedoch mit einem für Vereine geeigneten Handwerkszeug für die Vereinsfinanzen (Kapitel 3). Darin geht es z. B. um Finanzplanung, Budgetierung, Liquiditätsmanagement und die Kostenanalyse. Aber auch das Risiko- und Krisenmanagement muss angesprochen werden. Es nützt ja wenig, wenn man immer neues Geld für den Verein heranschafft, dies aber anschließend nicht vernünftig bewirtschaftet wird.
Die Vielzahl der möglichen Einnahmequellen (Kapitel 4) erfordert eine gute Systematik bei der Auswahl der Formen, die zum eigenen Verein und der Finanzierungsaufgabe passen. Die Formen unterscheiden sich auch durch die Vorgehensweise, wenn man sie in Anspruch nehmen will. Entsprechend sind auch die wesentlichen Ausgabemöglichkeiten näher zu betrachten (Kapitel 5).
Kapitel 6 schließlich enthält als Anhang ergänzende Instrumente und Vertiefungen, die für einzelne Vereine wichtig werden können.
Die in diesem Buch verwendeten Quellen sind in Kapitel 7 ausführlich zitiert, damit Sie bei Bedarf darauf zugreifen können.
Die spezifischen Anforderungen im Vereinsbereich richten sich selbstverständlich nach den steuerlichen und sonstigen rechtlichen Besonderheiten, die – insbesondere im Rahmen der Gemeinnützigkeit – beachtet werden müssen. Weitere rechtliche Regelungen, z. B. zu Satzungsregelungen, zur Beteiligung der Mitglieder per Abstimmung und zur Rechnungslegung, können hinzukommen. Die rechtlichen Bedingungen werden hier nicht weiter betrachtet, da es dazu bereits umfangreiche Informationsquellen gibt. Viele Hinweise enthält z. B. die Loseblatt-Sammlung »Der Verein« (Geckle o. J.). Nur an einzelnen Stellen haben wir entsprechende Hinweise aufgenommen.
Lesetipps:
Leser:innen, die mit dem Thema Finanzierung starten, beginnen mit dem ersten Einblick ab Kapitel 2.
Leser:innen, welche die Grundlagen der Finanzierung schon kennen und sich zunächst für das Handwerkszeug interessieren, beginnen mit Kapitel 3.
Leser:innen, die an den konkreten Ansatzpunkten für Einnahmen und Ausgaben interessiert sind, starten mit den Kapiteln 4 und 5.
Natürlich können Sie jederzeit zurückblättern, wenn die Darstellungen in den Kapiteln zu Nachfragen führen.
2 Ein erster Einblick: Geldströme im Verein
Aus der Praxis unserer Vereinsvertreter:innen
Telefonat zwischen Jan und Konrad:
Jan: Hallo Konrad, wie geht es dir? Ich habe da mal eine Frage.
Konrad: Hallo Jan, soweit alles okay. Wo drückt der Schuh?
Jan: Bei uns steht demnächst die Mitgliederversammlung mit Neuwahlen an. Der Vorstand hat mich gefragt, ob ich das Amt des Schatzmeisters übernehmen könnte. Da bin ich dann doch unsicher, ob ich das hinbekomme. Gesunden Menschenverstand habe ich ja, aber … die Finanzlage in unserem Verein scheint eher auf Kante genäht zu sein, soweit ich das im Moment sehen kann.
Konrad: Du meinst, du hast ein komisches Gefühl dabei? Vielleicht solltest du erst einmal eine Bestandsaufnahme machen. Wo gibt es bei euch denn Unklarheiten?
Jan: Na ja, so genau weiß ich das nicht. Aber allein schon die vielen mündlichen Absprachen, vor allem bei Zusagen für finanzielle Unterstützungen. Und auch der Umgang mit ausstehenden Beiträgen. Ich habe keine Lust, als der Mensch in die Vereinsgeschichte einzugehen, der die Insolvenz beantragt.
Konrad: Das kann ich verstehen. Zuerst solltest du genau schauen, wie der Stand der Dinge ist. Dazu sind sicherlich einige Gespräche notwendig. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei.
2.1 »Geld regiert die Welt« – und auch den Verein
Es ist eigentlich ganz einfach: Kann ein Verein seine Rechnungen nicht mehr bezahlen, hat er ein echtes Problem. Genau wie bei großen Unternehmen oder Privatmenschen kann am Ende die Insolvenz stehen. Die Liquidität bzw. Zahlungsfähigkeit ist das zentrale Überlebenskriterium in unserer Gesellschaft. Es geht also in erster Linie um die Beschaffung von Finanzmitteln und die gute Bewirtschaftung. Da Vereine aber in vielen Fällen als Nonprofit-Organisationen arbeiten und damit an erster Stelle ein Sachziel und kein Finanzziel (Gewinn, Rendite) verfolgen, ist das Umgehen mit den Finanzen speziell.
Wirtschaftsunternehmen streben mit dem Absatz ihrer Produkte und Dienstleistungen nach Gewinn – finanzielle Maßstäbe sind letztlich leitend für die Entscheidungen. Ein Gesangsverein strebt in erster Linie danach, Angebote für seine Mitglieder auf die Beine zu stellen, künstlerische Leistungen zu ermöglichen und keinen Verlust zu produzieren. Entscheidungsgrundlage ist also das inhaltliche Angebot. Hier muss geschaut werden, wie dafür die Finanzen zusammenkommen.
Auf den Punkt
Hauptorientierung des Vereins ist die Arbeit in Richtung auf ein Sachziel. Das ist meist kein wirtschaftliches Ziel. Dennoch muss die Kasse stimmen.
Hinzu kommt, dass viele Vereine in hohem Maße auf freiwillige und unentgeltliche ehrenamtliche Mitarbeit angewiesen sind. Ein Thema, das sich in den Finanzen auf den ersten Blick nur in sehr geringem Umfang niederschlägt, aber – neben den Mitgliedsbeiträgen – die zweite Lebensgrundlage vieler Vereine ist. Bei den Ausgaben fällt vielleicht eine Ehrenamtspauschale an, Reisekosten oder Kosten für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen. Demgegenüber steht der Einsatz persönlicher Lebenszeit und Kompetenz, der in einer solchen Finanzbetrachtung höchstens indirekt, als eingesparte Bezahlung von Mitarbeiter:innen, vorkommen könnte. Leider ist der Begriff des »Ehrenamts« in Bezug auf die Bezahlung heute vielfach verwässert, denn eine Erstattung von realen Auslagen oder die Zahlung der Ehrenamtspauschale sind möglich. Für dieses Buch gelten alle Mitarbeiter:innen ab einem Minijob bzw. Honorarkräfte als bezahlte Kräfte. Das ist auch nicht schlimm. Wo ein Verein funktionieren soll und unentgeltliches Engagement fehlt, muss bezahlte Mitarbeit zum Einsatz kommen.
Vereinsfinanzierung, EinflüsseWie schon kurz angesprochen wirken viele Einflüsse, sowohl von außen als auch von innen, auf die Rahmenbedingungen der Vereinsfinanzierung ein (Abbildung 1).
Abb. 1: Einflüsse auf die Vereinsfinanzierung (Grafik: Wach)
öffentliche KassenDa sind zum Beispiel die öffentlichen Kassen der Länder und Kommunen, die ihrerseits seit Jahren sparen müssen. Auch die Wirtschaftspartner der Vereine verlängern Verträge in manchen Fällen nicht oder sie kommen Zahlungsversprechen nicht mehr oder nur verspätet nach.
Auf der anderen Seite fehlen den Vereinen z. B. aufgrund der demografischen Entwicklung oder einer nachlassenden Attraktivität des Vereinsprogramms neue zahlungsbereite Mitglieder. Erschwerend kommt hinzu, dass die Bereitschaft, sich ehrenamtlich bzw. freiwillig zu engagieren, abnimmt. Das bedeutet: Der Verein muss im Zweifelsfall über bezahlte Mitarbeit oder bei Dienstleistern Leistungen gegen Entgelt zukaufen.
In dieser mit einigen Unsicherheiten gespickten Situation hat die Vereinsführung aufmerksam und mit der notwendigen Vorsicht die finanziellen Belange des Vereins zu steuern. Das ist nicht immer einfach und verlangt eine genaue Abschätzung der aktuellen Lage und der Möglichkeiten der zukünftigen Entwicklung. Insofern ist das Finanzthema in den Vereinen mit der Vereinsstrategie und der daran gekoppelten Zukunftsfähigkeit verbunden. Dabei hilft ein systematisches Bild des eigenen Vereins, aus dem die wesentlichen Punkte für das Funktionieren ersichtlich sind.
2.2 Vereinsressourcen – die Grundlagen der Vereinsexistenz
VereinsressourcenUnabhängig von der Art und den Themenbereichen eines Vereins gibt es eine gleichbleibende Grundsystematik. Die Vereinsressourcen bilden die Lebensgrundlagen eines Vereins (Abbildung 2). Finanzmittel sind zwar eine eigenständige Kategorie, der Finanzbedarf und der Zugang zu einzelnen Finanzquellen sind aber eng mit den anderen Ressourcen verbunden.
2.2.1 Grundkonzept der Vereinsressourcen
Abb. 2: Ressourcenmodell für Vereine (Quelle: Wadsack)
In Abbildung 2 sind drei wesentliche Bereiche zu unterscheiden:
Bereich 1: Die eigentlichen Vereinsressourcen innerhalb des Ovals, dargestellt als Dreiecke bzw. Trapeze.
VereinskulturBereich 2: Hinzu kommt die Vereinskultur als Ausdruck für alles, wofür der Verein steht: Ziele bzw. Themen des Vereins, der persönlichen Umgang miteinander, seine Geschichte und Tradition. Die Vereinskultur ändert sich mit der Zeit, durchdringt alle anderen Bereiche und bildet die Grundlage für die Mitgliederbindung.
VereinsführungBereich 3: Die Vereinsführung ist nicht nur eine rechtliche Instanz, sondern muss vor allem mit ihrer inhaltlichen und zukunftsorientierten Arbeit für die Fortexistenz des Vereins überzeugen – selbstverständlich auf der Basis der Entscheidungen der Mitgliederversammlung. Der strategische Auftrag ist also die Sicherung oder sogar der Ausbau der für die Vereinsarbeit notwendigen Ressourcen. Die aktuelle inhaltliche Arbeit zeigt dann das Vereinsprogramm.
Vereinsführung, AufgabenDie Vereinsführung hat, neben der grundsätzlichen Aufgabe der strategischen Planung, die Sicherung und Entwicklung der Vereinsressourcen als wichtige Herausforderungen zu meistern. Um die finanzielle Lebensfähigkeit des Vereins zu sichern, muss sie
die finanzielle Planung und Kontrolle des Vereinshaushalts verantworten,
sich um die Beschaffung von finanziellen Ressourcen kümmern,
die Beschaffung von Sachmitteln unterstützen sowie
die Akquise von Spenden und Sponsoring fördern.
Die Rolle der Vereinsführung variiert je nach Größe und Art des Vereins. In kleineren Vereinen übernimmt normalerweise der Vorstand die Führungsaufgaben. In großen Vereinen wird i. d. R. ein hauptamtlicher Geschäftsführer oder eine Geschäftsführerin eingesetzt.
Auf den Punkt
Im Rahmen ihrer Aufgabe zur strategischen Vereinsentwicklung und Sicherung der Zukunftsfähigkeit spielt der Bereich Finanzen eine sehr zentrale Rolle.
VereinsprogrammDas Vereinsprogramm hat eine wichtige Stellung. Die Leistungen des Vereins sind entweder nur für die Mitglieder gedacht oder auch für Personen außerhalb des Vereins. Mischformen sind in der Praxis ebenfalls zu finden, wenn z. B. neben den auf Mitglieder beschränkten Angeboten Kurse für Nichtmitglieder existieren oder Auftritte für ein Publikum gegen Entgelt zum Vereinsprogramm gehören.
Die einzelnen Ressourcen werden im Folgenden genauer erläutert und erste Verbindungen zur Finanzierungsthematik hergestellt.
2.2.2 Finanzmittel
Vereinsressourcen, FinanzmittelFinanzmittelVon seinem Grundgedanken her sollte der Verein in der Lage sein, seine Aktivitäten durch die eingebrachten Ressourcen seiner Mitglieder (Beiträge, Spenden, Engagement) durchzuführen. Aus verschiedenen Gründen hat sich die finanzielle Aufstellung von Vereinen im Lauf der Zeit verändert. Subventionierungen aus öffentlichen Kassen, Fundraising einschließlich Mäzenatentum oder der Verkauf von Rechten und Leistungen sind hinzugekommen. Die Möglichkeit, entsprechende Finanzquellen zu nutzen, ist eng mit dem Aufgabengebiet und dem öffentlichen Auftreten eines Vereins verbunden. Das wird in den folgenden Kapiteln dieses Buches sehr deutlich werden.
2.2.3 Infrastruktur, Material und Rechte
Vereinsressourcen, RechteVereinsressourcen, MaterialienVereinsressourcen, InfrastrukturRechteRäumeMaterialienFür die Vereinsarbeit werden meist unterschiedliche Räumlichkeiten und Materialien benötigt. Das könnte zum Beispiel ein Aufenthaltsraum mit einer Küchenzeile für Besprechungen oder ein gemeinsames Frühstück in der Gruppe sein. Hinzu kommen unterschiedliche Materialien wie Malutensilien, Musikinstrumente, ein Beamer, um nur ein paar Beispiele aufzuzählen. Beim Einsatz von Musik für die Vereinsarbeit kann z. B. die Nutzung unter Lizenzbedingungen stehen (z. B. GEMA-Gebühren) – das wären dann erforderliche Rechte. Manchmal sind einzelne Konzepte, welche in der Vereinsarbeit verwendet werden, lizenzpflichtig. Im Sport gilt das zum Beispiel für bestimmte Fitnessangebote. In Zeiten der Digitalisierung sind weitere Rechte erforderlich, sei es zur Nutzung einer bestimmten Software oder für die Inanspruchnahme von Cloud- oder Streamingdiensten.
Auf den Punkt
Es ist wichtig, bei der Nutzung von z. B. gewerblichen Fotos und Bildern, Grafiken, Kartenmaterial oder eben auch Angebotskonzepten die Rechtesituation im Blick zu behalten. Eine Abmahnung mit Strafzahlung wird u. U. teuer.
Und letztlich fallen in den Bereich der Rechte auch die Nutzungsrechte für Räumlichkeiten, sofern diese nicht dem Verein selbst gehören. Dabei ist es unerheblich, ob diese angemietet werden oder kostenfrei zur Verfügung stehen.
2.2.4 Mitglieder
MitgliederVereinsressourcen, MitgliederMitglieder sind der Grund, warum ein Verein existiert. Die Zahlen sind enorm unterschiedlich und können von weniger als zehn bis in die Zehntausende reichen, vom ADAC und anderen Großorganisationen mit Millionen von Mitgliedern einmal abgesehen. In diesem Buch zur Vereinsfinanzierung soll es aber v. a. um die lokalen bzw. regionalen Vereine vor Ort gehen.