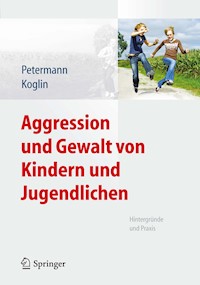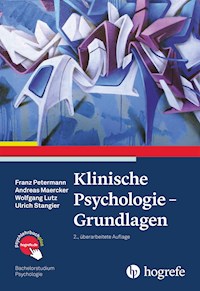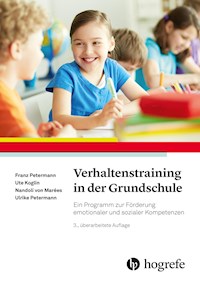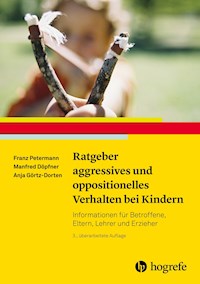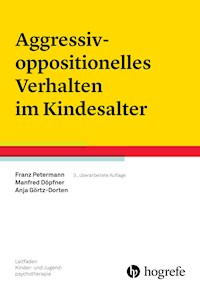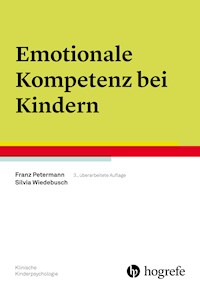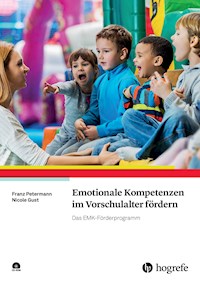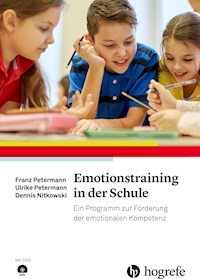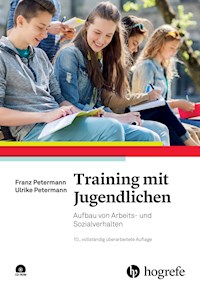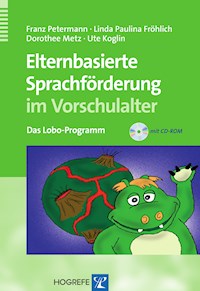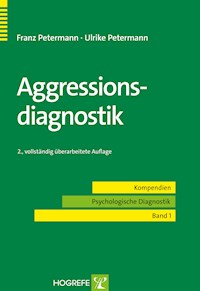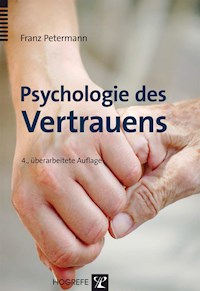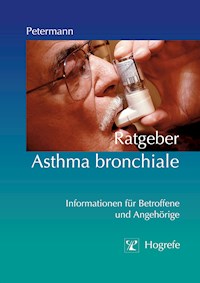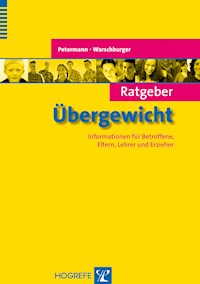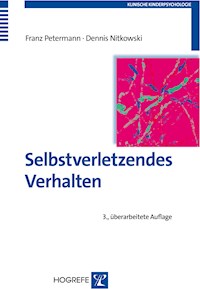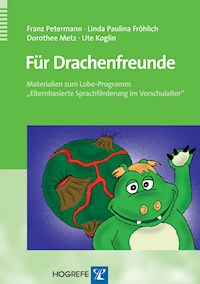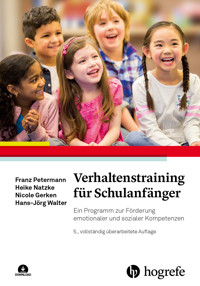
35,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe Verlag
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Das Verhaltenstraining ist ein Gruppenprogramm zur Förderung sozialer und emotionaler Kompetenzen am Schulbeginn. Es trägt dazu bei, frühzeitig oppositionellem und aggressivem Verhalten vorzubeugen. Es hat sich sowohl in der Schule in der ersten und zweiten Klasse als auch in anderen pädagogischen Einrichtungen wie Heilpädagogischen Gruppen oder Kinderhorten gut bewährt. Das vorliegende Trainingshandbuch gibt eine Einführung in den theoretischen Hintergrund des Trainings, behandelt Themen wie Klassenführung und Krisenintervention und enthält detaillierte Beschreibungen der 23 Trainingssitzungen. Im Rahmen dieser Sitzungen begeben sich die Kinder gemeinsam mit dem Chamäleon "Ferdi" auf eine Schatzsuche. Dabei begegnen sie Fantasiefiguren wie Gespenstern und einem Drachen. Auf spielerische Weise werden so Aufmerksamkeit, Problemlösefähigkeit, Konfliktmanagement und Regelverhalten geschult, sowie der Umgang mit Gefühlen, Einfühlungsvermögen, Selbstkontrolle und pro-soziales Verhalten erlernt. Die 5. Auflage wurde vollständig überarbeitet und dabei zeitgemäß aktualisiert und neu illustriert. Einige Figuren wurden neu konzipiert und die Lieder wurden neu eingespielt. Zugunsten einer höheren Flexibilität bei der Durchführung wurden die Rollenspiele von neun auf sechs reduziert und die zeitintensive Punktevergabe am Ende der Stunde gestrichen. Zahlreiche Onlinematerialien zum Training können nach erfolgter Registrierung von der Hogrefe Website heruntergeladen werden. Ein Arbeitsheft für Kinder ist separat erhältlich. Bitte beachten Sie, dass die 5. Auflage des "Verhaltenstrainings für Schulanfänger" nur mit der aktuellen 4. Auflage des Arbeitsheftes kompatibel ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Franz Petermann
Heike Natzke
Nicole Gerken
Hans-Jörg Walter
Verhaltenstraining für Schulanfänger
Ein Programm zur Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen
unter Mitarbeit von Ute von Düring
5., vollständig überarbeitete Auflage
Prof. Dr. Franz Petermann (1953 – 2019). 1991 – 2019 Inhaber des Lehrstuhls für Klinische Psychologie an der Universität Bremen und ab 1996 Direktor des Zentrums für Klinische Psychologie und Rehabilitation der Universität Bremen. Darüber hinaus war er Leiter des Ausbildungsinstituts für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie (NOKI).
Dipl.-Psych. Heike Natzke (1962 – 2008). 1999 – 2008 Mitarbeiterin am Zentrum für Klinische Psychologie und Rehabilitation der Universität Bremen.
Dipl.-Psych. Nicole Gerken, geb. 1972. Seit 2010 als niedergelassene Psychologische Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche in Bremerhaven tätig.
Dr. Hans-Jörg Walter, geb. 1951. Seit 1999 als niedergelassener Psychologischer Psychotherapeut für Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Bremen tätig. Seitdem als Dozent, Supervisor (ab 2003) und Lehrtherapeut für das Norddeutsche Institut für Verhaltenstherapie (NIVT) in Bremen tätig.
Wichtiger Hinweis: Der Verlag hat gemeinsam mit den Autor:innen bzw. den Herausgeber:innen große Mühe darauf verwandt, dass alle in diesem Buch enthaltenen Informationen (Programme, Verfahren, Mengen, Dosierungen, Applikationen, Internetlinks etc.) entsprechend dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes abgedruckt oder in digitaler Form wiedergegeben wurden. Trotz sorgfältiger Manuskriptherstellung und Korrektur des Satzes und der digitalen Produkte können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden. Autor:innen bzw. Herausgeber:innen und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und keine daraus folgende oder sonstige Haftung, die auf irgendeine Art aus der Benutzung der in dem Werk enthaltenen Informationen oder Teilen davon entsteht. Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Alle Rechte, auch für Text- und Data-Mining (TDM), Training für künstliche Intelligenz (KI) und ähnliche Technologien, sind vorbehalten. All rights, including for text and data mining (TDM), Artificial Intelligence (AI) training, and similar technologies, are reserved.
Die erste Auflage des Werkes ist 2002 im Verlag Ferdinand Schöningh erschienen.
Copyright-Hinweis:
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
Merkelstraße 3
37085 Göttingen
Deutschland
Tel. +49 551 999 50 0
www.hogrefe.de
Umschlagabbildung: © iStock.com / FatCamera
Illustrationen: Lena Walter, Bremen
Satz: Franziska Stolz, Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen
Format: EPUB
5., vollständig überarbeitete Auflage 2025
© 2006, 2013, 2016, 2025 Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen
(E-Book-ISBN [PDF] 978-3-8409-3013-3; E-Book-ISBN [EPUB] 978-3-8444-3013-4)
ISBN 978-3-8017-3013-0
https://doi.org/10.1026/03013-000
Nutzungsbedingungen:
Durch den Erwerb erhalten Sie ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das Sie zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere dürfen Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernt werden.
Das E-Book darf anderen Personen nicht – auch nicht auszugsweise – zugänglich gemacht werden, insbesondere sind Weiterleitung, Verleih und Vermietung nicht gestattet.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden. Davon ausgenommen sind Materialien, die eindeutig als Vervielfältigungsvorlage vorgesehen sind (z. B. Fragebögen, Arbeitsmaterialien).
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Download-Materialien.
Die Inhalte dürfen nicht zur Entwicklung, zum Training und/oder zur Anreicherung von KI-Systemen, insbesondere von generativen KI-Systemen, verwendet werden. Das Verbot gilt nicht, soweit eine gesetzliche Ausnahme vorliegt.
Zitierfähigkeit: Dieses EPUB beinhaltet umrandete Seitenzahlen (Beispiel: 1) und in einer Seitenliste, die den Seitenzahlen der gedruckten Ausgabe und des E-Books im PDF-Format entsprechen.
5Vorwort zur 5. Auflage
Es hat uns alle tief getroffen und fassungslos gemacht, dass unser Mitautor, Mentor und Freund, Prof. Dr. Franz Petermann, verstorben ist. Es ist mit seinem Tod nicht nur eine große wissenschaftliche Lücke, sondern auch der Wille entstanden, seine Ideen und Projekte in der Verhaltenspsychologie und besonders in der Kinderpsychologie weiterzuführen und weiterzuentwickeln. So auch das Verhaltenstraining für Schulanfänger, das nun in der 5., vollständig überarbeiteten Auflage vorliegt.
Seit Erscheinen der 4. Auflage haben sich die gesellschaftlichen Bedingungen verändert: verstärkte Migration, die Corona-Pandemie, Kriege mit vielen Geflüchteten, die zunehmende Digitalisierung, um nur einige Einflussgrößen auf unser Zusammenleben zu nennen. Sie machen sich natürlich auch im schulischen Alltag bemerkbar. Glücklicherweise gibt es auch positive Entwicklungen in unserer Gesellschaft, wie mehr Toleranz gegenüber Anderslebenden, mehr Offenheit für konstruktive Veränderungen, das Einsetzen für demokratische Werte.
All diese Entwicklungen spiegeln sich im Schulalltag wider und machen es Kindern, Eltern und den Lernbegleitern oftmals nicht leicht, gemeinsam das Ziel einer gelungenen und produktiven Schulstunde, bis hin zum gewünschten Abschluss der Schulzeit zu erreichen.
Veränderte gesellschaftliche Bedingungen verlangen neue pädagogische und didaktische Strukturen in der Schule. Das Vorhaben der Integration in den Schulen entwickelt sich in vielen Bundesländern nur schleppend und belastet Lehrkräfte, und Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen sowie die betroffenen Kinder gleichermaßen. Das angestrebte Lernen und sich Entwickeln von behinderten und nicht behinderten Menschen, von kognitiv schwachen und hochintelligenten Kindern, das Einbeziehen von geflüchteten Kindern, von Kindern mit unterschiedlichen familiären Werten und Normen sowie die Integration schwer chronisch kranker Kinder, all das fordert die Schule und letztendlich die Lehrkräfte extrem heraus und bringt diese nicht selten an ihre Grenzen.
Das Verhaltenstraining für Schulanfänger will hier einen Beitrag zu Verbesserungen im täglichen Miteinander leisten. Wie wir sehen werden, ist ein integratives und angemessenes Sozialverhalten von vielen äußeren und inneren Faktoren abhängig.
6Wir haben das Training mit neuen Illustrationen versehen, nicht mehr zeitgemäße Inhalte und Äußerungen verändert oder gänzlich herausgenommen. Die Punktevergabe nach jeder Trainingsstunde haben wir zugunsten der Möglichkeit eines individuelleren pädagogischen Vorgehens gestrichen, auch um mehr Raum für soziale Lerninhalten zu schaffen, da die Vergabe der Punkte viel Zeit in Anspruch genommen hat.
Einige Figuren des Trainings wurden verändert bzw. neu konzipiert (u. a. Cordula von Eich und der Ärgerdrache). Es gibt ein neues Suchbild zum Training der visuellen Wahrnehmung. Die Lieder wurden neu komponiert und eingespielt. Der Einstieg in die vierte Stufe wurde neu konzipiert und die daran anschließenden Rollenspiele wurden von neun auf sechs Situationen reduziert.
Wir danken besonders Frau Prof. Dr. Ute von Düring für die Aktualisierung des Theorieteils. Ihre großen Kompetenzen als Wissenschaftlerin am Institut für Sonder- und Rehabilitationspädagogik der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, gepaart mit ihrer langjährigen Erfahrung in der Konzeption und Umsetzung von Verhaltenstrainings in der Grundschule, sind für die 5. Auflage dieses Trainings ein großes Glück und eine enorme Bereicherung.
Die Ideen zu diesen Änderungen verdanken wir nicht zuletzt den konstruktiven Kritiken, Ideen und Beiträgen unserer Leserschaft sowie den Pädagoginnen und Pädagogen, die in ihrem Schulalltag wichtige Erkenntnisse gewinnen konnten.
Bei der Umsetzung unserer Ideen wurden wir tatkräftig unterstützt und möchten uns auf diesem Wege ganz herzlich bei Lena Walter bedanken, die für uns die wunderschönen neuen Illustrationen gestaltet hat. Das Wimmelbild ist absolute Klasse! Darüber hinaus gilt unser Dank Fenna und Iris Walter, sowie Ella Boeck und Kira Ibs von Seth, Janna Richter und Marlene Michalski, die uns tatkräftig beim Einsingen unserer neuen Lieder unterstützt haben.
Bremen, im September 2024
Nicole Gerken und
Hans-Jörg Walter
7Vorwort zur 1. Auflage
Jeder Übergang im Leben ist mit neuen Anforderungen und Aufgaben verbunden. Mit dem Eintritt in die Schule beginnt der „Ernst des Lebens!“ – so drohten uns früher unsere Eltern. Die Einschulung ist oft gleichbedeutend mit dem ersten, unumkehrbaren Schritt des Kindes ins Erwachsenenleben. Man wird erstmals mit unausweichlichen Anforderungen, festen „Dienstzeiten“, „Urlaub“ (Ferien), Aufgaben und Hausaufgaben konfrontiert. Die Kinder arbeiten in weitgehend willkürlich zusammengesetzten Gruppen, die abgelieferte Arbeit wird bewertet und ein Curriculum gibt das Arbeitstempo vor.
Viele Kinder sind diesen neuen Herausforderungen nicht gewachsen. Sie reagieren mit ungünstigem Sozialverhalten. Ungünstiges Sozialverhalten (mangelnde Mitarbeit, Unsicherheit, soziale Angst, oppositionell-aggressives Verhalten) gefährdet jedoch den Schulerfolg. Gerade in der Phase des Schulbeginns führt ungünstiges Sozialverhalten oft zu schlechten Schulleistungen. Darüber hinaus torpediert ungünstiges Sozialverhalten das „soziale Klima“ in der Klasse. Wenn bereits beim Eintritt in die Schule „das Faustrecht“ regiert, kann sich das Verständnis für soziale Regeln, die Freude am konstruktiven Wettbewerb und besonders die Entwicklung von Teamgeist nur sehr bedingt herausbilden.
Aus diesem Grund traten die Bremer Schulbehörde, das Landesinstitut für Schule (LIS) des Landes Bremen und die Senatorische Behörde für Bildung und Wissenschaft (Bremen) mit der Bitte an uns heran, ein präventives Verhaltenstraining für Schulanfänger zu entwickeln. Eine Arbeitsgruppe des Zentrums für Klinische Psychologie und Rehabilitation um Frau Dr. Dorothee Verbeek erarbeitete mit mir vor dem Hintergrund internationaler und eigener Präventionsprogramme ein Konzept, das vom Land Bremen finanziell unterstützt und gemeinsam mit dem Landesinstitut für Schule (LIS) realisiert wurde. Das Land Bremen übernahm den Hauptanteil der Kosten dieses Praxisprojektes, das in den Jahren 1999 und 2000 durchgeführt wurde.
Frau Dipl.-Psych. Heike Natzke und Dipl.-Psych. Nicole Gerken ist die Umsetzung des theoretischen Konzeptes in das nun vorliegende Verhaltenstraining für Schulanfänger zu verdanken. Zu ihren besonderen Leistungen gehörte darüber hinaus die Entwicklung und Durchführung der Lehrerfortbildungen, die Gestaltung unse8rer „Ferdi-Geschichte“ und vieles andere mehr. Mit Rat und Tat und seiner langjährigen praktischen Erfahrung als Psychologischer Psychotherapeut stand uns dabei Dr. Hans-Jörg Walter zur Seite. Frau Iris Walter (Bremen) erstellte als Mitglied unserer Gruppe alle Zeichnungen.
Wir bedanken uns bei den vielen Bremer Grundschulen, die uns durch ihre Kooperation und ihr Engagement unterstützten. Die Begeisterung der Lehrer, der Eltern und der Kinder verdeutlichte uns unmittelbar, dass unser eingeschlagener Weg richtig war.
Den Lesern und den Kindern, die mit unserem Training arbeiten, wünschen wir Spaß und Erfolg. Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wenn Sie unsere Hilfe bei der Umsetzung des Trainings brauchen.
Bremen, im Februar 2002
Für die Autorengruppe
Prof. Dr. Franz Petermann
131 Einleitung
Schulisches Lernen und Sozialverhalten entscheiden über den Schulerfolg eines Kindes. Oft behindert ungünstiges Sozialverhalten das schulische Lernen. Um die Schullaufbahn von Anfang an positiv zu beeinflussen, entwickelten wir seit 1999 ein neues Programm für die Phase des Schulbeginns, um den Kindern das „Einleben“ in die Schule zu erleichtern.
Wir bezeichnen unser Programm als „Verhaltenstraining“, wobei diese Wortwahl verdeutlichen soll, dass Sozialverhalten lern- und einübbar ist. Durch das Einüben von positivem Sozialverhalten soll problematisches Sozialverhalten reduziert werden. Problematisches Sozialverhalten wird vielfach schon im Kindergarten beobachtet und vom sozialen Bezugsfeld des Kindes oft (ungewollt) bekräftigt. Das bewirkt, dass Kinder bestimmte emotionale und soziale Fertigkeiten (= Kompetenzen) nicht entwickeln. Neuere entwicklungspsychologische Studien weisen darauf hin, dass der Erwerb sozialer Fertigkeiten ein breites Spektrum an sozial-kognitiven und emotionalen Kompetenzen voraussetzt (Denham, Bassett, Zinsser & Wyatt, 2014). So mangelt es Kindern mit auffälligem Sozialverhalten häufig an geeigneten Emotionsregulationsstrategien (Kullik & Petermann, 2012; Petermann & Wiedebusch, 2016; Webster-Stratton, 2000). Der Erwerb wirksamer Emotionsregulationsstrategien ist eng mit der Fähigkeit zur Aufmerksamkeits- und Verhaltenssteuerung verbunden. So gelingt es beispielsweise sozial kompetenten Kindern besser, ihre selektive Aufmerksamkeit auf positive Reize zu lenken. Kinder können auf diese Weise ihre Erregung reduzieren (Eisenberg et al., 2005). Eine angemessene Emotionsregulation und eine differenzierte soziale Wahrnehmung bilden demnach einen bedeutsamen Faktor im Rahmen der Entwicklung von sozial-kognitiven Kompetenzen und müssen bereits früh gefördert werden (Verhoef, van Dijk & de Castro, 2022).
Durch ein frühzeitig durchgeführtes Verhaltenstraining kann es gut gelingen, sozial-kognitive, soziale und emotionale Kompetenzen bei Schulanfängerinnen und Schulanfängern aufzubauen, um so der Entwicklung unangemessener Verhaltensweisen entgegenzuwirken. Das im Folgenden dokumentierte Programm wurde wissenschaftlich überprüft und die Stabilität der Ergebnisse konnte belegt werden (vgl. Gerken et al., 2002; Natzke & Petermann, 2009; Petermann & Natzke, 2008). Unser Verhaltenstraining basiert auf verhaltenspsychologischen Prinzi14pien, die in diesem Buch kurz ausgeführt werden. Als weiterführende Literatur zur Erläuterung verhaltenspsychologischer Prinzipien empfehlen wir die Übersichten von Linden und Hautzinger (2015) sowie von Petermann (2019).
Bevor auf die Grundlagen des Verhaltenstrainings eingegangen wird, soll das Trainingspaket kurz skizziert werden. Das Paket setzt sich aus drei Komponenten zusammen:
dem vorliegenden Trainingshandbuch,
einer Materialiensammlung (Audiodateien und PDF-Dateien), die nach erfolgter Registrierung von der Hogrefe Website heruntergeladen werden kann (siehe „Hinweise zu den Onlinematerialien“ im Anhang),
einem Arbeitsheft für Kinder.
Die für die Durchführung des Verhaltenstrainings notwendige Chamäleon-Handpuppe ist nicht im Trainingspaket enthalten und muss separat bestellt werden. Die Bestellung kann über die Testzentrale Göttingen (Herbert-Quandt-Str. 4, 37081 Göttingen, https://www.testzentrale.de) oder bei Jochen Heil folkmanis-and-more.de (JOCHEN HEIL Shop, Am Haag 11 C, 97234 Reichenberg, https://jochenheil.de) erfolgen.
Das Trainingshandbuch inkl. Onlinematerialien
Das vorliegende Buch gliedert sich in einen theoretischen und einen praktischen Teil, dem eigentlichen Manual zur Trainingsdurchführung. Der theoretische Teil umfasst alle Grundlagen des Trainings. Der praktische Teil des Buchs enthält eine ausführliche Darstellung der einzelnen Trainingssitzungen, inklusive aller Bildmaterialien. Da in einigen Trainingssitzungen zusätzlich zum Bildmaterial auch Audiodateien benötigt werden, stehen alle Materialien zum Download zur Verfügung (siehe „Hinweise zu den Onlinematerialien“ im Anhang). Um Veränderungen im Verhalten der Kinder dokumentieren zu können, befindet sich im Anhang ein auf die Trainingsinhalte abgestimmter Trainingsbeobachtungsbogen, der zusätzlich auch zum Download bereitsteht.
Im praktischen Teil dieses Buches (vgl. Kap. 12) wird jede Trainingssitzung ausführlich in Struktur und Inhalt geschildert. Die detaillierte Darstellung jeder Trainingssitzung wird durch eine Tabelle mit den Lernzielen, dem praktischen Vorgehen sowie einer Aufstellung der für die jeweilige Trainingssitzung benötigten Materialien eingeleitet. Ein Teil der Bildmaterialien des Verhaltenstrainings ist ausschließlich im Kapitel 12 bzw. den Onlinematerialien und nicht im Arbeitsheft enthalten. Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um Motive, die für die Einbindung in das Arbeitsheft der Kinder ungeeignet erschienen. Beispielsweise werden die Kinder auch mit unangemessenen Problem- und Konfliktlösungen konfrontiert. Um die Kinder davor zu bewahren, sich die Negativbeispiele einzuprägen, sol15len diese Lösungen den Kindern lediglich per Whiteboard oder Beamer zugänglich gemacht werden. Dazu müssen sie zuvor aus der Materialiensammlung heruntergeladen werden.
Das Arbeitsheft für Kinder
Um den Kindern die Sammlung loser Arbeitsblätter zu ersparen und eine über den eigentlichen Trainingszeitraum hinausreichende Wirkung der Inhalte zu gewährleisten, sollte jedem Kind ein auf das Verhaltenstraining abgestimmtes Arbeitsheft zur Verfügung gestellt werden. Das Arbeitsheft für die Kinder hat den Charakter einer „Fibel“, in der die wichtigsten Bildmaterialien des Trainings enthalten sind. Es sollte in Klassenstärke vorliegen (Petermann, Gerken & Walter: Auf Schatzsuche. Ein Abenteuer mit Ferdi und seinen Freunden, 4., vollständig überarbeitete Auflage 2025, ISBN 978-3-8017-3304-9). Im Trainingsmanual (Kapitel 12) dieses Buches finden Sie genaue Angaben über die Verwendung des Arbeitsheftes.
Die Trainingshandpuppe
Die Handpuppe, das Chamäleon „Ferdi“, spielt eine wichtige Rolle bei der Durchführung des Trainings. Um der Trainingsleitung den Umgang mit der Handpuppe zu erleichtern, werden in den Darstellungen im Trainingsmanual (Kapitel 12) Textvorschläge für die Handpuppe angeboten. Diese grau hinterlegten Textvorschläge dienen lediglich als Anregung für die individuelle Gestaltung durch die Trainingsleitung. Bei der Realisierung der Handpuppenszenen genügt es, die Kernaussagen der Textvorschläge umzusetzen. Um eine lebendige Ausgestaltung der Szenen zu erreichen, sollte auf Gesten und Stimmmodulation geachtet werden. Die Modulation der Stimme sollte so erfolgen, dass sie für die Schülerinnen und Schüler angenehm klingt. „Ferdi“ sollte dadurch eine freundliche und eigene „Persönlichkeit“ annehmen. Gleichzeitig sollte darauf geachtet werde, eine Stimmmodulation zu wählen, die man während des gesamten Trainings durchhalten kann. Eine gleichbleibende Präsentation der Handpuppe hilft den Kindern dabei, sich mit der Handpuppe zu identifizieren bzw. sie als eigenständige Persönlichkeit wahrzunehmen. Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, dieses vor Beginn des Trainings einmal von Außenstehenden beurteilen zu lassen. Der Umgang mit der Handpuppe muss vor dem Training also unbedingt geübt werden!
162 Trainingsbereich: Sozial-kognitive Kompetenzen
Wir wissen heute, dass Sozialverhalten bei Kindern und Jugendlichen (und auch Erwachsenen) generell von einer Vielzahl unterschiedlicher Faktoren beeinflusst wird. Es spielen hier sowohl personenbezogene, biologische sowie psychische als auch kontextorientierte soziale Aspekte eine bedeutsame Rolle (siehe hierzu auch Kap. 3, 4, 5 und 6). Als ausgesprochen gewichtige Einflussfaktoren für Sozialverhalten haben sich sozial-kognitive Prozesse herauskristallisiert, die darüber entscheiden, wie wir handlungsrelevante Informationen
aufnehmen,
interpretieren,
bewerten und
zur Weiterverarbeitung bereithalten (abspeichern).
Als sozial-kognitive Kompetenzen werden demnach all jene Prozesse bezeichnet, die einem konkreten sozialen Verhalten vorausgehen und seine Ausführung „überwachen“. Im Prinzip kann man von einer inneren Handlungsvorbereitung und -steuerung sprechen. Beelmann und Lösel (2005) bezeichnen sie anschaulich als „Schnittstelle“ zwischen kognitiven Verarbeitungsmechanismen und ihren biologischen Grundlagen einerseits sowie kulturellen und sozialen Einflüssen und der Entwicklung von Handlungskompetenzen andererseits.
Doch welche inneren Prozesse sind an unserer Handlungsplanung beteiligt? Welche inneren Vorgänge geben den Ausschlag darüber, ob ein Kind sich in einer bestimmten konkreten Situation sozial angemessen oder aggressiv und unsozial verhält? Obwohl in den vergangenen Jahren durch Erkenntnisse der Hirnforschung einiges Licht in das Dunkel zerebraler Prozesse gelangte, sind die präzisen Vorgänge, die uns zu bestimmten (sozialen) Verhaltensweisen führen, weiterhin unklar. Es ist jedoch zu vermuten, dass handlungsvorbereitende Prozesse höchst komplexer Natur sind und vielen verschiedenen Einflüssen, wie zum Beispiel Gefühlen, Erfahrungen, der biologischen Konstitution oder auch dem Temperament, unterliegen. Aus diesem Grund wurden sogenannte soziale Informationsverarbeitungsmodelle entwickelt, um diese vermuteten inneren Vorgänge verständlich abzubilden.
17Als eines der bedeutsamsten Modelle gilt das sozial-kognitive Informationsverarbeitungsmodell von Crick und Dodge (1994; s. Abb. 1).
Abbildung 1: Sozial-kognitives Informationsverarbeitungsmodell (modifiziert nach Crick & Dodge, 1994)
Die Autoren gliedern den Verarbeitungsprozess sozialer Informationen in sechs Stufen:
Erkennen sozialer Informationen
Zunächst muss die Ausgangssituation einer sozialen Interaktion erkannt werden. Auslöser können sowohl inneren Vorgängen, wie etwa eigenen Gefühlen oder Gedanken, entsprechen als auch aus der Umwelt wahrgenommen werden.
Beispiel 1: Ich verspüre einen leichten Schlag eines Mitschülers auf den Rücken, während ich mich auf einem Schulhof aufhalte.
Beispiel 2: Ich verspüre einen leichten Schlag eines Mitschülers auf den Rücken, während ich mich auf einem Schulhof aufhalte, und höre eine leise, aber freundliche Begrüßung.
Interpretation und Bewertung der aufgenommenen Informationen
In der nächsten Verarbeitungsstufe werden den wahrgenommenen Reizen Bedeutungen und Ursachen zugeschrieben. Hier entscheidet sich etwa, ob das Verhalten eines Interaktionspartners als feindselig oder friedfertig interpretiert wird.
18Beispiel 1: Ich interpretiere den Schlag auf den Rücken als feindselige Attacke eines Mitschülers und bewerte diese gedanklich („Gemeinheit!“) und emotional (starke Ärgerreaktion).
Beispiel 2: Ich interpretiere den Schlag auf den Rücken als überschwängliche Begrüßung eines Mitschülers und bewerte diese gedanklich („Wie nett!“) und emotional (Freudereaktion).
Klärung des Handlungsziels anhand der Interpretation und Bewertung
Auf der Grundlage der Wahrnehmung und Interpretation der „Auslöser“ wird ein eigenes Handlungsziel, eine Verhaltensreaktion, entworfen.
Beispiel 1: Ich entscheide mich für einen „Vergeltungsschlag“ („Dem zeig’ ich’s! Der soll mich kennenlernen! Mich schlägt niemand ungestraft! Den mache ich fertig!“).
Beispiel 2: Ich entscheide mich für eine freundliche Entgegnung („Na, dem muss ich jetzt erst mal freundlich „Tag“ sagen. Ich freue mich ihn zu sehen.“).
Handlungsrecherche in Abstimmung mit dem Handlungsziel
Anhand des entworfenen Handlungsziels werden mögliche Reaktionen aus dem abgespeicherten Handlungsrepertoire abgerufen oder neue Handlungsmöglichkeiten geplant.
Beispiel 1: Ich könnte treten, hauen oder schubsen und zusätzlich noch schimpfen.
Beispiel 2: Ich könnte ihm auch einen Klaps auf die Schulter geben oder die Hand zum Schütteln hinhalten, lächeln und „Hallo“ sagen.
Handlungsauswahl
Die Handlungsauswahl erfolgt anhand der Kriterien Kosten, Nutzen, Folgen und weiteren Kriterien wie etwa sozialer Erwünschtheit.
Beispiel 1: Im Schubsen bin ich richtig gut. Außerdem habe ich den Gegner dann erst einmal in einiger Distanz zu mir und kann schon mal den nächsten „Schlag“ planen. Ich wähle passend dazu das gemeinste Schimpfwort, das mir einfällt.
Beispiel 2: Ich freue mich unheimlich ihn zu sehen. Ein Klaps auf die Schulter zeigt dem Mitschüler, wie sehr ich mich freue. Ich weiß, dass er das gern mag.
Handlungsausführung
Die ausgewählte Handlung wird eingeleitet und ihre Ausführung überwacht.
Beispiel 1: Ich schubse den vermeintlichen Angreifer mit voller Wucht zurück und beschimpfe ihn unflätig. Es klappt gut. Er stürzt und stöhnt vor Schmerz.
Beispiel 2: Ich gebe dem Mitschüler einen freundlichen Klaps auf die Schulter, lächle ihn an und sage „Hallo“.
Bewertung und Reaktion der Umwelt sowie eigene Empfindungen
Die Reaktionen und Bewertungen von mittelbaren oder unmittelbaren Interaktionspartnern sowie eigene Empfindungen werden registriert und gegebenenfalls zum Auslöser einer erneuten Handlung.
Beispiel 1: Um uns herum hat sich eine erschrockene Menge gebildet. Ich sehe ihre bewundernden Blicke und anerkennendes Johlen. Jetzt komme ich so richtig in Fahrt …
19Beispiel 2: Der Mitschüler lächelt zurück und erzählt mir begeistert von seinem „Einser“ in der Mathematikarbeit.
Die dargestellten kognitiven Verarbeitungsprozesse können natürlich nicht ohne Rückgriff auf den eigenen abgespeicherten Wissens- und Erfahrungsschatz erfolgen. Aus dieser von Crick und Dodge (1994) als „Datenbasis“ bezeichneten „Schaltzentrale“ können beispielsweise Informationen über soziale Regeln, regelkonformes Verhalten, Erinnerungen an ähnliche Vorerfahrungen, Erfolge und Misserfolge mit entsprechenden Verhaltensweisen abgerufen werden. Obwohl das Modell wegen seiner linearen Abfolge etwas anderes suggeriert, laufen all diese Prozesse in der Regel weitgehend automatisiert ab und bieten daher wenig Spielraum für Variationen.
Das ursprüngliche Modell von Dodge et al. (1997) wurde von Lemerise und Arsenio (2000) insofern modifiziert, als dass sie einen stärkeren Beitrag von Emotionen an den beschriebenen Prozessen postulieren. Demnach kann man von einer emotionalen Beteiligung auf praktisch jeder der sechs Verarbeitungsstufen ausgehen.
Welche Informationen wir aufnehmen und wie wir sie bewerten und in unser Erfahrungsspektrum einordnen, entscheidet maßgeblich darüber, wie wir Beziehungen und Kommunikation gestalten (vgl. Aronson, Wilson & Akert, 2004; Zimbardo & Gerrig, 2004; Zimmer, 2005). So hat sich in vielen Studien gezeigt, dass Kinder mit problematischen, aggressiven Verhaltensweisen Defizite und Abweichungen auf allen beschriebenen Verarbeitungsstufen aufweisen. Aggressive Kinder
zeigten demnach eine stärkere selektive Aufmerksamkeit für aggressive Hinweisreize,
nahmen ihre Interaktionspartner als aggressiver wahr und unterstellten ihnen häufiger feindselige Absichten,
entwarfen eher unsoziale, aggressive Ziele,
zeigten ein tendenziell eingeschränktes Handlungsrepertoire mit dem Schwergewicht auf aggressivem und impulsivem Verhalten,
wählten eher Handlungen mit geringerer Selbstkontrolle und kurzfristiger Orientierung und
beurteilten Konsequenzen aggressiven Verhaltens eher positiv (vgl. u. a. Gifford-Smith & Rabiner, 2004; Lösel & Beelmann, 2005; Lösel & Bliesener, 2003; Petermann & Petermann, 2013; Zelli, Dodge, Lochman, Laird & Conduct Problems Prevention Research Group, 1999).
Es lässt sich weiter aufzeigen, dass Kinder mit impulsivem aggressivem Verhalten Verzerrungen in anderen Schritten der sozialen Informationsverarbeitung aufzeigen als Kinder mit zielgerichtetem aggressivem Verhalten (Verhoef, van Dijk & de Castro, 2022). Kinder, die starke Wut empfinden, neigen dazu, anderen eher feindselige Absichten zu unterstellen. Zudem haben sie Schwierigkeiten, Emotio20nen zu regulieren, sodass Wut oder Frustration direkt zu aggressivem Verhalten führt. Andere Schritte der Informationsverarbeitung, wie zum Beispiel das Nachdenken über die Konsequenzen des Verhaltens, werden dann übersprungen. Auf der anderen Seite gibt es Kinder, die aggressives Verhalten zielorientiert einsetzen. Sie haben gelernt, damit ihre Ziele erfolgreich zu erreichen. Verhoef et al. (2022) empfehlen daher, diesen Stil der sozialen Informationsverarbeitung bei Kindern zu beobachten und in der Förderung zu berücksichtigen.
Es sind jedoch nicht nur Kinder mit aggressiven Verhaltensweisen, die Defizite in der sozialen Informationsverarbeitung aufzeigen (Luebbe, Bell, Allwood, Swenson & Early, 2010). Kinder mit ängstlichem Verhalten und depressiven Symptomen weisen ebenfalls solche Defizite auf. Diese Kinder fokussieren zum Beispiel stärker auf bedrohliche oder potenziell negative Reize als Kinder ohne Depressionen oder Ängsten. Negative Emotionen wie Angst oder Trauer können dazu führen, dass anderen Kindern eher feindselige Absichten oder Desinteresse unterstellt wird. In uneindeutigen sozialen Situationen, z. B. eine Gruppe von Kindern lacht, neigen sozial ängstliche Kinder dazu, das Lachen negativ auf sich zu beziehen, obwohl es nichts mit ihnen zu tun hat (Nikolic, 2020). Gleichzeitig berichten traurige Kinder weniger von sozialen Zielen wie Freundschaft und Beziehungen mit Gleichaltrigen. Die Kinder erwarten eher negative Folgen aufgrund ihrer Handlungen oder ihrer Leistung. Dadurch werden soziale Handlungen unterdrückt bzw. vermieden. Es wird angenommen, dass dieser Stil der sozialen Informationsverarbeitung negative Gefühle und damit Ängste und Depressionen aufrechterhält oder sogar verstärkt.
Um derartigen Defiziten vorzubeugen, sollten Kinder bereits frühzeitig in der differenzierten Verarbeitung sozialer Informationen gestärkt werden. Im Verhaltenstraining für Schulanfänger erfolgt eine Förderung sozial-kognitiver Kompetenzen speziell in der Trainingsstufe 2 (Aufmerksamkeitslenkung, differenzierte Wahrnehmung und Interpretation) sowie in der Trainingsstufe 4 (vor allem das Finden vieler alternativer Lösungsstrategien, Antizipation von Handlungskonsequenzen und Bewertung von Handlungen und deren Konsequenzen).
213 Trainingsbereich: Emotionale Kompetenzen
Erst der kompetente Umgang mit eigenen Gefühlen und den Gefühlen anderer ermöglicht es uns, ein angemessenes Verhaltensrepertoire zu entwickeln, befriedigende Beziehungen zu knüpfen, aber auch uns vor Gefahren zu schützen. Wie wir in Kapitel 2 sehen konnten, sind Emotionen auf praktisch allen Stufen kognitiver Verarbeitung sozialer Informationen mitbeteiligt. Doch was versteht man unter emotionalen Kompetenzen?
Petermann und Wiedebusch (2016) fassen unter dem Begriff der emotionalen Kompetenz die folgenden Aspekte zusammen:
den eigenen mimischen Ausdruck von Emotionen,
das Erkennen des mimischen Emotionsausdrucks anderer,
den sprachlichen Emotionsausdruck,
das Emotionswissen und -verständnis und
die selbstgesteuerte Emotionsregulation.
Es existieren mittlerweile verschiedene Konzepte zur emotionalen Kompetenz. Ein weithin anerkanntes Konzept wurde von Saarni (1999; 2002) entwickelt. In diesem Konzept werden emotionale Kompetenzen vor allem im Hinblick auf ihren Nutzen für soziale Interaktionen betrachtet. Demnach liegt emotionale Kompetenz vor, wenn Kinder emotionale Fertigkeiten in sozialen Interaktionen anwenden und so selbstwirksames Verhalten zeigen. Man kann also von emotionaler Selbstwirksamkeit sprechen, wenn:
Kinder sich darüber bewusst sind, dass ihr eigener Emotionsausdruck andere Personen beeinflusst, und
sie gelernt haben, ihr Verhalten strategisch zu steuern, um gewünschte Reaktionen bei anderen hervorzurufen.
Saarni (2002) beschreibt acht emotionale Schlüsselfertigkeiten, die Kinder in sozialen Beziehungen erlernen und die stark von familiären und kulturellen Einflüssen geprägt sind.
22Kasten 1:Acht Schlüsselfertigkeiten emotionaler Kompetenz (nach Saarni, 2002, S. 13)
• Die eigenen Gefühle erkennen;
die Gefühle anderer erkennen und verstehen;
die Fähigkeit, altersangemessenes Emotionsvokabular verstehen und einsetzen zu können;
sich in andere einfühlen können;
wissen, dass Gefühlserleben und Gefühlsausdruck unterschiedlich sein können;
mit belastenden Emotionen und Problemsituationen angemessen umgehen können;
wissen, dass soziale Beziehungen durch das emotionale Ausdrucksverhalten mitgeprägt werden;
emotionales Selbstwirksamkeitserleben.
Die eigenen Gefühle erkennen. Erst mit dem Erkennen und dem Bewusstsein für eigene Gefühle wird die Voraussetzung geschaffen, über Gefühle zu reden. Ist man sich der eigenen Gefühle bewusst, kann man anderen mitteilen, wie es einem geht. Beim Erleben belastender Gefühle wird es so leichter, nach Lösungen zu suchen.
Die Gefühle anderer erkennen und verstehen. Es ist notwendig, das Ausdrucksverhalten anderer zu erkennen, situationsbedingte Ursachen für Emotionen zu verstehen und zu begreifen, dass emotionale Zustände höchst subjektiv sind. Durch das Verständnis der Subjektivität emotionalen Erlebens wird deutlich, dass Menschen in gleichen Situationen sehr verschiedene Gedanken und Gefühle haben können. Die Fähigkeit, Emotionen anderer zu erkennen, führt dazu, das eigene Handeln besser auf den Interaktionspartner abstimmen zu können. Erst wenn ein Kind beispielsweise erkennt, dass ein anderes Kind traurig ist, kann es ihm helfen und es trösten.
Die Fähigkeit, altersangemessenes Emotionsvokabular verstehen und einsetzen zu können. Das Emotionsvokabular variiert mit dem Alter, der kulturellen Zugehörigkeit und Subkultur. Mit zunehmendem Alter wird es notwendig, dabei auch soziale Rollen und Verhaltenskonventionen mit zu berücksichtigen. So wird mit fortschreitender Kindheit gelernt, dass es zum Beispiel nicht in jeder Situation angemessen ist, aufrichtig mitzuteilen, wie man sich gerade fühlt.
Sich in andere einfühlen können. Diese Fähigkeit geht über das bloße Erkennen des Gefühls hinaus. Empathisch auf andere zu reagieren bedeutet, die Gefühle anderer nachzuempfinden und sich in die Gefühlswelt anderer hineinzuversetzen. Diese Fähigkeit gilt als eine wesentliche Voraussetzung für prosoziales Verhalten.
Wissen, dass Gefühlserleben und Gefühlsausdruck unterschiedlich sein können (Maskierung). Die Fähigkeit eigene Gefühle vor anderen verbergen zu können, diese also zu „maskieren“, ist für ein Leben in der Gemeinschaft notwendig. Würden 23wir immer sofort deutlich zeigen, wie wir uns fühlen, würde ein friedlicher Umgang mit anderen deutlich erschwert. Man würde häufiger der vollen Stärke, der Wut oder der Trauer des jeweils anderen ausgesetzt sein. So wäre beispielsweise ein „diplomatischer Umgang“ in Krisensituationen nahezu unmöglich. Die Fähigkeit zur Maskierung hilft uns, eigene Ziele zu erreichen, sich beispielsweise zu schützen. Die Erkenntnis, dass es in bestimmten Situationen sinnvoll ist, eigene Emotionen zu maskieren, bezieht sich sowohl auf die eigene Person als auch auf andere Personen. Ein Kind lernt, dass nicht nur es selbst eigene Gefühle maskiert, sondern auch andere. In diesem Zusammenhang lernen Kinder zudem, wie ihr Ausdrucksverhalten andere beeinflusst und das Wissen darüber, wie es wirkt.
Mit belastenden Emotionen und Problemsituationen angemessen umgehen können. Dies schließt den Einsatz von Selbstregulationsstrategien ein, mit denen die Dauer und Intensität negativer Emotionen verringert werden können. Kinder, die sich nicht von ihren Emotionen überwältigen lassen, können sich besser auf soziale Situationen einstellen. In einer Konfliktsituation können sie sich beispielsweise flexibler mit Problemen auseinandersetzen und dabei auch die Gefühle und Interessen anderer berücksichtigen.
Gefühle werden reguliert, indem man sie vermeidet, hemmt, aufrechterhält oder verändert (vgl. Eisenberg, Smith, Sadovsky & Spinrad, 2004; Eisenberg & Spinrad, 2004). Dadurch wird das Auftreten, die Art, die Intensität oder die Dauer von Emotionen beeinflusst. Durch die Regulation von Gefühlen können so körperliche oder soziale Anforderungen bewältigt werden, beispielsweise, indem man die Aufmerksamkeit umlenkt, Selbstberuhigung einsetzt, Hilfe sucht und Verhalten in Abhängigkeit von der Situation hemmt oder aktiviert. Typische Emotionsregulationsstrategien, die im Kindesalter häufig auftreten, werden in Kasten 2 zusammengefasst.
Kasten 2:Emotionsregulationsstrategien in der Kindheit (nach Petermann & Wiedebusch, 2016)
• Interaktive Strategien (mit anderen reden, um Hilfe bitten),
Aufmerksamkeitslenkung (die eigene Wut regulieren, indem man an etwas „Schönes“ denkt),
Selbstberuhigungsstrategien (Selbstgespräche oder Verhaltensrituale),
Rückzug aus der emotionsauslösenden Situation (Weggehen oder Abwenden),
Manipulation/Veränderung der Situation (z. B. Gegenstand entfernen),
kognitive Regulationsstrategien (Gefühle oder die Situation herunterspielen, die Situation neu bewerten),
externale Regulationsstrategien (z. B. Wut und Ärger körperlich ausagieren) und
Einhalten von Darbietungsregeln (eigene Emotionen verstecken oder andere vorspielen).
24
7.
Wissen, dass soziale Beziehungen durch emotionale Kommunikation mitgeprägt werden. Dies beinhaltet das Wissen, dass soziale Beziehungen zu anderen Personen von der Art und Weise geprägt sind, in der über Emotionen gesprochen wird. Hier ist weniger die Art der situativen Auseinandersetzung mit Emotionen gemeint, sondern der Stellenwert, den Emotionen in Beziehungen situationsübergreifend erhalten. Es gibt Personen, mit denen Kinder intensiver und offener über eigene Gefühle sprechen (z. B. die Mutter) als mit anderen. Die Art und Weise, wie über Emotionen gesprochen wird, beeinflusst die Qualität der Beziehung. So werden bestimmte Emotionen nur sehr vertrauten Personen mitgeteilt, da diese Informationen auch verletzlich machen.
8.
Emotionales Selbstwirksamkeitserleben. Diese Fähigkeit beinhaltet das Akzeptieren der eigenen Emotionen, unabhängig davon, ob diese positiv oder negativ sind. Das Akzeptieren basiert auf der Überzeugung, dass die erlebten Gefühle gerechtfertigt sind und unter Achtung der eigenen Wertvorstellungen bewältigt werden können. Diese Fähigkeit beeinflusst damit erheblich das Selbstwertempfinden einer Person. Diese anspruchsvolle Fähigkeit setzt allerdings erst ab dem Jugendalter ein.
Die Auswahl dieser acht Schlüsselfertigkeiten basiert ausschließlich auf empirischen Befunden zur emotionalen Entwicklung. Saarni (2002) stellt fest, dass es über die genannten Schlüsselfertigkeiten hinaus weitere geben mag, die hier noch nicht genannt sind. Die Entwicklung dieser Fertigkeiten kann nach Saarni (2002) nur in sozialen Beziehungen gelingen, das heißt in den Beziehungen der Kinder zu ihren Eltern, den Gleichaltrigen oder auch Lehrkräften.
Besonders den Eltern kommt in der emotionalen Entwicklung eine wichtige Funktion zu, denn die Kinder imitieren die emotionalen Ausdrucksweisen und Bewertungen ihrer Eltern. Sie geben ihren Kindern beispielsweise durch Lob oder Tadel Rückmeldungen darüber, wie angemessen ein geäußertes Gefühl ist, und sie helfen ihrem Kind dabei, Emotionen zu regulieren. Daher kann emotionale Kompetenz ausschließlich in sozialen Beziehungen gelernt werden. Nach Saarni (2002) steht emotionale Kompetenz eng mit eigenen Werten und mit der eigenen Moral im Zusammenhang. Wie emotionale Fertigkeiten eingesetzt werden, hängt von den Handlungszielen ab, die wiederum von den eigenen Werten und moralischen Maßstäben geprägt sind. So ist es ein Unterschied, ob ein Kind Emotionen bei anderen erkennen will, um eigene Vorteile zu erreichen oder um auf andere einzugehen und zu helfen.
Im Verhaltenstraining für Schulanfänger werden emotionale Kompetenzen sensu Saarni (2002) in der dritten und vierten Trainingsstufe vermittelt, indem besonders folgende Aspekte berücksichtigt werden:
die eigenen Gefühle erkennen,
die Gefühle anderer erkennen und verstehen,
25die Fähigkeit, ein altersangemessenes Emotionsvokabular verstehen und einsetzen zu können,
sich in andere einfühlen zu können sowie
mit belastenden Emotionen und Problemsituationen angemessen umgehen zu können.
264 Trainingsbereich: Soziale Kompetenzen
Soziale Kompetenzen oder soziale Fertigkeiten können in hohem Maße zu einem friedlichen Miteinander beitragen. Defizite in diesem Bereich stellen dagegen einen Risikofaktor für problematisches Sozialverhalten bei Kindern und Jugendlichen dar. Die Förderung sozialer Fertigkeiten bildet daher in den meisten namhaften Präventionsprogrammen einen integralen Bestandteil (Beelmann, Pfost & Schmitt, 2014). Doch was verstehen wir unter sozialen Kompetenzen oder sozialen Fertigkeiten?
Eine Herausforderung in der Forschung ist es, Konstrukte wie „soziale Kompetenz“ zu definieren. Für die soziale Kompetenz gilt dabei, dass verschiedene Disziplinen wie die Pädagogik, Psychologie oder Sozialarbeit sich damit beschäftigen und jeweils ihre Perspektive auf soziale Kompetenz betonen. Eine allgemeingültige Definition für soziale Kompetenz zu finden, ist damit schwierig. Merrell und Gimpel (2014) haben versucht, die Kernaspekte aus verschiedenen Definitionen von sozialer Kompetenz zu analysieren. Demnach werden soziale Fähigkeiten erworben durch Lernprozesse, besonders durch z. B. soziales Lernen, Beobachtungs- und Modelllernen und Feedback für Verhalten. Soziale Fähigkeiten beziehen sich auf spezifisches verbales und nonverbales Verhalten, das eingesetzt wird, um Interaktionen zu initiieren oder darauf zu reagieren. Durch den Einsatz sozialer Fähigkeiten erfahren Kinder positive Konsequenzen von anderen Kindern oder Erwachsenen. Zudem werden soziale Fähigkeiten durch andere Menschen und durch situative Aspekte beeinflusst. Merrell und Gimpel (2014) betonen außerdem, dass soziale Fähigkeiten damit insgesamt sehr gut durch Präventionsangebote gefördert werden können, da sie gezielt Raum geben für spezifisches Lernen sozialer Fähigkeiten.
Mit diesem Rahmen zur sozialen Kompetenz wird deutlich, dass soziale Fähigkeiten und soziale Kompetenzen miteinander verwobene Begriffe sind, aber nicht identisch (Merrell & Gimpel, 2014). Während soziale Fähigkeiten sich auf konkret beobachtbares Verhalten beziehen, z. B. ein anderes Kind trösten, bezieht sich soziale Kompetenz auf ein breiteres Urteil über das Verhalten eines Kindes. Beispielsweise bewerten Lehrkräfte oder Eltern, ob ein Kind im Vergleich zu anderen sozial kompetent ist. Soziale Kompetenz ist jedoch keine Garantie dafür, dass ein Kind in einer spezifischen Situation soziale Fähigkeiten zeigt.
27Welche konkreten sozialen Verhaltensweisen lassen sich nun sozialen Fähigkeiten und damit der sozialen Kompetenz zuschreiben? Im Rahmen einer Meta-Analyse untersuchten Caldarella und Merrell (1997), welche Verhaltensweisen in einschlägigen Studien am häufigsten unter dem Begriff „soziale Fertigkeit“ subsummiert wurden. Für das Kindes- und Jugendalter kristallisierten sich fünf Kompetenzbereiche heraus (s. Kasten 3).
Kasten 3:Bereiche sozialer Fertigkeiten nach Caldarella und Merrell (1997)
• Gestaltung von Gleichaltrigenbeziehungen: etwa durch prosoziales Verhalten, wie andere loben; Empathie und soziale Teilhabe;
ausgewogenes Selbstmanagement: etwa durch die Fähigkeit, sich auch in schwierigen Situationen anpassen zu können; das eigene Verhalten regulieren oder kontrollieren zu können;
schulische Anpassungs- und Leistungsfähigkeit: wie etwa Aufforderungen nachkommen; Aufgaben zu Ende führen; Anweisungen von Lehrkräften befolgen;
Kooperationsbereitschaft: zum Beispiel Erwartungen akzeptieren; Regeln befolgen; Teilen sowie
Selbstbewusstsein: beispielsweise Gespräche beginnen, Kontakt herstellen können.
Ein weiteres interessantes Modell sozialer Fertigkeiten entwarf Merrell (2003). Es ist deshalb nennenswert, weil es eine Reihe unterschiedlicher Konzepte hierarchisch zueinander in Beziehung setzt (vgl. Abb. 2).
Abbildung 2: Modell sozialer Fertigkeiten modifiziert nach Merrell (2003)
Merrells Modell (2003) ordnet die soziale Kompetenz adaptiven Verhaltensweisen unter. Ein Beispiel für adaptive Verhaltensweisen wäre zum Beispiel die Fähigkeit, eine Sprache zu sprechen und verstehen zu können. Merrell (2003) unterscheidet ebenfalls zwischen den Begriffen „soziale Kompetenz“ und „soziale Fertigkeit“ und ordnet sie hierarchisch an. Demnach transportiert der Begriff der „sozialen Kompetenz“ eine Einschätzung darüber, wie angemessen man soziale Auf28gaben ausführt. Dem gegenüber versteht man unter „sozialen Fertigkeiten“ spezifische soziale Verhaltensweisen, die man ausführen muss, um als sozial kompetent eingestuft zu werden (Merrell, 2003).
Gleichaltrigenbeziehungen sind hier nicht das Ergebnis sozialer Kompetenzen, sondern stehen zu ihnen in einer wechselseitigen Beziehung: Gute Beziehungen können aus sozialen Kompetenzen resultieren, können allerdings ebenso die Voraussetzung für den Erwerb sozialer Kompetenzen bilden.
Eine weitere Perspektive auf soziale Kompetenzen stammt aus der Entwicklungspsychologie. Vertreter dieser Richtung fokussieren bei der Beschreibung sozialer Fertigkeiten eher bestimmte Prozesse, aufgrund derer man kompetente und inkompetente Kinder unterscheiden kann. Für Kindergarten- und Grundschulkinder nennen Cillessen und Bellmore (2004) vier Alltagsaufgaben, in denen hohe soziale Fertigkeiten gefragt sind:
beim Spielverhalten,
beim Eintritt in eine laufende soziale Interaktion,
beim Regulieren von Emotionen und
bei der Suche nach angemessenen Konfliktlösungen.
Demnach wurden Kinder dieser Altersgruppen von Gleichaltrigen oder anderen Beurteilenden, wie etwa Lehrkräften, sozial umso kompetenter eingeschätzt, je häufiger sie in komplexe Spiele mit mehreren Gleichaltrigen verwickelt waren und je stärker sie soziale Rollenspiele bevorzugten.
Bezogen auf den Eintritt in eine soziale Interaktion wurden die Kinder von Gleichaltrigen als sozial kompetenter eingeschätzt, die in der Lage waren, sich sozial (z. B. in ein Spiel oder eine Unterhaltung) zu integrieren, anstatt Gleichaltrige zu dominieren. Für den Bereich der Emotionsregulation tritt eine Überschneidung zur emotionalen Kompetenz auf, die nach wie vor häufig in der Literatur vorzufinden ist (zur Übersicht: Petermann & Wiedebusch, 2016). In soziometrischen Untersuchungen, in denen Kinder ihre Spielkameradinnen und Spielkameraden nach Beliebtheit einschätzen, korrelierte soziale Kompetenz mit dem Ausdruck positiver Emotionen, während sie negativ mit dem Ausdruck von Ärger assoziiert wurde. Schließlich schätzten Kinder Gleichaltrige als sozial kompetenter ein, je seltener sie in Konflikte verwickelt waren und je stärker sie auf prosoziale Lösungsstrategien zurückgriffen. Umgekehrt wurden die Kinder weniger von Gleichaltrigen akzeptiert, die häufiger zu feindseligen Konfliktlösungsstrategien (z. B. verbale oder körperliche Aggression) neigten (Rose & Asher, 1999).
Im Verhaltenstraining für Schulanfänger werden soziale Kompetenzen vor allem in der vierten Trainingsstufe eingeübt. Dabei findet man eine Vielzahl der oben genannten Aspekte sozialer Fertigkeiten wie etwa:
die Sammlung möglichst vieler angemessener Problemlösungen in sozialen Situationen,
29die positive Gestaltung von Gleichaltrigenbeziehungen,
ausgewogenes Selbstmanagement,
schulische Anpassungs- und Leistungsfähigkeit sowie
Kooperationsbereitschaft.
305 Integratives Modell sozial-emotionaler Kompetenzen
Die Bereiche soziale Informationsverarbeitung sowie emotionale und soziale Kompetenzen sind notwendig aber nicht hinreichend, damit Kinder sich positiv entwickeln und lernen können. In den vorherigen Kapiteln wurde bereits deutlich, dass diese Kompetenzbereiche nicht unabhängig voneinander sind. Sowohl in der Entwicklung dieser Kompetenzen als in der Anwendung in konkreten Situationen wirken sie wechselseitig aufeinander ein.
Denham et al. (2014) haben ein Modell entwickelt, das diese Bereiche miteinander kombiniert. Gleichzeitig werden die Lebenskontexte der Kinder explizit mit einbezogen. Das Modell sozial-emotionaler Kompetenz wird in der Form eines Prismas dargestellt (s. Abb. 3). Sozial-emotionale Kompetenz liegt demnach vor, wenn Kinder in Interaktionen effektiv handeln. Die Effektivität ist gegeben, wenn kurz- und langfristige Ziele dabei erreicht werden. Ob ein Kind diese erreicht, drückt sich in den Bereichen Selbstwirksamkeit, der Qualität der Beziehungen zu Gleichaltrigen und Erwachsenen sowie dem Status in der Gleichaltrigengruppe aus. Um dieses zu erreichen, müssen Kinder spezifische Entwicklungsaufgaben bewältigen, und zwar:
positive Interaktionen mit der Umwelt aufrechterhalten,
eine angemessene Selbstregulation erreichen und
positiv mit Gleichaltrigen und Erwachsenen interagieren.
Auf der untersten Ebene des Prisma-Modells werden einzelne Fähigkeiten dargestellt, die wir den emotionalen und sozialen Kompetenzen oder der sozialen Informationsverarbeitung zuordnen können. An der Seite des Modells ist sichtbar, dass auch die Kontexte Gleichaltrige, Eltern und Kindergarten/Schule mit einbezogen werden.
Bezogen auf den Schulkontext argumentieren Denham et al. (2014), dass sozial-emotionale Kompetenzen ebenfalls für den Schulerfolg ausschlaggebend sind. Sozial-emotionale Kompetenzen haben zum Beispiel einen Einfluss auf das Verhalten im Schulunterricht wie Motivation, Aufmerksamkeit und positive Teilhabe an Interaktionen im Unterricht. Damit gehen sozial-emotionale Kompetenzen ebenfalls positiv mit akademischen Leistungen einher.
31Die große Bedeutung sozial-emotionaler Kompetenzen für eine gesunde psychische und für eine positive schulische Entwicklung wird durch eine Reihe von Längsschnittstudien betont. Domitrovich, Durlak, Staley und Weissberg (2017) fassen zusammen, dass eine erhebliche Evidenz dafür vorliegt, dass sozial-emotionale Kompetenzen Kindern dabei helfen, sich angemessen zu verhalten, Risiken zu vermeiden, positive Beziehungen zu Gleichaltrigen und Erwachsenen aufzubauen und gute schulische Leistungen zu erzielen. Dies scheint besonders auf Kinder zuzutreffen, die einer Reihe von familiären Risikofaktoren ausgesetzt sind. Die sozial-emotionalen Kompetenzen wirken dann als Schutzfaktor für die Entwicklung. Sie können auch als Schlüssel der Veränderung bezeichnet werden, wenn Kinder im Rahmen von Präventionsprogrammen lernen, Einstellungen zu erwerben, die prosoziale Handlungen anstelle von z. B. aggressiven Handlungen favorisieren (Durlak et al., 2017).
Abbildung 3: Integratives Modell zum Erlernen sozial-emotionaler Kompetenzen (nach Denham et al., 2014, S. 428)
326 Problematisches Sozialverhalten
Präventionsprogramme wie das Verhaltenstraining für Schulanfänger können dazu beitragen, Verhaltensproblemen bei Kindern vorzubeugen. Doch was verstehen wir unter problematischem Sozialverhalten?
Eine verbreitete Einteilung von Verhaltensproblemen im Kindesalter unterscheidet zunächst danach, ob das Verhalten eher nach außen (externalisierende Verhaltensprobleme) oder nach innen gerichtet ist (internalisierende Verhaltensprobleme). Zu den externalisierenden Verhaltensproblemen werden aggressives und trotziges Verhalten gezählt, aber auch impulsives und hyperaktives Verhalten. Das Verhalten ist für Erwachsene in der Regel gut beobachtbar. Zu den internalisierenden Verhaltensproblemen gehören beispielsweise Ängste oder depressive Symptome. Es liegen Symptome bei den Kindern vor, die von Erwachsenen nicht einfach beobachtet werden können, wie zum Beispiel Selbstzweifel und Mutlosigkeit. Dennoch können auch bei diesen Kindern problematische Verhaltensweisen vorliegen, zum Beispiel wenn sie soziale Interaktionen vermeiden oder nur mit großen Hemmungen an gemeinsamen Aktivitäten teilnehmen.
Das inklusive Schulsystem muss einen Weg finden, um Kindern mit Verhaltensproblemen entsprechende Förder- und Bildungsangebote zu machen. Dazu ist es u. a. möglich, für Kinder mit Verhaltensproblemen einen sonderpädagogischen Förderbedarf festzustellen. Nach der Kultusministerkonferenz (KMK, 2000, S. 10) ist „ Sonderpädagogischer Förderbedarf … bei Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen der emotionalen und sozialen Entwicklung, des Erlebens und der Selbststeuerung anzunehmen, wenn sie in ihren Bildungs-, Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten so eingeschränkt sind, dass sie im Unterricht der allgemeinen Schule auch mithilfe anderer Dienste nicht hinreichend gefördert werden können.“ Mit der Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs können in der Regel mehr Ressourcen sowie eine gezielte Diagnostik und Förderung angeboten werden.
Allerdings unterscheiden sich die Bundesländer teilweise erheblich darin, wie das Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs sich gestaltet und ab welcher Klassenstufe dieser überhaupt festgestellt wird (Sälzer, Gebhardt, Müller & Pauly, 2015). Teilweise kommt es in einigen Ländern auch zur Aussetzung von Feststellungsverfahren, besonders im Primarbereich. Es stellen sich damit große Herausforderungen an Regellehrkäfte, aber auch an Sonderpädagoginnen 33und Sonderpädagogen. Gleichzeitig zeigen die Daten des Kinder- und Jugend-Gesundheitssurveys (KiGGS) vom Robert-Koch-Institut auf, dass Verhaltensprobleme bei Kindern relativ weit verbreitet sind (Hölling, Schlack, Petermann, Ravens-Sieberer & Mauz, 2014; Mauz et al., 2020).