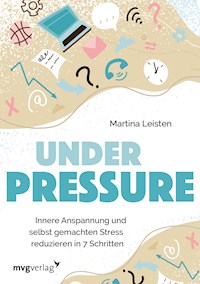2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: mvg Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Martina Leisten träumt von ihrem eigenen Café in Berlin. Endlich ihre eigene Chefin sein! Doch was anfangs so vielversprechend aussieht, endet in einem Desaster: Privatinsolvenz mit Anfang 30 und das niederschmetternde Gefühl, alles falsch gemacht zu haben. Aber statt den Kopf in den Sand zu stecken, kämpft sie weiter, findet neue Projekte und – scheitert auch hier im großen Rahmen. Unterhaltsam und schonungslos ehrlich erzählt sie von den Hürden, die sie meistert, den Fehlern, die sie macht und der wilden Achterbahnfahrt der Gefühle, die sie durchlebt. Sie zeigt dabei, dass Scheitern zwar richtig scheiße ist, aber zugleich macht ihre Geschichte auch allen Gescheiterten Mut und beweist, dass es völlig in Ordnung ist, den Karren mal richtig an die Wand zu fahren, solange man nur wieder aufsteht, den Staub abklopft und weitergeht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 290
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Martina Leisten
VOLL verkackt!
Martina Leisten
VOLL verkackt!
Wie ich auf ganzer Linie scheiterte und was ich daraus lernte
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen:
Originalausgabe
1. Auflage 2019
© 2019 by mvg Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Nymphenburger Straße 86
D-80636 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Redaktion: Carina Heer
Umschlaggestaltung: Sonja Vallant
Umschlagabbildung: shutterstock.com/WNstock
Satz: Helmut Schaffer, Hofheim a. Ts.
Druck: CPI books GmbH, Leck
ISBN Print 978-3-7474-0111-8
ISBN E-Book (PDF) 978-3-96121-461-7
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-96121-462-4
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.mvg-verlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de.
Für Klaus
INHALT
Prolog
Auf hoher See
Der große Traum
Das Frollein Palisander
Krieg und Unfrieden
Ernüchterung
Sommer in Berlin
Durchhalten
Schuldenberge
Rock that Frollein
Dem Ende nah
Letzte Atemzüge
Herzstillstand
Schiffbruch
Unterwegs
Viva Colonia
Lichtblicke
Der Zusammenbruch
Segel setzen
Zurück auf Anfang
Der Befreiungsschlag
Die flotte Rita
Notbremse
Epilog
Danksagung
Über die Autorin
PROLOG
Es klingelte penetrant an meiner Wohnungstür. Ich stand gerade unter der Dusche und genoss die Sonnenstrahlen, die durch das kleine Badfenster auf mich schienen.
Wer zur Hölle kann das jetzt sein?
Das war sicherlich wieder der Paketbote mit einem Riesenkarton für einen meiner Nachbarn.
Okay, wenn das jetzt nicht wirklich wichtig war, würde ich ausrasten!
Schnell ein Handtuch überwerfen. Abtrocknen konnte ich mich auch später. Das raubte nur wertvolle Zeit. Ich stampfte aus dem Bad und riss wutentbrannt die Wohnungstür auf.
»Guten Tag, sind Sie Frau Leisten?«, fragte der Herr vor meiner Tür.
»Wer will das wissen?«, patzte ich ihn an.
»Ich bin im Auftrag meines Mandanten hier und möchte den Betrag von 8.675 Euro und 93 Cents von Ihnen einfordern. Sie haben die vereinbarte Ratenzahlung nicht eingehalten, weshalb ich jetzt den restlichen offenen Betrag von Ihnen sofort haben möchte. Sie können bar oder mit Karte zahlen, eine eidesstattliche Versicherung abgeben, um wahrheitsgemäß Ihre Zahlungsunfähigkeit zu bezeugen oder aber direkt mit ins Gefängnis kommen. Wie möchten Sie zahlen?«
Ich stand regungslos da. Für einen Moment hörte die Welt auf, sich zu drehen. Ich hörte die Wassertropfen, die von meinem Körper leise auf den Boden klatschten. Kater Jimmy neben mir guckte auch doof aus der Wäsche. Da half nur die Flucht nach vorne.
»Haben Sie mir gerade ernsthaft mit Gefängnis gedroht?«, fragte ich ihn empört.
»Ja, absolut korrekt«, sagte der Herr sachlich. »Das ist aber weniger schlimm, als man vielleicht denkt. Nach einem Wochenende sind Sie wieder raus.«
»Ich habe das Geld aber nicht. Was meinen Sie wohl, warum ich damals eine Ratenzahlung vereinbart habe? Ich habe keine Goldbarren unter dem Bett versteckt. Sie können sich gerne in meiner Wohnung umschauen. Kann ich denn nicht einfach weiter den Betrag wie bislang abbezahlen?«, verlegte ich mich nun aufs Flehen.
»Es tut mir leid. Aber das sind die drei Möglichkeiten, die wir haben.«
Ich stand totenblass und sprachlos wie noch nie zuvor in meinem Leben – und ich hatte schon so einiges erlebt.
Das, was ich seit zwei Jahren versucht hatte, zu vermeiden, war nun eingetreten. Ich hatte keine Kraft mehr, weiter dagegen anzukämpfen.
Dreißig Sekunden später hob ich die Hand wie vor Gericht zur Abgabe meiner eidesstattlichen Versicherung. Ich war pleite. Der Kampf war verloren.
Die Privatinsolvenz würde von nun an die Macht über mein Leben übernehmen.
So eine verdammte Scheiße!
AUF HOHER SEE
Der große Traum
Geschafft!
Dass ich vergangene Nacht durchgeackert hatte wie eine Bekloppte, hatte sich gelohnt. Meine Diplomarbeit im Fachbereich Marketing meines sozialwissenschaftlichen Studiums war pünktlich zum vorgesehenen Abgabetermin fertig geworden. Für das Korrekturlesen blieb zwar kaum noch Zeit. Aber wen juckten schon ein paar kleine Rechtschreibfehler, wenn der restliche Inhalt meiner Arbeit zum Ergebnis führte, dass ich ein Diplom in der Tasche hatte?
Meine Mühen wurden trotz kleinerer Unstimmigkeiten belohnt. Die Arbeit wurde mit einer 1,7 benotet, was als Schulnote einer Zwei mit Stern entspricht. Insgesamt kam ich mit den anderen Fächern dann auf eine 2,3, was als eine durchschnittlich gute Leistung angesehen werden konnte. Ich war zufrieden, denn ich hatte etwas geschafft. Ich hatte jetzt einen qualifizierten Hochschulabschluss erlangt, der mir einen hoffentlich reibungslosen Start ins Berufsleben ermöglichen würde!
Als ich kurze Zeit später mein Zeugnis als Diplom-Sozialwirtin in der Hand hielt, war ich bereit, mit den anderen Absolventen in das Haifischbecken »Arbeitsmarkt« zu springen. Nachdem ich nun fast fünf Jahre auf diesen Titel hingearbeitet hatte, waren meine Hoffnungen groß, dass ich damit den Schlüssel in der Hand hielt, um gutes Geld zu verdienen. Mittlerweile war, im Gegensatz zu vielen Dekaden zuvor, ein akademischer Titel nichts Besonderes mehr auf dem Arbeitsmarkt. Er wurde für fast alle Jobs, die mich interessierten, standardmäßig vorausgesetzt. Selbst dann, wenn es sich lediglich um ein Praktikum handelte. Und davon gab es viele. Wir schrieben nämlich gerade das große Zeitalter der »Generation Praktikum«.
Nachdem ich das Leben in der kleinen Studentenstadt Göttingen während des Studiums genossen hatte, wusste ich, dass ich mich für einen erfolgreichen Einstieg ins Berufsleben umorientieren musste. Es gab dort fast ausschließlich Stellen im universitären Bereich, die für mich nicht infrage kamen. Dazu war einerseits mein Abschluss nicht gut genug und andererseits wollte ich in der freien Marktwirtschaft arbeiten. Hinzu kam, dass ich nach vielen Jahren in Göttingen auch eine Art »Lagerkoller« hatte und mich darauf freute, wieder in eine größere Stadt in meiner alten Heimat, dem Rheinland, zu ziehen. Wenige Monate nach Erhalt des Diploms war die Entscheidung gefallen, dass ich Göttingen für immer den Rücken kehren würde. Es fiel mir zwar nicht leicht, da ich viele tolle Freundschaften geknüpft hatte, aber ich war nicht die Einzige meines Abschlussjahrgangs, die wieder raus in die weite Welt ziehen wollte. Und so war ich binnen einer Woche mit Sack, Pack und meinem Kater Jimmy nach Köln umgezogen und begann, mich eigeninitiativ zu bewerben.
Während dieser Bewerbungsphase bewahrheitete sich meine Vermutung, dass ich auch hier ohne Praktikum nicht weiterkam. Ich erhielt zahlreiche Absagen auf meine Bewerbungen für gut bezahlte Jobs in Festanstellungen. Also begann ich schweren Herzens, mich auch auf Praktika zu bewerben. Ich wollte ja arbeiten und den Fuß in die Tür kriegen. Und wenn es mit so einem blöden Praktikum sein musste, dann war ich nun bereit, mich den Gegebenheiten des Arbeitsmarktes anzupassen. Wie aber sollte ich mit Ende 20 und eigener Wohnung von 250 Euro Praktikantenvergütung leben? Gingen die davon aus, dass ich wieder bei meinen Eltern einzog oder Unterstützung vom Staat beantragte? Ich entschied, dass ich mich mit diesen Fragen dann auseinandersetzen würde, wenn es so weit wäre.
Als ich meine Bewerbungsstrategie änderte, wurde ich sofort belohnt. Binnen kürzester Zeit ergatterte ich ein Praktikum in der Marketingabteilung eines renommierten Musikmagazins. Bereits an meinem ersten Arbeitstag durfte ich auf ein tolles Konzert mitgehen. Es war eine wirklich aufregende Zeit mit tollen Kollegen und großartigen Konzerten. Ich wusste aber auch von vornherein, dass ich mit dem Praktikum allein meine Miete nicht zahlen konnte. Ich musste noch zusätzlich an Abenden und den Wochenenden jobben.
Als ich nach einer Weile merkte, dass es mich total kaputt machte, an den freien Wochenenden auch noch kellnern zu müssen, und ich keinerlei Zeit hatte, um mich zu erholen, wusste ich, dass es so nicht weitergehen konnte. Kurz zuvor hatte sich eine Werbeagentur, für die ich im Studium freiberuflich tätig gewesen war, auf eine meiner früheren Initiativbewerbungen hin gemeldet und mir ein Jobangebot gemacht. Eine Festanstellung in Vollzeit.
Jackpot!
Ich griff sofort zu.
Meine Freude war dennoch mehr als verhalten. Ich fühlte mich in dem Musikverlag sehr wohl und vermutete, dass es für mich nicht besonders erfüllend sein würde, neue »Promoter«, also vor allem Studenten, die für uns Flyer verteilen oder andere Werbeaktionen übernehmen sollten, zu casten und zu koordinieren. Da ich ja bereits dort gearbeitet hatte, kannte ich die Auftraggeber und auch die Art des Arbeitens. Ich sagte der Werbeagentur dennoch zu. »Ich freue mich total auf den Job« – und log damit nicht nur sie, sondern auch mich selbst an. Lange blieb ich jedoch nicht in dieser Firma, auch wenn ich jetzt ein richtiges Gehalt bezog, von dem ich ganz gut leben konnte. Ich spürte tief in mir, dass ich nicht dafür studiert hatte, um meine wertvolle Lebenszeit mit sinnlosen Tätigkeiten zu vergeuden. Dann hätte ich auch damals direkt bei Aldi an der Kasse anfangen können und nicht studieren müssen. Ich wollte in meinem Beruf auch meine Berufung leben. Nur, was genau war diese überhaupt? Und konnte ich in der schwierigen Zeit der »Generation Praktikum« überhaupt auswählen, womit ich mein Geld verdienen wollte? Ich war innerlich zerrissen, entschied mich aber gegen die Sicherheit des für mich sinnlosen Agenturjobs. Und ließ mich kündigen. Ich hatte die Hoffnung, mich ohne den Job im Nacken neu orientieren und eine bessere Anstellung finden zu können. Wenn es doch jetzt schon mit einem solchen Job geklappt hatte, warum dann nicht auch mit einem, der besser zu mir passte?
Meine Rechnung ging nicht auf.
Nach mehreren Monaten der Arbeitslosigkeit erkannte ich, dass ich weder einen besseren Job fand, noch, dass ich genau wusste, was ich langfristig machen wollte. Ich hatte unendlich viele offene Fragen in mir, die ich mir selbst nicht beantworten konnte und mit denen ich mich gefühlt nur im Kreis drehte. Ich entschied, dass es für mich in Köln nicht weiterging. Das, was mich zuvor nach Köln gezogen hatte, nämlich die Vertrautheit meiner Heimat, stieß mich nun ab. Ich wollte einen Neustart. Etwas völlig anderes machen. Mich neu erfinden und kennenlernen. Und das möglichst ganz weit weg. Der Nomade in mir war bereit aufzubrechen. Ein weiterer Umzug also. Doch wohin sollte meine Reise jetzt gehen?
Nach Berlin natürlich. Berlin war in der Tat ganz weit weg – zumindest nach meinen damaligen Maßstäben – und zudem eine richtige Großstadt. Außerdem war Berlin für mich wirklich etwas ganz anderes. Außer auf Oberstufenfahrt in der Schule war ich noch nie in dieser Stadt gewesen. Aber irgendwie hatte mich unsere Hauptstadt schon immer fasziniert.
Keine vier Wochen später wohnte ich zur Untermiete in der bekannten Schönhauser Allee im Prenzlauer Berg. Ich hatte zwar noch keinen Job. Mein Portemonnaie verlor ich gleich am zweiten Tag mit allen wichtigen Papieren. Und ich kannte niemanden. Aber zum Glück hatte ich meinen Kater Jimmy an meiner Seite. Durch ihn fühlte ich mich weniger allein in der fremden Stadt. Und ich war bereit für ein neues und aufregendes Leben. In Berlin, hieß es, könne man noch etwas bewegen. Hier gab es viele junge Start-ups, Kreative und Querdenker. Eine Stadt also, in der ich mich hoffentlich frei entfalten und zu mir selbst finden konnte.
Ganz so aufregend wie erhofft, verlief der Start in mein neues Leben zunächst aber nicht.
Die ersten sechs Wochen verbrachte ich mit Kater Jimmy allein in der spärlich eingerichteten Altbauwohnung, die ich ungesehen aus Köln angemietet hatte. Schön war sie ohne Frage. Aber es gab keine Möbel außer einem Bett, einem Esstisch mit Stühlen und Bücherregalen voll englischer Fachliteratur von der Vermieterin. Für mich nicht gerade ein Tempel der Gemütlichkeit.
Außerdem gab es weder Fernsehanschluss noch Internet. So dermaßen auf das Wesentliche reduziert, hatte ich mir mein Leben im hippen Prenzlauer Berg in einer schicken Altbauwohnung nicht vorgestellt. Ich setzte also alles daran, diesen Zustand schleunigst zu ändern. Zeit genug, um mich um Jobs zu kümmern hatte ich. Zudem kannte ich noch niemanden, mit dem ich hätte Kaffee trinken und mich ablenken können. Ein netter Nachbar hatte mir beim Einzug zwar mit meinen Kisten geholfen und war zum Glück auch für mich da, als ich mein Portemonnaie inklusive aller Ausweise und Bankkarte verloren hatte. Aber mehr als das ergab sich aus diesem Kontakt nicht. Ich hatte aber immer schon gut neue Kontakte schließen können und machte mir diesbezüglich am wenigsten Sorgen. Da unterschied ich mich von vielen Bekannten, die sich nicht vorstellen konnten, ohne Freunde, Partner und ohne Job in eine fremde Stadt zu ziehen. Ich war da einfach angstfrei wie in vielen anderen Lebensbereichen auch.
Um meinen neuen Alltag zu strukturieren und auch um täglich ein bisschen unter Menschen zu kommen, ging ich jeden Tag in ein benachbartes Internetcafé und arbeitete stoisch meine Listen ab. Ich verschickte eine Bewerbung nach der anderen. Häufig, ohne genau darauf zu achten, wofür ich mich überhaupt bewarb. Doch der Druck war groß, und so versuchte ich, durch eine möglichst große Streuung an einen guten Job zu gelangen.
Nach einer gefühlten Ewigkeit war es dann endlich so weit. Offiziell waren zwar erst wenige Wochen vergangen, aber für einen ungeduldigen Menschen wie mich war das wirklich eine lange Zeit. Eine große, nationale PR-Agentur lud mich zum Vorstellungsgespräch ein. Und – was für ein Karrieresprung – diesmal würde es nicht um ein Praktikum, sondern um ein Volontariat gehen. Ich kannte diesen Begriff aus dem Bereich des Journalismus, bei dem nicht jeder einfach so einen derartigen Platz ergattern kann. Außerdem enthielt der Job noch das Versprechen, nach den knapp zwei Jahren, die das Volontariat dauern sollte, in einer Festanstellung in der gleichen Agentur anfangen zu können. Wobei ich nicht so naiv war, das wirklich zu glauben. Was gab es Besseres, als hoch qualifizierte Arbeitskräfte auf diese Art billig für sich arbeiten zu lassen? Ich war Realistin und nicht mehr gewillt, solche Ammenmärchen zu glauben. Zu viele Unternehmen beschäftigten mittlerweile fast ausschließlich Praktikanten und Volontäre. Ich ließ mich trotzdem darauf ein, besser als ein Praktikum war ein Volontariat allemal. Dennoch würde ich nicht viel verdienen, musste aber immerhin nicht zusätzlich arbeiten, wenn ich bereit war, mich finanziell stark einzuschränken.
Ich bekam den Job und war voller Hoffnung, jetzt endlich in ein neues Leben durchstarten zu können. Mein erster Arbeitstag verlief dann jedoch mit dem Gefühl, im falschen Film gelandet zu sein.
Ich hatte vor und während meines Studiums freiberuflich über viele Jahre lässig Werbefilme in Sneakern organisiert. Hatte ständig mit interessanten Models, Regisseuren und Agenturen zu tun gehabt. Ich konnte es im Sommer schneien lassen, wenn es der Film verlangte. Ich war kreativ. Innovativ. Und organisiert. Und jetzt sollte ich Kongresse für verschiedenste Ministerien koordinieren? Hatte ich beim Vorstellungsgespräch nicht richtig zugehört oder wollte ich es nicht hören? Das wirkliche Ausmaß meines zukünftigen Arbeitsumfeldes wurde mir erst jetzt schlagartig bewusst. Und ich erschrak. Ich war nämlich keine Beamtenseele, die sich in ein Businesskostüm quetschen lassen wollte. Aber was sollte ich nun tun? Ich konnte nicht einfach wieder absagen. Ich entschied mich dafür, es durchzuziehen. Ich hatte mir die Suppe eingebrockt. Jetzt musste ich sie auch auslöffeln.
Während es in meinem familiären Umfeld gut ankam, dass ich in Berlin jetzt »mit den hohen Tieren« zu tun hatte, machte sich in mir eine beklemmende Leere breit. Wieder organisierte ich irgendeinen Quatsch, zu dem ich keinerlei Bezug hatte. Statt Promotern für Hundefutter koordinierte ich nun Dolmetscher für Ministerkonferenzen. Immerhin hatte ich nette Kollegen. Aber ob das auf die Dauer ausreichte?
Ich kannte die Antwort vom ersten Tag an. Und auch in dieser Agentur hielt ich es nur wenige Monate aus. Ich brachte immerhin recht erfolgreich einen Schulleiterkongress und eine Ministeriumskonferenz hinter mich. Ich versuchte, mich dabei gedanklich an den schönen Momenten des Jobs festzuhalten.
Bei der Schulleiterkonferenz ging es teilweise sehr sachlich und stressig zu. Da kam ich auf die Idee, mir meine Handschrift auf den Namensschildern von den Lehrern benoten zu lassen, was viele zum Lächeln und mir letztlich auch ein großes Dankeschön vom Auftraggeber einbrachte.
Nach einer erfolgreich organisierten Konferenz eines Ministeriums wiederum erhielt ich zum Beispiel zahlreiche freundliche Dankesmails von Dolmetschern und anderen Beteiligten, die ich mir extra ausdruckte, um sie mir als Motivation an den Rechner zu kleben. Es half aber alles nichts. Der Job interessierte mich weiterhin nicht die Bohne. Ich kapitulierte innerlich und mein Körper ebenso. Ich hatte unerträgliche Rückenschmerzen, mit denen ich weder schmerzfrei sitzen, liegen oder stehen konnte. Nach einigem Überlegen ließ ich mich erneut kündigen. In einem Abschlussgespräch hatte mir mein Arbeitgeber sein vollstes Verständnis signalisiert. Doch das Arbeitszeugnis sprach eine andere Sprache. Ich warf es in die Tonne, da ich es für zukünftige Bewerbungen nicht benutzen könnte. Ich hätte ein besseres Zeugnis einklagen können. Aber ich hatte keine Kraft, dafür zu kämpfen, und fiel erneut in ein tiefes Loch.
Zu diesem Zeitpunkt beantragte ich zum ersten Mal Arbeitslosengeld II – bekannter unter dem Namen »Hartz IV«, da die Zeit, in der ich in Berlin und Köln angestellt gewesen war, zusammengerechnet trotzdem nicht für Arbeitslosengeld I ausreichte. Ich hatte ein ungutes Gefühl, mich beim Jobcenter melden zu müssen. Ich wusste aus Erzählungen und TV-Berichten, dass man dort eventuell zu Ein-Euro-Jobs verdonnert werden konnte. Das machte mir schon ein wenig Angst. Beider Vorstellung, ein weiteres Praktikum zu beginnen, spürte ich jedoch erneut ein tiefes Stechen im Kreuz. Ich meldete mich beim Jobcenter und war positiv überrascht. Meine ersten Erfahrungen auf dem Amt waren gar nicht so schlimm wie erwartet.
Anstatt sinnlos nach prekären Jobs suchen zu müssen, erfuhr ich, dass ich ein Coaching finanziert bekommen konnte. Ich hatte meinen Vermittler wahrheitsgemäß davon überzeugen können, dass ich aufgrund meiner Erfahrungen nicht wusste, wo meine berufliche Reise hingehen sollte. Vor allem, weil ich mir auch eine selbstständige Tätigkeit vorstellen konnte. Denn eins hatte ich in diesem ersten Berufsjahr nach dem Studium bereits festgestellt: Ich wollte lieber mein eigener Chef sein, als mich weiterhin den aus meiner Sicht schlechten Gegebenheiten des Arbeitsmarktes für Angestellte aussetzen zu müssen.
Der Herbst brachte dann endlich den erhofften »Berlin-Drive« in mein Leben. Wie gewünscht, erhielt ich mein individuelles Coaching als Maßnahme vom Jobcenter finanziert. Gefühlt hatte ich zum ersten Mal in meinem Leben die Erlaubnis, mich ernsthaft mit mir und meinen beruflichen Wünschen zu befassen, ohne gleich eine Bewerbung nach der anderen hinausballern zu müssen. Bis dahin hatte die einzige Berufsberatung, in deren Genuss ich gekommen war, kurz vor dem Abitur stattgefunden. An unserem Wandertag war die ganze Klasse nach Köln in ein großes Arbeitsamt gefahren und hatte sich in alten Schmökern verschiedenste Berufe anlesen dürfen. Zusätzlich gab es an Computern eine Art Frage-und-Antwort-Spiel, das uns bei der Berufswahl helfen sollte. Das war alles.
Ich wusste danach zwar besser, welche Ausbildungen und Studiengänge es so gab. Aber was ich beruflich machen wollte, wusste ich deshalb immer noch nicht. Ich war nach diesem Tag gefühlt also genauso schlau wie vorher.
Ich erwartete jetzt also etwas mehr als diesen damaligen groben Berufeüberblick von meinem Jobcenter-Coaching. Im Netz nach Berufsarten googlen konnte ich nämlich noch immer selbst. Was ich aber brauchte, war eine strukturierte Herangehensweise und vor allem eine Hilfestellung, um einen besseren Weg in ein erfolgreiches Berufsleben zu finden als den, den ich bislang gegangen war. Mein zukünftiger Berater hieß Stefan. Er war mir auf Anhieb sympathisch. Ein ehemaliger Filmproduzent, der sich durch eine Coachingausbildung auf Existenzgründungsmanagement spezialisiert hatte. Ich merkte schnell, dass mir dort ein erfahrener Mann gegenübersaß, mit dem ich auf einer Wellenlänge lag und der mich nicht in irgendeine Rolle drängen würde, die nicht zu mir passte.
Mit dem intensiven Coaching, das mehrfach in der Woche stattfand, brach eine unvergessliche Zeit in meinem Leben an. Es war ein bisschen so, als würde Stefan mir kleiner Raupe dabei helfen, mich zu verpuppen, um dann später als schöner und erfolgreicher Schmetterling in die Welt hinauszufliegen.
Es ging bei unseren Gesprächen sehr viel um meine Persönlichkeit, meine Talente und natürlich auch um meine Ziele. Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich das Gefühl, dass ich als Mensch total in Ordnung war, genauso wie ich war. Dass meine Wünsche weder irrational noch überheblich waren. Dass ich frei und groß denken durfte, um etwas zu erreichen. Das klang vielleicht banal. Aber da mir diese Fähigkeiten nicht gerade in die Wiege gelegt wurden, war ich glückselig, einen Mentor gefunden zu haben, der mir dabei beistand. Und wahrscheinlich war es auch genau das, was ich mir von meinem Umzug nach Berlin erhofft hatte. Parallel zu seinem Coaching entdeckte ich selbst noch eine amerikanische Buchautorin, die mir mit ihren Ratgebern aus der Seele sprach. In ihren Büchern ging es darum, zu erkennen, wer man wirklich war, wie wichtig es war, Träume zu haben und zu realisieren, dass man sich, je nach Charakter, nicht zwangsläufig nur auf eine Sache im Leben beschränken musste. Da ich schon durch die Wahl meines Studiums eher ein Generalist als ein Spezialist war und immer auch schon in meinen Nebenjobs eine Art »Hans Dampf in allen Gassen« war, halfen mir ihre Werke zusätzlich, mich auf den Weg zu mir, meiner Berufung und dem passenden Lebensmodell zu begeben. Eines wusste ich unbewusst nämlich schon immer: Für ein »normales« Leben mit einem »normalen« Nine-to-Five-Job war ich nicht geboren. Irgendwann – nach einer langen Phase des intensiven Brainstormings – war es schließlich so weit: Der Kokon brach auf, der Schmetterling begann, zu schlüpfen. Das war sie plötzlich: die Idee, ein eigenes Café zu führen. Sie kam zunächst ein wenig wie aus dem Nichts. Aber die Grundsteine dafür hatte ich in der Vergangenheit längst gelegt. Ich hatte nämlich mein Studium zum großen Teil selbst durch Jobs finanziert. Ein Bereich meiner Arbeit waren das Produzieren von Werbefilmen und das Ausführen von Werbeaktionen wie z.B. Gratisverteilaktionen auf Festivals gewesen, der andere die Gastronomie. Schon zu Abiturzeiten hatte ich in der Dorfpommesbude gekellnert. Drei Teller mit wackeligen Eierbechern zu tragen, hatte ich dann später in einem Kölner Traditionscafé gelernt.
Die dortige, teilweise harte Schule hatte mir zudem noch geholfen, den Überblick in stressigen Situationen zu behalten und schnell abkassieren zu können. Während des Studiums in Göttingen arbeitete ich dann mehrere Jahre in einem Studentencafé. Dort war man meist alleine tätig, was wiederum die Koordinationsfähigkeit schulte. Neben diesen beiden Jobs hatte ich aber zusätzlich noch in weiteren Bars und Restaurants gearbeitet, wodurch ich die unterschiedlichsten Betriebsmodelle kannte. Aus meiner Sicht war ich also auch ohne klassische Berufsausbildung in der Lage, selbst einen gastronomischen Betrieb zu führen. Auch Stefan war anhand meiner bisherigen Berufserfahrungen davon überzeugt, dass ich branchentypische Fachkenntnisse mitbrachte, und bestätigte mich in meiner Selbsteinschätzung.
Es bestanden für uns beide also wenig Zweifel daran, dass ich bereits einschlägige Berufserfahrung mitbrachte. Und dass es ein Café und keine Kneipe werden sollte, wusste ich auch sofort. Ich liebte das Tagesgeschäft rund um Kaffee, Kuchen und Frühstück. Das gastronomische Abend- bzw. Nachtgeschäft war mir auch sehr vertraut, zog mich in meinem eigenen Vorhaben gedanklich aber nicht so in seinen Bann.
Jetzt stellte sich nur noch die nicht ganz unwichtige Frage nach der Finanzierung. Ich war offiziell Hartz-IV-Empfängerin ohne eigene Rücklagen. Ich hatte keine reiche Verwandtschaft. Und zudem würde mir keine Bank der Welt einen Kredit geben. Dachte ich zumindest.
Mit einer der glücklichsten Tage in dieser Zeit war jener, als Stefan mit mir die Möglichkeiten durchging, wie ich an Gelder für den Laden kommen könnte. Wir hatten zu diesem Zeitpunkt bereits eine grobe Kalkulation mit dem notwendigen Minimum durchgeführt. 10.000 Euro mussten es mindestens sein. Dabei schlossen wir aber von vornherein Objekte aus, bei denen ich eine Ablösesumme zu zahlen hätte, die meist erst bei 50.000 Euro losging. Wir wussten zwar beide, dass man sich mit einer Ablöse eine gute Lage und Stammkunden erkaufen konnte. Aber da ich solche Summen auf gar keinen Fall aufbringen konnte, stand fest, dass ich kleiner zu denken hatte. Dann musste ich mich eben von null alleine hocharbeiten zur erfolgreichen Gastronomin. Aber hey, ich lebte schließlich in Berlin. War es da nicht an der Tagesordnung, dass man eine Kaffeemaschine und ein paar olle Möbel vom Flohmarkt in einen Raum stellte und ein Jahr später ein gut laufendes Szenecafé besaß? Ich war also mehr als optimistisch, dass ich trotz eingeschränkter finanzieller Mittel Erfolg haben würde.
Wir kamen schließlich auf eine Berliner Bank, die Kleinkredite zeitnah, auch an Arbeitslose, vergab und auf Gründer spezialisiert war. Das Einzige, was man brauchte, war eine saubere Schufa, in meinem Fall einen Vormietvertrag für einen Laden und einen gut durchdachten Businessplan. Aber Letzteres war für mich die kleinste Schwierigkeit. Mit Zahlen hatte ich schon immer gut umgehen können und dank Stefans Hilfe hatte ich ziemlich schnell einen perfekt ausgearbeiteten Plan zur Hand. Und zum Glück hatte ich zu dieser Zeit noch keine Schufa-Einträge, sodass die einzige Herausforderung aus damaliger Sicht nur noch in der Anmietung eines passenden Objekts bestand.
Ich hatte also zusammengefasst innerhalb weniger Monate nicht nur entschieden, nicht mehr angestellt, sondern selbstständig arbeiten zu wollen und hierzu nicht nur eine konkrete Geschäftsidee entwickelt, sondern auch noch eine Finanzierungsmöglichkeit in Aussicht. Ich schwebte innerlich auf Wolke sieben. Genau das war das Lebensgefühl, das ich mir durch meinen Umzug nach Berlin erhofft hatte. Da fehlte eigentlich nur noch der passende Mann an meiner Seite.
Wie es der Zufall so wollte, sollte ich auch den kurze Zeit später kennenlernen. Auf einer Party von Freunden stieß ziemlich spät ein großer, bärtiger Typ mit Jägermeister in der Hand dazu. Tim. Ich mochte ihn auf Anhieb. Er blieb nicht nur über Nacht, sondern für länger. Gestärkt durch die rosarote Brille der Verliebtheit, freute ich mich umso mehr auf den bevorstehenden Neustart mit meinem Café. Ich versprühte Lebensfreude wie zuletzt als verliebter Teenager. Und Tim war nicht nur von mir als seiner Freundin angetan, sondern auch von der Zielstrebigkeit, mit der ich als Unternehmerin an mein Vorhaben heranging. Er selbst war zwar als Handwerker angestellt, konnte sich aber auch vorstellen, irgendwann einmal selbstständig zu sein. Ich fühlte mich von ihm geliebt und verstanden. Alles war perfekt in dieser Zeit.
Und so machte ich mich voller Schwung auf die Suche nach einer passenden Immobilie. Ich durchstöberte die gängigen Internetseiten in der Hoffnung, dort überhaupt etwas Bezahlbares zu finden. Ich wusste ja selbst, dass die guten Objekte oft unter der Hand weggingen und meist nur noch die Läden auf dem offiziellen Markt waren, die entweder verhältnismäßig teuer waren oder irgendwelche Makel hatten. Läden, für deren Anmietung eine Maklerprovision fällig wurde, schieden für mich leider auch von vornherein aus. Also musste ich bei meiner Suche auf eine gewisses Quäntchen Glück hoffen, um überhaupt einen passenden Laden zu finden.
Von Vorteil bei der Immobiliensuche war, dass ich auch als Berlinneuling sehr genau wusste, wo die angesagten Ecken in den Bezirken der Gastronomie waren. Ich hatte nicht nur viel darüber gelesen, sondern war auch selbst viel unterwegs gewesen und kannte eine Menge Läden und guter Ecken. Und ich meinte auch, von mir behaupten zu können, zu wissen, was eine gute Ladenimmobilie ausmacht. Neben der Lage in Bezug auf weitere ansässige Geschäfte, Plätze und angrenzende Straßen musste auch das Objekt an sich schon bestimmte Eigenschaften mit sich bringen. Hierzu zählen nicht nur Baujahr, Raumaufteilungsmöglichkeiten oder Architektur, sondern eben auch die Tatsache, ob der Laden als Gebäude alleinsteht, in einer Häuserreihe liegt oder ein Eckladen ist. Ein guter Eckladen gilt häufig als das Wunschobjekt eines Gastronomen. Das hängt damit zusammen, dass ein solcher Laden durch das Aufeinandertreffen zweier oder mehrerer Straßen einfach besser von Menschen wahrgenommen wird. Liegt dieser Eckladen dann zusätzlich noch an einem schönen Platz in einer gut frequentierten Gegend, ist das fast schon die halbe Miete. Aber ich war mir dessen auch bewusst, dass ich nicht genügend Mittel für einen tollen Eckladen in 1A-Lage hatte. Aber so ein Laden neben dem heiß begehrten Eckobjekt, das wäre doch was, dachte ich mir noch, optimistisch wie ich damals war. Mit einem solchen Nachbarn hätte ich dann zwar nicht das Topobjekt selbst, könnte aber vielleicht ein Stück vom Erfolgskuchen abhaben. Ich malte mir aus, dass dessen Gäste dann auch meinen Laden wahrnehmen würden und beim nächsten Besuch auch mal bei mir vorbeischauten. Lieber also neben einem Eckladen ansässig sein und von einem eventuellen Abstrahleffekt profitieren als irgendwo alleine auf weiter Flur.
Ich schaute mir insgesamt genau drei Läden an. Ähnlich wie bei Wohnungen hatte ich vorab schon unglaublich viel selektiert, um mir Zeit zu ersparen. Ich erkannte schon an den Bildern oder der Anzeige, in welchem Zustand das Objekt war. Dafür musste ich dann nicht extra noch in eine Bruchbude fahren, um den Beweis dafür zu erhalten, dass das Objekt nichts taugte.
Der erste Laden im Kreuzberger Wrangelkiez wurde es nicht. Die Lage in einer wenig besuchten Seitenstraße war mittelmäßig, vor allem aber war die stets fehlende Sonne durch die riesigen Bäume ein Manko. Außerdem lagen die Renovierungskosten dann schließlich doch ein bisschen zu weit über meinem Budget.
Der zweite Laden lag für ein Café strategisch günstig im Kreuzkölln an einem großen Spielplatz. Und war sogar ein Eckladen. Allerdings war das Ganze nicht mehr als ein Rohbau und hatte zudem mehrere Stufen im Eingangsbereich, wodurch er leicht erhöht lag. Weder behinderten- noch kinderwagengerecht also. Außerdem waren die Fenster eher die einer Wohnung und keine großen Ladenschaufenster, sodass man den Laden aus meiner Sicht auch nicht wirklich als Laden wahrnahm.
Objekt Nummer drei war zwar nicht mein Favorit, weil er sehr groß war. Aber der Laden lag in Friedrichshain in der Nähe des Boxhagener Platzes, auch »Boxi« genannt. Eine wirklich schöne Ecke zum Leben und Ausgehen. Ein Nachteil war jedoch, dass der Laden als ehemalige Kneipe mit einem riesigen Biertresen mit Zapfanlage ausgestattet war. Ich wollte doch ein Café und keine Kneipe eröffnen. Und so einfach rausreißen lassen würde ich den Tresen sicherlich auch nicht können, vermutete ich. Doch ich schob meine ersten kleinen Zweifel beiseite und vereinbarte einen Besichtigungstermin mit der schon am Telefon sehr sympathischen Hausverwalterin. Ich erzählte ihr grob von meinem Vorhaben, und sie freute sich darauf, mich persönlich kennenzulernen.
An einem sonnig-kalten Tag im Februar stürmte ich dann freudig in den Laden zur Besichtigung. »Oh wow, ein Eckladen direkt am Boxi«, dachte ich noch draußen auf der Straße. »Und das zu dem Preis! Und er wird auch noch für mich renoviert?! Besser kann es nicht laufen!«
Ich trat ein und stellte mich dem Mann auf der Leiter als neue potenzielle Mieterin des Ladens vor. »Toll, dass Sie mit der Renovierung bereits begonnen haben!« Dem Mann klappte die Kinnlade runter. Er stieg von der Leiter und fuhr mich an, dass das sein Laden sei, und was ich hier verflucht nochmal wolle. Wie peinlich! Zielsicher war ich in den falschen Laden gerannt. Immerhin konnte ich mich auf mein Gespür für gute Objekte verlassen.
Zwei Minuten später stand ich mit der Hausverwalterin ein Haus weiter im richtigen Objekt. Ich Idiot! Ich hätte aufgrund der Backsteinmauern auf den Bildern auch von außen erkennen können, dass dieser hier der ausgeschriebene Laden war. Dass ich intuitiv daran vorbeigelaufen war, sollte sich später noch als größeres Problem entpuppen. Denn »fast direkt am Boxi« bedeutet auch eben nur »fast«.
Für mich war die Besichtigung trotz vorheriger Zweifel perfekt. Der Laden hatte nicht nur eine aktuelle Konzession, die Alkoholausschank erlaubte, sondern sogar noch eine funktionierende eingebaute Kühltheke mit Zapfanlage und viele weitere funktionsfähige Geräte in der Küche. Diese Fakten, die mich zuvor aufgrund meines Vorhabens, ein Tagescafé zu eröffnen, haben zweifeln lassen, ließen mich nun alles von einem anderen Licht aus betrachten. Ich erkannte, dass die teure Konzession und die Mitvermietung der Thekenzapfanlage eigentlich auch etwas Gutes sein konnten. Ich kannte aus meiner Berufserfahrung einige Läden, die als Mischkonzept funktionierten. Tagsüber Café, abends Kneipe. Wenn es gut lief, bedeutete dies größere Umsätze und bessere Gewinnchancen, als wenn man sich nur auf das Tagesgeschäft konzentrierte. Vereinfacht ausgedrückt: längere Öffnungszeiten gleich mehr Chancen auf Umsatz. Ich wollte zwar gerne aus persönlichen Vorlieben lieber ein Café führen. Hatte mich aber auch aus rein finanziellen Gründen darauf fokussiert. In den wenigsten Fällen kam man nämlich an ein bezahlbares Ladengeschäft ran, das sowohl eine Konzession als auch eine ausgestattete Tresenanlage mitvermietete. Ich bemerkte schnell, dass dieser neue Aspekt ein wahrlicher Glücksfall sein konnte.
Bei der weiteren Besichtigung stellte ich fest, dass der Laden zwar renovierungs-, aber nicht sanierungsbedürftig war. Auch hier würden sich die Renovierungskosten auf ein normales Ausmaß beschränken, was sich schnell als weiterer Bonus für mich erwies.
Und auch mein abschließender Hinweis an die Verwalterin, dass ich erst einen Kredit von der Bank bekommen würde, wenn mir ein Vormietvertrag vorläge, stellte kein Problem dar. Sie gestand mir in dem Kontext, dass in den letzten Jahren leider so einige in dem Laden ihr Glück versucht hätten, und sie nun mit mir daraus endlich ein gut laufendes Objekt machen wolle. Wie ihr zu Ohren gekommen war, hatte die letzte Besitzerin sogar in ihrer Verzweiflung Gardinen an die Fenster angebracht, um abends »oben ohne« bedienen zu können. Ach du Schreck! Wie verzweifelt muss man sein? Die Vorgängerin tat mir zwar unglaublich leid, aber als ich das hörte, war ich mir ziemlich sicher, dass ich es niemals so weit kommen lassen würde. Zuvor hätte man doch die Reißleine ziehen und aus dem Mietvertrag aussteigen können. Oder?
Die Verwalterin lenkte schnell vom Thema ab, indem sie mir sagte, dass mein Konzept gut durchdacht sei und ich auch, wie am Businessplan zu erkennen, gut mit Zahlen umgehen könne. Sie könne sich sehr gut vorstellen, dass ich endlich frischen Wind in das Objekt bringen und den Laden zum Erfolg führen könne. Das ging runter wie Öl.
Ich war sofort Feuer und Flamme. Die Verwalterin spürte meine Begeisterung, und auch sie hätte mir am liebsten sofort den Zuschlag gegeben, wie sie sagte. Wir sollten jedoch beide noch einmal darüber schlafen und uns am nächsten Tag mit dem Ergebnis kurzschließen.
Ich jubelte innerlich.
Ich hatte meinen Laden gefunden.
Für mich war die Sache entschieden.
Ich schlief zwar offiziell noch eine Nacht darüber, um der Verwalterin am nächsten Tag meine Zusage zu geben, aber bereits am selben Abend teilte ich Tim und auch Coach Stefan mit, dass ich meinen Laden gefunden hatte. Es ging jetzt nur noch um kleine Details.
Von außen betrachtet, könnte man jetzt vielleicht denken, dass ich mich vorschnell für den Laden entschieden haben könnte. Oder anders formuliert: Es gibt sicherlich Menschen, die sich nicht vorstellen können, dass man eine derart wichtige Entscheidung in so kurzer Zeit treffen kann. Vermutlich sind das aber auch diejenigen, die selbst generell Schwierigkeiten haben, überhaupt Entscheidungen zu treffen. Viele Menschen neigen aus meiner Sicht aus Unsicherheit oder Angst dazu, sich wochenlang in Gedankenkarussellen im Kreis zu drehen und dadurch bestimmte Vorhaben nicht in Angriff zu nehmen. Sie wollen es vermeiden, Fehler zu machen, und entscheiden sich letztlich vielleicht sogar gar nicht. Ich habe schon viele Menschen kennengelernt, für die das Träumen sicherer war, als wirkliche Schritte in die Realisierung zu wagen. Verbunden hiermit war auch oft die Angst vor dem Scheitern.