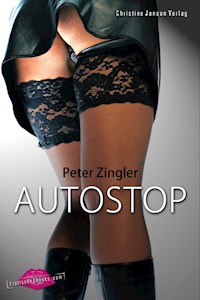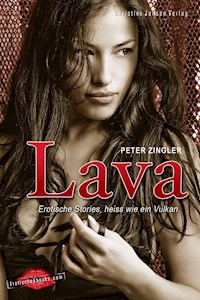Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Frankfurter Verlagsanstalt
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Peter Zingler, der bekannte Drehbuchautor und Verfasser zahlreicher "Tatorte", hat mit seinem autobiografischen Roman "Im Tunnel" (FVA 2015) den ersten Teil seiner unglaublichen, außergewöhnlichen Lebensgeschichte vorgelegt und darin eindrucksvoll von "der brutalen Kunst des Überlebens" (FAZ) erzählt. Turbulent, spannend, amüsant und lehrreich schildert er, wie er als Vierjähriger im harten Nachkriegswinter 1947 für Tabakschmuggler anschaffte und in der Trümmerlandschaft von Köln ›fringsen‹ ging. Die Anfänge seiner späteren Karriere als Berufseinbrecher: Teppichläden, Juweliere, Galerien, rund 150 geglückte Einbrüche gehen auf sein Konto, aber insgesamt zwölf Jahre musste er in Gefängnissen in aller Welt verbringen. Damit sollte nun Schluss sein. Während der Haft entdeckte er ein ganz anderes Talent: 1985 ließ er das kriminelle Milieu hinter sich und tauchte ein in die Welt des Schreibens. Doch er muss sich mit aller Kraft durchbeißen, um sich den Traum eines ehrlichen Lebens zu erarbeiten. Peter Zinglers Lebensroman zweiter Teil ist eine Erfolgsgeschichte voller aberwitziger Widerstände und absurder und abenteuerlicher redaktioneller Hürden. Denn wer meint, dass es in der so genannten Legalität korrekter zuginge als im Gefängnis oder ehrlicher als unter Ganoven, sieht sich gründlich getäuscht. Zingler gelingt es mit viel Witz sich seiner eigenen Lebensgeschichte zu stellen und sich vom (Gefängnis-)Tunnel auf die Himmelsleiter des späteren Grimme-Preisträgers vorzuarbeiten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 580
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Peter Zingler, der bekannte Drehbuchautor und Verfasser zahlreicher »Tatorte«, hat mit seinem autobiografischen Roman Im Tunnel (FVA 2015) den ersten Teil seiner außergewöhnlichen Lebensgeschichte vorgelegt: Er erzählt darin, wie er als Vierjähriger im harten Nachkriegswinter für Tabakschmuggler anschaffte und in der Trümmerlandschaft von Köln ›fringsen‹ ging; und auch von den Anfängen seiner späteren Karriere als Berufseinbrecher – rund 150 Einbrüche gehen auf sein Konto, insgesamt zwölf Jahre verbrachte er in Gefängnissen in aller Welt. Doch dann, nach seiner letzten Haftentlassung, entschließt er sich zu einer Kehrtwende: Er lässt das kriminelle Milieu hinter sich und taucht ein in die Film- und Literaturwelt.
Davon erzählt der zweite Teil von Peter Zinglers Lebensroman: Vom Tunnel zur Himmelsleiter ist eine Erfolgsgeschichte voller aberwitziger Widerstände und absurder redaktioneller Hürden. Denn wer meint, dass es in der sogenannten Legalität ehrlicher zuginge als unter Ganoven, sieht sich gründlich getäuscht.
»Wäre das alles nicht Wirklichkeit, es wäre ein wirklich schräger Film.« Der Spiegel über Im Tunnel
»Diese Lebensgeschichte ist abenteuerlich und unglaublich!« HR1 über Im Tunnel
Inhalt
2. Teil der Tunnelsaga: Im hehren Kreis
Das Haus in den Bergen
Der Betriebsausflug
Der Besuchstag
Jackpot
Lisa
Arbeit
Das Gebiss
The Looser
Ruben
Abschied von Gabriele
Der Totengräber
Der alte Mann und die Mär – Das Ende einer Legende
Papa Clemente, der Papst von Sevilla
Kurz vor Sevilla
Tatort Hessischer Rundfunk – Über die Ermordung eines Drehbuchs
Spuk in marokkanischer Nacht
Wiener Blut, Wiener Tod
Das Bedürfnis
Die Brüder Rondanilla
Der Häuptling
Der Tod des Schamhaares – Betrachtungen eines älteren Herrn
2.TEIL DER TUNNELSAGA:IM HEHREN KREIS
Im Tunnel befand sich Paul Zakowski meist in Haft und lief im kleinen Kreis des Gefängnishofes.
In Vom Tunnel zur Himmelsleiter sagt nun Peter Zingler der Ganovenwelt adieu und begibt sich in den hehren Kreis der »anständigen« Menschen. Ob das gutgeht?
»Nach dem Spiel ist vor dem Spiel.«
Der Typ, der vor dem Düsseldorfer Flughafen aus dem Taxi stieg, sah nicht aus wie ein Erste-Klasse-Passagier. Peter Zingler trug Jeans, Sweatshirt, eine kurze schwarze Lederjacke und auf dem Kopf die Batschkapp, unter der seine langen Haare hervorstrubbelten. Auch einen Vollbart hatte der Kerl, der sich nun vorsichtig sichernd umschaute, als fürchte er Ungemach. Für den kalten Januartag war er viel zu dünn angezogen, und in seiner kleinen Leinentasche war sicher kein Platz für dicke Wintermäntel. Er betrat das Flughafengebäude, orientierte sich, passierte den Sicherheitscheck und stand dann vor der Passkontrolle. Wer ihn kannte, bemerkte die leichte Nervosität, das Schaben des rechten Fußes, dann die Gewichtsverlagerung auf den linken Fuß, bis der Grenzschutzbeamte den Pass zurückgab. Zingler bedankte sich, ging schnell einige Meter weiter außer Sichtweite, blieb stehen und atmete tief durch. Jetzt schlenderte er gemächlich zu einem Gate, auf dessen Anzeigetafel das Flugziel Montego Bay zu lesen war.
Die erste Hürde hatte Peter Zingler geschafft.
Nun saß er in der Maschine, einer Lockheed TriStar der LTU, die langsam Fahrt aufnahm, so stark beschleunigte, dass der Rumpf zitterte und dann endlich abhob. Peter schaute aus dem Fenster auf Düsseldorf hinunter und lehnte sich entspannt zurück. Erst mal entkommen. Er sah sich in der Maschine um. Zwar war ihm schon am Gate aufgefallen, wie viele alleinreisende Frauen auf den Abflug nach Jamaika warteten, hübsche junge Frauen, alle im besten Studentenalter. Es gab auch dunkelhäutige Gesichter, meist Männer in Begleitung weißer Frauen, aber auch zwei schwarze bildhübsche Mädels mit Baines, jenen geflochtenen, dünnen langen Locken. Nicht schlecht, dachte er, und überlegte, wie er die beiden, sie saßen zwei Reihen schräg vor ihm, ansprechen könnte. Aber war das überhaupt nötig, gab’s in Jamaika das alles nicht hundertfach? Noch während er grübelte, gähnte er heftig und der Stress der letzten Tage forderte seinen Tribut. Er schlief ein und erwachte, weil er Durst hatte. Speis und Trank waren zwischenzeitlich an ihm vorübergegangen, aber die Stewardess brachte ihm gerne und lächelnd ein Glas Wasser. Sie sah ihm in die Augen, und wieder überkam Peter eine ungeheure Sehnsucht nach einer Frau, er brauchte dringend was für Herz, Seele und Körper. Aus den Augenwinkeln entdeckte er zwei Passagiere am Cockpiteingang, Besichtigung. Peter erhob sich und stellte sich an. Seitdem er die Kneipe in Frankfurt betrieben hatte, war sein Verhältnis zum fliegenden Personal gestört. Ihn nervte ihre mit der Uniform ausgestrahlte Wichtigkeit. Und auch jetzt, als er das Cockpit betrat, fühlte er sich bestätigt. Da saßen drei Männer. Einer an der Seite, der sogenannte Flugingenieur, er hatte den Kopf auf die Arme gelegt und schlief. Die beiden Piloten waren zwar wach, aber mit Fliegen hatten sie nichts am Hut. Der Copilot las in einer Zeitschrift, der Captain trank Kaffee und gab den fragenden Passagieren bereitwillig Auskunft.
Klar, es gab eine Flugautomatik, aber Peter verglich die drei mit einem Busfahrer in der Stadt. Verglichen mit dem hatten sie einen Traumjob, wenig zu tun und viel, viel mehr Geld. Zehntausend Mark netto im Monat sicher, für was? Er ging zurück zu seinem Sitz und nickte wieder ein.
Montego Bay war wie jeder andere Flughafen auf der Welt, nur waren hier alle Bediensteten schwarz und sehr genau, fast pingelig. Peter schnappte sich seine Leinentasche, ging durch die Passkontrolle und stand vor der Halle. Ein Zaun umgab das Gebäude und jenseits des Zauns standen viele, viele Männer. Rastas, wie man unschwer an ihrer Haarpracht erkannte. Alle winkten, riefen, machten auf sich aufmerksam. Für wen? Jetzt erkannte Peter die Mädels aus seiner Maschine wieder, die an den Zaun stürmten und ihre Wahl trafen. Es ging zu wie auf einem Viehmarkt, genauso hektisch und nur der Augenschein zählte. Kaum trat eine Frau aus dem Tor, stürzte der Auserwählte auf sie zu und führte sie weg von der Konkurrenz, froh, die nächsten drei, vier Wochen ausgesorgt zu haben.
Peters Freund George wartete vor dem Flughafen. Er umarmte ihn sichtbar erfreut und bedankte sich gleich für den Rückflug, den Peter ihm damals besorgt hatte, aber George wollte auch, dass Peter sich auf seiner Insel wohlfühlen würde. Er führte ihn Richtung Strand zum Rumbaum. Natürlich gibt es keinen Rumbaum, aber der hier hieß so, weil in dem breiten, starken Geäst des uralten Baumes eine Kneipe untergebracht war. Man saß auf angenagelten Brettern oder aufgeschnittenen Rumfässern wie in Vogelnestern.
George und Peter tranken Rum und rauchten einen Joint, eine gefährliche Mischung. Der Rum, ein Privatbrand, war dick und süß, fast wie Melasse, und in den Joints war bestes Sinsemilla. Beides war der Gast aus Europa nicht gewohnt. Peter wusste später nicht mehr viel von dem Abend, nur noch, dass er in ein schönes blaues Cabriolet, einen Pontiac Trans Am, verfrachtet worden war. Eine große Seltenheit in Jamaika. Kinder und Erwachsene blieben am Straßenrand stehen und staunten. Üblicherweise fuhren auf Jamaikas Straßen Modelle von Morris, Mini, Vauxhall, Austin, also Autos, die noch aus der englischen Kolonialzeit von vor 1962 stammten. Allesamt fahrende Schrotthaufen. Nur die wenigen Leihwagen waren moderner. Allerdings brauchte man viel mehr Reputation, um einen zu mieten, als Peter es aus Europa kannte. An Jamaikaner wurden gar keine Wagen verliehen. Denn falls sie den Mietwagen überhaupt je zurückbrachten, fehlten Motor, Sitze oder andere wichtige Teile, die sie verkauft hatten. Im Grunde genommen war Jamaika ein Land nach Peters Geschmack. Alle Menschen waren Freibeuter, ohne Unrechtsbewusstsein. Nur war es nicht sein Land.
George fuhr mit Peter zu einer Ferienvilla in die Berge hinter Montego Bay, die einem seiner Freunde gehörte und die in dieser Woche nicht vermietet war. Er klärte Peter über den Umgang mit seinen Landsleuten auf, mahnte ihn zur Vorsicht, verwies auf manche Tücke und Hinterlist und zog ein Bündel Geldscheine aus den Strümpfen, doppelt so viele wie das Ticket gekostet hatte, das Peter ihm vor Jahresfrist besorgt hatte. Peter wollte es nicht annehmen, aber George ließ eine Ablehnung nicht zu. Er trug das Geld in seinen Strümpfen, weil so verdammt viele Diebe in Jamaika herumliefen. George gab ihm Adressen und Tipps und versprach Peter, ihm den Trans Am zu leihen, wenn er demnächst nach New York müsse. Dann fuhr er zurück nach Kingston. Peter war ein paar Tage auf sich alleine gestellt, aber das war nichts Neues für ihn.
Anfangs nahm Peter alles, wie es war und was es gab. Noch nie, so schien es ihm, war er so relaxed gewesen. Er saß unter der berühmten Palme, mit einem Joint in der Hand, und träumte vor sich hin. Es war ihm zum ersten Mal in seinem Leben egal, ob nachher irgendetwas anstand, ob der Bus gleich kam oder erst in drei Stunden oder nie mehr. Peter stellte erstaunliche Veränderungen an sich fest. Es machte ihm Spaß, nichts zu tun, nur seinen Gedanken freien Lauf zu lassen. Er ärgerte sich jetzt, dass er diese Form des Selbsterlebens aus dem Bauch heraus im Knast nicht stärker geübt hatte. Im Knast hatte er kein Ganja, wie das Zeug hier hieß, aber das war’s nicht. Es war eine Sache der Einstellung. Seine Geschichten, seine Phantasien, seine Bücher, der Kopf war das eine, sicher auch mit Emotionen verbunden, aber rein von innen heraus, ohne vom Kopf gesteuert zu sein, erlebte Peter jetzt und hier zum ersten Mal eine lang anhaltende Zufriedenheit.
Während er vor sich hin döste, bemerkte er einen großen Krebs, der sich weit den Strand hinauf getraut hatte. Der Rückenpanzer war so breit wie zwei Männerhände, und er bewegte sich auf seinen vielen Beinen tatsächlich seitwärts, jetzt wieder in Richtung Meer. Doch dann tauchte der Hund auf. Einer dieser gelbbraunen Bastarde, die hier wild herumliefen, eine Plage der Insel. Der Hund umlief den Krebs und schnitt ihm den Weg zum Meer ab, blieb stehen und schaute sich das Ungetüm abschätzend an. Er schien unsicher, wahrscheinlich war er noch keinem solchen Tier begegnet. Dennoch schob er sich drohend knurrend langsam vor. Der Krebs blieb zunächst stehen, erhob sich dann plötzlich wie ein Mensch auf zwei Hinterbeine und riss seine Scheren auf. Dabei klopfte er mit der linken auf die rechte Zange und verursachte ein hohles, knirschendes Geräusch, wohl um zu warnen. Knurrend schlich der Hund näher. Als er einen mächtigen Satz nach vorne machte, wich der Krebs aus. So blitzschnell sprang er aus dem Stand ein großes Stück zur Seite, dass der Hund ins Leere tapste und sich verdutzt umsah. Der Krebs senkte seinen Körper wieder ab, als habe er Luftfederung, und rannte aufs Meer zu. Zwei Meter gewonnen, und er blieb, wieder kampfbereit, aufgerichtet stehen. Dieses Mal näherte sich der Hund von der Seite, sprang ihn an und biss zu. Doch gleich begann er laut zu jaulen. Zwar hatte der Hund dem Krebs ein Bein abgerissen, aber der hatte seine Schere in die schwarze Nase des Hundes geschlagen und hielt fest und war auch durch wildes Kopfschütteln nicht loszukriegen. Peter sah fasziniert zu, seine Sympathie lag bei dem Krebs, aber plötzlich kam Scham in ihm hoch. Er entspannte wie nie zuvor in seinem Leben, und hier, gleich neben ihm, kämpfte eine Kreatur um ihr Leben, und er schaute zu, wie die Römer im Kolosseum, wo sich Menschen und Tiere zerfleischt hatten, während sie selbst auf bequemen Kissen saßen. Peter überlegte, in den Kampf einzugreifen, als sich die Lage erneut veränderte. Da der Hund die Krebsscheren trotz Kopfschüttelns nicht loswurde, legte er sich flach auf den Bauch und streifte nun den Feind mit den Vorderpfoten ab, was ihm auch gelang. Er hatte genug vom Kampf oder sprichwörtlich die Nase voll von den Bissen des Krebses und trollte sich. Der Krebs pumpte sich wieder hoch. Der Verlust des Beines schien ihm nichts auszumachen, er hatte genügend davon. Seine Augen kreisten auf hohen Stielen wie eine Radaranlage, während er seitwärts auf das Meer zuhielt und schließlich im schützenden Wasser verschwand. Peter applaudierte.
In diese ruhige Phase fiel die Begegnung mit Siggi und Wolfgang. Es war am Strand. Die beiden gingen langsam an ihm vorbei und sprachen Deutsch. Peter musterte sie. Sie war ein quirliges Mädchen, nicht zu groß, und zwitscherte wie ein Vögelchen. Er war größer, dunkelhaarig und wirkte ruhiger. Sie gingen an ihm vorbei, und Peter vergaß sie wieder. Nachdem er sein Erholungsschläfchen beendet hatte, stand er auf. George hatte ihm jede Menge Ganja dagelassen. Aber Peter ging behutsam damit um. Er wusste, warum er in Deutschland kaum Drogen genommen hatte, nicht mal Marihuana. Peter hatte sehr wenig Erfahrung damit. Aber hier, bei dem prallen Angebot, bot es sich an, außerdem war es nicht teurer als Zigaretten. Und da er sowieso rauchte … Aber tief in seinem Inneren hatte er Angst vor einem Rausch, den er nicht mehr würde kontrollieren können. Peter trottete am Strand entlang und beschloss, ein Bier zu trinken. Auch Rum schien ihm jetzt zu schwer.
In einer Bar sah er das Pärchen wieder. Er saß auf einem Stuhl und trank Bier, sie saß auf einem Stuhl am Strand, zwei schwarze Mädels flochten ihr das Haar zu kleinen dünnen Zöpfchen, die auf dem Kopf akkurate Streifen hinterließen wie Alleen. Peter schlürfte sein Bier und beobachtete, wie der Mann sein Bier trank und dabei seine Begleiterin betrachtete, die von den beiden hübschen Mädchen, die vielleicht zwölf oder dreizehn Jahre alt waren, schön gemacht wurde. Eines der Mädchen kam zu Peter, sie schaute ihn kurz an, zupfte an seinem Bart und sprach ihn mit »Rasta Man« an. Dann kicherte sie und fragte, ob sie ihm Locken in den Bart drehen solle. Peter wehrte lächelnd ab. Der Mann hatte diese Szene verfolgt, lächelte und so kamen sie ins Gespräch. Wolfgang war zum ersten Mal in Jamaika und begeistert von Sonne, Luft und Mädchen. Bisher war er allerdings nur in der Touristengegend um Montego Bay gewesen, den Rest der Insel kannte er nicht, und eigentlich wollte er ihn auch nicht kennenlernen. Er wollte sich erholen. Peter erfuhr, dass Wolfgang einen Radio- und Fernsehhandel betrieb, aber lieber seinem Hobby frönte, dem Fliegen. Eben machte er den Fluglehrerschein, um in seiner Heimatstadt Speyer eine Flugschule zu eröffnen. Peter spürte, den Mann bewegte etwas. Er wollte eine Veränderung. Siggi, seine Freundin oder Braut, war Studentin und plante, Lehrerin zu werden. Da die beiden einen Leihwagen hatten, fuhren sie mit Peter in die Berge. Es waren nur wenige Kilometer. Die beiden waren begeistert von der kleinen Ferienvilla und dem Pool. Natürlich waren sie auch neugierig und fragten nach Peters Leben, aber er hielt sich zurück, sagte nur, dass er als Letztes in Frankfurt eine Kneipe geführt habe. Das interessierte die beiden allerdings sehr, denn Wolfgang hatte vor, in der Pfalz ein Haus zu kaufen, in dem sich eine alte Kneipe befand. Peter und Wolfgang rauchten dann einen dicken Joint, Siggi wollte nicht. Dafür war sie später die nüchterne Chronistin ihres Trips. Sie lachte sich fast tot und konnte sich gar nicht davon erholen, wie Peter und Wolfgang zugekifft agiert hatten. Peter habe sie ständig Engelchen genannt, sei hinter ihr hergelaufen und habe sie einfangen wollen. Siggi sei ständig auf der Flucht vor ihm gewesen, sei sogar in den Pool gesprungen, derweil Wolfgang vor sich hin dämmerte und Unmengen Wasser trank. Die beiden verbrachten die Nacht noch in der Villa und fuhren am nächsten Morgen, zusammen mit Peter, zurück nach Montego Bay. Sie tauschten die Telefonnummern aus und versprachen, sich in Deutschland zu treffen.
Peters Geld würde nicht lange reichen. Und mit Einbrechen war hier nichts! George hatte ihn in der dritten Woche mit nach Kingston genommen und ihm dort ein Juweliergeschäft gezeigt. Bevor man als Kunde in den Laden kam, mussten erst zwei Gitter, dann zwei Türen geöffnet und schließlich der Alarm ausgeschaltet werden. Das galt – wohlgemerkt – für jeden Kunden. Alles, was in Jamaika irgendeinen Wert hatte, wurde wie eine Festung gesichert.
Peter grinste und dachte daran, dass Frankfurt »Hauptstadt des Verbrechens« genannt wurde und die Straßen der Stadt als total unsicher galten. Wer das sagte, kannte Kingston nicht. Im Frankfurter Bahnhofsviertel, damals die deutsche Zentrale der Kürschner, wurden täglich Pelze im Wert von Hunderttausenden auf fahrbaren Garderoben über die Straße geschoben, völlig ungesichert. In Kingston wären sie keine zehn Meter weit gekommen, ohne geraubt zu werden.
In Jamaika lebten allerdings auch sehr reiche Menschen, verbarrikadiert hinter hohen Mauern in abgesicherten Vierteln. Eines hieß Beverly Hills, es sollte an Los Angeles erinnern, täglich schoss die Security auf irgendwelche Typen, nur weil sie dort herumlungerten.
George hatte Peter jetzt in einem winzigen Haus in Montego Bay untergebracht, das einem Freund gehörte, der in den USA im Knast saß. Am Abend stellte George ihm den größten Dealer des Landes vor, William, Besitzer der weltberühmten Disco Inferno. Der Riesenschuppen mit einem Parkplatz, der für fünfhundert Autos ausgereicht hätte, lag an der Straße von Montego Bay nach Long Bay. Nun muss man wissen, dass die Jamaikaner alles, was jamaikanisch ist, für weltberühmt halten. Ganz egal, ob es ihre Strände sind, der Sonnenuntergang von Negril, die River Dunn Falls und die Blue Mountains, ihr gleichnamiger Kaffee oder das Red-Stripe-Bier. Sie können gar nicht glauben, dass es in Europa kein Red-Stripe-Bier geben soll. Von den Genüssen der Küche ganz zu schweigen. Curried Goat zum Beispiel, wie der Name schon sagt, Ziegenfleisch mit Curry – sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Nachdem Peter zwanzigmal Curried Goat gegessen hatte, fragte er sich, wo eigentlich die Goat war? Eine Ziege zerfiel hier in zwei Teile, in das Fleisch für die Reichen und die Knochen für den Rest. In den Straßenverkauf kamen nur Knochen mit ein paar Fleischfetzen. Vor dem Essen häufte sich Curried Goat noch vielversprechend auf dem Teller, danach lagen dort genauso viele abgelutschte Knochen. Aber das Gericht war gut gewürzt und der Reis körnig. Man wurde satt.
Ähnlich war es mit dem Nationalgericht Ackee and Saltfish. Ackee ist eine Frucht, eine Nuss, etwa so groß wie eine Zitrone. Das Innere sieht aus wie eine Walnuss. Roh soll sie nicht gut schmecken, sogar giftig sein. In Jamaika wird sie in der Pfanne gebraten, kurz gebrutzelt sieht sie aus wie Rührei. Und darauf kommt dann der Salzfisch. Codfish, im Spanischen und Portugiesischen Bacalao genannt, seit jeher das Notfutter armer Völker, Kabeljau in Salz gewendet und getrocknet.
Sogar die Imbissbuden waren in Jamaika gesichert wie Fort Knox. Der Koch stand hinter einer Drahtwand, vor An- und Übergriffen der hungernden Kundschaft geschützt. Eine kleine, halbrunde Durchreiche, wie am Bankschalter, diente der Essensausgabe und dem Kassieren.
In solch einem Imbiss war Peter Hookie erstmals begegnet. Der Typ trug so zerlumpte Klamotten, wie Peter es noch nie gesehen hatte, und von denen er glaubte, sie würden jede Sekunde in Fetzen von seinem Körper fallen. Er trug einen Borsalino auf seinem Kopf. Peter staunte. Hookie bewegte sich geschmeidig im Rhythmus imaginärer Musik wie eine Tänzerin und rauchte einen Joint nach dem anderen. Joints, die er im Hutband trug wie ein Großwildjäger die Munition. Den Namen Hookie hatte er, weil seine breite Nase einen gewaltigen Schwung nach oben machte und aussah wie ein Haken. Wovon mochte er leben, dachte Peter. Später erfuhr er, dass Hookie vor allem im Winter, wenn die weißen Mädels auf die Insel kamen und Dreadlocks suchten, sein Geld als Prostituierter verdiente. Im Sommer fuhr er alle paar Tage nachts in die nahen Berge. Dort hatte er im Gebüsch einen fahruntüchtigen uralten Morris versteckt, den er auf die Straße schob und eine Panne vortäuschte, die hilfsbereite Jamaikaner oder Touristen anhalten und helfen ließ. Da Hookie angeblich kein Werkzeug hatte, holten sie welches aus ihren Wagen; Taschenlampen und Schraubenschlüssel, die sie später, nachdem es ihnen nicht gelungen war, die Panne zu beheben, zurückließen, damit Hookie weiterbasteln konnte. Hatte er genug Werkzeug gesammelt, schob er das Wrack zurück ins Gebüsch und fuhr mit dem Fahrrad runter nach Montego Bay, um die Beute zu verkaufen. Er bekam meist nur zwei, drei Dollar dafür, aber das reichte ihm.
Peter begegnete Hookie Monate später wieder in Negril. Er hatte seinen Morris dorthin abschleppen lassen und trieb sein Spielchen mit den dortigen Touristen und Einheimischen. Negril war ein bekannter Platz im äußersten Westen der Insel. Es hieß, im Lokal Rick’s Café sei der prächtigste Sonnenuntergang der westlichen Hemisphäre zu sehen. Tatsächlich lag die Terrasse des Cafés zwanzig Meter steil über dem Meer. Viele Rastajungs führten dort ihr Kunststück vor und sprangen von hier oben ins Wasser. Aber es war ein teurer Sonnenuntergang, denn die obligatorischen Drinks auf der Terrasse kosteten reichlich, aber die Musik war klasse, und es war immer gut besetzt. Natürlich sah man hundert Meter links und hundert Meter rechts von Rick’s Café denselben Sonnenuntergang, nur fehlte eben der Rummel.
Warum das Café hieß, wie es hieß? Die einen sagten, der Inhaber habe es 1945 nach dem Film Casablanca so genannt, andere meinten, dass Humphrey Bogart nach dem Krieg in Jamaika zwei Filme gedreht und den Namen mitgebracht habe. Verbürgt ist aber nur, dass ein anderer Kinoheld, James Bond – gespielt von Sean Connery, oft auf der Insel gedreht hat. Was natürlich am Autor der Bond-Romane lag, Ian Fleming, der lange Zeit im Geheimdienst ihrer Majestät mit der britischen Armee in Jamaika gelebt und hier seinen Alterssitz gefunden hatte.
Jetzt stand Hookie vor Peter in der Schlange an der Essenausgabe von Sam’s Restaurant. Der Laden war eine aus alten Brettern mit neuen Nägeln zusammengezimmerte Baracke. Tür und Fenster waren Löcher. Links war der Gastraum mit einem einzigen Tisch, der von Sam selbst und seinem Backgammongegner besetzt wurde. Rechts befanden sich die Stehplätze. Auf zwei Holzböcken lag die während der Geschäftszeit nicht benötigte Außentür, und darauf standen verschiedene Plastikschüsseln. Männer füllten den Raum, reichten einen Spliff reihum und verzehrten Cabbage, das Zwanzig-Cent-menu. Jetzt war Hookie dran. Er überschlug sein Geld, fünfzig Cent, das reichte für Ackee and Saltfish. »Einmal, mit Dumpling«, bestellte er und zeigte auf das Gewünschte. Ein zehnjähriger Junge zählte sorgfältig Hookies Geld nach, nahm ein Stück doppelt gefaltetes Zeitungspapier, warf zwei Hände voll Ackee hinein und wandte sich dem von der Decke baumelnden Stockfisch zu. Hookie war nicht einverstanden. »Moment mal, brother«, stoppte er den Kleinen. »Du hast verdammt kleine Hände. Mach drei voll Ackee. Wenn Sam bedient, gibt’s auch zwei Hände voll, und seine sind mächtig größer als deine.« Die Männer im Hintergrund lachten. »Deshalb hat er ihn doch eingestellt«, rief einer, verschluckte sich am Ganjarauch und hustete ihn hinaus. Unentschlossen sah der Junge von einem zum anderen, spähte ängstlich zu Sam hinüber, der scheinbar nichts mitbekommen hatte, und griff noch mal in die Ackeeschüssel. Sams Stimme dröhnte: »Was habe ich dir gesagt, du Bastard? Zwei Hände voll, nicht mehr. Ackee kostet ne Menge dieses Jahr. Wenn die Bande mehr will, soll sie woanders hingehen.« Der Kleine nickte ergeben, griff ein Messer, legte das mit Ackee bedeckte Papier unter den Fisch und kratze an ihm herum, dass er wie Sägemehl auf das Ackee herabstäubte.
Hookie schimpfte über Sams Geiz und erzählte allen, dass dieser Stockfisch hier bestimmt schon zwei Jahre hing und mindestens zehntausend Portionen Ackee den Namen »and Saltfish« gegeben habe. Früher hätte er mit Sam gestritten, doch der sage immer nur: »Salzfisch ist teuer.«
Immer wenn Peter nun an Sams Restaurant vorbeiging, schaute er nach dem Saltfish: Hookie schien recht zu haben, der Fisch wurde trotz häufigen Gekratzes nicht weniger.
Jamaikaner sind nicht zimperlich und noch weniger sind sie es Fremden gegenüber. Peter war mitten im Wahlkampf auf die Insel gekommen. Die Parlamentswahl zwischen Edward Seaga und Michel Manley. Seaga war Chef der Jamaika Labour Party, JLP, die zwar Arbeiterpartei hieß, aber konservativ, rechts war. Manlay führte die PNP, die People’s National Party, was konservativ klang, die aber links war. Nach all den Jahren Seaga hatte zuletzt Manley gewonnen, sehr zum Verdruss der USA. Manley versuchte eine ähnlich autoritäre, von Amerika unabhängige Politik zu machen wie Kuba. Die USA reagierten mit Sanktionen und forderten die Amerikaner auf, nicht mehr nach Jamaika in Urlaub zu fahren.
Aber die Jamaikaner waren auch kein einiges Volk. Sie erschlugen und erschossen sich. Jeden Tag las man im Daily Gleaner von drei bis vier Morden und jeden zweiten Tag musste auch ein Polizist dran glauben.
Mehr als tausend Morde jährlich. Da in Jamaika genauso viele oder so wenige Menschen leben wie in Hamburg, war die Mordrate hier hundert Mal höher. Ein Leben war in Jamaika nicht viel wert.
Außerdem waren viele Jamaikaner total rassistisch, Peter spürte es am eigenen Leib. Das Problem war nicht, dass er weiß, sondern dass er arm war. Wer als Weißer kein Geld hatte, konnte in den Augen der Schwarzen nur ein Riesenarschloch sein. Denn sie waren fest davon überzeugt, dass wenn sie weiß auf die Welt gekommen wären, sie auch reich wären.
Gott sei Dank gab es Ausnahmen. Oft waren das die Typen, die mehr als nur ihr Inselchen gesehen und die mit Musik zu tun hatten.
Georges Bruder, Steve Golding, war ein exzellenter Bassist, und er besaß außerdem einen richtigen Reisepass. Deshalb spielte er mit Bob Marley bei den Wailers und mit Peter Tosh, vor allem wenn’s auf Tournee außer Landes ging. Durch ihn kam Peter in die Kingstoner Musikszene, ins Studio in Trench Town oder die Villa Marley. Rita Marley und ihre Kinder fragten Peter über Deutschland aus, weil Bob ja am Tegernsee in Dr. Issels Klinik lag. Aber auch der Wunderheiler konnte mit seiner Tumor-Therapie Bobs aggressiven Krebs nicht stoppen.
Im Mai 1981 war Peter zusammen mit Winston und Steve Golding bei Marleys Familie, als der größte Star, den das Land je hatte, tot aus dem Flugzeug in Kingston getragen wurde. Ganz Jamaika trauerte um Bob Marley. Schon als er in Saint Ann’s Bay im Kreis der Familie beigesetzt wurde, verabschiedeten sich Tausende Menschen von ihm. Im Nationalstadion von Kingston waren es dann kurz darauf Hunderttausende, die sich drinnen und draußen vor den Toren drängten, um ihr Idol zum letzten Mal zu feiern.
Aber es war nicht nur die Trauer um die Musiklegende, auch politisch war Bob Marley ein Gigant gewesen. Ihm hätte man zugetraut, die beiden verfeindeten Politiker und ihre Parteien versöhnen zu können.
Peter lernte den Sportminister kennen. George, Winston und Steve saßen nach der Trauerfeier mit dem Minister in den Katakomben des Stadions zusammen und rauchten dicke Tüten. Es versteht sich, dass Marihuana in Jamaika genauso verboten war wie fast überall auf der Welt. Daher sang Peter Tosh ja so flehend: »Legalize it …«
Für Peter, dem langsam das Geld ausging, wurde der Kontakt zum Minister sehr wichtig. Peter hatte per Post und Telefon organisiert, dass sein Bruder ihm aus England einen Mercedes-Benz mit Rechtssteuerung besorgen sollte, in Jamaika fuhr man ja links, seitdem die Briten erste Automobile in ihre Kolonie verschifft hatten. Es ging um einen über zehn Jahre alten 280 SE mit Automatik, aber verglichen mit den meisten Kisten, die hier rumfuhren, ein Luxusauto. Die Fracht war erschwinglich, keine achthundert Mark, dafür betrug die Einfuhrsteuer vierhundert Prozent. Der Benz hatte sechstausend Mark gekostet, darauf vierhundert Prozent Zoll, wie hätte Peter das bezahlen sollen, er war schließlich kein Rauschgifthändler. Also setzte der Minister ein Schreiben auf, dass das Fahrzeug für die Entwicklung des Sports in Jamaika von nationaler Bedeutung sei. Als das Auto fünf Wochen später eintraf, war der Minister höchstpersönlich am Hafen und sorgte dafür, dass es unbeschadet an Land kam.
Dem Minister gefiel das Auto so gut, dass er es Peter spontan abkaufen und mit Jamaika-Dollars bezahlen wollte. Ein zweischneidiges Schwert, denn nirgendwo auf der Welt konnte man diese Währung umtauschen, nur in Jamaika waren sie etwas wert. Aber der Preis, den der Minister bot, war so gut, dass Peter zustimmte. Jetzt diente das Auto wirklich dem Sport, und Peter hatte für dortige Verhältnisse eine Menge Kohle.
Das würde reichen, bis er nach Deutschland zurückkehrte. Dass er zurückkehren würde, stand für ihn bereits fest. Denn er hatte schnell gemerkt: Wohin er auch floh, er nahm sich immer mit. Er war hier noch einsamer als in Deutschland im Knast. Es musste eine Änderung in seinem Leben geben. Und die erste war, nach Deutschland zurückzukehren – aber nicht nur das. Er wusste, er musste noch mal ins Gefängnis, aber er schwor sich, das würde das letzte Mal sein. Er wollte nicht im Knast alt werden und sterben.
Aber jetzt war er ja erst mal finanziell gut ausgestattet in Jamaika.
Der Autodeal geschah ungefähr zu der Zeit, als Peter Flowers kennenlernte. Die hübsche schwarze Frau aus der Gegend um San Antonio arbeitete mit einer Freundin in einem Getränkekiosk. Flowers war achtzehn Jahre alt und hatte zwei Kinder von verschiedenen Männern. Die Kinder lebten bei Flowers Mutter in San Antonio und sie mit ihren Freundinnen in einer winzigen Hütte an den Hügeln. Peter hat zweimal bei ihr übernachtet, es war sehr gewöhnungsbedürftig. Alle Mädchen, egal ob mit oder ohne Begleitung, schliefen in einem engen Raum auf ausgeleierten Matratzen. Neben der Tür standen ein kleiner Tisch und ein Herd, der mit Holz befeuert wurde. Wasser gab’s draußen am Hydranten, das zum Waschen in Schüsseln und Kannen reingeholt werden musste. Eine Dusche gab es nicht und entsprechend roch es auch. »Wie im Zoo«, hatte Peter mal zu Flowers gesagt, aber sie konnte sich darunter nichts vorstellen. Die Intimitäten wurden in aller Stille vollzogen. Obwohl es alle taten, taten sie so, als hörten sie nicht, was die Nachbarn taten. In Europa hätten solche Situationen sicher mal zum Gruppensex geführt, hier undenkbar. Jamaikamädels waren monogam. Auch wenn das Verhältnis nur wenige Tage hielt. Moralisch betrachtet könnte man Jamaikas Girls für polygam halten, weil viele bereits mit zwanzig Jahren etliche Kinder von verschiedenen Vätern hatten. Aber das lag eindeutig an den Männern, die selten heirateten und sich bei Schwangerschaften aus dem Staub machten. Sie behaupteten, das sei die Schuld der Kolonialherren. Weil sie, die Männer, damals kolonnenweise ins Zuckerrohr geschickt worden seien, während die Frauen daheim bleiben mussten und dem Farmer gehörten. Nachts durften die Männer bei den Frauen schlafen, wurden aber am nächsten Tag weitergeschickt aufs nächste Feld. Die Frauen waren ständig schwanger und ihre Kinder mehrten den Reichtum des Sklavenbesitzers.
»Glaubt ihnen kein Wort«, beschwor Peter Flowers und ihre Freundin, mit der sie am Kiosk arbeitete. »Die Sklaverei ist schon seit hundert Jahren vorbei. Das ist nur eine Ausrede für ihre Verantwortungslosigkeit.«
In dem Kiosk am Strand verkauften die Mädels Brause-Eis. Eine Schippe Eisschnee wurde in ein kurzes Bambusrohr gehäufelt. Von Knoten zu Knoten etwa Fünfundzwanzig Zentimeter hoch hatte das Rohr einen Durchmesser von sechs Zentimetern und fasste etwa einen halben bis dreiviertel Liter Flüssigkeit. Auf den Eisschnee wurde ein kleines Tütchen Brausepulver geschüttet, und fertig war das beliebteste Kindergetränk Jamaikas. Dort, in dem Kiosk, der eigentlich nur ein Stand war und nicht einmal ein Dach hatte, verkehrte auch der Typ, der behauptete, Big John Hookers Bruder zu sein.
Das Haus in den Bergen
Der Imbissschuppen am Rande der Stadt lag unter der glühenden Julisonne. Es war zu heiß zum Essen, und ich trank ’ne kalte Soursop-Milch, die ich mit ’nem Schuss Rum aus der Taschenflasche schmackhafter machte. Das Mädchen in der Bude, die höchstens zwei Meter Durchmesser hatte, drehte das Transistorradio auf volle Lautstärke. Third World sang 96 Degrees in the Shade. So viel waren es bestimmt.
Das Mädchen bewegte sich im langsamen, lasziven Reggae-Rhythmus. Der Typ auf der anderen Seite des Ladens sah schon seit seiner Ankunft zu mir herüber. Er verzehrte nichts. Sicher überlegte er, ob er mich anbetteln konnte. So lange Zeit fürs Überlegen war ich nicht gewöhnt. Normalerweise kamen sie zu mir, forderten einen, zwei oder drei Dollar und murmelten so was wie: »Du weißt ja, Mann, ihr Weißen steckt tief in unserer Schuld. Schon seit fünfhundert Jahren.«
Allenfalls dankte mal einer mit: »Jah, macht alles wieder gut, brother.« Aber der da überlegte schon viel zu lange. Vielleicht war er stoned und wollte mich überfallen? Das würde sich für ihn nicht lohnen. Meine Sandalen waren schäbig, meine Hose schmutziger als seine und das Shirt billig und durchgeschwitzt. Seit Tagen schon trug ich, weil mir jemand meine Batschkapp geklaut hatte, einen Strohhut. Keinen breitkrempigen wie die Mexikaner oder einen hohen wie die Latinos, nein, er war modelliert wie ein europäischer Straßenhut, sogar mit Kniff in der Mitte. Aber seitdem das Band fehlte, fiel er immer mehr auseinander. Er taugte gerade noch als Sonnenschutz. Ich sah wirklich nicht aus wie ein potentes Opfer, dachte ich gerade, als der Typ um die Ecke der Bude auf mich zukam.
»Irie, brother«, grüßte er und musterte mich von Kopf bis Fuß. Das tat ich auch. Er stand gut 1,85 hoch auf seinen nackten Füßen, war schlank, kräftig, hatte ’ne alte Army-Hose an und einen grauen, geflickten Pullunder. Seine mächtigen Oberarme waren tätowiert, sein Gesicht afrikanisch. Breite Lippen, breite Nase. Im linken Nasenflügel und im linken Ohr trug er je einen Goldreif. Zu erkennen war der Ohrring nur, wenn er seine mächtigen Dreadlocks schüttelte. Die längsten Locken hingen ihm bis auf den halben Rücken und waren so dick wie Kinderarme.
Bevor er irgendeine Forderung an mich stellen konnte, zog ich einen Dollarschein aus der Tasche und hielt ihn ihm hin. »Da, kauf dir ’nen Drink.« »Ja, Mann!«, sagte er verblüfft, nahm den Dollar und ließ sich von der immer noch tanzenden Bedienung ein Bambusrohr voll Milch schütten. Der Schwarze hockte sich vor mich und hielt den Topf ausgestreckt in meine Richtung. Verdammt, er hatte mich vorhin beobachtet. Seufzend zog ich aus der Hosentasche die Rumflasche und versetzte seiner Milch die nötige Kraft.
Die Bewegung war schon zu viel. Ich geriet ins Schwitzen. Kingston im Juli ist immer wie in ’ner Dampfwaschküche. Du kannst duschen, dir frische Klamotten anziehen, kaum gehst du drei Schritte, bist du wieder nass geschwitzt. Oder es regnet! Zehnmal am Tag knallt es herunter wie aus Feuerwehrrohren, hört auf und verschwindet nach Minuten wieder in dicken heißen Wolken, die nach oben ziehen. Aufs Land müsste man geh’n, da ließe es sich aushalten.
Der Schwarze hatte das tolle Getränk aus Ziegenmilch, kleingefrästem Eis, Soursop-Saft und Rum in sich hineingeschüttet, ohne dass ein Schweißtropfen auf seiner Stirn erschien. Der Glückliche.
»Du«, sprach er mich an und wies auf meinen Vollbart. »Du bist rootsman, schon lange hier, he?«
Ich nickte nur. Den Mund zu öffnen, war ich zu faul. Deshalb hatte ich ihm ja den Dollar gegeben. Streit hätte zu viel Kraft gekostet.
»Dann kennst du auch Big John Hooker?«
Ich schüttelte den Kopf. Mein Gegenüber riss die Augen noch weiter auf und erhob sich. »Du kennst Big John Hooker nicht?« Er zeigte jetzt mit den Armen ganz weit nach oben und hielt sie ganz weit auseinander, um zu demonstrieren, wie groß Big John Hooker sei. Ich musste sogar den Rand des Strohhutes in den Nacken schieben, um so hoch raufzusehen, wie dieser Mensch da anzeigte.
»Mann, Big John Hooker, der Held der PNP bei den letzten Wahlen? Fast hätte er Seaga abgeknallt bei der großen Wahlveranstaltung im Stadion. Aber er hat zumindest drei Bullen erwischt. Du musst ihn kennen!«
Ich kannte ihn nicht. Im Vorjahr hatte es Tausende von Schießereien mit einem Ergebnis von rund neunhundert Toten gegeben. Aber ich wollte meine Ruhe, daher sagte ich: »Ach so, der, ja, den kenn ich. Wo ist er? Ist er auch tot?« »Tot?« Der Bursche war entsetzt. »Mein Bruder stirbt nicht!«
»Wo ist er denn?« »Im Zentralgefängnis. Der Gun Court hat ihm lebenslänglich gegeben. Aber Big John Hooker, mein Bruder, kommt wieder!« Ich nickte nur dazu. Hier im Land gab’s drakonische Strafen, doch die meisten Gefangenen brachen nach einigen Wochen wieder aus. Das war Usus.
»Gut, dass du Big John Hooker kennst.« Er war zufrieden. »Denn nur Leute, die ihn kennen, dürfen sein Haus sehen.«
Was sollte das schon wieder? Ich war im Halbschlaf, konnte ihm kaum folgen. »Stell dir vor, Mann! Bist du aus den Staaten?« »Nein, aus Deutschland.« »Gut, noch viel besser. Bei euch gibt’s die Alpen und die schönen Alpenhäuser, weißt du, was ich meine, he?«
Ich nickte und wusste immer noch nicht, auf was er rauswollte.
»Siehst du, Mann, so ein Haus hat Big John Hooker gebaut. Ich will’s dir zeigen.« »O nein!« Jede Bewegung in der Hitze hätte mich umgebracht. »Warum mir? Zeig’s doch dem Mädchen da!« »Unsinn«, sagte er. »Du bist Weißer, kennst Big John Hooker, und Weiße versteh’n mehr von Häusern als wir.«
»Wo ist es?« »Nicht hier. Es ist auf dem Land.« »Auf dem Land?« Das wäre ja vielleicht was. Aus der heißen Stadt rauskommen. »Und wie sollen wir dahin gelangen?«, fragte ich. »Na, mit deinem Auto!«
»Mit meinem Auto? Ich hab kein Auto!« Erstmals war der Schwarze geschockt. Ein Weißer ohne Auto! »Auch kein Ren-a-car?«, bohrte er ungläubig nach. Ich schüttelte den Kopf. »Nope!« Gott sei Dank schien damit die Sache erledigt. Doch er gab nicht auf. »Könnt mir ja ’nen Wagen leihen, wenn du das Benzin kaufst.«
Ich weiß nicht, ob ich zustimmte oder nicht. Jedenfalls verschwand er. Ich wäre besser auch verschwunden, konnte aber nicht. Die Hitze hatte mich auf dem Platz festgeschweißt.
Nach ’ner Stunde war Big John Hookers Bruder wieder da. Schon das Geräusch des Ford Escort verriet mir einiges über seinen Zustand. Er hatte keinen Auspuff. Der Rest sah nicht besser aus. Irgendwann war er mal ausgebrannt. Nur das Nötigste war repariert, die Polster nicht. So setzten wir uns auf blanke Federn, tuckerten zur nächsten Gasstation und von da in die blauen Berge. Zweimal hielt er unterwegs an, um die Räder festzudrehen, die sich auf der holprigen Strecke lösten. Dabei sah ich, dass kein Profil mehr auf den Reifen war.
Wir rauchten beide einen Joint, und ich schlief ein, bis er ausrief: »Da ist es, da ist Big John Hookers Haus!«
Ich befreite mich aus den Autofedern und meinem Rausch und sah in die Richtung, in die er deutete. Da stand ein Alpenhaus wie in Kärnten: Tief heruntergezogenes Dach mit Teerpappe und Steinen beschwert. Jeden Moment glaubte ich, Heidi und den Alm-Öhi zu sehen. Nur der Anstrich war jamaikanisch. Lila, blau, gelb und rosa kamen reichlich vor. Es lag auf der Spitze eines Berges, zwar überragt von einigen Gipfeln in der Nachbarschaft, aber doch ganz schön hoch. Das Klima war angenehm, nicht zu kühl, nicht zu heiß.
»Komm rein, Mann, du wirst staunen!« Ich wusste immer noch nicht, was das Ganze sollte. Wollte er mich berauben? Umbringen? Nein, das hätte er auch in Kingston tun können. So folgte ich neugierig. Mir blieb wirklich der Atem weg. Sauber wie die Stube einer deutschen Edelhausfrau. Filzfliesen, Teppichböden gab es, eine komplette Einbauküche, Einbauschränke, ein gefliestes Bad mit Dusche, Toilette, Bidet, alles blitzblank.
Big John Hookers Bruder, wenn er es überhaupt war, stand inmitten dieser Pracht und breitete die Arme aus. »Na, hab ich dir zu viel versprochen? Du musst erst mal die Nacht hier verbringen. Wie kühl es hier ist, du glaubst es kaum, und es gibt keine Moskitos!« »Ja, ja. Aber wie sollen wir die Nacht hier verbringen? Es gibt kein Bett!« »No problem, ich hole Kissen. Schau dich nur um, sag mir nachher, wie dir’s gefällt.«
Er verschwand, und ich ging durchs Haus. Ich spielte am Herd, kein Strom. Ich drehte den Wasserhahn auf, es kam nichts. Wie sollte das auch funktionieren, hoch oben auf dem Berg? Ein Brunnen müsste hundert Meter tief sein oder mehr.
Mein Rastafreund kam zurück. Kissen sah ich nicht, aber zwei Mädchen. Nicht alt, vielleicht achtzehn oder neunzehn. Eine hatte ein Baby im Arm. »Meine Schwestern«, stellte er sie vor. »Elly und Hyacinth.« Beide waren hübsch.
»Wie viel ist noch in der Taschenflasche?«, fragte er mich. Ich zog sie heraus. Halbvoll war sie noch. Er nahm sie mir aus der Hand, ließ sie reihum gehen. Sie wurde leer. Wir setzten uns auf den Fußboden und drehten dicke Joints. Alle rauchten in Ruhe. Dann begann ich zu reden. »Wie hat Big John Hooker sich das nur vorgestellt? Er schafft alles hier rauf, aber hier gibt’s weder Strom noch Wasser?«
Der Bruder druckste rum. »Irgendwas hat Big John sich dabei gedacht. Wenn wir nur wüssten, was? Er war nicht nur größer und stärker, er war auch schlauer als wir. Wüssten wir’s, wär das Haus längst verkauft!«
»Aber«, er begann aufs Neue, »für dich als Deutschen ist das doch alles kein Problem, ihr wisst doch alles. Ihr könnt alles. Wenn du erst mal hier wohnst, fällt dir auch ein, woher du Wasser und Strom nehmen kannst.«
Das war’s also. Sie wollten mir das Haus verkaufen oder vermieten. Jetzt nur keine falsche Bemerkung machen. Ich wusste nicht, wo ich war, was sie vorhatten, am besten war es, das Spiel mitzuspielen und, wenn’s billig war, das Haus vielleicht sogar zu mieten? Mal sehen. Daher fragte ich zunächst: »Wie weit ist das nächste Dorf von hier entfernt?« »Da unten, zwei Meilen von hier, wo die Mädchen her sind. Und das versprech ich dir, wenn du hier wohnst, werden dich Elly und Hyacinth Tag und Nacht bedienen.« Die beiden nickten strahlend.
»Und wenn du länger bleibst«, fuhr Big John Hookers Bruder fort, »brauchst du dir auch keine Sorgen zu machen. Elly ist neunzehn, Hyacinth achtzehn, und wir haben noch drei Schwestern von sechzehn, vierzehn und zwölf, die rücken dann nach. Du musst nur Big John Hookers Haus kaufen, dann gehört alles dir.«
Ich überlegte. »Und wenn wir aus diesem Dorf ’ne Leitung ziehen bis hier oben mit einer kleinen Pumpstation dazwischen?«
»Hurraahhh!« Der Kerl schlug sich auf die Schenkel. »Ich hab doch gewusst, dass ein Weißer gleich die richtigen Ideen hat, gratuliere, nur … im Dorf gibt’s auch keine Wasserleitung.«
»Gibt’s Strom im Dorf?« »In den nächsten zwei Jahren sollen wir welchen bekommen.« O Gott, dachte ich. Big John Hooker war ein Idiot, ein Individualist, aber ein Idiot.
Es wurde dunkel. Ich schlug vor, uns draußen hinzulegen. Gras ist immer noch weicher als Teppichboden mit harten Brettern drunter. Doch Big Johns Bruder machte mir vor, wie’s ging, er beorderte Hyacinth in die Rückenlage und streckte sich aus, lag mit Kopf und Oberkörper weich auf ihr, während sie klaglos die Last auf sich nahm. Elly bereitete sich ebenso für mich vor, allerdings im anderen Raum, der mal das Schlafzimmer werden sollte. Ich war müde vom Rauchen und schlief auf ihrer linken Brust liegend ein, während die rechte dem Baby als Schlafplatz diente.
Wach wurde ich durch zweierlei. Erstens ging ein ungeheures Gewitter runter, doch das Dach schien dicht zu sein. Zweitens fühlte ich Ellys streichelnde Hand unter meinem Hemd, dann an meiner Hose. Sie flüsterte, ich solle mich ruhig verhalten. Mit geschickten Fingern legte sie mich frei. Dann nestelte sie an ihren Kleidern, hob sich leise an und setzte sich über mich. Sie bewegte sich langsam und geräuschlos, hielt gar den Atem hinter ihren Raubtierzähnen verborgen. Es war der schweigsamste Fick meines Lebens, aber es war schön, auch wenn das Baby immer irgendwie im Wege war. Kaum glitten wir erschöpft auseinander, kamen Hyacinth und Big John Hookers Bruder zu uns rüber.
Die Mädchen legten sich an meine Seite, der Mann hockte sich im Schneidersitz vor mich, zündete einen Joint und eine Kerze an und sah mich lauernd an. »Jetzt wollen wir verhandeln«, eröffnete er das Verkaufsgespräch. »Gewiss, es ist ein Notverkauf, und einiges stimmt noch nicht ganz an diesem Haus, aber fünftausend Dollar ist es trotzdem wert. Was meinst du?« Was sollte ich schon meinen? Würde ich das Gespräch boykottieren, gab’s bestimmt Ärger. So verhandelte ich.
»Okay, mein Freund, Fünftausend ist nicht schlecht, nur … zunächst brauch ich die Unterlagen, ob das Haus auch auf deinen Bruder eingetragen ist. Hast du die hier?« Er überlegte einen Moment. »Nein, nicht hier. Also gut, ohne Papiere, viertausend Dollar!« »Dann brauche ich die Vollmacht deines Bruders, dass er überhaupt verkaufen will.« »Wie sollen wir die denn aus dem Zentralgefängnis rausbekommen? Er hat’s unserer Mutter gesagt, und das gilt. Aber ich verstehe dich, okay, also ohne die Vollmacht dreitausend Dollar.«
»Dann muss ich ’ne Stromleitung legen lassen, vom nächsten Verteiler, kostet bestimmt auch ’nen Tausender!« Big John Hookers Bruder schien nichts zu schocken. »Einverstanden, also zweitausend Dollar, aber keinen Cent weniger!« »Und was ist mit dem Wasser? Ich müsste es kübelweise hier raufschleppen.« »Die Mädchen bringen es mit, jeden Tag«, versprach er. »Nein, wenn hier schon alle Leitungen liegen, muss ich auch eine Zuleitung bauen.« Immer noch stoisch antwortete er: »Einverstanden, letzter Preis tausend Dollar.« »Als Ausländer muss ich ’ne Menge Steuern bezahlen, wenn ich hier was erwerbe, mindestens zweihundert Dollar!«
Einen Moment herrschte Schweigen, dann stimmte er auch da zu.
»Allerletzter Preis achthundert Dollar. Wo ist das Geld?«
Jetzt wusste ich nichts mehr zu sagen, höchstens noch, ob er US- oder Jamaika-Dollars meinte, aber das war egal. Er hätte es auch für achthundert Jamaikas verscherbelt.
»In Kingston!« »In Kingston?«, fragte der Schwarze enttäuscht. »Ja, glaubst du, ich schleppe so viel Geld mit mir rum? Fahren wir morgen früh hin und dann hierher zurück.« Es blieb ihm nichts anderes übrig. Ich erhob mich und ging zur Toilette.
Ein großes Rohr nach außen ließ alles auf die Wiese plätschern. Aus Gewohnheit drückte ich den Spülkasten und erschrak. Mit einem gurgelnden Geräusch lief das Wasser aus dem Kasten. Die drei kamen angelaufen und starrten auf das Wunder. Leise hörte man, wie sich der Kasten wieder füllte. Ellys Hand drehte die Dusche an. Ein leichtes Zittern, dann spritzte ein dicker Strahl hernieder.
Nackt wie wir waren, drängten wir uns darunter, kreischten und lachten wie Kinder. Big John Hookers Bruder rannte durchs ganze Haus und drehte an allem, was er fand. Auch in Küche und Waschküche sprudelte es aus den Hähnen. Nur der Herd ging nicht an, der brauchte Strom, kein Wasser. Big John Hookers Bruder rief in einem fort: »Doch tausendachthundert Dollar, mein Freund, doch tausendachthundert!«
Ich ging nach draußen, fand eine Leiter und kletterte aufs Dach. Hinter der vorgetäuschten Dachfassade war ein großes Auffangbecken eingebaut. Der Regen dieser Nacht hatte es zum Überlaufen gefüllt. Unten spielten sich Wasserschlachten ab. Wanne, Becken, Toilette liefen über. Elly setzte sich immer wieder aufs Bidet und sprang kreischend auf, wenn’s spritzte. Big Johns Bruder forderte jetzt offiziell tausendachthundert Dollar von mir, die ich ihm ohne Zögern zugestand. Alleine wegen der lustigen Stunden und der verrückten Situation. Auch wenn das Haus nie mir gehören würde. Ebenso wenig wie es wahrscheinlich Big John Hooker oder seinem Bruder gehörte. Sie suchten nur ab und zu ’nen Tölpel wie mich. Auf jeden Fall nutzte ich alles aus.
Zuletzt, kurz bevor die Quelle auf dem Dach versiegte, lief das Wasser schon zur Haustür raus. Dann übermannte uns die Müdigkeit, und wir schliefen bis zum Mittag.
Auf halbem Weg nach Kingston zeigte ich Big John Hookers Bruder meinen Geldgürtel. Sofort bog er in die nächste Seitenstraße ein und stoppte den Wagen. »Du hast es also doch bei dir. Warum sollen wir dann erst nach Kingston fahren?« »Ich will eben nach Kingston«, forderte ich ihn heraus.
»Nein, mein Junge«, grinste er hinterhältig, »hier und jetzt wird bezahlt.«
Damit schlug er seine Jacke zurück und zeigte mir den Griff einer amerikanischen 45er Automatic.
Die Mädchen winkten schon von weitem, als sie den alten Escort den Berg hinaufkeuchen hörten. Aber ihre Freude wandelte sich in Entsetzen, als sie mich erkannten, doch bald hatte ich sie beruhigt.
Nun wohne ich schon drei Jahre dort oben. Wie versprochen werden Hyacinth und Elly noch Rose, Lilli und Elisabeth folgen. Mit Hyacinth und Elly habe ich heute schon viel Spaß und sechs Kinder.
Besucht mich doch mal, ihr aus Deutschland, besonders dann, wenn ihr ein schönes Haus in Jamaika kaufen wollt. Was Besseres könnt ihr nicht finden. Das meinten auch die sechzehn Leute, denen ich’s bisher verkauft habe.
———————
Den Besitzer der Disco Inferno nannte Peter nur »William den Ersten«, weil er wie ein König residierte. Der Mann hörte sich Peters Lebensgeschichte an und lobte Peter für seine Großzügigkeit, seinem Brother George damals in Deutschland den Rückflug bezahlt und damit dessen vorzeitige Haftentlassung ermöglicht zu haben. William klärte Peter über das Drogengeschäft auf. Marihuana war das eine, aber Jamaika war auch ein Umladeplatz für Kokain.
William kaufte das Kokain günstig ein, und weil die Flugzeuge, die aus Kolumbien, Peru oder Venezuela direkt nach Europa flogen, in den großen Drehkreuzen wie London oder Frankfurt unerbittlich kontrolliert wurden, verteilte er es auf die Abflughäfen der französischen oder holländischen Karibikinseln, deren Flieger weder in Paris noch in Amsterdam übermäßig streng gefilzt wurden. Das galt auch für den LTU-Flug nach Düsseldorf. Wenn es gelang, jemandem Rückflüge abzukaufen, setzten Williams Leute meist Frauen ohne Namensänderung des Tickets auf den Flug. Mit Bananenbrei mussten die Mädels vor dem Abflug dreißig bis vierzig mit je fünfzig Gramm Kokain gefüllte Präservative schlucken, außerdem wurden einige in Mastdarm und Vagina verstaut. Bananenbrei deshalb, weil der angeblich den Stuhlgang verhindert. Intern wurden diese Mädels »Black Packages« genannt.
William schickte Peter in die Berge, damit er einen Eindruck von Jamaikas Marihuana-Produktion bekam. Es waren riesengroße Felder, manchmal zwei Bergrücken nebeneinander. Dass die angeblich nicht aus der Luft zu entdecken seien, war kaum zu glauben, aber da Jamaika keine Luftwaffe besaß und die beiden Polizeihubschrauber wegen Triebwerkschäden ständig ausfielen, gehörte die Lufthoheit nicht den Behörden, sondern den Schmugglern.
Jeffrey, den Peter begleitete, zeigte ihm allein in der ersten Woche mindestens zehn Flugzeuge, die lädiert im Gebüsch lagen, weil sie bei der Landung beschädigt, abgestürzt oder gar nicht erst hochgekommen waren. Kleine, meist einmotorige Privatflieger, die von irgendeiner Nachbarinsel oder in Florida, Mexiko oder Belize gestartet waren. Es wurde dann mitten im Urwald ein notdürftiger Runway gebaut, Büsche und kleine Bäume gerodet, ein paar Fässer mit brennendem Holz waren die Signalfeuer für die Nachtlandungen. Peter traf zwei Piloten in amerikanischen Militäruniformen, und es sah nicht so aus, als hätten sie sich die bloß geliehen. Nach der Landung wurden die Maschinen mit Kartons oder Säcken voll Ganja beladen. Manchmal waren sie überladen und kamen deshalb nicht mehr hoch, aber meistens schafften sie es, in einem mühsam langsamen Steigflug die Insel wieder zu verlassen. Einmal ist Peter mitgeflogen.
Eigentlich durfte er ja die Insel nicht verlassen, weil sein Pass abgelaufen war. Aber als er in der deutschen Botschaft saß und wartete, um ihn verlängern zu lassen, realisierte er, dass immer mehr Leute in den Raum kamen, in dem er saß, in dicken Büchern blätterten und telefonierten. Er spürte, dass etwas nicht stimmte und haute ab. Sie riefen ihm hinterher, er solle bleiben, man müsse etwas klären. Eine Frau hielt ihn sogar am Arm fest, Peter schüttelte sie ab und ging einfach weiter. Es hieß zwar, dass Jamaika nicht ausliefere, aber wer wusste schon, was denen stattdessen eingefallen wäre. Nein, in Jamaika wollte Peter auf keinen Fall in den Knast, das normale Leben war hier schon heftig genug, wie mochte es da erst im Knast sein?
Also flog Peter mit einem von Williams Buschpiloten illegal nach Belize. Ein Jamaikaner, der überwiegend in den USA lebte und bei der US Army das Fliegen gelernt hatte. Sie flogen mit einer Cessna 180. Rund vierhundert Kilo Marihuana waren an Bord, und obwohl die Piste um zweihundert Meter verlängert worden war, kamen sie nur mit Mühe hoch. Steigflug, höchstens ein Meter pro Minute, aber da zwischen dem Ende der Startbahn und dem Meer keine hohen Bäume standen, war das okay. Das war und blieb dann auch die Reiseflughöhe, denn dicht über dem Wasser unterflogen sie die Radarkontrollen. Peter hatte keine Angst, aber später doch einmal Bedenken, als er sich ausrechnete, wie weit das Ziel noch entfernt war. Der Pilot beruhigte ihn: »No problem.« Die Floskel für alles in Jamaika. Aber Peter hatte richtig gerechnet, eine Tankfüllung reichte nicht. Mitten im Nirgendwo der Karibik musste die Cessna auf einer unbewohnten Insel zwischenlanden, wo es eine behelfsmäßige Rollbahn und im Gebüsch versteckt drei Fünftausend-Liter-Tanks voll Sprit gab, der per Hand ins Flugzeug gepumpt werden musste. Jetzt wusste Peter auch, warum sie zu zweit flogen. Sie mussten die Cessna unter die Bäume schieben. Einer allein hätte das nicht geschafft. Dann wurde der Schlauch angelegt. Peter pumpte, und der Pilot machte ein Schläfchen. Fünf Stunden später ging’s weiter, sie wollten im Dunkeln ankommen.
Belize liegt im Südosten der Halbinsel Yucatán und grenzt an Mexiko und Guatemala, daneben liegt Nicaragua. Erst kürzlich hatten die Briten ihre Kolonie Belize aufgegeben und zur Selbstständigkeit geführt. Es lebten fast nur Schwarze dort. Die Maschine landete auf einer richtigen Asphaltpiste in der Nähe von Belmopan, der Hauptstadt. Es war niemand dort, nur ein großer Range Rover stand da, auf dessen Ladefläche Peter, der Pilot und der Roverfahrer im Eiltempo das Ganja verluden. Danach haute der Fahrer mit Vollgas ab. Keine fünf Minuten später erschienen zwei Polizisten. Der Pilot verhandelte mit ihnen wegen der illegalen Einreise, er habe keinen Sprit mehr gehabt und sei notgelandet, erklärte er. Fünfzig US-Dollar wechselten den Besitzer und die beiden Polizisten halfen ihnen sogar noch, die Cessna an die Tankstelle zu schieben. Dann nahmen sie Peter und den Piloten mit in die Stadt und ließen sie in der Nähe des Hafens raus. Der Pilot war müde und ruhte sich aus, derweil schlenderte Peter durchs Hafenviertel und sah sich um. In einer Hafenkneipe saß unübersehbar ein Mann in Uniform mit sehr vielen Orden und Abzeichen. Irritierend angesichts der vergammelten Gäste um ihn herum. Peter trat auf ihn zu, deutete auf die Uniform und fragte hochachtungsvoll, wer er sei? Der Typ, stolz wie ein Gockel, freute sich über Peters Interesse und stellte sich als Colonel Ramon, designierter Kriegsminister der Sandinistas, vor. Stolz bekannte er, Waffen zu schmuggeln und gegen die Diktatur und den Kapitalismus im nahen Nicaragua zu kämpfen.
Peter hatte in Deutschland schon von den Sandinistas gehört. Viele linke Studenten fuhren nach Nicaragua und halfen den armen Kaffeebauern bei der Ernte, damit die Männer Zeit und Kraft hatten, gegen die Diktatur zu kämpfen. In Wirklichkeit sah das so aus: Während die weißen Intellektuellen den Kaffee pflückten – ein mühsames Geschäft, weil man nur die roten, nicht die grünen Bohnen pflücken darf, und sich dabei ständig die Finger und Hände aufreißt –, saßen die Sandinistas mit ihren Kalaschnikows am Rande des Feldes in der Sonne, grinsten und machten heimlich Witze über die klugen Helfer aus Deutschland.
Colonel Ramon war aus anderem Holz geschnitzt. Ein Kriegsherr. Er behauptete, er verdiene keinen Pfennig an der guten Sache, aber nach dem Sieg würde er Verteidigungsminister werden. Dessen war er sich sicher.
Vorweg gesagt, als Peter etwa sieben Jahre später wieder in Mexiko war, machte er einen Ausflug nach Belmopan. Er ging in dieselbe Hafenkneipe, und wen traf er dort? Richtig, Colonel Ramon. Peter war genauso überrascht wie Ramon. Aber dann erklärte Ramon, er schmuggle immer noch Waffen. Jetzt aber für die Contras, weil die Sandinistas ihn nach ihrem Sieg nicht zum Verteidigungsminister ernannt hatten, obwohl es fest versprochen war. Aber sollten die Contras gewinnen, dann würde er endlich Verteidigungsminister, ganz bestimmt. Und dann verriet er Peter im Flüsterton die große Wahrheit über die südamerikanische Politik: »Weißt du, warum es hier so viele Revolutionen gibt? Ganz einfach, weil noch nicht jeder Einwohner Präsident war und sich die Taschen füllen konnte.«
Peter verstand mittlerweile, wie schwierig es war, Marihuana ordentlich anzupflanzen. Durch das jamaikanische Klima – meist regnete es in den Bergen abends leicht und mit der vielen Sonne tagsüber schossen die Pflanzen nur so in die Höhe – konnte man ständig ernten. Aber gute Erträge bedeuten auch viel Arbeit. Zum Beispiel das Vereinzeln: Wenn die Jungpflanzen heranwachsen, müssen alle männlichen Pflanzen in mühsamer Arbeit per Hacke aus dem Feld entfernt werden, um die weiblichen Pflanzen vor den männlichen Samen zu schützen. Nur so wachsen ihre Pollen, von den Jamaikanern mit Vaginas verglichen, dick und saftig heran und werden immer saftiger, je länger sie auf den Samen warten, der natürlich nicht kommt. Das Ergebnis sind die dicken, satten Dolden, die als Sinsemilla, das heißt ohne Samen, als absolute Spitzenqualität angeboten und verkauft werden.
Mittlerweile hatte Peter einen recht großen Freundeskreis in Jamaika. Und als George in Amerika war, durfte er dessen Trans Am benutzen und fuhr damit durchs Land. Die Sache mit Flowers war eingeschlafen, weil er nicht mehr so oft in Kingston war. Außerdem gab es ja Girls genug.
Immer öfter aber tauchte in seinem Hinterkopf die Frage auf: Wie lief’s wohl jetzt in Deutschland? Und er fragte sich, was er hier eigentlich noch wollte? Besonders morgens, wenn er vor die Hütte trat, nach oben schaute und schon wieder die Sonne schien. Dieses ewig schöne Wetter nervte ihn. Another shitty day in paradise. Peter träumte davon, nachts durch kalte Straßen zu laufen, den Mantelkragen hochzuschlagen, in eine Kneipe einzukehren und sich mit einem Schnaps innerlich aufzuwärmen.
Doch noch war Peter in Jamaika und nahm mit, was ihm die Insel zu bieten hatte: die schönen Frauen, die geile Musik, Floßfahrten auf wilden Flüssen im Dschungel, die vielen Vögel, vor allem die winzigen Kolibris, und er hörte Jeffrie zu, Williams Plantagenchef, wenn der ihm die Welt erklärte, zum Beispiel den kubanischen Tabak. Jeffrie hatte einige Zeit in Kuba gelebt und schwor Stein und Bein, dass der kubanische Tabak nur deswegen den ersten Platz in der Weltrangliste besetzte, weil nach drei Tabakernten zwei Jahre lang Marihuana auf den Feldern gepflanzt und später untergepflügt wurde, damit es im Boden aufgehen und in die Tabakpflanzen eindringen konnte. Nur deshalb seien die kubanischen Zigarren so gehaltvoll, meinte Jeffrie. Ganz abwegig scheint dieser Gedanke nicht …
Peter verbrachte jetzt seine Nächte mit Hyacinth in Flankers. Sie wohnte zwar alleine, aber der Geruch in der Hütte war auch nicht besser. Sie gingen zusammen zum Reggae Sunsplash, ein Konzert mit den besten Reggaebands der Insel und ein Volksfest, obwohl mittlerweile viele Ausländer eigens für das Festival angeflogen kamen. Tag und Nacht dröhnte die Musik, aber es machte Spaß – zu tanzen, zu trinken und zu rauchen. Die Menge wogte im Rhythmus der Reggae-Riffs, aber so sehr die Frauen herumtollten, die Männer tanzten cool und doch intensiv mit ihren sparsamen Körperbewegungen. Sie schienen nur aus Unterkörper und Hüfte zu bestehen, so hingebungsvoll bewegten sie sich fast auf der Stelle. Eine Folge der Sklaverei. Wenn die Männer in den Zuckerrohrfeldern arbeiteten und dabei sangen und mit Sugarcane-Stangen Rhythmus schlugen, bewegten sie nur Hüften und Oberkörper, weil die Füße in Ketten lagen und kaum Bewegung zuließen.
Hier begegnete Peter vielen gemischten Paaren, junge deutsche Frauen und Rastas, Hand in Hand. Und jeder Flieger aus Düsseldorf brachte Frischfleisch für die Jungs und ihren Big Bamboo. Aus den Augenwinkeln beobachtete Peter einen langhaarigen Weißen, der sich an einige dieser Paare ranmachte und mit den Männern sprach. Es hörte sich an wie ein Verhör oder war es ein Interview? »Do you know this lady on your side already a longer time?« Bei dem ungelenken Englisch, lachte Peter in sich hinein, konnte das nur ein Deutscher sein.
Die Jamaikaner sprachen natürlich auch kein sehr feines Englisch. Der Satz »Migonnadudat« hatte Peter lange Rätsel aufgegeben, bis er ihn schließlich als »We are going to do that« verstand. In Jamaika wurde das Wort »Irie« sowohl als Gruß, als auch als Einverständnis gebraucht. Ebenso häufig wurde eine Aussage mit »Man« bekräftigt, genauso ausgesprochen wie das deutsche Mann. »Jamann« bedeutete Yes, »Iriemann« Okay und »Nomann« niemals. Marihuana hieß »Ganja« oder »Weed« und das stärkste Schimpfwort der Insel »Claaadt« bedeutete benutzte Monatsbinde.
Peter lauschte also, was der Deutsche mit dem Rasta da zu klären versuchte. Das Interesse des Mannes galt der Frau, die laut Rasta Christine hieß und aus Deutschland kam. Das wusste der Deutsche aber längst, sogar, dass sie aus Frankfurt stammte. Ihn interessierte ihr Nachname, den sie ihm nicht verraten wollte und den der Schwarze nicht kannte. Das Mädel zog ihren Rasta mit einem bösen Blick von dem neugierigen Deutschen weg, und der suchte sich das nächste deutsch-jamaikanische Paar.
Peter ließ von ihm ab und wandte sich wieder seiner Freundin zu. Hyacinth war fast einen Kopf größer als Peter und schlank. Sie tanzte ohne Pause und ließ stundenlang die Hüften kreisen. Wenn sie frühmorgens heimkamen, briet sie Bananen in der Pfanne, die sie mit Honig getränkt hatte. Sie war überzeugt, dass diese »Plátanos« Peters Libido weckten, und so warf sie sich sofort auf ihn. Vor Jamaika hatte Peter noch keine Frau erlebt, die beim Sex laut lachte und strahlte, es war meist sehr ernst zugegangen. Hier nicht.
Wenn Peter gerade Georges Trans Am nicht zur Verfügung hatte, war er mit sogenannten PPVs unterwegs. Private Public Vehicles stand auf den Schildchen, die sich jeder auf die Scheibe kleben und dann für wenige Cent Passagiere mitnehmen durfte. Er mied die Kleinbusse, wo neben den Fahrern, die meist eine Ganjatüte zwischen den Lippen hatten, eine Stereoanlage stand, deren Riesenboxen hinten allein vier Plätze einnahmen und aus denen in einer irren Lautstärke die obligatorischen Reggae-Rhythmen dröhnten, dass man fast taub wurde. Dazu kamen die oft ungepflegten, streng riechenden Passagiere mit ihren Ziegen oder Hühnern.