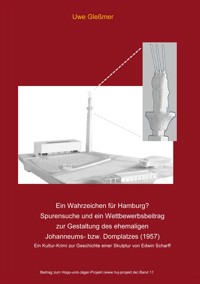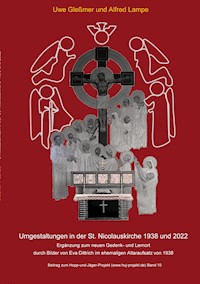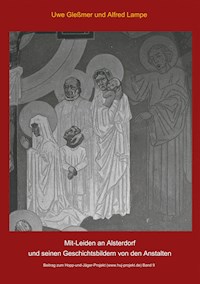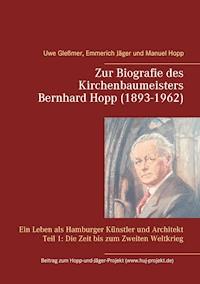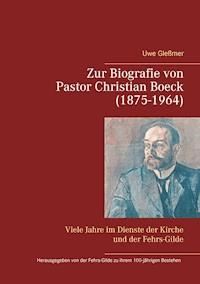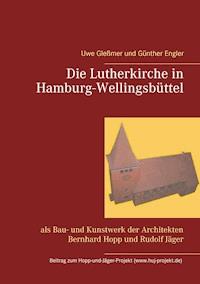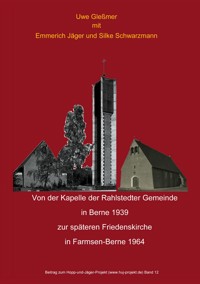
Von der Kapelle der Rahlstedter Gemeinde in Berne 1939 zur späteren Friedenskirche in Farmsen-Berne 1964 E-Book
Uwe Gleßmer
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Friedenskirche in Farmsen-Berne hat ihren Namen erst 1964 bei einem grundlegenden Umbau der bereits 1939 errichteten Kapelle erhalten. In ersten Veröffentlichungen 1938 wurde auf diesen geplanten Bau einer Kapelle verwiesen: "Hamburg-Berne, Gemeinde Alt-Rahlstedt" hieß es da. Wissen um die lange Vorgeschichte und Verortung in regionaler und kirchlicher Hinsicht ist wichtig, um die Anfänge der Baugeschichte zu verstehen. Traditionell gehörte das Berner Gut wie andere Ortschaften und Dörfer der Umgebung schon lange zur kirchlichen Betreuung der sehr alten Muttergemeinde in Rahlstedt. In der Alt-Rahlstedter Kirche (ab 1248) oder von den dortigen Geistlichen wurden Kindstaufen vorgenommen und auf dem Friedhof dort wurden sie später auch begraben. Nach der Reformation im 16. Jahrhundert wurden mehrere Kirchspiele nach und nach zur Propstei Stormarn. Politisch wurde die Region in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Teil der preußischen Provinz Schleswig-Holstein. So ist Farmsen-Berne zu einer Hamburger Exklave umgeben vom preußischen Gebiet geworden. Ursprünglich gehörten die Berner Ländereien zum Hamburgischen Kloster St. Georg. Als ehemaliges "Landgebiet" sind Farmsen und Berne erst in der NS-Zeit durch das Groß-Hamburg-Gesetz 1937/38 mit den früheren preußischen, westlichen Teilen Stormarns gemeinsam unter Hamburgische Administration gekommen. Diese lange Vorgeschichte von kirchlicher und politischer Zuordnung hat auch die kirchliche Baugeschichte beeinflusst, wie bei der Näherbetrachtung der am Bau Beteiligten deutlich wird. Dabei liegt in diesem Heft der Schwerpunkt auf Besonderheiten, die für die im März 1939 eingeweihte Kapelle sehr deutlich die Hände der beiden Architekten B. Hopp und R. Jäger erkennen lassen. H&J hatten in den ersten fünf Jahren ihrer gemeinsamen Tätigkeit eine besondere Innenraum-Gestaltung geprägt. Diese zeigt sich noch deutlich in anderen Kirchbauten des Alstertals: Beschriftung der Holzbalken, die Tonnendecke oder Emporenkonstruktion tragen, werden als Träger biblischer Voten und als nicht nur dekorative Signale mit genutzt. Wie dieses in die kirchliche und politische Umgebung passte, darum geht es in diesem Heft. Ebenso wird der Weg zur Erweiterung mit Gemeindehaus 1963 und der Umbau mit 180 Grad Umorientierung des Innenraumes geschildert: 1964 konnte die Friedenskirche - jetzt mit Turm - eingeweiht werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 97
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zum Inhalt:
Die Friedenskirche in Farmsen-Berne hat ihren Namen erst 1964 bei einem grundlegenden Umbau der bereits 1939 errichteten Kapelle erhalten. In ersten Veröffentlichungen 1938 wurde auf diesen geplanten Bau einer Kapelle verwiesen: "Hamburg-Berne, Gemeinde Alt-Rahlstedt" hieß es da. Wissen um die lange Vorgeschichte und Verortung in regionaler und kirchlicher Hinsicht ist wichtig, um die Anfänge der Baugeschichte zu verstehen.
Traditionell gehörte das Berner Gut wie andere Ortschaften und Dörfer der Umgebung schon lange zur kirchlichen Betreuung der sehr alten Muttergemeinde in Rahlstedt. In der Alt-Rahlstedter Kirche (ab 1248) oder von den dortigen Geistlichen wurden Kindstaufen vorgenommen und auf dem Friedhof dort wurden sie später auch begraben. Nach der Reformation im 16. Jahrhundert wurden mehrere Kirchspiele nach und nach zur Propstei Stormarn. Politisch wurde die Region in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Teil der preußischen Provinz Schleswig-Holstein. So ist Farmsen-Berne zu einer Hamburger Exklave umgeben vom preußischen Gebiet geworden. Ursprünglich gehörten die Berner Ländereien zum Hamburgischen Kloster St. Georg. Als ehemaliges "Landgebiet" sind Farmsen und Berne erst in der NS-Zeit durch das Groß-Hamburg-Gesetz 1937/38 mit den früheren preußischen, westlichen Teilen Stormarns gemeinsam unter Hamburgische Administration gekommen.
Diese lange Vorgeschichte von kirchlicher und politischer Zuordnung hat auch die kirchliche Baugeschichte beeinflusst, wie bei der Näherbetrachtung der am Bau Beteiligten deutlich wird. Dabei liegt in diesem Heft der Schwerpunkt auf Besonderheiten, die für die im März 1939 eingeweihte Kapelle sehr deutlich die Hände der beiden Architekten B. Hopp und R. Jäger erkennen lassen. H&J hatten in den ersten fünf Jahren ihrer gemeinsamen Tätigkeit eine besondere Innenraum-Gestaltung geprägt.
Diese zeigt sich noch deutlich in anderen Kirchbauten des Alstertals: Beschriftung der Holzbalken, die Tonnendecke oder Emporenkonstruktion tragen, werden als Träger biblischer Voten und als nicht nur dekorative Signale mit genutzt. Wie dieses in die kirchliche und politische Umgebung passte, darum geht es in diesem Heft. Ebenso wird der Weg zur Erweiterung mit Gemeindehaus 1963 und der Umbau mit 180 Grad Umorientierung des Innenraumes geschildert: 1964 konnte die Friedenskirche - jetzt mit Turm - eingeweiht werden.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1.
Anlass & Vorgeschichte
2.
Die Kapelle und Friedenskirche in Berne
3.
Wie ist es zum Bau der Kapelle gekommen?
3.1 Die ideologischen Auseinandersetzungen vor 1939
3.2 Welche Akteure stehen hinter dem kirchlichen Bau von 1939?
3.3 Die Architekten Bernhard Hopp (1893-1962) und Rudolf Jäger (1903-1978)
3.3.1 Typische Gestaltungen in H&J-Kirchbauten
3.3.2 H&J-Gestaltung der Berner Kapelle 1937-1939
3.4 Trägerschaft der Rahlstedter Muttergemeinde
3.5 Staatliche Einflussnahme auf den Bau
4.
Der Umbau zur Friedenskirche 1962-1964
4.1 Kirchbau mit Gemeindehaus
4.2 Kirchbau mit Turm
5.
Resumé
6.
Anhang 1: Frühere H&J-Veröffentlichungen zu Berne
6.1 Die Kapellen in HH-Berne und Sundern
6.2 Friedenskirche (1939 HH Rahlstedt/Farmsen-Berne)
7.
Anhang 2: Zu den Balken-Inschriften in frühen H&J-Kirchen
8.
Anhang 3: weitere Details zur Friedenskirche
8.1 Korrekturen zu o.g. früheren H&J-Veröffentlichungen
8.2 Fotos von Details
8.2.1 Empore und Orgel
8.2.2 Glocken
9.
Anhang 4: Biographisches zu Einzelpersonen
9.1 Herntrich, F (1903-1951)
9.2 Herntrich, V. (1908-1958)
9.3 Hoeck, C. (1881 –1967)
9.4 Holzgreen, H. (1894-1966)
9.5 Paetel, O. (1894–1945)
9.5.1 Böe (1978) S. 87:
9.5.2 Rademacher (1995) S. 114:
9.5.3 Uwe Schmidt (2010) S. 424:
9.5.4 De Lorent (2016) Bd I S. 34
9.5.5 Zeitungsausschnitte
9.6 Rothacker, E. (1903-1986)
9.7 Sommer, J. (1909-1943)
9.8 Surkau, H.-W. (1910-1993)
10.
Anhang 5: Herntrich „Neuheidentum und Christusglaube“ (1935)
11.
Abkürzungen, Archivalien und Indices zu Personen, Orten und Themen
11.1 Abkürzungen
11.2 Archivalien:
11.3 Kurztitel und Literatur
11.4 Personen-Index
11.5 Orts- und Straßennamen
11.6 Themen-Index
12.
Dokumentationen aus dem H&J-Projekt
13.
13 Zu Autorin und Autoren
Vorwort
Die folgende Materialzusammenstellung zur Kapelle und späteren Friedenskirche in Berne ist im Zusammenhang mit einem Vortrag entstanden, der auf Einladung des Denkmalvereins am 30.11.2024 stattfand. Den Anlass dazu bildete die Situation, dass eine Entscheidung des Gemeindekirchenrats gefallen war, dass eine weitere Unterhaltung des Gebäudekomplexes beendet werden müsse. Die Konsequenz, dass die Kirche eventuell abzureißen wäre, hat am Ort zu Unruhe und einer Initiative für den Erhalt der Kirche geführt. Zwischen den teils sehr polarisierten verschiedenen Sichtweisen muss es zu einem gemeinsamen Nachdenken kommen. – Ein Schritt und Beitrag in diese Richtung könnte das gemeinsame Wissen um die Geschichte des Bauwerks bilden, das zwar nicht unter Denkmalschutz steht, aber doch von einer denkwürdigen Vergangenheit zeugt. Denn an dem Ort mit der in den 1920er Jahren entstandenen Genossenschaftssiedlung der Berner Gartenstadt bildete zwar eine neue Schule ein wichtiges kommunales Vorhaben, das unter Oberbaudirektor Schumacher 1930 fertig gestellt wurde. Eine Kirche gehörte jedoch nicht zu den Elementen der Stadtplanung der damals hamburgischen Exklave aus den Orten Farmsen und Berne. Wie ist es dann zum Bau der Kapelle 1939 in der NS-Zeit gekommen?
Im Dokumentationsprojekt zu den Architekten B. Hopp und R. Jäger (= H&J) ist bereits zu einigen der NS-zeitlichen Kirchen zu baugeschichtlichen Materialien und Kontexten geforscht und publiziert worden. Allerdings waren für den kleinen (und teils vergessenen) H&J-Kapellen-Bau nur wenige Archivalien und Dokumentationen verfügbar. Das liegt z.T. an den wechselnden Zugehörigkeiten zu anderen Gemeindeteilen (Rahlstedt und Farmsen) bzw. zum Kirchengemeindeverband Rahlstedt als Teil der Propstei Stormarn. Aber auch die für die hamburgische Geschichte wichtige neue politische und gebietsmäßige Veränderung durch das Groß-Hamburg-Gesetz 1937/38 bildet eine zu bedenkende Komponente. Die Randlage und Zugehörigkeit zur „Muttergemeinde“ in der ehemaligen preußischen Provinz Schleswig-Holstein erschwert ein Finden von weitergehenden Unterlagen. Diese Lücke kann aber hoffentlich durch den Impuls aus diesem ersten Schritt verkleinert werden.
Unsere früheren Bezugnahmen auf dieses Bauwerk sind im Rahmen von Überblickstexten publiziert worden, die unten in einen Anhang mit aufgenommen sind. Das geschieht einerseits, weil die „Beiträge zum Hopp-und-Jäger-Projekt“1 für Interessierte zwar über die einschlägigen Suchmittel zugänglich sind, aber die entsprechenden Passagen nur zweimal drei bzw. vier Seiten umfassen. Andererseits waren auch Korrekturen an diesen Texten notwendig, die sich aus der erneuten Beschäftigung ergeben. Uns liegt daran, jetzt möglichst gesicherte und nachprüfbare Informationen zu bieten. Wir selbst haben z.T. Dinge abgeschrieben, die in Chroniken zwar überliefert sind, die aber aus einer Kette von Abschreibvorgängen stammen, die jedoch nicht an Quellen überprüft wurden.
Die vorliegende Erweiterung des Vortragstextes u.a. mit Anmerkungen ist aus dem Werdegang dieses Büchleins zu erklären: Denn einerseits hatte ich in der Vorbereitungsphase möglichst dokumentiert, woher Informationen kamen und in welchem Originalwortlaut sie vorliegen. Andererseits konnte im gesprochenen Vortrag, der mit einer separaten Powerpoint-Präsentation unterstützt war, nicht die umfangreichere Version des Entwurftextes genutzt werden. Dieser enthielt in Anmerkungen neben Quellenangaben auch andere ausführlichere Verweise, die nun – für eine an neue Leserschaft gerichtete Fassung – zusammen mit weiteren Ergänzungen nützlich sein können. Das erklärt eine gewisse Uneinheitlichkeit im Duktus.
So soll mit der jetzigen Textfassung ein Nachvollziehen bei der Lektüre oder beim Vergleich mit abweichenden Angaben leichter möglich sein. Denn Differenzen existieren auch in solchen offiziellen Werken, die vorschnell als verlässlich angesehen werden. Zeitlich bedingte, unterschiedliche Quellenauswertung führt gelegentlich zu sehr abweichender Gewichtung der Darstellung. Unkritisches und ungeprüftes Übernehmen von Detailangaben wollen wir – wie gesagt – jedoch möglichst vermeiden. Das lässt sich trotzdem leider nur weitgehend erreichen. Doch in Zeiten von nur auf Wikipedia basiertem „Wissen“ und scheinbar künstlicher Intelligenz wird dieses Phänomen uns auch in künftigen Textproduktionen nicht erspart bleiben. Das Überprüfen von Informationen wird eine wichtige Aufgabe u.a. auch der Erziehung bleiben.
Für den ursprünglichen Vortrag war eine Einladung des Denkmalvereins ergangen, der ca. 35 Personen gefolgt waren. Von den Rückmeldungen der Besucherinnen und Besucher sowie von den zu dem Event überlassenen Fotos wollen wir (als Gruppe von Beteiligten aus dem Denkmalverein und H&J-Projekt) wichtige Teile unten im Anhang aufnehmen.
Im März 2025 Uwe Gleßmer für die Gruppe der an der Vorbereitung Beteiligten dieses Heftes
https://www.denkmalverein.de/angebote/veranstaltungen/date:20241130/id:besichtigung-friedenskirche-berne
1 Siehe in der Liste der Publikationen unten S. 75.
1 Anlass & Vorgeschichte
Gern habe ich zugesagt, als ich vom Denkmalverein durch Silke Schwarzmann gefragt wurde, ob ich über die von den Architekten Bernhard Hopp und Rudolf Jäger (= H&J) gebaute Kirche eventuell einen Vortrag halten würde. Ich wusste seit einiger Zeit bereits aus der Presse, dass sich viele Menschen Gedanken machen, wie es um die Friedenskirche steht. Über diese H&J-Kirche hatten wir bisher nur in zwei unserer Projekt-Beiträge auch berichtet,2 so dass jetzt der Anlass zu einer Vertiefung gekommen war.
Selbst bin ich aber nicht in die Fragen verwoben, die sich um die Zukunft des Gebäudes drehen. Möglicherweise haben Sie in der Einladung hinter meinem Namen gelesen „Pastor im Ruhestand“ und vermuten deshalb eine bestimmte Sichtweise. Doch bin ich kein kirchlicher Ruhegeld-Empfänger, sondern war nach dem 2. Examen und Ordination fast ununterbrochen in der Universität tätig. Theologie ist mir aber auch außerhalb eines besoldeten Amtes weiterhin wichtig.
Seit meinem Ruhestand bin ich ab 2014 einem scheinbar „un-theologischen“ Hobby nachgegangen: Ich wollte mehr dazu wissen, welche Umstände dazu geführt haben, dass einige mir als Gebäude bekannte Kirchen gebaut wurden.
Das interssierte mich während des Theologie-Studiums in den 1970er Jahren kaum. Allerdings ist für die Kirchen aus der NS-Zeit solches Fragen nicht unwichtig, wie ich jetzt weiß. Doch war mein Bild damals eher so, dass Kirchen in der NS-Zeit gar nicht gebaut werden konnten. So stand es auch in schlauen Büchern, deren Bilder von Geschichte ich übernommen hatte. Aber: wie ich seit 2014 weiß, haben die Architekten Hopp und Jäger vor dem Zweiten Weltkrieg zahlreiche Kirchen gebaut, andere z.T. wesentlich umgebaut.
Auch nach dem Krieg waren sie sehr aktiv: sowohl beim Wiederaufbau der zerstörten großen Innenstadt-Kirchen (wie St. Katharinen und St. Jacobi) als auch beim Neubau von Kirchen und Gemeindezentren. Darüber haben wir in einem 2014 begonnenen Dokumentationsprojekt viele Materialien zusammengetragen (www.huj-projekt.de). Und das war der Hintergrund der Anfrage für die Veranstaltung des Denkmalvereins.
Mein 2014 neu gewonnenes Interesse muss ich versuchen, kurz in Stichworten zu erklären: In meiner Biografie sind mehrere Hopp-und-Jäger-Kirchen wichtige Stationen gewesen. Allerdings wusste ich (wie die meisten Kirchenbesucher) nichts über deren Architekten.
Abb. 1: HAA_ORh_050.1_(0403) Ausschnitt Hakenkreuz
Das änderte sich durch ein Geschichtsprojekt der Wellingsbütteler Lutherkirche. Denn dieses 1937 fertig gestellte Bauwerk bietet in seinem äußeren Mauerwerk u.a. ein Hakenkreuz. Mit dem 75-jährigen Kirchweihjubiläum 2012 begann eine Diskussion um ein angemessenes Gedenken. Vor allem ein engagiertes Gemeindeglied ließ nicht locker.3 So hat Herr Dr. Engler, mich auch für ein Mitmachen geworben. Wir hatten in Wellingsbüttel zuvor bis 2008 gewohnt und mit unseren Kindern wichtige Lebensphasen u.a. im Kindergottesdienst verlebt.
Über die Beschäftigung mit den Umständen der Entstehung und der Frage nach dem Anteil der Architekten an der Gestaltung des problematischen „Mauerdekors“ sind wir dann tiefer eingedrungen: Es musste das Interesse von Hopp-und-Jäger an Kirchen weiter geklärt werden. Warum bauten sie Kirchen? In der NS-Zeit haben das nur sehr wenige Architekten getan, z.T. mit sehr fragwüdigen ideologischen Motiven.4
Dabei wurde mir bewusst, dass ich auch in einer 1938 erbauten H&J-Kirche, Maria-Magdalenen in Klein Borstel, als Vikar zu Beginn der 1980er Jahre tätig war. Unsere älteste Tochter wurde dort 1983 getauft. Erst als unsere Kinder im Wohnort
in der Wellingsbütteler Gemeinde in kirchliche Kindergruppen kamen, endete diese Phase.
Abb. 2: HAA_ORh_028.2_(0560)
In Klein Borstel hatte ich zuvor – nach der Ordination 1982 – auch einen ehrenamtlichen Predigtauftrag und wirkte in Kinderarbeit, im Konfirmandenunterricht und Predigtdienst mit, später auch noch im Posaunenchor.
Bei mir stand naturgemäß die alltägliche Gemeindearbeit im Vordergrund, – ohne dass ich mich um die früheren Zeitumstände am Ort gekümmert hätte.
[[Auch zu Maria-Magdalenen gab es zu ihrer Bau- und Einweihungszeit viele bisher kaum bedachte Details – etwa zum Altarraumbild.5]]