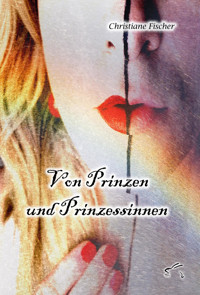
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edition Paashaas Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dominik führt ein vielseitiges Leben: Mal fühlt er sich als Mann, mal als Frau. Mit Leidenschaft nimmt er an Drag-Shows teil. Sein Freund duldet sein zweites Dasein als Cross-Dresser, aber befürwortet es nicht wirklich. Als Dominik eine neue Stelle als Pfleger in einer Psychiatrie antritt, trifft er auf Laura. Die junge Frau wurde entführt und sehr lange gefangen gehalten. Seit ihrer Befreiung ist sie stark suizidgefährdet. Doch nichts ist, wie es scheint ... Als Dominik sie näher kennenlernt und nachforscht, kommt er einem Skandal auf der Spur. Er ist sich sicher: Laura gehört nicht in diese Anstalt. Er fasst einen gewagten Entschluss, um ihr zu helfen ... Ein dunkles Geheimnis, Freundschaft, Liebe, Toleranz , Freiheit und Selbstfindung ... Eine Geschichte - so vielseitig und bunt wie ein Feuerwerk.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Fünfzehn Jahre später
Ein neues Leben
Geständnisse
Die Reise
Das Wiedersehen
Rehabilitiert
Epilog
Danksagung
Nachwort
Über die Autorin
Weitere Bücher der Autorin
Impressum
Edition Paashaas Verlag
Titel: Von Prinzen und Prinzessinnen
Autor: Christiane Fischer
Originalausgabe August 2024
Covermotive: Pixabay.com
Covergestaltung: Michael Frädrich
Lektorat: Renate Habets, Manuela Klumpjan
Printed: BoD GmbH, Norderstedt
© Edition Paashaas Verlag
Printausgabe: ISBN: 978-3-96174-150-2
Sämtliche Handlungen und Charaktere in diesem Buch sind frei
erfunden. Eventuelle Ähnlichkeiten mit Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.d–nb.de abrufbar
Von Prinzen
und Prinzessinnen
Prolog
Es war heiß an diesem Julitag. Die Sonne stand golden am tiefblauen Himmel, der nur von wenigen Wolken durchzogen war. Hin und wieder wehte mir ein lauer Wind um die Nase, der jedoch wenig Abkühlung verschaffte. Wie jeden Nachmittag nach der Schule spielte ich draußen im Garten. Spielen war vielleicht das falsche Wort dafür, denn meistens lag ich einfach bloß im Gras, verschränkte meine Arme hinter dem Kopf und blickte hoch zum Himmel, träumte vor mich hin. Doch an diesem Tag hatte ich auch dazu keine Lust. Papa schickte mich immer raus, zum Spielen, wollte, dass ich im Dreck herumwühlte, Regenwürmer sammelte oder ein Baumhaus baute. Lieber noch sollte ich das mit Jungs aus der Nachbarschaft machen. Allerdings hatte ich dort wie auch in der Schule keine Freunde. Die Interessen der Jungs aus meiner Klasse, die aus Fußballspielen, Spielzeugautos sammeln oder Fahrradfahren bestanden, konnte ich nicht teilen. Auch fand ich es überhaupt nicht cool, wenn sie die Mädchen aus unserer Klasse ärgerten. Da machte ich nie mit. Ich bevorzugte es, allein zu sein. Lieber war ich drinnen als draußen, hörte Musik oder spielte mit Mamas Schmuck. Der war wunderschön. Er funkelte und glitzerte so toll, faszinierte mich. Ich horchte auf vom Gesang einer Drossel, die sich in unserem Apfelbaum befand. Ihr liebliches Getriller zauberte mir augenblicklich ein Lächeln ins Gesicht. Ich warf den Kopf in den Nacken, peilte den Baum an und suchte nach dem Vogel, doch er blieb verborgen. Ich pfiff, bekam prompt eine Rückantwort von ihm. Zufrieden stopfte ich eine Hand in die Hosentasche und pfiff abermals. So ging es eine ganze Weile lang hin und her, bis ich beschloss, endlich zurück ins Haus zu gehen. Im Flur hörte ich Mama und Papa wieder einmal streiten. Ich folgte ihren Stimmen, die aus der Küche drangen.
„Du dusselige Kuh“, brüllte er.
„Bitte, Carsten, hör auf“, gab Mama in weinerlichem Ton zurück.
Vorsichtig lugte ich durch den leicht geöffneten Türspalt und sah Mama am Herd stehen. Papa war an die Arbeitsplatte gelehnt, mit einem roten und zu einer Fratze verzerrtem Gesicht. Nur allzu gut kannte ich diesen Ausdruck. Er bedeutete immer schlimmen Ärger.
„Wenn du zu dämlich bist, ein Steak medium zu braten, dann hast du noch mehr verdient als bloß Schimpfe!“, wetterte er und verzog seine Augen zu kleinen Schlitzen.
Mama trug das lange Jeanskleid, das ich so gern an ihr sah. Ihr Schluchzen und Wimmern versetzte mir einen Stich. Pure Angst war darin zu hören. Die Kajalfarbe um ihre Augen war leicht verlaufen, das konnte ich selbst aus der Entfernung erkennen. Sie schüttelte den Kopf und schniefte. Ihre schulterlangen, kastanienbraunen Locken wippten auf und ab. Langsam bewegte Papa sich auf sie zu, wirkte wie ein gefährliches Raubtier, das seine Beute fixierte. Mama klammerte sich mit beiden Händen an der Arbeitsplatte fest.
Papa hob seine Hand, holte zum Schlag aus.
„Nein!“, schrie ich und rannte auf Mama zu.
„Dominik“, flüsterte meine Mutter und strich mir sanft über den Kopf, nachdem ich mich in ihre Arme geworfen hatte.
„Geh aus dem Weg!“
Papas Stimme klang bedrohlich. Er hob einen Finger in die Höhe. Sein Blick war finster, bescherte mir eine Gänsehaut. Dennoch konnte ich Mama nicht im Stich lassen.
„Mein Schatz, bitte tu, was dein Vater gesagt hat. Ich komme schon klar“, sagte Mama und löste sich sanft von mir.
Wie oft hatte Papa sie schon geschlagen? Ich hatte aufgehört zu zählen. Für jede Kleinigkeit bekam sie einen Tritt oder eine Ohrfeige. Entweder war das Essen seiner Meinung nicht warm genug, zu heiß, oder in der Wohnung war es nicht ordentlich genug. Er fand immer Gründe, um wütend zu sein. Ich sah wieder zu Papa hinüber, der wie ein Stier schnaubte. „Hör auf, Mama zu hauen“, sagte ich bestimmt.
Seine Miene verdüsterte sich. „Was hast du gerade gesagt?“, gab er mit lauter Stimme von sich, bewegte sich auf mich zu. Sein Schnäuzer zuckte leicht.
„Bitte, lass den Jungen!“, wandte Mama ein.
„Halt du dich da raus, du Schlampe!“
Mein Vater hob seine Hand und verpasste mir eine schallende Ohrfeige. Augenblicklich ging ich in die Knie, begann zu weinen und legte meine Finger auf die brennende Wange.
Mama hockte sich vor mich, nahm mich in den Arm. „Ganz ruhig, mein Kleiner“, wisperte sie mir zu, hielt mich noch fester.
„Schluss jetzt! Du behandelst ihn wie eine kleine Memme. Der Junge ist schon neun Jahre alt“, peitschte mein Vater drauf los, woraufhin Mama mich langsam wieder freigab.
„Spiel ein bisschen in unserem Schlafzimmer“, schlug sie vor, da sie wusste, wie gern ich ihren Schmuck in die Hände nahm. Dann widmete sie sich wieder ihren Töpfen und Pfannen.
Einen letzten Blick warf ich noch auf sie, während ich mich unsicher von ihr fortbewegte. Papa hatte sich inzwischen im Küchenstuhl zurückgelehnt. Er wirkte deutlich entspannter.
Wenn er seine Wut jetzt an mir ausgelassen hat, verschont er wenigstens Mama, dachte ich und steuerte das Schlafzimmer an. Ich setzte mich an Mamas kleinen Schminktisch, der sich rechts neben dem Bett befand, ließ meinen Blick über die prächtigen Parfümflakons schweifen, die aussahen wie funkelnde Zauberfläschchen. Entschieden griff ich nach einem, der die Form einer Schlange aufwies, und sprühte mir etwas davon auf mein T-Shirt, schloss die Augen und atmete den Duft nach wilden Rosen und Lavendel ganz tief ein. Anschließend schnappte ich mir den roten Lippenstift aus dem Schminkkästchen und bemalte meine Lippen.
Eingehend betrachtete ich mein Spiegelbild. Meine Lippen waren so schön rot, es gefiel mir. Zufrieden grinste ich vor mich hin. Dann lief ich zum Kleiderschrank und nahm Mamas unterschiedliche Kleider in Augenschein. Schon immer hatte ich Lust gehabt, eines davon anzuprobieren, wollte wissen, wie sich der Stoff auf meiner Haut anfühlte. Schließlich entschied ich mich für das rote Kleid mit den Spaghettiträgern. Rasch schlüpfte ich aus den Jeans, zog mir das Shirt über den Kopf und ließ alles unachtsam zu Boden gleiten. Andächtig betrachtete ich das Kleid für einige Sekunden, ehe ich es mir anzog. Glatt und seidig schmiegte sich der Stoff an meine Haut. Mein Herz pochte aufgeregt vor sich hin. Ich lief zum Wandspiegel, bestaunte mein Spiegelbild. Auch wenn mir das gute Stück noch zu groß war, sah es toll an mir aus, fand ich. Nun fehlen bloß noch die passenden Schuhe, überlegte ich und visierte auch schon Mamas Schuhkommode an, die unter dem Fenster aufgebaut war. Mir stachen sofort die roten Pumps ins Auge, die ich im nächsten Moment auch schon anzog und mit ihnen vorsichtig durchs Zimmer lief. Sie waren mir natürlich viel zu groß. Ganz vorsichtig musste ich darin laufen, um nicht hinzufallen.
„Was soll denn diese Scheiße?“, hörte ich plötzlich meinen Vater keifen. Wenige Sekunden darauf stürzte er sich auf mich, prügelte mich hart. Immer wieder schlug er auf mein Gesicht und meinen Rücken ein. In meinen Ohren begann es zu rauschen. Bloß noch gedämpft hörte ich seine Worte: „Ich ziehe keine Schwuchtel groß! Ich ziehe keine Schwuchtel groß!“
Weder Angst noch Schmerz fühlte ich in diesem Moment. Wie betäubt war ich. Ich hörte Mamas Schreie, die an den Wänden widerhallten. Schützend stellte sie sich zwischen Papa und mich.
„Das kommt bloß von deiner ganzen Verhätschelei“, giftete er, stieß sie beiseite und wendete sich erneut mir zu. „Ich prügle das schon aus dir raus!“
Mit einem Satz riss er mir das Kleid vom Leib und schlug mir so fest gegen den Kopf, dass ich das Bewusstsein verlor.
Fünfzehn Jahre später
Dominik
Das Klingeln meines Handys riss mich aus meiner morgendlichen Meditation. Augenblicklich verließ ich meinen Platz auf dem langflorigen rosa Teppich, auf dem ich zuvor noch im Schneidersitz geruht hatte, rannte in mein Schlafzimmer und griff mir mein Smartphone vom Nachttisch. Auf dem Display erkannte ich die Nummer der Johann Klinik. Dort hatte ich letzte Woche ein Vorstellungsgespräch gehabt.
„Hallo? Dominik Sträter hier“, meldete ich mich zu Wort und ließ mich angespannt auf mein Bett nieder.
„Guten Morgen, Herr Sträter! Hier ist Herr Mainz von der Johann Klinik. Ich wollte Ihnen bloß mitteilen, dass wir uns für Sie entschieden haben. Sie können nächste Woche anfangen.“
Erleichtert atmete ich aus. Es war natürlich nicht so, dass es Bewerber für die Stelle als Pfleger in einer Nervenheilanstalt zuhauf gab, dennoch war ich skeptisch, was mich betraf. Ich hatte als ehemaliger Altenpfleger wenige Erfahrungen auf diesem Gebiet und würde erst einmal intensiv eingearbeitet werden müssen. In dem Altenheim, wo ich zuvor tätig gewesen war, hatte ich gekündigt. Die Tatsache, dass ich andauernd von meinen Kollegen ausgenutzt und übergangen worden war, hatte ich nicht mehr weiter hinnehmen wollen. Ein neuer Wirkungskreis war es, was ich dringend brauchte. Mein Vorstellungsgespräch mit Herrn Mainz war etwas verkrampft verlaufen. Er hatte alles wissen wollen: Wo ich zur Schule gegangen war, wie meine Kindheit verlaufen war, ob ich in einer Beziehung steckte.
„Das freut mich. Ich danke Ihnen.“ Ich lächelte breit.
„Uns freut es ebenfalls. Herzlich willkommen in unserem Team. Bis nächste Woche dann.“ Die Stimme von Herrn Mainz klang heiter.
„Bis nächste Woche.“
Zufrieden beendete ich das Telefonat. Tief atmete ich aus, lief zum Schrankspiegel hinüber und begutachtete mich. In dem weißen Unterhemd und den roten Satin-Shorts fühlte ich mich zuhause immer noch am wohlsten. Doch es war Zeit, sich ein Outfit auszusuchen. Am Abend würde ein weiterer Auftritt von mir stattfinden, auf den ich mich schon sehr freute. Ich zerzauste meine dunkelblonden Haare und lief ins nächste Zimmer, meinen Ankleideraum. Sonnenstrahlen drangen aus dem Fenster und tauchten das Zimmer in warmes Licht. Ein überdimensional großer Spiegel mit goldenen Verschnörkelungen war an der Wand angebracht. Links und rechts neben ihm waren Kleiderstangen mit den unterschiedlichsten Outfits zu finden. Ganz hinten in der Ecke gab es ein gut bestücktes Schuhregal, in dem sich Pumps, Stilettos, Stiefel und High Heels aneinanderreihten. Einen kleinen Schminktisch sowie einen mittelgroßen Tisch, auf dem Puppenköpfe mit Perücken verschiedener Farben und Längen aufgebaut waren, gab es dort auch. In den letzten Jahren hatte ich mir eine beachtliche Sammlung edler Kleidungsstücke und Accessoires angeschafft. Da solch glamouröse Stücke natürlich einiges kosteten, hatte ich mich für Secondhand und Duplikate entschieden, die erschwinglich für meinen Geldbeutel waren. Nach dem Tod meines Vaters hatte ich ein kleines Erbe ausgezahlt bekommen. Außerdem konnte ich auf eine größere Geldrücklage durch den Verkauf meines Elternhauses zurückgreifen, die ich jedoch gedachte, sparsam einzusetzen, um mir ein finanzielles Polster zu lassen. Kleider in rosa, roter und schwarzer Seide, aus Chiffon, Velours, Satin, Tüll, Cord hingen feinsäuberlich geordnet an den Stangen. Sie besaßen viel oder wenig Ausschnitt. Die meisten von ihnen waren mit Pailletten in Gold, Silber, mit kostbaren Applikationen oder mit Federn bestückt. Lange Mäntel mit Kunstpelz oder Kunstleder hingen ebenfalls an den Stangen. Jedes der Kleidungsstücke hatte ich nach Farben sortiert. Willkürlich griff ich nach dem kleinen schwarzen Kleid aus Samt, das gerade mal meinen Po bedeckte, überlegte einige Sekunden, hängte es dann wieder zurück. Nein, an diesem Abend wollte ich noch mehr Glamour! Zielstrebig durchforstete ich mein Arsenal und entschied mich schließlich für ein langes, weinrotes Abendkleid aus Chiffon mit V-Ausschnitt und Spitze. Die Mode war meine große Leidenschaft – und ich war sehr stolz auf meine Sammlung. Aus dem Schuhregal suchte ich mir silberne High Heels heraus, die im Sonnenlicht funkelten und glitzerten wie abertausende von Diamanten. „Ja“, stieß ich selig hervor, trug die Sachen in mein Schlafzimmer, stellte die Schuhe vor dem Bett ab, legte das Kleid darauf und verschwand ins Bad.
Nach dem Duschen schlüpfte ich in meinen rosafarbenen Morgenmantel mit den mit Kunstpelz bestückten Ärmeln. Die Schleppe war ebenfalls mit Kunstpelz besetzt und gab mir dieses leichte und lockere Gefühl, das ich so sehr liebte. Ich lief quer durch das Wohnzimmer auf der Suche nach meinen Zigaretten. Obwohl meine Wohnung stets sauber und aufgeräumt war, konnte ich ein echter Schussel sein, verlegte immer mal wieder entweder Feuerzeug oder Glimmstängel. Ich wohnte in einer Stadtwohnung in Köln-Deutz. Das Wohnzimmer besaß große Fenster, durch die ausreichend Tageslicht in den Raum fiel. Eine rote Samtcouch stand in der Mitte des Raumes. Davor war ein gläserner Couchtisch, auf dem eine Vielzahl für mich wichtige Modezeitschriften in Reih und Glied platziert waren. Schließlich musste ich ja auf dem Laufenden bleiben, was zurzeit en vogue war! Rosafarbene Plüschteppiche lagen auf hellem Laminat verteilt. Eine große Wohnwand mit Fernseher und Büchern in den Regalen war weiter rechts ausgerichtet. An den Wänden hingen eingerahmte Poster meiner Lieblingsdiven wie Marilyn Monroe, Barbra Streisand und Aretha Franklin. Sehr gerne hörte ich ihre Platten auf einem alten Plattenspieler, den ich auf einem Trödelmarkt hatte ergattern können. Von Stereoanlagen oder sonstige Bluetooth-Boxen hielt ich nicht viel, da war ich eher altmodisch. Es musste Vinyl sein. Der Sound war für mich der beste.
Da! Endlich.
Die Zigarettenpackung war in die Sofaritze gerutscht. Mit einem Satz zog ich sie hervor, entnahm eine Zigarette, griff nach der Zigarettenspitze und dem Feuerzeug, welche auf dem Couchtisch lagen, steckte die Zigarette auf die Spitze, zündete sie an und nahm einen tiefen Zug. Die Zigarettenspitze benutzte ich hin und wieder, wenn ich mich besonders reizvoll fühlen wollte. Genüsslich schloss ich die Augen, wanderte anschließend in die Küche, die sich einen Raum weiter befand. Diese war recht klein. Herd, Arbeitsplatte, Kühlschrank, sowie ein kleiner rundlicher Küchentisch mit drei Stühlen genügte mir voll und ganz. Ich schlenderte zur Kaffeemaschine und ließ mein Lebenselixier durchlaufen.
***
Ich parkte meinen blauen Opel Corsa in einem Parkhaus und lief durch die Altstadt. Das Licht der Straßenlaternen leuchtete mir den Weg in der bereits eingetretenen Abenddämmerung. Die aneinandergereihten Clubs, Restaurants und Kneipen lockten mit ihren bunten Leuchtreklamen. Englische, deutsche und orientalische Musiken streiften meine Ohren. Mein komplettes Outfit und mein kleines Schminkköfferchen trug ich in einer blauen Sporttasche mit mir herum. Passanten, die mir entgegenkamen, würden niemals anhand meines Äußeren erahnen können, dass ich in meiner Freizeit hin und wieder eine Frau war. Für die Außenwelt war ich Dominik Sträter, der stets schlichte Hemden und Jeanshosen trug, dessen Statur kräftig und eher muskulös war. In meinen vier Wänden und auf der Bühne wurde ich allerdings zu Dominique, der hingebungsvollen Diva, der glamourösen Dragqueen. Jedes Mal war es ein Hochgenuss, ein Rausch für mich, sie zu sein. Ich liebte es, den weichen Stoff auf meiner Haut zu spüren, ein Dekolleté mit einem üppigen Busen zu füllen, selbst wenn dieser nicht echt war. In diesem Moment fühlte es sich jedoch immer echt an. Ich liebte es, weich und zart zu sprechen, mich anmutig zu bewegen, mich einfach als Frau zu fühlen. Zwei Leben führte ich: das eine als Mann, der einem verantwortungsvollen Beruf nachging, immer höflich und leise war, und das andere als sexy Frau, die auch einmal frivol und frech sein konnte.
Von weitem erkannte ich die großen, in pinker Farbe leuchtenden Lettern “Kiss“. Das war ein angesagter Drag-Club mitten im Herzen Kölns, direkt neben einem Friseursalon und einer Boutique. Wie praktisch! Mein Herz machte einen freudigen Satz, als ich den bereits gut gefüllten Club betrat. Dragqueens mit schrillen Perücken in grün, blau oder rosa sprangen mir ins Auge. Das waren die Luder, die ganz besonders auffallen wollten. Ihre Kleider und Schuhe waren quietschgelb, giftgrün, türkis oder violett. Jede von uns hatte zweifelsohne ihren eigenen Stil. Das war ja auch das Aufregende und Spannende an uns, wie ich fand. Auch die Ladys in Pelz- und Glitzerfummel tummelten sich auf der Tanzfläche, bewegten sich ausgelassen zu “Slave to the Rhythm“ von Grace Jones. Dieser Club war sehr vielseitig. Man konnte die Shows genießen, an der Bar sitzen oder auch zu bestimmten Uhrzeiten auf einer Tanzfläche abtanzen. Vor fünf Jahren hatte ich mich dank meines großen Talents für glamouröse Auftritte in diesem Club qualifiziert. In langsamerem Tempo lief ich auf den Backstagebereich zu, vorbei an der tanzenden Menge. Einige Gesichter erkannte ich, nickte ihnen zu und verschwand schließlich hinter der Bühne, betrat die Garderobe.
„Hi, Mädels!“, flötete ich ausgelassen, als ich Vivianne und Aisha sah, die sich in der Maske befanden.
„Hi“, erwiderten sie und standen auf, um sich mir präsentieren zu können.
Viviannes Style konnte ich wirklich nur bewundern. Sie trug eine platinblonde lange Perücke und ein hautenges schwarzes Kleid, das ihrer Taille schmeichelte. Das Rouge betonte ihre hohen Wangenknochen ausgezeichnet. Ihre dunkelroten Lippen waren groß und voluminös. Gott, diese Schuhe! Es waren Riemchenpumps mit funkelnden Nieten, die sie an den Füßen trug. Die hatte vielleicht Beine! So lang und wohlgeformt, ein wahrer Augenschmaus.
Aisha bestach mit feuerrotem Haar. Ihre weiße Seidenrobe bildete einen deutlichen Kontrast zu ihrer dunklen Haut. Grün glitzernde Schmetterlingsflügel hatte sie sich über die Augen gemalt.
Schließlich widmeten sich beide wieder ihren Gesichtern. Vivi puderte sich, Aisha zog ihre Augenbrauen nach. Ich nahm in einer Reihe von Drehstühlen mit Tisch und Spiegel meinen Stammplatz ein, schlüpfte rasch aus meinen Klamotten, zog mir meine Silikonbrüste über, die wie eine zweite Haut an mir saßen. Das Vakuum in ihnen sorgte dafür, dass sie sich an meiner Brust festsaugten und alles sehr gefühlsecht für mich machten. Ich stieg in das weinrote Abendkleid, zog die hohen Pumps an, nachdem ich in die Strumpfhose geschlüpft war. Dann setzte ich mich wieder hin und begann, Make-up, Puder, Rouge, diverse Pinsel, Eyeliner und Augenbrauenstift feinsäuberlich auf dem Tisch vor mir auszubreiten. Ich versteckte mein Haar unter einem Haarnetz, trug Make-up und Puder auf und klebte mir Eyelashes auf die Augenlider.
„Welchen Song wirst du gleich darbieten?“, fragte mich Vivi, die mittlerweile hinter mir stand und mich durch den Spiegel anlächelte. Ihre Zähne traten weiß hervor.
Aisha war schon gegangen.
„Lass dich überraschen“, flötete ich mit heiterer, hoher Stimme.
„Menno, Dominique! Du bist gemein!“, erwiderte sie in gespielt enttäuschtem Tonfall.
Ich hoffte, dass sie wieder einen ihrer Shakira-Songs zum Besten geben würde. Vivianne sah mir noch ein paar Minuten interessiert beim Schminken zu, dann verließ auch sie den Raum. Ich war für mich allein. Vorsichtig setzte ich die Perücke auf, schaute zufrieden in den Spiegel. Ich hatte bordeauxrote, schulterlange Haare. Glücklich lächelte ich meinem Spiegelbild zu, trug dunkelroten Lippenstift auf, und schon war es vollbracht. Ich war Dominique, die Diva, die Göttliche.
Vor der Bühne saß ich und genoss die Show. Eine Darbietung von “If I could turn back time“ von Cher war zu hören und vor allem zu sehen, dann kamen Barbra Streisand und Britney Spears dran.
Danach war es endlich soweit. Higgi, die Moderatorin, die durch den Abend führte, wedelte mit ihrem Finger. „Meine sehr verehrten Damen! Nun habe ich einen weiteren Leckerbissen für euch.“ Sie hob mit einem breiten Grinsen ihre Augenbrauen nach oben. Ihr buntes Paillettenkleid funkelte mit dem silbrig glitzernden Collier, das sie am Hals trug, märchenhaft im Scheinwerferlicht um die Wette. „Hier und jetzt für euch, Dominique mit “Conga“ von Gloria Estefan!“
Mein Herzschlag beschleunigte sich. Das Adrenalin, das durch meine Venen pumpte, brachte meine Knie leicht zum Zittern. Doch als das Playback einsetzte, war ich vom Rhythmus des Songs gefangen, ließ meine Hüften kreisen und tanzte aus vollem Herzen. Ich war ganz in meinem Element.
***
Es war 22:00 Uhr, als ich meine Wohnung bereits abgeschminkt und in Männersachen betrat. Ich entdeckte Phillip, der breitbeinig und lässig auf meiner Couch saß. Ein Lächeln konnte ich nicht mehr unterdrücken, warf meine Tasche in die Ecke und kam auf ihn zu geeilt. „Hey, Schatz“, hauchte ich und setzte mich auf seinen Schoß. Vor sechs Monaten hatte ich Phillip in einem Gay-Club kennengelernt. Seitdem waren wir ein Paar. Er war zwölf Jahre älter als ich, besaß einen kleinen Kugelbauch, einen Schnäuzer und eine Glatze. Seine leuchtend grünen Augen hatten mich von Anfang an verzaubert. Außerdem liebte ich seine markanten Gesichtszüge und seine dunkle Stimme. Wie so häufig trug er eine schwarze Lederhose, die seinen Hintern gut betonte, dazu ein weißes Hemd. Ich fasste mit einer Hand in seinen Nacken und küsste ihn hingebungsvoll. Gott, er roch so gut!
„Na, wie war deine Show?“, wollte er von mir wissen, nachdem sich seine Lippen wieder von meinen gelöst hatten. Er lächelte.
„Ausgezeichnet. Ich hab den Laden gerockt.“
Ich stand auf, lief hinüber in den Flur, um mir Zigaretten und Feuerzeug aus meiner Jackentasche zu holen, zündete mir eine an und nahm einen kräftigen Zug. „Komm, wir feiern ein bisschen. Ich hab noch Rotwein im Schrank“, schlug ich vor und sah Phillip intensiv an.
„Aber bloß ein Glas, Dominik. Ich muss morgen wieder früh raus“, gab er zur Antwort und rutschte tiefer in die Sitzpolsterung.
Ich legte eine Platte von Gladys Knight & the Pips auf, stellte den guten Tropfen samt Weingläser auf den Tisch und schenkte ein.
Anschließend stieß ich mit den Worten „Auf uns“ mit ihm an.
„Wie war dein Tag?“, wollte ich wissen und lehnte mich ein Stück zurück, um ihn besser betrachten zu können.
Phillip hob für etwa eine Sekunde die Mundwinkel an, die dann wieder erschlafften. „Frag lieber nicht. Das ist momentan einfach zu viel Arbeit im Büro. Ich habe den Eindruck, mein Chef halst mir alles auf, während die anderen Kollegen sich an den Füßen pulen.“
„Du Armer! Bei so viel Stress kannst du sicherlich eine Rückenmassage vertragen. Komm, dreh dich einmal um“, forderte ich ihn auf, woraufhin Phillip sein Glas auf dem Tisch stellte und mir seinen Rücken entgegenstreckte. Ich stellte mein Glas ebenfalls ab und begann seine verspannten Schultern durchzukneten.
„Das tut gut“, brummte er vor sich hin.
„Ich habe gute Neuigkeiten.“ Inzwischen widmete ich mich seinen Schulterblättern.
„Was denn?“
„Ich habe den Job in der Psychiatrie bekommen.“
„Hm.“
„Was, hm?“ Ich machte eine Pause mit meiner Massage, wartete seine Antwort ab.
„Nun, du bist so zart besaitet. Die Arbeit dort ist alles andere als ein Zuckerschlecken. Das liegt ja wohl auf der Hand. Da bist du umgeben von Geisteskranken. Die Geschlossene ist voll von Gemeingefährlichen. Da wird dir alles abverlangt werden.“
Ich hörte deutliche Sorge in Phillips Stimme mitschwingen.
Ich setzte meine Massage fort. „Natürlich ist mir das alles klar. Ich habe einmal ein Praktikum dort gemacht. Weißt du, es ist eine wichtige Aufgabe. Ich möchte den Menschen dort wirklich helfen. Da laufen ja nicht lauter Axtmörder rum oder sowas. Diese sind in einer forensischen Psychiatrie untergebracht. Damit habe ich nichts zu tun. Die ganze Realität wird in Filmen gern mal verzerrt“, beendete ich meine Aussage und hörte, wie Phillip abermals brummte. Diesmal nicht wegen der Massage.
„Du hättest in der Altenpflege den älteren Menschen genauso weiterhin helfen können.“
Mir war klar, dass Phillip es gut meinte, sich bloß Sorgen machte. Ich hatte meinen alten Beruf sehr geliebt, doch ich hatte immer gewusst, dass mein Weg anders verlaufen würde. Ich suchte die Herausforderung, wollte etwas bewirken. Ganz genau wusste ich, was seelische Qualen bedeuteten. Die jahrelange Gewalt meines Vaters hatte meine Seele gebrandmarkt. Nachdem ich von ihm weggezogen war, hatte ich mir Hilfe bei einer Selbsthilfegruppe gesucht, ging für ein Jahr sogar zu einer Therapie, hatte erkannt, dass ich beruflich genau das tun wollte: Menschen in schlimmen Ausnahmesituationen helfen und zur Seite stehen. Außerdem war ich alles andere als ein Schwächling. Früher hatte ich sogar eine Zeitlang als Türsteher gearbeitet, hatte fünf Jahre lang regelmäßig Krav Maga gemacht, ein modernes, eklektisches israelisches Selbstverteidigungssystem. Gerade als Transvestit konntest du schnell mal Zielscheibe von Gewalt werden, und ein Opfer wollte ich ganz bestimmt nicht sein!
„Schluss mit der Diskussion. Ich fange Montag an!“
Ehe mein Süßer noch etwas darauf erwidern konnte, drehte ich ihn zu mir herum, sah ihn sehnsüchtig an und knöpfte langsam sein Hemd auf. Phillips Atmung wurde schneller. Ich sah Verlangen in seinen Augen aufblitzen. Hastig zog er mir mein Shirt über den Kopf, presste seine Lippen auf meine. Unsere Zungen umkreisten sich immer schneller. Mein Herz pumpte wie verrückt, während ich ungeduldig seine Hose aufknöpfte …
Der erste Arbeitstag
Überpünktlich steuerte ich an diesem Montagmorgen auf das weiße imposante Klinikgebäude zu, das sich inmitten des Deutzer Büroparks von Gebäuden, Bäumen und mit Laternen gesäumten Gehwegen deutlich hervorhob. In dicken schwarzen Lettern war zu lesen: Klinik für Therapie und Psychotherapie.
In etwas kleinerer Schrift stand darunter: Eine geschützte Akut- und Diagnostikstation für Erwachsene ab achtzehn Jahren.
Es war schneidend kalt. Rau und ungestüm peitschte mir der Märzwind um die Nase. Der Himmel war wolkenverhangen, zog sich wie ein graues Zelt über die Stadt, hatte etwas Unheilvolles an sich. Vielleicht aber hatte mein unbehagliches Gefühl mit Phillips letzten Worten zu tun. Doch wusste ich, was ich wollte.
Tief atmete ich durch und näherte mich dem Eingangsbereich. Die gläsernen Flügel der Automatiktür öffneten sich und ließen mich eintreten. Rasch stellte ich mich bei der Aufnahme-Ärztin, die hinter einer dicken Glasscheibe saß, vor und erklärte ihr, dass ich der Neue im Pflegeteam der Station B sei, woraufhin sie den Pflegeleiter anrief, mir einen Spindschlüssel und Pflegekleidung in die Hand drückte und mich passieren ließ. Mit dem Fahrstuhl fuhr ich zuerst in die erste Etage zu den Personalräumen, öffnete den Spind mit der Nummer dreiunddreißig, verstaute meinen Rucksack und meine Jacke darin, zog mir das weiße Baumwoll-Shirt und die weiße Hose an, stopfte Hemd und Jeans ebenfalls in den Spind und schloss ab.
Anschließend erreichte ich mit dem Fahrstuhl die Pflegestation. Ein langer Gang erstreckte sich vor mir. Durch das körpergroße Fenster am Ende des Flures strömte ausreichend Tageslicht. Zusätzliches Licht fiel von den Deckenleuchten auf den gelben Vinylboden, der leicht schimmerte.
In der nächsten halben Stunde lernte ich mein Team kennen, das aus drei Pflegern und zwei Pflegerinnen bestand und besprach die Tagesplanung.
Nachdem ich meinen Kollegen bei der Medikamentenvergabe über die Schulter geguckt hatte, begleitete ich einen weiteren Kollegen bei Gesprächen einzelner Patienten.
Anschließend folgte zu meiner Überraschung mein erstes Gruppengespräch ... Die Pfleger hatten zusammen mit den Psychiatern ein besonderes Therapie-Konzept entwickelt. Eine Handvoll ausgewählter Patienten, die ihren Einschätzungen nach kein Risiko füreinander darstellten, sollten einmal in der Woche eine kleine Gruppensitzung haben. Für gewöhnlich war das hauptsächlich Patienten einer offenen Psychiatrie möglich. Doch man wollte für die Geschlossene neue Chancen ergreifen. Es funktionierte scheinbar gut, denn in den letzten drei Monaten hatte es überwiegend positive Wirkungen erzielt und gute Rückmeldungen gegeben. Mein Vorgesetzter hatte die Entscheidung getroffen, dass ich so ein Gruppengespräch schon heute leiten sollte. Wahrscheinlich war er so überzeugt von mir, weil ich während meines Vorstellungsgesprächs erzählt hatte, dass ich vor einigen Jahren eine Selbsthilfegruppe für Opfer von häuslicher Gewalt geleitet hatte. Tja, da hätte ich den Mund nicht so voll nehmen sollen! Aber ich hatte natürlich überzeugen wollen mit meinen Qualitäten, außerdem war es die Wahrheit gewesen. Ich hatte zwar diverse Fortbildungen bezüglich psychiatrischer Arbeit insbesondere den Umgang mit Patienten abgelegt und bestimmt dreimal den Leitfaden durchgelesen, dennoch war ich “Der Neue“.
Vielleicht wollten sie aber auch nur testen, was ich wirklich draufhatte … egal!
Theorie war nicht dasselbe wie Praxis. Dementsprechend nervös war ich auch. In einem Stuhlkreis saß mir meine zugeteilte Gruppe in einem der Besprechungszimmer gegenüber. Ich faltete meine Hände auf dem Schoß zusammen und warf einen Blick in die Runde, die aus Männern und Frauen unterschiedlichen Alters bestand.
„Hallo zusammen! Mein Name ist Dominik Sträter, ich bin der neue Pfleger. Es würde mich freuen, euch ein kleines bisschen besser kennenzulernen, den Grund zu erfahren, warum ihr hier seid“, beendete ich meine kleine Einleitung und machte eine kurze Pause.
Es war still im Raum wie in einer Kirche. Keiner machte den Anfang.
„Okay, dann gehen wir am besten reihum. Fangen wir mit dir an“, stammelte ich zu meinem Ärger unsicher vor mich hin und schaute den jungen, schlaksigen Mann direkt neben mir an, der meinen Augenkontakt nicht erwiderte, sondern teilnahmslos auf den Boden starrte.
Doch dann reagierte er endlich auf meine Worte und hob langsam den Kopf. „Ich bin Sebastian Ruprecht, bin achtzehn Jahre alt und schizophren. Seit drei Wochen bin ich hier. Also, ich höre sehr oft Stimmen, die mir zum Beispiel befehlen, dass ich mich verletzen soll oder jemand anderes. Doch durch die Medikamente ist das Gott sei Dank alles jetzt ruhig gestellt.“
Ich nickte schnell. „Danke, Sebastian! Wir werden später noch ausgiebig darüber reden. Nun zu dir.“ Ich lächelte der korpulenten Frau neben Sebastian zuversichtlich zu.
Die Dame räusperte sich, schlug ein Bein über das andere und antwortete: „Ich bin die Inge. Ich habe eine Essstörung, wie man wohl unschwer erkennen kann.“ Sie zeigte mit dem Zeigefinger auf ihren großen Bauch und fuhr fort: „Ich stopfe einfach alles in mich hinein, sogar Nägel.“ Inge lachte sarkastisch auf und sah an sich herab, dann schaute sie wieder mich an.
Sie war zwar sehr füllig, ihr Gesicht aber war wunderschön. Die junge Frau besaß einen kleinen Schmollmund, zarte Haut und schwarzes, schulterlanges Haar, das seidig glänzte.
„Vielen Dank, Inge.“
Als nächstes sprach Volker, ein Mann mittleren Alters, der sich als manisch-depressiv offenbarte. Jürgen war der Älteste in der Runde, wirkte mit seinem langen, weißen Bart wie ein Tattergreis. Er war Alkoholiker. Leider konnte er im Rausch äußerst aggressiv werden und schlug dann schon mal auf Autos oder Menschen ein, wie er erzählte. Die junge Frau, die Magdalena hieß, war bloß Haut und Knochen. Ihr Gesicht war blass und eingefallen, die Hände, die sie auf dem Schoß liegen hatte, waren knorrig und lang.
„Ich bin stark suizidgefährdet. Zwei meiner Versuche schlugen bereits fehl “, erklärte sie in monotonem Tonfall und kratzte sich den Nacken.
„Essen tust du übrigens auch kaum. Ich würde dir gern etwas von meinen Pfunden abgeben“, meldete sich Inge zu Wort und zwinkerte Magdalena zu.
„Danke, Magdalena“, sagte ich und schaute auf die letzte Person in unserer Runde. Die junge Frau, der ich ein Mut machendes Lächeln schenkte, starrte ins Leere.
„Ich hab das schon so oft gemacht“, murmelte sie und schnaubte. „Bitte, sei doch so gut und verrate mir oder uns, warum du hier bist“, erwiderte ich sanft und nickte ihr erwartungsvoll zu. Die Frau müsste um die zwanzig Jahre alt sein, schätzte ich. Ihr Teint war blass, ihre Lippen dünn. Hohe Wangenknochen verliehen ihrem Gesicht etwas Edles.
„Ich heiße Laura Koch.“ Sie machte eine Pause, warf sich eine ihrer langen blonden Haarsträhnen hinter die Schulter und fuhr fort. „Ich wurde als Mädchen entführt. Nach neun Jahren bin ich endlich freigekommen.“
Mir stockte der Atem. Das muss unvorstellbar grauenhaft gewesen sein! Ich bekam eine Gänsehaut und musste schlucken.
„Ich bin dann hier ge…“ Laura ließ ihren Satz abreißen. So als hätte sich bei ihr ein Schalter umgelegt, sackte sie in sich zusammen. Wahrscheinlich eine Reaktion auf die traumatischen Erinnerungen, rätselte ich.
„Nicht wundern. Sie schläft nur“, warf Inge ein.
Verdutzt schüttelte ich den Kopf. „Keine Sorge, das liegt nicht daran, dass dein Gespräch so langweilig ist. Es ist eben ihre Krankheit. Narko… Narko…“
„Narkolepsie“, vervollständigte Volker das Wort.
„Ja, genau. So heißt dieses Leiden, wenn man plötzlich mitten am Tag und sogar plötzlich im Stehen einschläft“, fügte Inge hinzu.
„Oder eben jetzt mitten in der Besprechung“, meinte Volker kopfschüttelnd.
„Nun, dann lassen wir sie eben ein bisschen schlafen und fangen schon mal ohne sie an“, empfahl ich.
Tiefes Mitleid empfand ich für jeden einzelnen aus der Runde. Sie alle hatten mit schlimmen Dingen zu kämpfen. Ganz besonders aber erschütterte mich Lauras Schicksal. Als ob sie mit einer jahrelangen Entführung nicht schon genug gebeutelt gewesen wäre, hatte sie auch noch Narkolepsie. Natürlich war mir das Krankheitsbild bekannt. Andauernd oder oft müde zu sein und mitten in seinem Tun plötzlich wegzudämmern, stellte ich mir mehr als bloß problematisch vor.
Ich warf einen Blick auf Laura, die nach wie vor fest schlummerte. Der Kopf baumelte vor ihrem Brustkorb. Vielleicht würde sie ja gleich aufwachen, hoffte ich. Ich fragte Sebastian, wie sein bisheriges Leben vor dem Klinikaufenthalt verlaufen war, und stellte diese Frage wieder im Uhrzeigesinn. Jedes einzelne Schicksal bewegte mich. Sebastian war der jüngste und würde wohl für den Rest seines Lebens auf eine immer wiederkehrende ärztliche Behandlung angewiesen sein. Volker hatte keinerlei Angehörige, die ihm nach seinem Klinikaufenthalt zur Seite stehen könnten, was ich äußerst bedenklich im Hinblick auf seine schweren Depressionen fand. Jürgen hatte schon fünf Entzüge gemacht und war immer wieder rückfällig geworden.
Meine Kehle war wie zugeschnürt. Was hattest du erwartet, Dominik? Das Leben kann grauenvoll sein, verhöhnte mich meine innere Stimme. Alle hatte ich inzwischen interviewt. Alle bis auf Laura, die immer noch tief und fest schlief.
„Ich kann etwas zu Laura sagen“, meldete sich Inge wie eine eifrige Schülerin, die Pluspunkte sammeln wollte, zu Wort.
„Ähm, ich denke, es wäre besser, wenn Laura das selbst tut“, erklärte ich und nickte langsam.
„Ich glaub nicht, dass die reden wird“, meinte Sebastian und räusperte sich.
„Sie redet sehr wenig“, warf Jürgen ein und schnaubte.
„Sie ist schon länger als wir alle hier drin. Hätte sie nicht kurz vor ihrer Entlassung versucht sich umzubringen, wäre sie längst draußen“, plapperte Inge ungeniert aus und erntete daraufhin einen strengen Blick von Magdalena, die aus ihrer Deckung trat.
„Halt einfach den Mund, Inge! Das hier ist ein Gruppengespräch und keine Tratsch-Runde.“
„Ich hab kein Bock auf den Scheiß hier!“, sagte Laura plötzlich, stand auf und verließ den Raum.
Laura
Mein Herz krampfte sich eigenartig zusammen. Wie viele dieser Gespräche sollte ich noch führen? Wem alles sollte ich noch von meiner Vergangenheit erzählen? Dieser übereifrige Pfleger war neu und wollte all das wissen, was ich bestimmt schon zehn anderen Leuten, die hier arbeiteten, erzählt hatte …
Ich hatte mitbekommen, dass Inge, Jürgen und Sebastian über mich gesprochen hatten, war längst wieder wach gewesen.
Ich zupfte am Ärmel meines Sweatshirts herum und wanderte den düsteren Flur entlang. Schon immer fühlte ich mich hier drin wie ein eingesperrtes Tier. Na ja, wer tat das nicht? Bis auf ein paar Ausnahmen empfanden wohl fast alle Patienten hier drin so. Würde ich jemals hier rauskommen? Oder war es mein Schicksal, auf ewig eingesperrt zu bleiben? Mittlerweile war ich mir nicht mehr so sicher.
Am Ende des Ganges erreichte ich eine Sitzecke und ließ mich auf einen Korbsessel plumpsen. Die kalkweißen Wände um mich herum wirkten trostlos. Daran änderten auch die Aquarell-Bilder mit den Wiesen und Blumen nichts. Das Geschrei des Typen, der ständig nach seiner Mutter rief, nahm ich kaum noch wahr. Auch weitere Wortfetzen anderer Patienten, die sich im Aufenthaltsraum nebenan aufhielten, erreichten nicht wirklich meine Ohren.
Doch die Schritte, die immer näherkamen, konnte ich plötzlich nicht ignorieren.
Der neue Pfleger setzte sich mir gegenüber, seufzte einmal tief und sagte: „Wenn du willst, machen wir jetzt ein Einzelgespräch. Es ist wichtig, dass du dich nicht verschließt, verstehst du?“
„Tzz. Was wissen Sie schon ...“
„Du. Wir bleiben hier beim Du. Ich bin Dominik.“
„Ich weiß, wie du heißt.“ Ich stieß die Luft aus, drehte mich zur Wand.
Warum kann mich hier eigentlich keiner in Ruhe lassen? Blöde Klapse!
„Laura, möchtest du über irgendetwas sprechen?“
„Nein. Wozu soll das gut sein?“
„Es kann dich erleichtern. Für deine Therapie ist es wichtig …“
„Blablabla … Meine Therapiestunden mit Doktor Marens und Doktor Rudolph nehme ich regelmäßig wahr, das muss reichen.





























