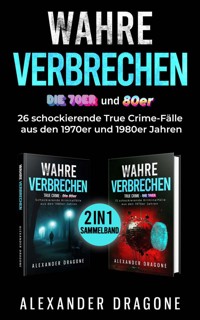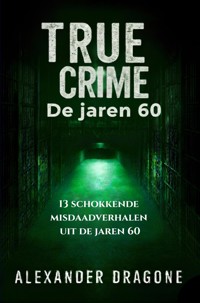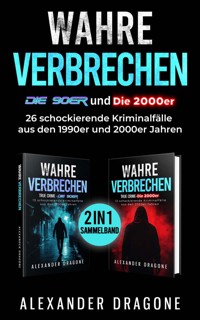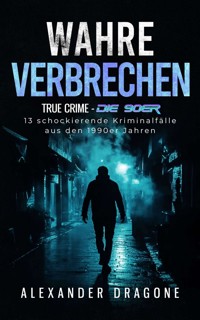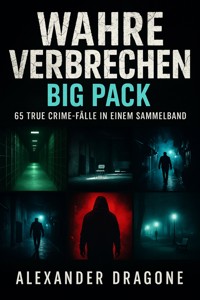
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
True Crime Fälle aus 5 Jahrzehnten. Tauchen Sie ein in die dunkelsten Kapitel der Kriminalgeschichte mit dieser Sammlung von 65 authentischen True Crime Fällen aus den 1960er bis 2000er Jahren. Fünf Jahrzehnte voller Verbrechen, die ganze Nationen erschütterten und bis heute nachhallen. Was Sie in diesem umfassenden True Crime Sammelband erwartet: 5 komplette True Crime-Bücher in einem Band - von den 60ern bis zu den 2000ern ⚖️Basierend auf Gerichtsakten, Polizeiprotokollen und authentischen Ermittlungsakten Internationale Fälle aus Europa und Nordamerika Tiefgehende Täterprofile und psychologische Einblicke Perfekt für: •Fans von True Crime Büchern und echten Kriminalfällen •Leser, die sich für Kriminalpsychologie und Ermittlungsarbeit interessieren •Sammler von True Crime Literatur •Alle, die die dunklen Abgründe der menschlichen Natur verstehen möchten Dieses Buch zeigt, dass die Realität oft grausamer ist als jede Fiktion. ⚠️ WICHTIGER HINWEIS: Dieses Buch enthält explizite Gewaltdarstellungen und ist nur für erwachsene Leser geeignet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 539
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wahre Verbrechen - Big Pack
65 True Crime-Fälle in einem Sammelband
Wahre Verbrechen - Die 60er
Wahre Verbrechen - Die 70er
Wahre Verbrechen - Die 80er
Wahre Verbrechen - Die 90er
Wahre Verbrechen - Die 2000er
Alexander Dragone
Copyright©2025Ganesh Media LLC
Alexander Dragone
Ganesh Media, New York
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über dnb.dnb.de abrufbar.
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß §44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.
AlleRechtevorbehalten.
Kein Teil dieses Buches darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung des Autors oder des Verlages kopiert, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Die in diesem Werk geschilderten Fälle sind wahre Kriminalfälle, die sich tatsächlich so zugetragen haben. Sie basieren auf Informationen, die im Rahmen von Gerichtsverfahren und polizeilichen Ermittlungen öffentlich gemacht wurden, sowie auf Berichten verschiedener Medien.
Bei der Recherche und Aufbereitung der Fälle wurde größte Sorgfalt angewandt, um die Richtigkeit der dargestellten Fakten zu gewährleisten. Trotz aller Bemühungen lassen sich vereinzelte Ungenauigkeiten jedoch nicht gänzlich ausschließen. Autor und Verlag übernehmen für etwaige Fehler keine Verantwortung.
Zudem sei darauf hingewiesen, dass zum Zwecke der Veröffentlichung in Buchform stellenweise erzählerische und dramaturgische Anpassungen vorgenommen wurden. Diese dienen allein dem Ziel, die Geschehnisse packend und nachvollziehbar darzustellen, ohne dabei den Wahrheitsgehalt zu verfälschen.
Inhalt
Wahre Verbrechen - Die 60er
13 schockierende Kriminalfälle aus den 1960er Jahren
Alexander Dragone
Inhalt
Der Herr der Fliegen
DieDąbrowski-Straße14in Katowice wirkte wie jede andere Straße in dem schlesischen Industrieviertel. Rauchende Schornsteine der nahegelegenen Zinkhütte färbten den Himmel grau, während Arbeiter in schmutzigen Overalls ihre Schichten begannen. In dem mehrstöckigen Mietshaus lebten einfache Leute – Arbeiter, Rentner, alleinstehende Frauen. Niemand von ihnen ahnte, dass sich direkt über ihren Köpfen, im kleinen Dachgeschoss, ein Albtraum abspielte, der die polnische Kriminalgeschichte für immer prägen würde.
Bogdan Eugeniusz Arnold schien der perfekte Nachbar zu sein. Ruhig, zurückhaltend, hilfsbereit. Die 34-jährige Frau aus dem zweiten Stock erzählte später der Polizei: „Er war so bescheiden. Wenn ich schwere Einkaufstüten hatte, half er mir beim Tragen. Er sprach nie laut, machte keinen Lärm. Ein echter Gentleman."
Doch hinter dieser Maske der Bescheidenheit lauerte ein Monster. In der winzigen Dachgeschosswohnung, bestehend aus nur einem Zimmer und einer Abstellkammer, spielten sich zwischen Oktober 1966 und Mai 1967 unfassbare Szenen ab. Bogdan Arnold hatte einen Ort geschaffen, an dem vier Frauen ihr Leben lassen mussten – und wo ihre verstümmelten Überreste monatelang verwesten, während er seinen Alltag als unauffälliger Arbeiter einfach so fortsetzte.
Arnold wurde am 17. Februar 1933 in Kalisz geboren. Seine Kindheit in einer wohlhabenden, intellektuellen Familie ließ nichts von dem späteren Horror erahnen. Der blonde, schmächtige Junge absolvierte brav seine Berufsschule als Elektriker und schien auf einem normalen Lebensweg zu wandeln. Doch bereits in jungen Jahren zeigten sich die ersten Risse in der Fassade.
Mit nur 18 Jahren heiratete Arnold zum ersten Mal. Die Ehe scheiterte innerhalb weniger Monate – aufgrund seiner Gewaltausbrüche und seines schon damals exzessiven Alkoholkonsums. Seine erste Frau berichtete später von nächtlichen Szenen, in denen Arnold sie schlug und beschimpfte, nur um am nächsten Morgen weinend um Verzeihung zu bitten. Ein Muster, das sich durch alle seine Beziehungen ziehen sollte.
Die zweite Ehe folgte wenige Jahre später – mit demselben Ausgang. Auch die dritte Frau verließ ihn aus denselben Gründen. Aus diesen gescheiterten Ehen stammten drei Kinder, für die Arnold Unterhalt zahlen sollte. Doch er entzog sich dieser Pflicht, genau wie er sich allem entzog, was Verantwortung bedeutete.
1960 zog Arnold nach Katowice und bezog die verhängnisvolle Wohnung in der Dąbrowski-Straße 14. Er fand Arbeit in einem Zinkverarbeitungswerk, wechselte jedoch ständig den Arbeitsplatz. Alkoholprobleme und Pflichtverletzungen machten ihn zu einem unzuverlässigen Angestellten. Die Kollegen beschrieben ihn als verschlossen, aber nicht unfreundlich.
Niemand ahnte von seinen perversen Neigungen. Eine seiner Partnerinnen berichtete den Ermittlern später von Szenen, die bereits die Brutalität der späteren Morde erahnen ließen: „Er beschimpfte mich. Er fesselte meine Arme und Beine mit Draht und steckte Wodkaflaschen in meine Vagina. Nur wenn er mich erniedrigte, erreichte er sexuelle Befriedigung. Er schlug mich, folterte mich und umarmte mich dann und entschuldigte sich. Er fesselte mich und schlug mich, er sagte mir, ich solle in seinen Körper beißen, nur dann erreichte er einen Orgasmus."
Der 12. Oktober 1966 war ein kühler Herbstabend in Katowice. In der Bar „Kujawiak" herrschte die übliche Atmosphäre – Zigarettenrauch, billiges Bier und die Gespräche müder Arbeiter nach einem langen Tag. Bogdan Arnold saß an der Theke und beobachtete die Anwesenden. Sein Blick fiel auf eine Frau Ende 30 mit blondierten Haaren und abgewetzter Kleidung. Maria B. war eine Prostituierte und suchte an diesem Abend nach Kunden.
Arnold sprach sie an. Mehrere Biere später hatte er sie davon überzeugt, mit ihm zu kommen, und sie gingen durch die dunklen Straßen zu dem Mietshaus in der Dąbrowski-Straße.
Die enge Treppe zum Dachgeschoss knarrte unter ihren Schritten. Arnold schloss die Tür seiner kleinen Wohnung auf – ein Raum, der bald zum Tatort werden sollte. Was als harmloser Abend begonnen hatte, eskalierte schnell zu einem Albtraum.
„Ich dachte, sie ging mit mir aus Liebe, nicht für Geld", gestand Arnold später bei seiner Vernehmung. Als Maria ihm Sex für 500 Zloty anbot, explodierte seine seit Jahren aufgestaute Wut. Arnold, der sich selbst für attraktiv genug hielt, um kostenlosen Sex zu bekommen, fühlte sich zutiefst gedemütigt. In seiner perversen Logik war dies ein Angriff auf seine Männlichkeit, der nur mit Gewalt beantwortet werden konnte.
Der Hammer lag griffbereit auf dem Tisch – ein Werkzeug, das Arnold für kleine Reparaturen in der Wohnung verwendete. In einem Wutanfall griff er danach und schlug zu. Der erste Schlag traf Maria an der Schläfe, der zweite Schlag war tödlich. Arnold stand über der Leiche und starrte auf das, was er getan hatte. Doch anstatt Reue zu empfinden, spürte er etwas anderes: Befriedigung. Die Gewalt hatte ihm ein Gefühl der Macht gegeben, das er nie zuvor erlebt hatte.
Was als spontaner Gewaltausbruch begonnen hatte, entwickelte sich zu einem durchdachten und perversen Ritual. Arnold wusste, dass er die Leiche nicht einfach entsorgen konnte, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Also begann er mit einem Prozess, der ihn zum gefürchtetsten Serienmörder Polens machen sollte.
Zunächst schleppte er Marias Körper ins winzige Badezimmer. Mit einem Küchenmesser öffnete er den Bauchraum und entfernte systematisch alle Eingeweide. Arnold arbeitete methodisch, fast chirurgisch. Die Eingeweide zerschnitt er in kleine Stücke und spülte sie durch die Toilette.
Den Körper transportierte er dann in die Badewanne und bedeckte ihn mit Chlor – zehn Tüten hatte er in der nahegelegenen Drogerie gekauft. Das ätzende Pulver sollte die Verwesung verlangsamen und den Gestank reduzieren. Einige Körperteile verbrannte er im kleinen Ofen seiner Wohnung, wodurch ein süßlicher, widerlicher Geruch entstand, den er seinen Nachbarn gegenüber als „Verbrennung von alten Lumpen" erklärte.
Monate vergingen. Arnold lebte weiter in der Wohnung, aß, schlief und arbeitete, während nur wenige Meter entfernt die Überreste von Maria B. langsam verwesten. Die Nachbarn bemerkten gelegentlich einen seltsamen Geruch, dachten aber an verstopfte Abflüsse oder tote Ratten in den Wänden.
Der Mord an Maria B. war für Arnold kein einmaliger Ausrutscher – er war der Beginn einer Sucht. Die Gewalt, die Kontrolle über Leben und Tod, die perverse Befriedigung des Tötens: All das wurde zu seinem neuen Lebensinhalt.
Am 12. März 1967, fünf Monate nach dem ersten Mord, wiederholte sich das grausame Spiel. Eine etwa 40-jährige Prostituierte, deren Identität nie festgestellt werden konnte, folgte Arnold in seine Wohnung. Doch diesmal war die Motivation eine andere. Arnold behauptete später, sie habe die Überreste von Maria B. entdeckt und gedroht, zur Polizei zu gehen.
„Sie sah das Zeug in der Badewanne und wurde hysterisch", erzählte Arnold den Ermittlern. „Sie schrie, sie würde mich anzeigen. Ich konnte das nicht zulassen." Der zweite Mord war daher kein spontaner Gewaltausbruch, sondern kaltblütige Berechnung. Arnold erwürgte die Frau mit einer Drahtschlinge. Wieder folgte das makabre Ritual: Zerstückelung, Entsorgung der Eingeweide, Behandlung mit Chlor. Die Überreste versteckte er neben denen von Maria B. Die kleine Wohnung wurde immer mehr zu einem Leichenschauhaus, während Arnold sein Doppelleben als unauffälliger Arbeiter fortsetzte.
Der dritte Mord geschah am 21. April 1967. Das Opfer war die 35-jährige Stefania M., die Arnold in einer Bar kennengelernt hatte. Auch sie wurde in seiner Wohnung erwürgt und nach demselben perversen Schema behandelt. Die Routine war bereits so eingespielt, dass Arnold die Tat wie eine alltägliche Arbeit verrichtete.
Der 22. Mai 1967 markierte den Höhepunkt von Arnolds Blutrausch. An diesem Tag lockte er die 30-jährige Prostituierte Helga G. in seine Wohnung. Doch diesmal wählte er eine andere Methode: Er erstach sie mit einem Küchenmesser. Die Klinge durchbohrte ihr Herz und sorgte für einen schnellen Tod, doch die Brutalität des Aktes übertraf alles Bisherige.
Arnold versteckte Helgas Überreste unter seinem Bett. Die kleine Wohnung war nun mit vier Leichen gefüllt – ein Museum des Todes, in dem er weiterhin lebte. Der Gestank war mittlerweile so penetrant geworden, dass selbst die großzügige Verwendung von Chlor und anderer Chemikalien ihn nicht mehr überdecken konnte.
In seinen späteren Geständnissen beschrieb Arnold detailliert, wie er mit den Leichen umgegangen war: „Zuerst wollte ich Teile der Leichen verbrennen, aber ich hatte keine Kohle, und es war schwer, es mit Holz zu tun. Also öffnete ich die Bauchhöhlen mit einem Küchenmesser, aus denen ich alle Eingeweide herausnahm, die ich in Stücke schnitt und durch ein Abflussloch in meiner Wohnung ablaufen ließ, während ich die Leichen in eine Holzkiste legte, die innen mit Metallblechen bedeckt war."
„Ich wollte Ätznatron kaufen, um die Zersetzung der Leichen zu beschleunigen, aber ich konnte es nirgendwo bekommen, also kaufte ich etwa zehn Tüten Chlor. Ich löste es auf und goss heißes Wasser darüber. Ich legte den abgetrennten Kopf in einen Kessel mit heißem Wasser. Ich konnte den Anblick nicht ertragen, also ging ich in die Bar, um zu trinken. Als ich zurückkam, stellte ich den Kessel auf die elektrische Heizung. Ich schlief ein. Beim Aufwachen stellte ich fest, dass der Inhalt des Kessels gekocht hatte."
Ende Mai 1967 wurde das Haus in der Dąbrowski-Straße 14 von einem unerträglichen Gestank heimgesucht. Ein süßlicher, fauliger Geruch, der durch die Flure zog und stärker wurde, je höher man stieg. Dazu gesellten sich Schwärme von Fliegen – mehr Fliegen, als jemand je in einem Wohnhaus gesehen hatte.
Arnold selbst hatte die Wohnung zu diesem Zeitpunkt bereits verlassen. Das Leben mit vier verwesenden Leichen war selbst für ihn unerträglich geworden. Er versteckte sich eine Woche lang in einem verlassenen Lagerhaus in der Nähe seines Arbeitsplatzes und hoffte wohl, dass das Problem von selbst verschwinden würde.
Am 8. Juni 1967 konnte ein Bewohner des Hauses die Situation nicht mehr ertragen. Er rief die Polizei und berichtete von dem Schwarm Fliegen und dem penetranten Geruch aus der Dachgeschosswohnung. Die Polizeibeamten, die zum Tatort geschickt wurden, bestätigten sofort die Meldung. Der Gestank war so intensiv, dass er bis auf die Straße zu riechen war. Im Hof des Gebäudes entdeckten die Beamten seltsame Fleischstücke neben den Mülltonnen, die von Katzen angefressen wurden. Der Anblick ließ bereits das Schlimmste befürchten.
Da niemand auf das Klopfen an der Tür reagierte, wurde die Feuerwehr gerufen. Ein Feuerwehrmann stieg über eine Leiter zum Dachgeschoss hinauf und schlug ein Fenster ein. Doch selbst mit einer Gasmaske konnte er die Wohnung zunächst kaum betreten – der Verwesungsgeruch war so überwältigend, dass er beinahe das Bewusstsein verloren hätte.
Als die Tür schließlich aufgebrochen wurde, enthüllte sich der ganze bestialische Horror: Die kleine Wohnung glich einem Schlachthaus. Überall lagen Teile verwesender menschlicher Überreste: unter dem Fenster, in einer Holzkiste, in der Badewanne, in einem Waschkessel und verstreut auf dem Boden. Der Verwesungsprozess war so weit fortgeschritten, dass es zunächst unmöglich war festzustellen, wie viele Personen gestorben waren oder wer sie gewesen sein könnten. Auf dem Tisch tickte noch ein Wecker – ein surreales Detail, das die Normalität des Lebens inmitten dieses Horrors symbolisierte.
Die genaue Identifizierung der Opfer übernahm das Institut für Gerichtsmedizin: Neben den menschlichen Überresten fanden die Experten auch die Mordwaffen: einen Hammer, eine Drahtschlinge und Strumpfteile, die zum Erwürgen verwendet worden waren. Jedes Werkzeug erzählte seine eigene grausame Geschichte.
Während die Identifizierung der Opfer lief, begann die intensive Suche nach dem Bewohner der Wohnung. Bogdan Arnold war nach dem letzten Mord untergetaucht und versuchte, sich vor den Strafverfolgungsbehörden zu verstecken. Doch sein Versteck in dem verlassenen Lagerhaus bot nur temporären Schutz.
Am 8. Juni 1967, dem Tag der Entdeckung der Leichen, bemerkte ein Polizeibeamter in der Nähe der schlesischen Zinkhütte einen Mann mit ungepflegtem Aussehen und schmutziger Kleidung. Als der Beamte ihn ansprach und nach Dokumenten fragte, hatte Arnold keine bei sich. Zunächst wollte der Polizist ihn als gewöhnlichen Betrunkenen gehen lassen, entschied sich aber im letzten Moment doch, ihn zur Polizeistation zu bringen.
Dort enthüllten Fingerabdrücke die wahre Identität des Mannes: Bogdan Arnold, der Bewohner des Apartments des Grauens. Die Ermittler konnten ihr Glück kaum fassen – der meistgesuchte Mann Katowices war ihnen direkt in die Arme gelaufen.
Arnold brach sofort zusammen, als er konfrontiert wurde. Doch seine Reaktion war nicht die eines reuigen Sünders, sondern die eines Mannes, der erleichtert war, endlich über seine Taten sprechen zu können. Er gestand alle vier Morde und gab zusätzlich zu, versucht zu haben, seine dritte Ehefrau zu vergiften.
„Spielt es eine Rolle, wie viele? Acht oder sechzehn, ich werde sowieso hängen", antwortete er lakonisch auf die Frage des Richters nach der genauen Anzahl seiner Opfer.
Arnold bedauerte seine Taten kein bisschen, sondern nur, dass er seine Ex-Frau nicht hatte töten können. Er führte seine Frauenfeindlichkeit auf die Scheidung zurück und zeigte eine Verachtung für Frauen, die pathologische Züge trug.
Die psychiatrische Untersuchung, die sich über sechs Monate erstreckte, ergab weder intellektuelle Defizite noch psychische Störungen im klinischen Sinne. Arnold war voll zurechnungsfähig und verstand die Konsequenzen seiner Handlungen. Die Gutachter diagnostizierten deutliche Züge einer Psychopathie, verstärkt durch Alkoholismus, aber er galt als schuldfähig.
Am 9. März 1968 wurde Bogdan Arnold von einem polnischen Gericht zum Tode durch Erhängen verurteilt. Das Urteil wurde am 16. Dezember 1968 vollstreckt. Bis zum letzten Moment zeigte er die gleiche kalte Gleichgültigkeit, die seine Verbrechen geprägt hatte. Er wurde in einem unmarkierten Grab auf einem speziellen Friedhof für hingerichtete polnische Verbrecher beigesetzt.
Arnold erhielt den Spitznamen "Der Herr der Fliegen" – eine Anspielung auf den Roman von William Golding und die Schwärme von Fliegen, die letztendlich zur Entdeckung seiner Verbrechen führten.
Das Kind, das mordete
DiezehnjährigeMaryBell war in ihrer Gegend gefürchtet – nicht wegen ihrer Größe, sondern wegen ihrer Grausamkeit. Ihre Mutter, Betty Bell, war eine stadtbekannte Prostituierte, die sich auf sadomasochistische Praktiken wie Bondage spezialisierte und ihre Freier oft mit nach Hause brachte – und Mary musste zusehen. Bereits mit vier Jahren wurde das kleine Mädchen gezwungen, Sex mit den Kunden ihrer Mutter zu haben.
In den späten 1960er Jahren war das Viertel Scotswood im englischen Newcastle ein raues Pflaster. Verfallene Häuser, enge Gassen: eine vergessene Gegend, die viele nur „Rat Alley" nannten – Rattenstraße. Ganze Straßenzüge waren dem Abriss geweiht, Hochhausbauten ersetzten langsam die alten Slums. Armut war allgegenwärtig, doch die Kinder der Nachbarschaft schienen irgendwie damit umzugehen. Sie spielten unbeaufsichtigt in Ruinen und verfallenen Gebäuden: ein Alltag, der gleichzeitig gefährlich und vertraut war.
Mary Bell war eines dieser Kinder. Sie war strohblond und wirkte auf den ersten Blick wie jedes andere Mädchen. Doch hinter der unschuldigen Fassade war sie manipulativ und unberechenbar. Andere Kinder hatten große Angst vor ihr. Auch ihre Lehrer nahmen sie wahr – nicht wegen guter Leistungen, sondern wegen ihrer sadistischen Ausbrüche. Ein Lehrer erinnerte sich, wie Mary einer Mitschülerin eine brennende Zigarette auf der Wange ausdrückte – weil das Mädchen eine bessere Note bekommen hatte. Mary gab die Tat offen zu. Die Schule reagierte nicht.
Am Samstag, dem 11. Mai 1968, streiften Mary und ihre Freundin Norma Bell – mit ihr weder verwandt noch verschwägert – durch die Straßen. Gemeinsam trafen sie auf einen dreijährigen Jungen, den sie überredeten, mit ihnen mitzukommen. Sie versprachen ihm Süßigkeiten. Später wurde das Kind blutend auf der Straße aufgefunden. Die beiden Freundinnen hatten brutal auf den Jungen eingeschlagen. Die Polizei wurde gerufen, doch es passierte nichts.
Am folgenden Tag meldete eine Mutter einen weiteren Vorfall: Mary habe versucht, ihre Tochter auf einem Spielplatz zu erwürgen, während Norma das Mädchen festgehalten habe. Doch auch diese Anzeige gegen zwei zehnjährige Mädchen wurde nicht ernst genommen. Die Beamten schenkten dem Fall kaum Beachtung.
Zwei Wochen später, am 25. Mai – einen Tag vor Marys elftem Geburtstag – spielte der vierjährige Martin Brown draußen vor seinem Haus. Mary beobachtete ihn. Dann trat sie auf ihn zu. Sie sagte, sie wolle ein Spiel mit ihm spielen und nahm ihn mit zu einem der vielen leerstehenden Häuser in der Nachbarschaft. Oben, in den staubigen, verlassenen Räumen, sagte sie dem Jungen, er sehe krank aus – vielleicht habe er Halsschmerzen. Sie könne ihm helfen, ihn heilen. Mary legte ihre kleinen Hände um seinen Hals. Und drückte sie erbarmungslos zu.
Einige Stunden später entdeckte ein Bauarbeiter Martins Körper. Der Junge lag leblos in dem baufälligen Haus. Seine Haut war blass, aus seinem Mundwinkel trat ein wenig Blut. Doch Verletzungen waren keine erkennbar.
Neben ihm lagen einige Tabletten. Die Polizei wurde gerufen und schloss zunächst auf einen Unfall oder eine versehentliche Vergiftung. Später gingen die Ermittler davon aus, Martin könne „vor Schreck" gestorben sein – möglicherweise, weil er eine Treppe hinuntergestürzt sei. Eine ernsthafte Obduktion wurde nicht durchgeführt. Der Tod des kleinen Jungen wurde als tragisches, aber natürliches Ereignis eingestuft.
Die Lokalpresse griff die Geschichte auf. Martin Brown wurde zum „Rat Alley Boy".
Einige Tage nach dem Vorfall klopfte Mary bei Martins Mutter. „Ich bin gekommen, um Martin zu sehen", sagte sie. Die Mutter, die glaubte, Mary wisse nichts vom Tod ihres Sohnes, antwortete: „Martin ist tot."
Mary erwiderte: „Ich weiß. Ich will ihn in seinem Sarg sehen."
Martins Mutter schloss entsetzt die Tür.
Doch Mary hörte nicht auf. Stolz erzählte sie Schulfreunden und Familienmitgliedern, dass sie Martin getötet habe. Niemand glaubte ihr. Man hielt es für eine kindliche Fantasie. Doch dann zeichnete sie in ihr Schulheft eine Szene: Martins Körper lag – so wie er gefunden wurde – auf dem Boden. Daneben: ein Fläschchen mit Tabletten. Über dem Bild stand das Wort „Tablette". Und daneben war eine Figur gezeichnet, die dem Bauarbeiter ähnelte, der den Jungen entdeckt hatte.
In einem Notizbucheintrag schrieb Mary:„Neben einem alten Haus standen viele Menschen. Ich fragte, was los sei. Da sei ein Junge gewesen, der sich einfach hingelegt habe und gestorben sei."
Keiner dieser Hinweise wurde ernst genommen. Die Polizei sah keinen Zusammenhang.
Zwei Tage nach Martins Tod wurde in eine nahegelegene Gärtnerei eingebrochen. Die Beamten fanden vier beschriebene Zettel mit wirren Botschaften:„Ich morde, damit ich zurückkommen kann."„Wir morden, passt auf."„Wir haben Martin Brown ermordet."„Verpiss dich, du Schlampe."
Die Polizei wertete die Nachrichten als schlechten Scherz. Kein Hinweis führte weiter.
In der Nachbarschaft machte sich Unruhe breit. Bewohner machten die verfallenen Slums für den Tod des Jungen verantwortlich. Demonstrationen gegen die Stadtverwaltung wurden organisiert. Mary nahm an einem dieser Protestzüge teil – am 31. Juli 1968.
Betty Bell war keine Mutter im klassischen Sinn. Immer wieder versuchte sie, ihre Tochter umzubringen – mit Medikamenten, die sie als Bonbons tarnte. Mehrmals behauptete sie, das Kind habe versehentlich ihre Schlaftabletten genommen. Einmal sagte sie, Mary sei aus dem Fenster gefallen. Auch das Misstrauen von Familienangehörigen änderte nichts daran. Betty versuchte sogar, Mary an Verwandte „abzugeben", nahm sie dann aber wieder zurück.
Oft war sie tagelang verschwunden und ließ Mary allein zurück. Marys Vater Billy war selten da, und wenn doch, war er betrunken und brutal. Er schlug sowohl Betty als auch seine Tochter. Gewalt, Vernachlässigung, Missbrauch – das war Marys Alltag.
Zwei Monate nach Martins Tod beging Mary erneut einen Mord – diesmal mit Unterstützung ihrer Freundin Norma. Die Öffentlichkeit hatte keine Ahnung, dass ein Kind für den ersten Mord verantwortlich war. Die Kinder in der Nachbarschaft spielten weiterhin unbeaufsichtigt in den Gassen.
Am 31. Juli 1968 trafen Mary und Norma den vierjährigen Brian Howe, der allein spielte und die Abrissarbeiten in der Rat Alley beobachtete. Sie sprachen ihn an – und führten ihn in ein verlassenes Gelände, das die Kinder „Tin Lizzy" nannten.
Als Brian Stunden später als vermisst gemeldet wurde, begann die Polizei mit der Suche. Schließlich fanden die Beamten seinen Körper: halbnackt, mit gespreizten Armen – wie in Kreuzform. In der Nähe lagen eine Schere und eine Haarlocke. Die Ermittler stellten fest: Brian war erwürgt worden. Nach seinem Tod waren ihm die Waden durchbohrt, die Beine aufgeschnitten, der Penis verstümmelt worden. In seinen Bauch war der Buchstabe „M" geritzt.
Die Obduktion bestätigte: Die Verstümmelungen erfolgten post mortem. Trotz der Parallelen zog die Polizei keine Verbindung zu Martin Browns Tod.
Als Brians Sarg einige Tage später aus dem Haus der Familie getragen wurde, beobachtete Detective Chief Inspector James Dobson die Szene – und bemerkte etwas Ungeheuerliches: Während alle Anwesenden weinten, stand Mary Bell vor dem Haus – und lachte.
„Sie rieb sich die Hände, als hätte sie etwas erreicht", sagte Dobson später. „Ich wusste in dem Moment: Wir müssen sie holen. Sonst passiert es wieder."
Kurze Zeit später gab die Polizei öffentlich bekannt, dass ein Kind unter Verdacht stand. Mary stand in der ersten Reihe der Zuschauer. Sie hörte aufmerksam zu – als suche sie geradezu die Aufmerksamkeit. Schließlich sprachen Ermittler mit Mitschülern – und erfuhren, dass Mary wiederholt damit geprahlt hatte, Martin Brown getötet zu haben. Erst jetzt begannen die Beamten, ernsthaft zu ermitteln.
Zunächst verweigerte ihr Vater die Zusammenarbeit. Dann willigte er ein und Mary wurde befragt. Als man sie mit dem Verdacht konfrontierte, reagierte sie mit gespielter Empörung: „Holen Sie meinen Anwalt!"
Ein neunjähriger Junge hatte der Polizei berichtet, er habe beobachtet, wie Mary Brian erwürgte. Die Aussage reichte jedoch nicht für eine Festnahme. Doch die Hinweise mehrten sich. Norma wurde ebenfalls verhört – und schließlich gestand sie ihre Beteiligung. Sie schob die gesamte Verantwortung auf Mary.
Die Polizei überprüfte erneut die vier Zettel aus der Gärtnerei – und stellte eine Verbindung zu Mary her. Die Zeichnungen in Marys Schulheft, insbesondere die Tablettenflasche, waren ein entscheidender Beweis. Denn diese Information war niemals öffentlich gemacht worden.
Am 8. August 1968 wurde Mary Bell offiziell angeklagt.
Der Prozess gegen Mary und Norma dauerte neun Tage. Die beiden Mädchen durften bei ihren Anwälten sitzen – eine Ausnahme, bedingt durch ihr junges Alter.
Die Staatsanwaltschaft argumentierte, dass beide Morde zusammenhingen. Graue Wollfasern von Marys Kleid wurden an den Leichen beider Opfer gefunden. Kastanienbraune Fasern von Normas Rock fanden sich an Brians Kleidung. Schriftsachverständige analysierten die Gärtnerei-Notizen und die Zeichnungen in Marys Schulheft.
Psychiater bescheinigten Mary eine „psychopathische Persönlichkeitsstörung". Sie sei intelligent, manipulierend, emotionslos, handle impulsiv und ohne Reue. Norma dagegen erschien vielen als überforderte Mitläuferin.
Im Gerichtssaal zeigte Mary kaum Emotionen. Sie fragte nach Süßigkeiten, kicherte, drehte sich um, während über ihre Taten gesprochen wurde. Norma dagegen brach mehrmals in Tränen aus.
Nach fünfeinhalb Stunden Beratung fällte die Jury ihr Urteil: Norma wurde freigesprochen. Sie sei zu einfältig gewesen, um die Konsequenzen ihres Handelns zu begreifen.
Mary Bell hingegen wurde wegen Totschlags verurteilt – unter verminderter Schuldfähigkeit. Die Strafe: unbefristete Haft „zur Verfügung Ihrer Majestät". Über Marys Herkunft und ihre Kindheit erfuhr die Jury nichts.
Die Behörden entschieden sich dafür, Mary nicht wie eine Erwachsene zu bestrafen. Sie sollte resozialisiert werden – weil man davon ausging, dass sie die Tragweite ihrer Taten nicht verstand. Sie kam in eine Sicherheitseinrichtung – zu jung für eine psychiatrische Klinik. In der "Red Bank Erziehungsanstalt" war sie das einzige Mädchen unter 22 Jungen. Sie zeigte dort keinerlei Reue und schob ihre Schuld auf andere.
In einem Brief an ihre Mutter schrieb sie:„Bitte, Mum, beruhige mein kleines Gemüt, sag es dem Richter und den Geschworenen auf den Knien. Der Schuldige bist du, nicht ich. Es tut mir leid, dass es so sein muss. Wir werden beide weinen, und du wirst gehen. Sag ihnen, dass du schuldig bist, bitte. Dann, Mama, bin ich frei. Deine Tochter, Mary."
Jahre später trat Betty Bell im Fernsehen auf. Sie war gezeichnet vom Leben, abhängig von Alkohol und Tabletten.
Mary Bell wurde 1980 entlassen. Sie war 23 Jahre alt – und erhielt eine neue Identität. Während ihrer Haft hatte sie ein Kind bekommen. Ihre Tochter erfuhr erst durch die Medien von der Vergangenheit ihrer Mutter. 2003 garantierte das Gericht Mutter und Tochter lebenslange Anonymität.
Der Leichen-Schänder von Kuibyshev
ZagfarGayfullin,einfreiwilliger Milizhelfer, traute seinen Augen nicht. Es war kurz nach Mitternacht auf einer Nebenstraße nahe der Flughafen-Autobahn von Kuibyshev in Russland. Der Mann auf dem Fahrrad fuhr langsam, fast gemächlich, als hätte er alle Zeit der Welt. Doch unter seinem Mantel verbarg sich eine Axt, die er zuvor frisch geschärft hatte.
Gayfullin wusste sofort: Das war er. Der Killer, der die Stadt seit über einem Jahr in Angst und Schrecken versetzte. Der Mann, der ganze Familien auslöschte. Der Radfahrer bemerkte den starren Blick des Milizhelfers und trat härter in die Pedale. Die Verfolgungsjagd begann.
Boris Serebryakov sprang vom Fahrrad und rannte in den Hof eines Privathauses. Die Bewohner schliefen, ahnungslos, dass sich das Monster, vor dem sich die ganze Stadt fürchtete, in ihrer Außentoilette versteckte. Als ein weiterer Milizhelfer die Tür öffnete, traf ihn Serebryakovs Faust ins Gesicht. Ein Ziegelstein folgte, zielte auf den Kopf des Mannes. Blut spritzte.
Serebryakov flüchtete zum Bahnhof und kletterte auf den Heizöltank eines Güterzugs. Vielleicht könnte er mit dem Zug entkommen, dachte er. Doch ein Maschinengehilfe entdeckte die dunkle Gestalt auf dem Tank. Wieder musste Serebryakov fliehen.
In seiner Verzweiflung kletterte er auf einen Baum und sprang über den Zaun des Progress Rocket Space Center - eine streng bewachte Raketenproduktionsanlage. Die Alarmsirenen heulten auf. Sicherheitskräfte schwärmten aus. Nach drei Stunden Flucht war es vorbei. Das Monster war endlich gefasst.
Boris Efimovich Serebryakov kam am 18. August 1941 in Malgobek zur Welt, einer kleinen Stadt in der Tschetscheno-Inguschischen Autonomen Sowjetrepublik. Der Zeitpunkt hätte ungünstiger nicht sein können - zwei Monate zuvor hatte Nazi-Deutschland die Sowjetunion überfallen. Krieg, Hunger und Tod prägten seine ersten Lebensjahre.
Über seine Kindheit ist wenig dokumentiert. Die sowjetischen Behörden führten keine detaillierten psychologischen Profile, wie es im Westen üblich war. Was bekannt ist: Serebryakov zeigte früh Anzeichen von Gewaltbereitschaft. Als Kind quälte er Tiere, als Jugendlicher prügelte er sich ständig. Der Alkohol wurde sein ständiger Begleiter, verstärkte seine ohnehin aggressive Natur.
Die Nachbarn in Malgobek mieden den jungen Serebryakov. Er hatte etwas an sich, das Menschen instinktiv zurückschrecken ließ. Seine Augen, sagten sie später, waren wie die eines Raubtiers, das seine Beute fixiert.
Mit der Volljährigkeit kam die Einberufung zur Sowjetarmee. Drei Jahre Dienst, die ihn hätten disziplinieren sollen. Stattdessen lernte er dort, effizienter zu töten. Nahkampftechniken, Waffenkunde, das Überwinden von Sicherheitsvorkehrungen - alles Fähigkeiten, die er später nutzen würde.
Im Januar 1967 wurde Serebryakov aus der Armee entlassen. Statt in seine Heimat zurückzukehren, zog er zu seiner Schwester nach Kuybyshev, dem heutigen Samara. Die Stadt an der Wolga war ein industrielles Zentrum mit einer Million Einwohner und Dutzenden Fabriken. Perfekt, um unterzutauchen.
Seine Schwester verschaffte ihm Arbeit in einer Kabelfabrik. Monotone Arbeit am Fließband, acht Stunden täglich Kabel wickeln, sortieren, verpacken. Für einen Mann mit Serebryakovs Temperament eine Tortur. Die Kollegen merkten schnell, dass mit ihm etwas nicht stimmte. Er sprach kaum, starrte die weiblichen Arbeiterinnen an, verschwand in den Pausen; niemand wusste wohin.
Nach Feierabend durchstreifte er die Stadt auf seinem Fahrrad - einem schwarzen Modell aus der Charkov-Fahrradfabrik. Stundenlang fuhr er durch die Wohnviertel, prägte sich Straßen ein, beobachtete Häuser. Besonders interessierten ihn Erdgeschosswohnungen, Wohnheime und schlecht gesicherte Hinterhöfe.
Am 4. September 1967 eskalierte Serebryakovs Verhalten zum ersten dokumentierten Gewaltverbrechen. Yekaterina Kharitonova arbeitete als Disponentin im Straßenbahndepot. Ihre Nachtschicht endete um zwei Uhr morgens. Der Kontrollraum lag abgelegen, nur schwach beleuchtet.
Serebryakov hatte das Depot wochenlang beobachtet. Er wusste, wann Schichtwechsel war, welche Wege die Arbeiter nahmen, wo die Sicherheitslücken lagen. In dieser Nacht trug er nur eine Badehose unter einem langen Mantel. In der Hand: ein Küchenmesser mit 15 Zentimeter langer Klinge.
Er stürmte in den Kontrollraum. Kharitonova schrie auf und versuchte zum Telefon zu greifen. Doch der Angreifer war schneller: Das Messer traf sie am Hals, verfehlte die Halsschlagader nur knapp. Blut spritzte über die Dienstpläne an der Wand. Ein zweiter Stich traf ihren rechten Arm und durchtrennte eine Sehne.
Doch Kharitonova kämpfte und Serebryakov, völlig überrumpelt vom Widerstand seines Opfers, floh. Kharitonova überlebte, konnte ihren rechten Arm aber nie wieder vollständig nutzen. Bei der Polizei beschrieb sie den Angreifer so: mittelgroß, dunkle Haare, stechende Augen. Und dieser Geruch - eine Mischung aus Schweiß, Alkohol und etwas Animalischem.
Nach dem gescheiterten Angriff auf Kharitonova verschwand Serebryakov von der Bildfläche. Er ging weiter zur Arbeit und verhielt sich unauffällig. Doch in seinem Inneren brodelte es. Dieser Misserfolg nagte an ihm. Er hatte versagt und war geflohen wie ein erbärmlicher Feigling.
In den folgenden Monaten perfektionierte er seine Methoden. Er studierte die Schichtpläne der Miliz, kannte ihre Routen. Er übte das lautlose Eindringen in Wohnungen, testete verschiedene Werkzeuge. Ziegelsteine erwiesen sich als effektiv - sie waren überall verfügbar und hinterließen keine eindeutigen Spuren. Die forensische Psychiaterin, die ihn später untersuchte, stellte fest: In dieser Zeit realisierte Serebryakov, dass lebende Frauen ihn nicht erregten. Nur Leichen konnten seine perversen Fantasien befriedigen. Die Nekrophilie wurde zur treibenden Kraft seiner kommenden Verbrechen.
April 1969, kurz nach Mitternacht. Das Wohnheim lag in Dunkelheit. 24 Zimmer, meist von Fabrikarbeitern bewohnt. Dünne Wände, durch die man jedes Geräusch hörte. Serebryakov kannte das Gebäude wie seine Westentasche. Er hatte es wochenlang observiert.
Das Fenster zum Zimmer der Familie Zorkin stand einen Spalt offen - die Nacht war warm. Serebryakov schob es lautlos auf und kletterte hinein. Im Zimmer schliefen drei Menschen: Stepan Zorkin, 34, Arbeiter in der Traktorenfabrik. Seine Frau Maria, 28, Näherin. Ihr Sohn Lyonya, gerade fünf Jahre alt geworden.
Serebryakov griff nach einem Ziegelstein, den er vom Hof mitgenommen hatte. Der erste Schlag traf Stepan im Schlaf. Der Schädel brach mit einem dumpfen Knacken. Maria erwachte und der zweite Schlag traf sie an der Schläfe. Sie sackte zurück aufs Bett, Blut sickerte ins Kopfkissen.
Der kleine Lyonya wachte vom Lärm auf. Er sah die dunkle Gestalt über dem Bett seiner Eltern. Und Serebryakov zögerte keine Sekunde. Auch das Kind musste sterben. Es durfte keine Zeugen geben.
Nach den Morden zerrte Serebryakov Marias Leiche auf den Boden. Was dann genau passierte, darüber kann man nur spekulieren. Nekrophilie, stand als Stichwort im Gerichtsprotokoll. Die Leiche wies Spuren extremer sexueller Gewalt auf.
Bevor er ging, durchsuchte er die Wohnung. 135 Rubel fand er in einer Schublade - zwei Wochenlöhne eines Arbeiters. Dann übergoss er die Kleidung der Toten mit Petroleum aus einer Lampe und zündete sie an. Das Feuer sollte Spuren vernichten. Stattdessen alarmierte der Rauch die Nachbarn. Sie löschten den Brand und fanden die Leichen.
Der Verdacht fiel zunächst auf Marias Ex-Mann. Er hatte Maria mehrfach gedroht und war auch gewalttätig gewesen. Die Miliz verhörte ihn tagelang und sein Alibi war wackelig. Fast hätte ein Unschuldiger für Serebryakovs Verbrechen bezahlt.
Ein Jahr verging. Doch das Monster war nicht verschwunden, es ruhte nur und wartete auf die nächste Gelegenheit zuzuschlagen. Serebryakov hatte Blut geleckt. Die Erinnerung an die Macht, die er über Leben und Tod gehabt hatte, verzehrte ihn. Am 30. April 1970 schlug er wieder zu.
Ekaterina Kutsevalova vermietete Zimmer in ihrer Wohnung. Ihre Tochter Olga half ihr dabei. In dieser Nacht drang Serebryakov durch ein Kellerfenster ein. Er hatte eine Axt mitgebracht - ein neues Werkzeug, viel effizienter als Ziegelsteine.
Die stumpfe Seite der Axt traf Ekaterina am Hinterkopf. Sie brach zusammen. Olga, im Nebenzimmer, hörte den dumpfen Schlag. Als sie nach ihrer Mutter sehen wollte, traf auch sie die Axt. Beide Frauen lagen bewusstlos am Boden.
Serebryakov zerrte Ekaterinas Körper ins Schlafzimmer, begann mit seinem perversen Ritual. Doch Olga kam zu sich und schrie so laut, dass sie damit die Nachbarn alarmierte. Serebryakov floh durch das Fenster und beide Frauen überlebten schwer verletzt.
Nur neun Tage später, am 8. Mai, schlug er wieder zu: Praskovya Salova war 70 Jahre alt und lebte allein. Ihre Nichte Nina war zu Besuch. Serebryakov hackte beide Frauen mit der Axt nieder – und dieses Mal gab es keine Überlebenden.
Das Grauen erreichte seinen Höhepunkt in der Nacht vom 4. zum 5. Juni 1970. Familie Malomanov - Vater, Mutter, zwei Kinder im Alter von 8 und 11 Jahren - lebte in einem kleinen Haus nahe dem Stadtpark. Serebryakov drang durch die Hintertür ein.
Was in dieser Nacht geschah, überstieg alle bisherigen Grausamkeiten. Vier Menschen starben unter Axtschlägen. Die Wände waren rot von Blut. Nach der Schändung der toten Mutter übergoss Serebryakov das Haus mit Benzin. Nachbarn alarmierten sofort die Feuerwehr, doch für die Familie kam jede Hilfe zu spät.
Nach dem Massaker an der Familie Malomanov brach in Kuybyshev Panik aus. Vier Tote in einer Nacht, darunter zwei Kinder. Die Brutalität war beispiellos. Gerüchte machten die Runde: Ein Wahnsinniger sei unterwegs. Ein Monster, das nachts in Häuser eindringt und ganze Familien auslöscht.
Die Menschen verbarrikadierten ihre Fenster und Türen, Nachbarn organisierten Bürgerwehren, patrouillierten mit Knüppeln durch die Straßen. Frauen weigerten sich, nachts zur Arbeit zu gehen. Kinder durften nicht mehr allein zur Schule.
Das Ausmaß der Angst zeigte sich bei einem ungewöhnlichen Ereignis: 1970 standen Wahlen zum Obersten Sowjet an. In der Sowjetunion waren diese Wahlen zwar eine Farce - es gab nur einen Kandidaten pro Wahlkreis - aber die Teilnahme galt als Bürgerpflicht. Doch die Bewohner von Kuybyshev weigerten sich, Agitatoren in ihre Wohnungen zu lassen. Selbst wenn diese von Milizionären begleitet wurden.
Die Botschaft war klar: Solange der Mörder frei herumlief, würden sie nicht wählen. Eine beispiellose Form des zivilen Ungehorsams in der Sowjetunion. Die Behörden gerieten unter Druck und Moskau wurde auf die Mordserie aufmerksam. Eine Sonderkommission wurde gebildet: 50 Kriminalbeamte, 200 Milizionäre, unterstützt von Hunderten freiwilliger Helfer.
Die Ermittler arbeiteten fieberhaft. Sie analysierten die Tatorte, suchten nach Mustern. Der Täter drang nachts ein, meist durch Fenster oder schlecht gesicherte Türen. Er tötete mit stumpfen Gegenständen oder Äxten. Er schändete die weiblichen Leichen und legte Feuer, um Spuren zu vernichten.
Ein Detail fiel auf: An mehreren Tatorten wurden Reifenspuren eines Fahrrads gefunden. Zeugen erinnerten sich an einen Mann auf einem schwarzen Fahrrad, der in den Nächten der Morde in der Nähe gesehen wurde.
Der Durchbruch kam durch einen glücklichen Zufall. In der Nähe des ausgebrannten Malomanov-Hauses fand ein Milizionär einen kleinen Schlüssel. Die Prägung wies auf ein Fahrradschloss der Marke Charkov hin. Die Ermittler konzentrierten sich fortan auf Radfahrer.
Am Abend des 8. Juni patrouillierte Zagfar Gayfullin mit anderen Freiwilligen in der Nähe des Flughafens. Der Stadtteil galt als gefährdet - viele Wohnheime, schlecht beleuchtet, ideales Jagdrevier für den Killer.
Als der Mann auf dem Fahrrad auftauchte, wirkte er zunächst unverdächtig. Nur ein Arbeiter auf dem Heimweg, dachte Gayfullin. Doch dann öffnete eine Windböe den Mantel. Die Axt darunter glänzte im Licht der Straßenlaterne.
Was folgte, war eine wilde Verfolgungsjagd durch die nächtlichen Straßen von Kuybyshev. Serebryakov, in Panik, fuhr wie von Furien gehetzt. Die Milizhelfer rannten hinterher, alarmierten über Funk Verstärkung – und stellten die Bestie schließlich.
Im Verhörraum der Miliz saß Boris Serebryakov zusammengesunken auf einem Holzstuhl. Die Axt lag als Beweisstück auf dem Tisch. Er wusste, dass es vorbei war. Nach anfänglichem Leugnen brach er zusammen, gestand alles.
Die Details, die er preisgab, ließen selbst hartgesottene Ermittler erschaudern: Er beschrieb die Morde mit einer unfassbaren Kälte, so als erzähle er vom Wetter. Keine Reue, keine Emotion. Nur wenn er seine nekrophilen Handlungen schilderte zeigte er eine Regung - eine perverse Form der Erregung.
In seiner Wohnung fanden die Ermittler weitere Beweise: Gegenstände der Opfer, die er als Trophäen aufbewahrt hatte. Seine Fingerabdrücke stimmten mit denen an mehreren Tatorten überein. Die Blutgruppe passte. Die Reifenspuren seines Fahrrads entsprachen den Abdrücken. Die Beweislast war erdrückend.
Der Gerichtssaal des Regionalgerichts von Kuybyshev war im Herbst 1970 überfüllt. Hunderte drängten sich auf den Zuschauerplätzen, weitere Hunderte standen draußen. Sie alle wollten das Monster sehen, das ihre Stadt terrorisiert hatte.
Serebryakov erschien in Handschellen und Fußfesseln. Ein unscheinbarer Mann, mittelgroß, dunkelbraune Haare. Schwer vorstellbar, dass dieser durchschnittlich aussehende Mensch solche Grausamkeiten begangen hatte.
Die forensisch-psychiatrische Untersuchung attestierte ihm Zurechnungsfähigkeit. Keine Geisteskrankheit, die ihn vor Strafe schützen würde. Wohl aber eine schwere Persönlichkeitsstörung.
Der Staatsanwalt schilderte die Verbrechen in allen grausamen Details. Zeugen sagten aus, Überlebende berichteten unter Tränen. Die Beweise wurden präsentiert. Serebryakovs Verteidiger hatte wenig entgegenzusetzen.
Als das Urteil verkündet wurde, brach im Saal Applaus aus: Tod durch Erschießen. Menschen weinten vor Erleichterung. Doch Serebryakov zeigte keine Regung, bis auf einen Satz, der allen Anwesenden das Blut in den Adern gefrieren ließ: "Ich komme wieder."
Alle Gnadengesuche wurden abgelehnt und Anfang 1971 wurde Boris Serebryakov im Gefängnis von Syzran hingerichtet.
Die Exekution erfolgte nach sowjetischem Standard: Ein Schuss in den Hinterkopf, ausgeführt vom Henker des NKWD. Serebryakovs Leiche wurde in einem namenlosen Grab verscharrt. Keine Markierung, keine Zeremonie. Er sollte aus der Geschichte getilgt werden.
Serebryakov war nicht der einzige sowjetische Serienmörder. Andrei Chikatilo würde in den 1980ern über 50 Menschen töten. Alexander Pichushkin mordete in den 1990ern in Moskauer Parks. Doch Serebryakov war einer der ersten dokumentierten Fälle - und einer der brutalsten. Aber sein letzter Satz vor Gericht - "Ich komme wieder" - erfüllte sich nicht.
Die Bestie von Oberfranken
DerSchneelagschwer auf den Dächern von Kaltenbrunn. Dezember 1968. Ein kleines Dorf im oberfränkischen Itzgrund, wo jeder jeden kannte. Wo man die Haustüren nicht abschloss, weil Verbrechen etwas war, das nur in der Zeitung stand. Bis zu jenem Tag, als die 14-jährige Nora Wenzl nicht nach Hause kam.
Ihr Schulweg führte durch verschneite Felder, vorbei an der Molkerei, wo Manfred Wittmanns Vater arbeitete. Ein Weg, den sie hunderte Male gegangen war. Nur diesmal erreichte sie ihr Zuhause nicht. Als man sie fand, war sie tot. Erstochen. Verstümmelt. Ein Anblick, der selbst erfahrenen Polizisten die Sprache verschlug.
In Kaltenbrunn lebte zu dieser Zeit ein Mann, den alle kannten und doch niemand wirklich kannte: Manfred Wittmann. Ein stiller Mensch, der noch bei seinen Eltern wohnte. Schüchtern, unauffällig, harmlos. Das dachten jedenfalls alle.
Niemand ahnte, dass hinter dieser Fassade ein Monster lauerte. Ein Monster, das seit seiner Kindheit von Gewaltfantasien heimgesucht wurde. Das davon träumte, kleine Mädchen aufzuschlitzen. Das bereits einmal zugeschlagen hatte - und nun wieder morden würde.
1943 geboren, wuchs Manfred Wittmann als fünftes von sieben Kindern auf. Eine normale Familie in einem normalen Dorf. Doch ein Erlebnis aus seiner Kindheit sollte sein ganzes Leben prägen. Er war noch klein, als er zusah, wie ein Schwein geschlachtet wurde. Das Blut, das Zappeln des sterbenden Tieres, die aufgeschnittene Kehle - bei anderen Kindern löste so etwas Ekel oder Angst aus. Bei Manfred Wittmann löste es etwas anderes aus: sexuelle Erregung.
Von diesem Tag an waren seine Fantasien von Gewalt durchzogen. Während er masturbierte, stellte er sich vor, wie er kleine Mädchen erstach. Jahr für Jahr wurden diese Fantasien intensiver, drängender, unkontrollierbarer.
Mit 16 versuchte er, ein Mädchen kennenzulernen und wurde zurückgewiesen. Diese Abfuhr traf ihn hart. Zu seinem latenten Frauenhass gesellte sich nun die Gewissheit, dass er auf normalem Wege niemals bekommen würde, wonach er sich sehnte. Also würde er es sich nehmen. Mit Gewalt.
Weihnachten 1959. Während andere Familien unterm Tannenbaum saßen, lauerte der 16-jährige Manfred Wittmann im Dunkeln. Sein Ziel: Irmgard Feder, 19 Jahre alt, Arbeitskollegin seiner Schwester. Er kannte ihren Heimweg vom Kino.
Zuerst lief er nach Hause, holte einen Gummiknüppel und ein Küchenmesser. Dann wartete er. Als Irmgard vorbeikam, schlug er zu. Wieder und wieder prügelte er auf ihren Kopf ein. Zwang sie, sich auszuziehen. Stach mit dem Messer in ihren Hals.
Nach dem Angriff auf Irmgard Feder zog sich Wittmann zurück. Er beendete seine Tischlerlehre nicht - Prüfungsangst, hieß es. Stattdessen nahm er einen Job in der Asphaltmischerei an. Jeden Tag derselbe Weg zur Arbeit, dieselben Handgriffe, dasselbe graue Leben. Äußerlich der perfekte, langweilige Nachbar.
Doch in seinem Inneren brodelte es. Die Fantasien wurden nicht schwächer, im Gegenteil. Sie wurden detaillierter. Und brutaler. Er sah junge Mädchen auf der Straße und malte sich aus, was er mit ihnen tun würde. Nachts, allein in seinem Zimmer, lebte er diese Fantasien in Gedanken aus, während er masturbierte. Neun Jahre unterdrückte er den Drang. Dann, im Dezember 1968, war es vorbei mit der Selbstkontrolle.
Nora Wenzl war 14 Jahre alt. Eine Schülerin aus Welsberg bei Staffelstein, die zur falschen Zeit am falschen Ort war. Wittmann lauerte ihr auf, überwältigte sie, zerrte sie in ein Versteck. Dann lebte er seine kranken Fantasien aus. Mit einem Messer tötete er das Mädchen auf bestialische Weise. Ein Sexualmord dieser Grausamkeit war in der beschaulichen Region Oberfranken unvorstellbar. Die Polizei startete eine großangelegte Fahndung. Straßensperren wurden errichtet, Wälder durchkämmt, Hunderte von Männern befragt.
Auch Manfred Wittmann wurde vernommen, doch der Mann aus Kaltenbrunn machte einen harmlosen Eindruck. Kein Verdachtsmoment. Die Beamten zogen weiter.
In Coburg und Umgebung herrschte Panik. Eltern brachten ihre Töchter zur Schule und holten sie wieder ab. Mädchen durften nicht mehr allein das Haus verlassen. Die Angst ging um.
August 1969. Acht Monate waren seit dem Mord an Nora Wenzl vergangen. Die Polizei tappte noch immer im Dunkeln. Die Bevölkerung begann sich langsam zu beruhigen. Vielleicht war der Täter weitergezogen, hoffte man. Ein fataler Irrtum.
Helga Luther war 16 Jahre alt und kam aus Lichtenfels. Ein fröhliches Mädchen mit Zukunftsplänen. Sie wollte Krankenschwester werden, Menschen helfen. Stattdessen wurde sie zum zweiten Opfer von Manfred Wittmann. Wieder schlug er mit extremer Brutalität zu. Wieder benutzte er ein Messer. Wieder hinterließ er eine grausam zugerichtete Leiche. Die Panik kehrte zurück, intensiver als zuvor. Ein Serienmörder ging um in Oberfranken. Die Polizei verstärkte ihre Bemühungen, setzte eine Sonderkommission ein. Ohne Erfolg.
November 1969. Sieglinde Hübner, 16 Jahre alt, lebte in Kaltenbrunn, wie Manfred Wittmann. Sie kannten sich vom Sehen, grüßten sich auf der Straße. Ein fataler Fehler des Mörders, in seinem eigenen Umfeld zuzuschlagen.
Der Mord an Sieglinde war der brutalste von allen. Wittmann verstümmelte das Mädchen und schnitt ihr die Kehle durch. Es war, als hätte er jede Hemmung verloren, als wollte er seine kranken Fantasien bis zum Äußersten ausleben.
Doch diesmal hatte er einen Fehler gemacht: Er hatte zu nah an seinem Zuhause gemordet. Und plötzlich erinnerte sich jemand. Erinnerte sich an Weihnachten 1959. An die Kratzer in Wittmanns Gesicht nach dem Überfall auf Irmgard Feder.
Die Ermittler brauchten nicht lange, um die Verbindung herzustellen. Der Überfall von 1959, die drei Morde - alles passte zusammen. Manfred Wittmann wurde verhaftet.
Bei seiner Festnahme wirkte er fast erleichtert. Später sagte er aus, er sei froh gewesen, dass man ihn endlich gefasst habe. Der Druck seiner eigenen Taten, die Angst vor sich selbst, waren unerträglich geworden.
Am 7. November 1971 begann vor dem Landgericht Coburg einer der spektakulärsten Prozesse der deutschen Nachkriegszeit. Der Andrang war enorm. Im Gerichtssaal herrschte Lynchstimmung. Bauarbeiter aus Kaltenbrunn und Umgebung, die Wittmann kannten, hätten ihn am liebsten mit bloßen Händen erwürgt.
Im Mittelpunkt stand die Frage: War Manfred Wittmann zurechnungsfähig? Zwei psychiatrische Gutachter attestierten ihm eine "schwer abartige sexuelle Entwicklung mit sadistischer Prägung". Sie plädierten für Schuldunfähigkeit.
Die Staatsanwaltschaft sah das anders. Wittmann sei "körperlich und geistig gesund". Die Abnormitäten hätten keinen Krankheitswert. Er habe bei seinen Taten stets "einen klaren Kopf behalten".
Verteidigt wurde Wittmann von niemand Geringerem als Rolf Bossi, dem legendären Strafverteidiger. Bossi versuchte, eine Einweisung in die Psychiatrie zu erwirken. Vergeblich.
Am 15. Dezember 1971 fiel das Urteil: Dreimal lebenslänglich bei Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Das Gericht folgte nicht den Gutachtern, die Schuldunfähigkeit bescheinigt hatten. Die Richter befanden, Wittmann sei voll verantwortlich für seine Taten gewesen.
Die Verteidigung legte Revision ein, hoffte noch immer auf eine psychiatrische Unterbringung. Ohne Erfolg. Manfred Wittmann wurde nach Straubing verlegt, in eine der härtesten Justizvollzugsanstalten Bayerns.
In Straubing verbrachte Wittmann die nächsten vier Jahrzehnte. Er galt als Mustergefangener, unauffällig und angepasst. Irgendwann ließ er sich kastrieren und erhielt Medikamente zur Unterdrückung seiner Triebe.
2011, nach 40 Jahren Haft, stellte die Strafvollstreckungskammer fest: Wittmann könnte entlassen werden, wenn sich ein geeignetes Altenheim fände. Der Anstaltsleiter war dagegen, fürchtete trotz Kastration und Medikamenten einen Rückfall.
2013, nach 43 Jahren Haft, war es soweit. Der 70-jährige Wittmann wurde in ein Nürnberger Altenheim entlassen. Ein gebrochener Mann, der fast sein ganzes Leben hinter Gittern verbracht hatte.
Was macht aus einem Menschen ein Monster? Bei Manfred Wittmann lässt sich die Entwicklung nachzeichnen. Das prägende Kindheitserlebnis bei der Schweineschlachtung. Die frühe Verknüpfung von Gewalt und Sexualität. Die Zurückweisung, die seinen Frauenhass verstärkte. Die jahrelange Unterdrückung der Fantasien, bis der Damm brach.
Und doch bleiben Fragen. Warum entwickeln manche Menschen mit ähnlichen Erfahrungen keine Gewaltfantasien? Was unterscheidet den, der seine dunklen Gedanken kontrolliert, von dem, der zum Mörder wird?
Die Psychiater im Prozess sprachen von einer "schwer abartigen sexuellen Entwicklung". Aber war Wittmann krank oder böse? Schuldunfähig oder voll verantwortlich? Das Gericht entschied für Letzteres. Doch die Debatte über Schuld und Sühne, über Strafe und Therapie, geht bis heute weiter.
Manfred Wittmann, die "Bestie von Oberfranken", starb im Altenheim. Als freier Mann.
Als Monster geboren, als Monster gestorben
CharlesHatcherbegingseinen ersten Mord – im Knast. Es war der 2. Juli 1961 und Hatcher hatte Küchendienst im Missouri State Penitentiary. Die Küche war stickig, der Geruch von verkochtem Kohl hing in der Luft. An diesem Morgen fehlte Hatcher beim Appell.
Wärter fanden ihn dreißig Minuten später in der Speisekammer. Zu seinen Füßen lag Jerry Tharrington, 26 Jahre alt, ebenfalls Häftling. Tharringtons Hose war heruntergezogen, Blut sammelte sich unter seinem Körper. Die Autopsie ergab: Vergewaltigung, dann 23 Stichwunden, hauptsächlich im Brust- und Bauchbereich. Die Mordwaffe, ein Küchenmesser, steckte noch in Tharringtons Rücken.
Hatcher hatte Blut an seinen Händen und seiner Kleidung. Die Beweise waren überwältigend, aber ohne Zeugen reichte es nicht für eine Mordanklage. Stattdessen: Einzelhaft, unbefristet.
In der Isolation schrieb Hatcher Briefe an die Gefängnispsychologen und behauptete, Stimmen zu hören. Er beschmierte die Wände seiner Zelle mit Fäkalien, schrie stundenlang zusammenhanglose Worte. Doch der leitende Psychiater durchschaute die Farce. In seinem Bericht notierte er: "Der Häftling zeigt eindeutige Anzeichen von Simulation. Seine 'Symptome' sind lehrbuchhaft, zu perfekt, zu kontrolliert."
Nach seiner Entlassung 1963 verschwand Hatcher für sechs Jahre von der Bildfläche. Er tauchte erst wieder am 27. August 1969 in Antioch, Kalifornien, auf - wieder als Mörder.
Der zwölfjährige William Freeman fuhr mit seinem neuen Fahrrad durch die Nachbarschaft. Es war ein Geburtstagsgeschenk, metallic-blau, mit Gangschaltung. Hatcher folgte ihm in einem gestohlenen Wagen und wartete, bis der Junge eine einsame Straße erreichte.
Er lockte William zu einem ausgetrockneten Bachbett, einen halben Kilometer von der Straße entfernt. Was dort geschah, rekonstruierten die Ermittler aus den Spuren: Fesselungen an Handgelenken und Knöcheln. Sexueller Missbrauch. Dann Strangulation mit einem Nylonseil. Williams Leiche wurde erst drei Wochen später gefunden und war bereits stark verwest.
Zwei Tage nach Williams Verschwinden, am 29. August, schlug Hatcher erneut zu. Gilbert Martinez, 6 Jahre alt, spielte vor einem Süßwarenladen in San Francisco. Zeugen sahen einen Mann, der dem Kind ein Eis anbot. Gilbert folgte ihm. Im Golden Gate Park, hinter dichten Büschen, begann Hatcher seinen Übergriff. Ein Hundebesitzer, der seinen Terrier ausführte, hörte Schreie. Er fand Hatcher über dem weinenden Kind, die Hose heruntergezogen. Der Mann schrie, andere Parkbesucher eilten herbei. Hatcher versuchte zu fliehen, wurde aber von zwei Joggern zu Boden gerungen.
Bei seiner Verhaftung gab er den Namen Albert Ralph Price an. In seiner Tasche: ein Führerschein auf den Namen Horace Prater. Seine Fingerabdrücke passten zu keinem der beiden Namen. Wer war dieser Mann?
Als Albert Price angeklagt, begann Hatcher seine ausgefeilteste Täuschung: Im Gefängnis von San Francisco weigerte er sich zu sprechen, zu essen und sich zu bewegen. Er saß stundenlang in derselben Position und starrte auf einen Punkt an der Wand. Der Gefängnisdirektor schaltete eine Psychiaterin ein. Dr. Helen Morrison, eine erfahrene forensische Psychiaterin, untersuchte ihn im Oktober 1969. Hatcher reagierte nicht auf Fragen, Berührungen, nicht einmal auf Nadelstiche. Aber Morrison bemerkte etwas: Wenn sie den Raum verließ, entspannten sich seine Muskeln minimal. Als sie durch einen Spalt in der Tür spähte, sah sie ihn sich kratzen.
Das FBI identifizierte ihn schließlich durch alte Fingerabdrücke als Charles Ray Hatcher. Diese Information änderte alles – und nichts. Hatcher spielte weiter verrückt.
Monatelang wurde er zwischen Gericht und verschiedenen psychiatrischen Einrichtungen hin und her geschoben. Atascadero State Hospital. Napa State Hospital. Jede Einrichtung kam zu anderen Schlüssen. War er psychotisch? Simulierte er? War er verhandlungsfähig?
Charles Ray Hatcher wurde am 16. Juli 1929 in Mound City, Missouri, geboren - das jüngste von vier Kindern in einer Familie, die bereits am Rande des Zusammenbruchs stand. Sein Vater, Jesse James Hatcher (der Name war prophetisch), war Schmuggler während der Prohibition. Ein gewalttätiger Alkoholiker, der seine Frustration an seiner Familie ausließ, besonders am kleinsten und schwächsten Mitglied - Charles.
Die Familie lebte in einem kleinen Dorf außerhalb von St. Joseph, Missouri. Das Haus war mehr Schlachtfeld als Heim. Jesse prügelte seine Kinder mit Gürteln, blanken Fäusten und allem, was zur Hand war. Charles, klein für sein Alter und mit einem Stottern behaftet, war das bevorzugte Ziel. Die Nachbarn hörten die Schreie, sahen die blauen Flecken, aber sie taten nichts. In den 1930er Jahren mischte man sich nicht in "Familienangelegenheiten" ein.
In der Schule wurde Charles vom Opfer zum Täter. Die anderen Kinder verspotteten sein Stottern, seine schäbige Kleidung, den Geruch von Armut und Vernachlässigung, der ihm anhaftete. Diesmal wehrte Charles sich: anfangs mit Fäusten. Als er merkte, dass Gewalt Respekt - oder zumindest Angst - erzeugte, eskalierte er. Ein Junge, der ihn gehänselt hatte, landete mit einem gebrochenen Arm im Krankenhaus. Ein anderer verlor zwei Zähne. Die Lehrer schüttelten den Kopf über den "schwierigen Jungen", aber niemand griff ein.
Der 14. April 1936 war ein sonniger Frühlingstag. Charles, damals sechs Jahre alt, und sein älterer Bruder Arthur Allen ließen einen selbstgebauten Drachen steigen. Sie hatten Kupferdraht in einem alten Ford Model T gefunden und als Drachenschnur verwendet - eine tödliche Entscheidung.
Arthur, der den Drachen hielt, wollte ihn an Charles weitergeben. In dem Moment, als der Kupferdraht die Hochspannungsleitung berührte, schossen 2.300 Volt durch Arthurs Körper. Er war sofort tot, verkohlt und verkrampft; den Drachen hielt er noch in seinen Händen.
Charles stand daneben, erstarrt vor Schock. Er hatte gesehen, wie das Leben aus den Augen seines Bruders wich, hatte den Geruch von verbranntem Fleisch gerochen. Die Dorfbewohner eilten herbei, schrien, weinten. Jemand zog Charles weg, aber seine Augen blieben auf Arthur fixiert.
Jesse Hatcher ertrug den Verlust seines Sohnes nicht. Drei Wochen nach der Beerdigung packte er seine sieben Sachen und verschwand. Keine Erklärung, kein Abschied. Lula Hatcher stand nun mit drei Kindern und ohne Einkommen da.
Lula tat, was viele verzweifelte Frauen ihrer Zeit taten - sie suchte einen neuen Mann, der für die Familie sorgen konnte. Zwischen 1936 und 1945 heiratete sie dreimal. Jeder neue "Vater" brachte neue Regeln, neue Strafen, neue Formen der Vernachlässigung. Charles lernte früh, unsichtbar zu werden und sich anzupassen, um irgendwie zu überleben.
1945 zogen sie nach St. Joseph, in der Hoffnung auf einen Neuanfang in der größeren Stadt. Für den 16-jährigen Charles änderte sich wenig. Er war ein Außenseiter geblieben, gefangen zwischen Wut und Selbsthass. Die Stimme seines toten Bruders verfolgte ihn in seinen Träumen. Manchmal wachte er schreiend auf, überzeugt, dass Stromschläge durch seinen eigenen Körper liefen.
Mit 18 Jahren, im Jahr 1947, beging Hatcher sein erstes dokumentiertes Verbrechen. Er arbeitete für eine Holzfäller-Firma und stahl den Firmen-LKW. Als man ihn erwischte, zeigte er keine Reue. Der Richter, der seine schwierige Kindheit berücksichtigte, gab ihm Bewährung. Ein schwerer Fehler, wie sich später zeigen sollte.
Ein Jahr später stahl er einen Buick von einem Parkplatz in St. Joseph. Diesmal gab es keine Nachsicht. Zwei Jahre Gefängnis. Im Missouri State Penitentiary lernte Hatcher die Lektionen, die sein weiteres Leben prägen sollten: Vertraue niemandem. Zeige keine Schwäche. Und vor allem - lerne das System zu manipulieren.
Er beobachtete, wie Insassen, die psychische Probleme vortäuschten, in angenehmere Krankenhausflügel verlegt wurden. Er studierte ihre Techniken, ihre Symptome, ihre Geschichten. Ein Zellengenosse, ein mehrfacher Mörder namens Carl, lehrte ihn die Kunst der falschen Identität. Wie man eine neue Person wird, eine neue Geschichte erfindet und einfach spurlos verschwindet.
Nach seiner Entlassung am 8. Juni 1949 dauerte es nur Monate, bis Hatcher wieder straffällig wurde. Ein gefälschter 10-Dollar-Scheck in einer Tankstelle in Maryville. Die Fälschung war amateurhaft, die Schrift zittrig. Der Tankwart rief die Polizei, aber Hatcher entkam während des Transports zum Gericht.
Seine Freiheit währte nur drei Tage. Bei einem Einbruchsversuch in ein Lebensmittelgeschäft wurde er auf frischer Tat ertappt. Zwei weitere Jahre Gefängnis. Das Muster war etabliert: Verbrechen, Verhaftung, Gefängnis, Entlassung - und das Ganze wieder von vorn.
1954, kaum eine Woche nach seiner Entlassung, stahl er einen 1951er Ford in Orrick, Missouri. Der Besitzer hatte den Schlüssel stecken lassen - geradezu eine Einladung, die Hatcher nicht ausschlagen konnte. Vier Jahre Haft. Während er auf seinen Prozess wartete, versuchte er aus dem Ray County Gefängnis zu fliehen, indem er sich durch die Gitterstäbe zwängte. Gefängniswärter fanden ihn halb eingeklemmt, blutend von den Schnittwunden des rostigen Metalls. Zwei weitere Jahre wurden seiner Strafe hinzugefügt.
Am 26. Juni 1959 überschritt Hatcher eine neue Grenze. Sein Opfer war Steven Pellham, ein 16-jähriger Zeitungsjunge in St. Joseph. Hatcher lauerte ihm in einer Gasse auf, ein Fleischermesser in der Hand - 10 Zoll lang, die Klinge scharf genug, um Knochen zu durchtrennen.
Er befahl dem Jungen, in sein gestohlenes Auto zu steigen. Pellham, der Selbstverteidigung trainiert hatte, täuschte Gehorsam vor, dann rammte er Hatcher seinen Ellbogen in den Magen und rannte, so schnell er konnte. Verzweifelt erreichte er ein nahegelegenes Geschäft und hämmerte gegen die Tür, schrie um Hilfe.
Die Polizei fand Hatcher zwei Stunden später, immer noch in dem gestohlenen Wagen. Das Messer lag auf dem Beifahrersitz, Seile im Kofferraum. Was er mit Pellham vorgehabt hatte, wollte sich niemand ausmalen.
Der Richter wandte den Habitual Criminal Act an - Hatchers Strafregister war zu lang für Milde. Fünf Jahre im Staatsgefängnis. Die lokale Zeitung nannte ihn "den gefährlichsten Mann im Nordwesten Missouris seit Jesse James" - eine Überschrift, die Hatcher voller Stolz ausschnitt und aufbewahrte.
Nach seinen kriminellen Eskapaden in den 60er Jahren war Hatcher wieder einmal im Gefängnis.
Am 2. Juni 1971 nutzte er einen Moment der Unachtsamkeit während eines Transfers. Die Wärter hatten seine Fesseln gelockert, damit er die Toilette benutzen konnte. Er schlug einen Wärter nieder und entkam durch einen Notausgang. Sieben Tage lang war er auf der Flucht.
In Colusa, Kalifornien, 150 Meilen nördlich, stahl er einen Pontiac von einem Supermarktparkplatz. Der Besitzer hatte den Motor laufen lassen, während er Zigaretten kaufte. Als Hatcher mit quietschenden Reifen davonfuhr, notierte sich ein aufmerksamer Kunde das Kennzeichen. Die Polizei stoppte ihn drei Stunden später auf der Interstate 5. Diesmal gab er den Namen Richard Lee Grady an und behauptete, der Wagen gehöre einem Freund. Erst auf der Wache stellte sich seine wahre Identität heraus.
Von 1971 bis 1977 wurde Hatcher zum Pingpongball des kalifornischen Systems. Vacaville. San Quentin. Atascadero. Jede Institution versuchte, ihn zu kategorisieren, zu behandeln, zu kontrollieren. Mal spielte er mit, dann spielte er verrückt – je nachdem, was vorteilhafter war.
Im April 1973 fanden Wärter ihn in einem Lüftungsschacht, zwei zusammengeknotete Bettlaken um die Taille. Ein weiterer Fluchtversuch. Als Strafe: Verschärfte Sicherheitsmaßnahmen und Dauerüberwachung.
Zwei Monate später schnitt er sich mit einer zerbrochenen Glühbirne die Pulsadern auf. Oberflächlich und kalkuliert - genug Blut für Drama, nicht genug für echte Gefahr. Dr. Patricia Lim notierte: "Theatralischer Suizidversuch. Patient stellte sicher, in Sichtweite des Pflegepersonals zu sein."
1975 wandelte er sich dann plötzlich: Positive Bewertungen tauchten in seiner Akte auf. Hatcher nahm an Therapiesitzungen teil, arbeitete in der Gefängnisbibliothek, zeigte "Reue". Die Bewährungskommission setzte seine Entlassung für Dezember 1978 an. Dann änderte Kalifornien die Gesetze zur Anrechnung von Haftzeiten. Psychiatrische Unterbringung zählte jetzt doppelt. Hatchers neues Entlassungsdatum war Januar 1977.
Das Übergangsheim in San Francisco, in das Hatcher entlassen wurde, war ein heruntergekommenes viktorianisches Haus im Tenderloin-Viertel. Zwanzig Männer, alle mit psychiatrischer Vorgeschichte, teilten sich die engen Räume. Hatcher blieb genau eine Nacht. Am nächsten Morgen war sein Bett leer, das Fenster stand offen. Er hatte 200 Dollar aus der Kasse des Heimleiters gestohlen und war verschwunden.
St. Joseph, Missouri, 26. Mai 1978. Eric Christgen, gerade einmal vier Jahre alt, spielte vor dem Haus seiner Großmutter. Seine Mutter war bei der Arbeit, die Großmutter kochte das Mittagessen. Sie schaute alle paar Minuten durch das Küchenfenster - Eric schaukelte, Eric spielte im Sandkasten. Eric war plötzlich weg.
Nachbarn schwärmten aus, riefen Erics Namen. Die Polizei kam sofort mit Suchhunden und die Hunde nahmen eine Spur auf, verloren sie aber am Flussufer.
Drei Tage später fanden Angler Erics Leiche, angeschwemmt an einer Biegung des Missouri River. Die Autopsie war eindeutig: sexueller Missbrauch, Tod durch Erwürgen. Hautpartikel unter seinen Fingernägeln zeigten, dass er verzweifelt versucht hatte, sich zu wehren.
Die Polizei verhörte über 100 Verdächtige. Registrierte Sexualstraftäter, bekannte Pädophile, jeden mit einer Vorgeschichte. Sie konzentrierten sich dann auf Melvin Reynolds, 25 Jahre alt mit einem IQ von 73. Er war bekannt dafür, dass er gerne mit kleinen Kindern spielte.
Reynolds kooperierte vollständig. Er unterzog sich freiwillig Lügendetektortests, ließ sich sogar hypnotisieren und beantwortete jede Frage. Nach 14 Stunden Verhör, erschöpft und verwirrt, sagte er die Worte, die sein Schicksal besiegelten: Er würde sagen, was sie hören wollten. Unter dem massiven Druck konstruierte Reynolds ein Geständnis. Details, die ihm möglicherweise von den Ermittlern suggeriert wurden, fügten sich zu einer Geschichte zusammen. Im Februar 1979 wurde er wegen Mordes zweiten Grades zu lebenslanger Haft verurteilt.
Vier Jahre lang saß ein unschuldiger Mann im Gefängnis, während der wahre Mörder frei herumlief.
Unter dem Namen Richard Clark wurde Hatcher unterdessen am 4. September 1978 in Omaha wegen sexueller Nötigung eines 16-Jährigen verhaftet. Vier Monate psychiatrische Behandlung, dann Entlassung.
Mai 1979: Versuchter Mord an Thomas Morton, 7 Jahre alt, in Lincoln, Nebraska. Hatcher hatte versucht, den Jungen mit einem Küchenmesser zu erstechen. Wieder psychiatrische Einweisung, wieder Entlassung.
Oktober 1980: Sexueller Übergriff auf einen 17-Jährigen in Des Moines. 21 Tage Psychiatrie, dann frei.
Januar 1981: Messerstecherei in Davenport, Iowa. Einweisung, Behandlung, Entlassung in ein Obdachlosenheim.
Das System versagte immer wieder. Niemand verband die Punkte, niemand erkannte das Muster. Charles Ray Hatcher war zu Richard Clark geworden, und Richard Clark hinterließ keine Spuren.
Es war der 1. Juli 1982 in St. Joseph, Missouri. Michelle Steele, 11 Jahre alt, verließ ihr Haus, um eine Freundin zu besuchen. Sie kam nie an. Ihre Mutter wartete zwei Stunden, dann rief sie die Polizei.
Am nächsten Tag fand ihr Onkel Michelles Leiche am Flussufer, fast genau dort, wo Eric gefunden worden war. Gleiche Verletzungen, gleiche Todesursache. Die Parallelen waren unübersehbar. Diesmal hatte die Polizei mehr Glück. Ein Zeuge hatte einen Mann gesehen, der Michelle ansprach. Die Beschreibung führte zu einem Obdachlosen, der versuchte, sich im St. Joseph State Hospital einweisen zu lassen. Er nannte sich Richard Clark.
Im Verhörraum des St. Joseph Police Department saß Hatcher 72 Stunden lang FBI-Agenten gegenüber. Langsam und methodisch brachen sie seine Fassade auf. Am dritten Tag begann er zu reden.
16 Morde gestand er. Manche detailliert, andere nur vage Erinnerungen. Eric Christgen war dabei. Er beschrieb den Ort, die Methode und Details, die nie veröffentlicht worden waren. Er gestand den Mord an William Freeman, den Jungen mit dem Fahrrad von 1969. Name für Name, Ort für Ort: eine Litanei des Schreckens.
Melvin Reynolds wurde sofort freigelassen. Nach vier Jahren Unschuldshaft erhielt er eine Entschädigung von 750.000 Dollar - ein schwacher Trost für gestohlene Jahre.