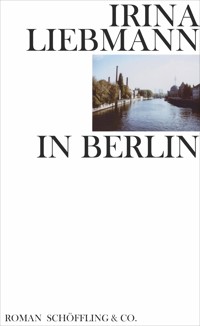21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schöffling & Co.
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
»Wäre es schön? Es wäre schön!« lautet die Überschrift eines von vielen Leitartikeln des glänzenden Journalisten Rudolf Herrnstadt. Bekannt wird der aus einer jüdischen Familie aus Oberschlesien stammende engagierte Kommunist, den es früh nach Berlin zieht, in der Weimarer Republik als Redakteur des Berliner Tageblatts. Langjährige Aufenthalte in Moskau, wo er auch eine Familie gründet, prägen ihn. Nach seiner Rückkehr steigt er auf zum Chefredakteur der Parteizeitung der DDR, bleibt aber eine streitbare Stimme. Aufgrund seiner Kritik am Umgang der Partei mit den Menschen wird er am Ende aus der SED ausgeschlossen. Aus Irina Liebmanns Gesprächen mit Zeitzeugen entsteht das Bild eines leidenschaftlichen und ironischen, humorvollen und radikalen Menschen, der bei den eigenen Genossen immer wieder aneckt. Mit der Vision einer Gesellschaft, in der die Einzelnen sich frei entfalten können, ist Herrnstadt tragisch gescheitert. Als großer Akteur der Zeitgeschichte bleibt er in diesem Buch lebendig.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 502
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
[Cover]
Titel
Prolog
VOR DEM GEWITTER
1903
Ich bin ein Dichter!
Ein Brief aus der Vergangenheit
Überraschungen
Liebe und Ahnungen, Panikattacken
Kurkapellen-Atmosphäre
Es wird ernst
KRIEGSBILD
Hier spricht Moskau – Goworit Moskwa
Das große Sterben beginnt
Noch einmal über Ilse
Deutsche Emigranten
Zeitung für Soldaten
Zwischenzeit
TRÜMMERBILD
40 Grad Fieber
Absturz in den Kalten Krieg
Zeitung für Genossen
Aufbauzeit
Ein Kapitel für sich – die Stalinallee
Jetzt muss gesprungen werden!
Das Ruder herumreißen – aber wie?
1953
Epilog
Anhang
Register
Autor:innenporträt
Kurzbeschreibung
Impressum
An einem Spätsommertag des Jahres 1953 fährt ein schwarzer BMW aus Berlin in Richtung Süden. Neben dem Chauffeur sitzt ein Mann im hellen Trenchcoat, hinten eine junge Frau und zwei kleine Mädchen. Der Mann vorne sieht starr geradeaus. Von hinten kann man sehen, wie seine Kiefermuskeln sich bewegen, als ob er die Zähne zusammenbeißt, und das sieht aus, als ob er weinen müsste. Zwei Stunden lang oder drei.
Gestern noch hat er die größte Zeitung des Landes geleitet, er hat in der Komintern gearbeitet und für den Generalstab der Roten Armee, er hat das seltsame kleine Land, in dem dieses Auto sich südwärts bewegt, aus den Trümmern mit aufgebaut und Ulbricht entmachten wollen, jetzt ist das alles vorbei, und er schweigt und sieht starr geradeaus.
Haltung. Immer noch ist das ein gebräuchliches Wort, im Jahr 1953. Und ist es nicht ein militärischer Begriff? Ein Kommando? Ein Einatmen, ohne auszuatmen? Was hat sich nicht alles dahinter verborgen, darunter versteckt, wie viel Leid. Wir werden es niemals erfahren. Dafür war sie ja da, diese Haltung, das tiefe Durchatmen, das steinerne Gesicht und der Blick nach vorn.
Dieser Mann im Sommermantel damals, schweigend und sich nicht umwendend, war mein Vater Rudolf Herrnstadt. Es war nicht nur seine Fahrt, nicht nur seine Niederlage. Es war unser Leben. Damals. Und ist immer noch unser Leben.
Rudolf Herrnstadt, 1952
Foto: Hans-Joachim Mollenschott
Prolog
Es ist gewagt, über seinen Vater zu schreiben, wenn man sechzig ist, aber vorher ist es mir nicht eingefallen. Da wollte ich ein eigenes Leben führen, selbst gebaut und selbst verantwortet, und nicht die Tochter eines berühmten Mannes sein, nur das nicht!
Es ist ein sogenanntes emanzipiertes Leben geworden, aber nun, wo ich auf Eigenes zurückblicken könnte, sehe ich zu ihm. Mehr noch – alles, was ich geschrieben habe, die Bücher, die Dramen, die Lieder mit ihren unterschiedlichen Themen erscheinen mir wie Stückchen, abgebrochen von dem Ganzen, das ich ausgelassen habe, und in der Mitte davon steht er.
Das ist natürlich auch das Bild eines psychischen Schadens: Vaterkomplex. Auch deswegen, weil ich davon immer wusste, unterließ ich es, sein Leben in meiner Arbeit zu beschreiben, ich führte auch gern einen anderen Namen, aber manchmal erwähnte ich ihn im Gespräch, und wenn dann ein in der jüngsten deutschen Geschichte gebildeter Mensch gerade dabeistand, dann kam dieses: »Ach!«
Und sofort war er wieder da, dieser Mann, den eine Zeit lang alle gekannt hatten und über den sie nichts wussten oder zu wenig, der aber Beunruhigung hinterlassen hatte, eine Spur in der Luft sozusagen, die nur langsam verebbte.
Aber tat sie das überhaupt?
Bei einem meiner letzten Umzüge geriet mir wieder ein Kinderbild in die Hände: Ich selber im Sommerkleid, etwa vier Jahre alt. Dieses Foto steckte in einem ordentlichen Passepartout, Seidenpapier war drübergelegt und hinten auf der Pappe ein Stempel der Fotografin: Eva Kemlein Pressefotos.
Da ich oft umzog, war mir der Name der Fotografin mit den Jahren geläufig, also hörte ich hin, als einmal im Radio ein Gespräch mit ihr angekündigt wurde. Sie lebt noch, dachte ich, es gibt sie also wirklich. Ich suchte den Namen im Telefonbuch und fand ihn. Rief sie an und sie war da. Wir verabredeten einen Besuch.
Es war Februar. Sie wollte, dass ich abends komme. Trotz der Dunkelheit fand ich das Haus ziemlich schnell, ein billiges Mietshaus, die Wohnung weit oben, ich klingelte. Diesen Weg zu ihr war ich bereits wegen meines Vaters gegangen, warum nun auf einmal, das weiß ich nicht, es trieb mich an, dass sie ihn gekannt hatte, das hatte ich ihr auch als Begründung gesagt. Ich klingelte also – nichts rührte sich. Ein Hund bellte. Ich wartete eine Weile vor der Wohnungstür, dann klingelte ich wieder. War sie nicht da? Hatte sie mich vergessen oder Angst bekommen oder ging es ihr schlecht? Die Frau war dreiundneunzig Jahre alt und lebte allein.
Alles blieb still. Sie kam nicht. Nur der Hund bellte.
Ich stand noch eine Weile vor der Tür, dann wollte ich gehen, da schob sich die Tür einen Spalt auf. Da stand ein Gnom, eine kleine, bizarre Figur! Einen Meter dreißig vielleicht in der Höhe. Der Kopf hing herunter, der Körper verdreht, stützte sich auf einen Stock mit breitem Elfenbeingriff, und die Beine, die Beine! Voreinander zusammengekrumpelt und in orthopädischen Schuhen.
Als der Hund sich beruhigt hatte, konnte ich zusehen, wie sie sich vorwärtsbewegte – Zentimeter um Zentimeter. Sie hatte zehn Minuten gebraucht, um zur Tür zu kommen. So war das also.
Sie schob sich mit äußerster Kraftanstrengung voran.
– Tut es weh?
– Fragen Sie nicht.
Eine kräftige, tiefe Stimme kam aus ihrem Winzlingskörper.
Eva Kemlein konnte den Kopf nicht heben. Wenn sie mich ansah, sah sie von unten hoch, die Augen blickten nach oben aus einem hängenden Kopf. Sie freute sich!
Die kleine Wohnung hatte zwei Zimmer, der Tisch war gedeckt. Ein Abendbrot!
Dafür musste sie Stunden gebraucht haben. Sie brauchte ja viele Minuten, bis sie den Tisch nun auch wieder erreichte. In niedrigen Sesseln saßen wir dran, ich stand aber wieder auf, um den Tee zu kochen, und sah sie von hinten, so grau und den Kopf auf der Brust hängend, das kleine Figürchen – ein Geist, dachte ich, wie ein Geist!
Die Stimme passte gar nicht dazu.
– Ihr Vater ist hier gewesen, sagte sie, ohne dass ich fragen musste.
Im Mai 1945, genau an dem Tag, als sie mit ihrem Mann diese Wohnung bekommen hätte, da habe ein Auto dort unten gehalten und Fritz Erpenbeck habe vor der Tür gestanden und gesagt, er sei einer von den KPD-Leuten, die gerade aus Moskau zurück seien, und nun würden sie eine Zeitung machen und brauchten dafür einen Fotografen.
– Und im Auto, da saß Ihr Vater.
Er habe einen ungeheueren Eindruck auf sie gemacht, sagte Eva Kemlein, einen ganz unbeschreiblichen Eindruck.
Ich bat sie, genauer zu sein, aber das konnte sie nicht. Sie sei eben so einem Menschen vorher noch nie begegnet und später auch nicht mehr.
An dieser Stelle winkte ich ab, so sei ja meine Erinnerung auch, sagte ich, aber bei mir sei es der Vaterkomplex.
– Sie haben keinen Vaterkomplex.
Das sagte die kräftige Stimme aus dem uralten Menschen, und weil diese Stimme ganz anders war als heute Stimmen sind, aus einer ganz anderen Zeit, war sie glaubwürdig, und zwar so sehr, dass ich mich schämte. Ich nannte ihn ja seit vielen Jahren im Stillen nicht anders als einen Deppen und einen Idioten.
– Das war der Anfang von unserem Ende.
Sie meinte seinen Sturz.
– Wir haben verloren. Vorläufig. Die Amerikaner haben gesiegt. Aber den Glauben darf man nicht verlieren.
Und in die Pause, die eintrat:
– Sie glauben doch noch daran?
Ich schwieg. Ich wollte sie nicht verletzen, sie war dreiundneunzig Jahre alt, sie war eine kranke Greisin, was konnte sie ertragen an Widerspruch? Ich schwieg.
– Man muss daran glauben.
Ich schwieg.
– Ihr Vater hat gewiss daran geglaubt.
Das stimmte. Seine Genossen hatten ihn umbringen wollen, sie hatten ihn aus ihrer Partei ausgeschlossen und Lügen verbreitet, zu Tode gehetzt, aber den Glauben hatte er behalten.
– Sehen Sie.
Ich sagte, ich hätte das immer als absurd empfunden. Und überhaupt: Im Radio damals hätte ich gehört, dass sie ihr Leben lang hier in Westberlin gewohnt hätte, aber im Osten gearbeitet. Als wir dort alle eingesperrt waren, sei sie so hin- und herspaziert, wie hatte sie das fertiggebracht?
– Ich habe hier gewohnt und dort gearbeitet.
Aus solchen zwei Zimmern mit der U-Bahn zum Zoo und dann mit der S-Bahn zur Friedrichstraße, das war nicht der Westen, von dem wir geträumt hatten, das sah ich wohl, und doch – warum hat sie nicht im Westen gearbeitet?
– Für Adenauer??!!
– Es gab in der BRD keine politischen Gefangenen, keine Folter und Kinder, die ihren Eltern weggenommen wurden so wie in der DDR, immerhin.
– Davon wusste man nichts.
– Sie haben es nicht geglaubt.
– Natürlich nicht. Und nach einer Pause: Wir wollten ja rüber. Aber die Partei hat verlangt, dass wir im Westen wohnen bleiben, um die demokratischen Kräfte zu stärken.
– Na, sagte ich zufrieden, ich war nie in einer Partei.
– Mich haben sie 1952 ausgeschlossen.
– Und? Haben Sie auch so darunter gelitten wie mein Vater?
– Ach wo! Da musste man ständig Versammlungen haben und irgendwelche Verpflichtungen. Ich bin Künstlerin! Keine Zeit für so was!
– Aber im Osten zu arbeiten, das war doch auch schlecht mit dem Geld.
– Natürlich war es schlecht, und ich habe ja auch nichts. Aber das waren meine Leute, ja. Meine Familie. Dort habe man sie übrigens auch immer loswerden wollen, aber es habe immer Genossen gegeben, die ihr eine kleine Arbeit verschafft hätten.
– Aber es wurde doch immer schlimmer dort drüben!
– Die Funktionäre haben alles verdorben.
– Ich bin weggegangen von dort, das sagte ich vorsichtig, ich wollte sie nicht verletzen.
– Aber Sie sind wiedergekommen!
– Berlin. Für mich ist es Berlin.
Wir schweigen eine Weile, dann sagt sie so leise, dass ich es kaum verstehe: Der Antifaschismus. Es war wegen dem Antifaschismus.
– Ja, sage ich, der unehrliche Antifaschismus, und wieder ist lange Pause.
Sie sitzt da, gekrümmt, mit hängendem Kopf, ringsherum Bilder an den Wänden, Fotos. Viele davon zeigen denselben Mann, sieht aus wie ein Schauspieler, sieht schön aus, ein blonder Siegfried mit wehenden Locken.
– Wer war das?
– Der Stein.
Folgt die Geschichte des Mannes Werner Stein, tatsächlich ein Schauspieler, aber auch Regisseur, sie war ja Theaterfotografin, so hat sie ihn kennengelernt in den vierziger Jahren, nachdem sie sich von dem ersten Mann mit dem Namen Kemlein scheiden ließ, weil der die vielen Schwierigkeiten wegen der Mischehe nicht aushielt, sie war ja jüdisch. Der Stein aber auch, und als ihre Mutter abgeholt wurde, musste sie sich verstecken, und der Stein ging mit ihr zusammen, denn er liebte sie ja. Das war im Februar 1942.
– Wir haben uns drei Jahre versteckt.
– Drei Jahre?
– Jede Nacht woanders, ja.
– Bis 1945?
– Ja.
– Zu zweit?!
– Ja.
Ich kann es nicht glauben, sie nennt Namen, Adressen, Bruchstücke von Erinnerungen – ein Zaun zur Lietzenburger Straße, ein Zimmer in einer Gemeinschaftswohnung, aber es sind nicht drei Jahre Angst und Flucht, die sie erzählt, sondern drei Jahre Liebe, und immer von ihm – der Stein!
Er hat tagsüber bei Leuten Sessel gepolstert, so verdiente er Geld zum Leben, gekauft wurde, was ohne Marken zu haben war, meistens Weißkohl, die U-Bahn und S-Bahn haben sie nicht benutzt, wegen Geld und wegen der Razzien, sie sind durch Berlin nur gelaufen, immer gelaufen und immer zu zweit, und als Sozialist war er so überzeugt von der glücklichen Zukunft für alle, das stand für den ganz unumstößlich fest.
– In dieser Zeit?
– Gerade in dieser Zeit.
– Morgens nicht wissen, wo man abends schlafen wird und ob man sich wiedersieht, und überall konnten Sie verraten werden, war es so?
– Unsere Freunde haben uns nicht verraten.
– Haben Sie nur bei Freunden gewohnt?
– Nein! – Ganz unbekannte Leute seien es manchmal gewesen, hier ein Tipp, da ein Tipp, es habe überall Genossen gegeben, aber viele hätten auch einfach zeigen wollen, dass sie gegen die Nazis sind.
– Sie haben viel Vertrauen gehabt.
– Ja.
– Sie hatten mehr Vertrauen als Angst?
– Ja.
Dann spricht sie wieder über den Stein. Wie unvergleichlich er gewesen sei, voller Ideen und Begeisterung und felsenfest überzeugt vom Sieg der Sowjetunion.
– Wir haben über die Zukunft gesprochen. Mit ihm hatte man keine Angst. Solche Menschen habe es damals gegeben, aber: Das lässt sich nicht mehr vermitteln.
Wie gut sie das gesagt hatte: Das lässt sich nicht mehr vermitteln.
Deswegen saß ich ja hier. Weil es etwas gab, was sich nicht mehr vermitteln ließ.
Sie hatte es mir erklären sollen. Rudolf Herrnstadt. Aber das konnte sie nicht. Stattdessen setzte sie gleich einen zweiten daneben, ebenfalls unerklärlich. Aber wahr. Mit Sicherheit wahr. Man sah es ja, dass es die Wahrheit war. Nur eben – was war das gewesen? Was hatten die, was wir nicht haben?
Dabei hatte ich es vor Augen, die kleine Wohnung, voll mit Skizzen, Radierungen, Fotografien, alles Geschenke befreundeter Künstler, dazu Evas Fotos: Ernst Busch vor allem, Helene Weigel, und überall an den Wänden ihr Mann Werner Stein. Ein Sofa dazu und ein Bett und ein Tisch und ein Schreibtisch – das war’s.
Bücherregale.
In so einer Wohnung könnte ich mich blind zurechtfinden, solche Wohnungen kannte ich von klein auf, es waren die Wohnungen der zurückgekehrten Emigranten, der Leute, die nichts mehr besaßen, aber Freunde und Ideale, und sie konnten auch alle etwas, sie haben immer gearbeitet.
– Wir wollen Wein trinken, sagte sie.
Ich öffnete die Flasche Rotwein, die auf dem Tisch stand, wir tranken auf unsere Begegnung und aßen belegte Brote.
Sie konnte nicht wissen, dass ich gerade vom Totenbett aufgestanden war, operiert und zusammengenäht. Sie wunderte sich nur, dass ich so vorsichtig trank und gegen zehn Uhr nach Hause wollte.
– Warum so früh?
Als ich schon den Mantel angezogen hatte, stand sie im Türrahmen. Sie sagte: Wann haben Sie es erfahren?
Seltsamerweise wusste ich sofort, was sie meinte. Stalin.
– Wir haben es nicht geglaubt, sagte sie. Wir haben es lange nicht geglaubt.
Übrigens habe der Stein immer gesagt: Warte ab, wenn die deutschen Genossen aus Moskau kommen, da wirst du Menschen kennenlernen, die du noch nie gesehen hast. Aber als die dann in Berlin waren, da seien sie wie Eisblöcke gewesen.
Ich fragte, ob das auch für meinen Vater gelte, und wieder sagte sie, wie außergewöhnlich er auf sie gewirkt habe.
Ich hätte auch nicht fragen müssen, denn sie bedankte sich immer wieder für diesen Besuch. Es sei etwas ganz Besonderes für sie, und sie hätte es nie geglaubt, das zu erleben – noch einmal eine Berührung mit Rudolf Herrnstadt.
So waren wir am Ende des Abends wieder an seinem Anfang angelangt, und ich wankte nun regelrecht raus in die Kälte, ins Freie und Dunkle.
Diese Zwergin war ein Gigant in Wirklichkeit, mit ihrer kräftigen Stimme und den klar formulierten Sätzen. Und ich?
Wieder ein Blatt im Wind.
VOR DEM GEWITTER
Rudolf Herrnstadt (ganz rechts) mit Freunden in der Tatra im Sommer 1933. Die vorn sitzende Frau könnte Ilse Stöbe sein. Foto: privat
1903
Es waren einmal ein Uhrmacher und ein Advokat. Der Uhrmacher war ein Christ und der Advokat war ein Jude, sie wohnten in der Stadt Gleiwitz im gleichen Haus, und beiden wurde im gleichen Jahr ein erster Sohn geboren.
In Kinderwagen mit hohen Speichenrädern schoben die Hausangestellten von nun an die Kinder durch die kleine Stadt, zum Markt und zum Rathaus, vielleicht auch zum Park und einmal im Kreis um das Palmenhaus.
Es war das Jahr 1903, und das Licht, in dem die vergötterten Knaben – und dass sie vergöttert wurden, ist nachweisbar – da schliefen und brüllten manchmal, stelle ich mir so vor, wie ich es von Turner gemalt in der alten Tate Gallery gesehen habe: Karthago vor seinem Untergang. Ganz von Gold überflutet der Himmel, das Meer und die Menschen, sie stehen am Hafen und starren ins Wasser, sie warten. Es herrscht Abendstille und Windstille auch. Völlige Windstille.
In der Windstille dieser Jahre sind radikale Menschen zur Welt gekommen, heute weiß man es, aber damals? Was für Herzen schlagen unter den Spitzenkleidchen und Seidenbändern, was für Schicksale warten auf sie?
Eine Kindheit kann nicht glücklicher sein als im reichen Oberschlesien, wenn man die richtigen Eltern hat. Die Stadt hat sich alle wichtigen Bauten in der größtmöglichen Ausführung bestellt: das Landgericht, das Hauptpostamt, den Bahnhof. Dazu noch das rote Gymnasium, es ist alles beklemmend groß, viel zu groß, aber man ist ja Verwaltungszentrum, und wiederum sind die Straßen schmal und winklig, alt und abgeschrägt viele Häuserwände, schwupp, ist er weg wie ein Fisch im Wasser, so ein Lausejunge, so heißen sie hier, Lausejunge, du Lausejunge, der kleine Lothar, der kleine Rudolf – es kann ihnen gar nichts passieren!
Und die Sonne scheint. Ich sehe die Stadt immerzu in der Sonne, ein tiefes, regelrecht wonniges Gefühl kommt von dort, wenn ich mich anstrenge, das Bild aufzurufen, dieses Bild von Gleiwitz in der Vergangenheit, golden. Wann kam der Wind auf?
Sie sind alle tot, die ich fragen könnte, aber egal, was die Antwort wäre – mein Vater Rudolf hat eine Heimat gehabt. Tief verankert, nie vergessen: Gleiwitz in Oberschlesien.
Immer wieder tauchte sie auf in Erzählungen und Geschichten, im Namen des Drogisten und des Justizrates, des Flusses und der Zeitungen, der Mohnklöße und des schlesischen Himmelreichs, in den Namen der Lehrer natürlich, der Mitschüler auch, und in der Beschreibung der drei kleinen Teufel aus Bronze, die tanzten vor dem Oberschlesienhaus. Dort tanzen sie immer noch.
Rudolf hatte einen Vater Ludwig, eine Mutter Maria-Clara und einen kleinen Bruder hatte er auch, der hieß Ernst.
Doktor Ludwig Herrnstadt war eine Respektsperson in der Stadt, Rechtsanwalt und Notar, Sozialdemokrat seit 1894, was selten war bei dem Beruf und dem Erfolg dieses Mannes. Er verdiente gut, er vertrat große Konzerne, aber auf der Wahlliste seiner Partei stand er neben Grubenarbeitern und Schneidergesellen als einziger vornehmer Mann. Im Gleiwitzer Stadtarchiv fand ich seine Unterschrift, tief gezackt wie ein grobes Sägeblatt, kraftvoll.
Auf dem einzigen Foto, das noch vorhanden ist, ist ein ausgesprochen bodenständiger Mann zu sehen, ein Mann, der mit der Faust auf den Tisch hauen konnte.
Dass er seinen Sohn vergötterte, lässt sich unter anderem daran erkennen, dass der Sohn ihn ebenfalls vergötterte. Auch hier Geschichten, Anekdoten, kleine und große Erinnerungen. Nur über ihn – seinen Vater.
Denn mein Vater Rudolf hat über niemanden aus seiner Familie reden können, also gar nichts erzählt, seine Erinnerung war von Schmerzen wie anästhetisiert, denn sie alle sind in deutschen Konzentrationslagern grausam ermordet worden. Nur mein Großvater war so stark, dass er auch diesen Schutzwall durchbrach und in unserer Nachkriegswelt erschien. Eine große Liebe, aus der ein großer Kampf wurde, und der musste einfach erzählt werden.
Zuerst aber eitel Sonnenschein. Die Knaben Lothar und Rudi werden die besten Freunde, auch wenn die Familien bald in verschiedenen Häusern wohnen, es ist doch alles die Innenstadt.
Sie gehen in beiden Familien ein und aus, in kurzen und langen Hosen, besuchen die gleichen Schulen.
Wenn der Vater Rudi Aufgaben stellt, ist der ehrgeizig, sie zu erfüllen, und erzählt es auch später noch stolz, denn es waren »unmögliche« Aufgaben gewesen.
So blieb er bei einem Sonntagsspaziergang vor einem Schaufenster stehen, wo Konservenbüchsen mit Schoten oder Erbsen pyramidenförmig übereinandergetürmt waren, zeigte auf eine bestimmte Büchse in der untersten Reihe, sah auf die Uhr und meinte, zwei Stunden sollten wohl ausreichen, um genau diese Büchse zu besorgen.
Also hetzte Rudi mehrmals durch die ganze Stadt, bis er an diesem Sonntagnachmittag den Menschen gefunden hatte, der den Schlüssel zu Laden und Schaufenster besaß. Es war eine Frau, die sich schließlich überreden ließ, mit ihm zu kommen, und dann auch noch die ganze Dekoration auseinandernehmen musste, um genau die Büchse hervorzuziehen, auf die der Vater gezeigt hatte.
Spätestens an dieser Stelle der Erzählung protestierte ich, weil es doch ganz egal sein könnte, welche Büchse er nun nach Hause brachte, aber da entrüstete sich mein Vater – nein, nein, also das sei ja wohl eine Selbstverständlichkeit, dass der Vater sich darauf verlassen konnte, dass ihm die richtige Büchse gebracht werden würde. Auch die preußischen Juden waren Preußen.
Als der Krieg beginnt, der Sturm losgeht, sind die Kinder elf Jahre alt, als er verloren wird, sind sie schon fünfzehn, das Gymnasium ist ihnen ein Graus, trotzdem sollen sie zu den größten Hoffnungen Anlass geben. Ein Abgesandter der Kirche will Rudolf unbedingt für ein Priesterseminar gewinnen, er besucht Ludwig in seiner Kanzlei, der ist nicht mehr religiös – »… aber ich bin Jude!«
– Wir haben auch jüdische Kardinäle, soll die Antwort gewesen sein, und mein Vater hätte sie mir nicht erzählen können, wenn sein Vater sie ihm nicht erzählt hätte. Ein Fehler, wie sich bald zeigen wird – Rudi wird übermütig.
Vorläufig ist es nur Pubertät, aber heftig. Zu heftig, wie es den Eltern scheint. Gleiwitz ist eine kleine Stadt. Jedenfalls, wenn man an der Hauptstraße wohnt und am Markt seine Anwaltskanzlei hat, denn die Hauptstraße führt zum Markt und auf dem Markt wird auch Markt gehalten – und wenn dann der Sohn am helllichten Tage als Schulschwänzer volltrunken über den Platz kommt, dann ist man nicht allein auf der Welt. Aber sie wollen ja provozieren, Lothar und Rudi – »… wir waren der Bürgerschreck«.
Es muss eine Zeit gegeben haben, in der Ludwig Herrnstadt wegen dieses Sohnes vollkommen verzweifelt war. Und doch, noch laufen sie in den vorgegebenen Gleisen, die Freunde. Sie wollen beide Jura studieren – was sonst? Ludwig Herrnstadt ist ihnen das große Vorbild.
Also gab’s keinen Bruch mit dem Vater? Er ist schon geschehen, es hat nur niemand richtig bemerkt: Ins Gymnasium kommt ein neuer Lehrer, ein ausgemusterter Kriegsteilnehmer. Der starre preußische Unterricht ist bei ihm plötzlich verschwunden. Sensation: Da setzt sich ein junger Mann auf das Pult – er setzt!! sich darauf – und erzählt vom Krieg, was er erlebt hat, die schreckliche Wahrheit.
Vater Ludwig war bei Kriegsausbruch schon zu alt, er wird nicht mehr eingezogen. Der kann Meinungen haben, aber dieser Lehrer hat was riskiert!
Rückblickend erscheint es mir wie ein Muster in Herrnstadts Leben: Da ist ein Mann seinen Zuhörern mit dem ganzen Körper zugewandt, ein beweglicher, offener Mensch. Kein Pauker mehr, der Gehorsam verlangt. Er nimmt »seine Jungs« ernst, dazu muss er nur das sein, was er an der Front gerade erst war: ein »Kamerad«. Einer, der glaubwürdig etwas Unerhörtes erlebt hat – ein Kämpfer.
Immer, wenn mein Vater später von wichtigen Begegnungen erzählt hat, ist dieses Vorbild erschienen – der Held, der durchs Feuer gegangen war. Die Tat rückt hier in den Mittelpunkt, das wagemutige, unabgesicherte Tun. Da war der Bruch.
Davon abgesehen – die ganze Welt ist ja im Umbruch.
Zumal Oberschlesien. Hier bebte die Erde am stärksten in Deutschland. Denn diese Schatzkammer soll an Polen gehen, das neu geschaffene Polen wäre sonst nicht lebensfähig, ist das Argument. Das trifft auf Widerstand. Schon am Anfang der Zwanzigerjahre wird Gewalt hier alltäglich. Deutsche, Juden und Polen sollen bis dahin friedlich zusammengelebt haben. Nicht konfliktlos, aber immerhin friedlich. Das ist vorbei.
Nationalgefühl wird angefeuert, es kommt zu Unruhen, Kämpfen zwischen Polen und Deutschen. Schließlich schickt der Völkerbund Truppen, besetzt und beruhigt das Gebiet. Es soll freie Wahlen geben. Die Bevölkerung soll entscheiden, ob Oberschlesien zu Deutschland oder zu Polen kommt. Die Mehrheit entscheidet sich für Deutschland, darunter auch viele Polen. Entgegen dieser Wahlentscheidung soll Oberschlesien nun geteilt werden. Wieder Kämpfe. Auch Schlageters Freikorps zieht in Gleiwitz ein mit Judenhass und Gebrüll. Ein Schock. Das Gleiwitzer Bürgertum ist zu einem großen Teil jüdisch und selbstbewusst deutsch-patriotisch. Juden sind hier Bürgermeister, Gerichtspräsidenten, Träger der deutschen Kultur. Die unterlegene Kultur war hier die polnische, für Fortkommen und Bildung von Polen hatten gerade deutsche Sozialdemokraten sich eingesetzt, auch Ludwig Herrnstadt. Als Anwalt hat er Arbeiter kostenlos verteidigt, und das waren sehr oft Polen. Im Hause Herrnstadt hieß es bisher: Im Zweifel für die Polen, denn sie waren die Schwächeren. Wiederum ist es die Politik der Sieger, die Empörung hervorruft. Der Willen der Wähler wird ignoriert, so beginnt hier die Demokratie, und wer jetzt hier aufwächst, der wird politisch. Er muss es werden.
Das Gebrüll der Schlageter-Truppe jedenfalls hat Rudolf nicht vergessen, und als er weggeht aus Gleiwitz, zuerst nach Berlin, dann nach Heidelberg, trifft er wieder auf so was. Die Universität wird von schlagenden Verbindungen beherrscht, die dominieren auch die Studentenlokale und die Tanzböden, und ein Jude wird geschnitten, nicht aufgenommen in alle diese »Arminias« und »Teutonias«. Das war schon früher so? Das hat der Vater sich bieten lassen?
Herrnstadt ist zum ersten Mal alleine, er ist achtzehn Jahre alt und versteht es nicht: »Was haben die Juden den Deutschen getan?«
Er kommt aus einem Industriegebiet, offen und handfest, aber das hier? Weinseligkeit und Kastengeist, Ende der Welt.
Bald nach seinem neunzehnten Geburtstag ist er wieder in Gleiwitz. Ein Abgangszeugnis bringt er nach zwei Jahren Jurastudium zwar mit, aber weitermachen will er nicht. Er habe gemerkt, dass dieses Fach nicht das Richtige für ihn sei, hat er später gesagt.
Der Vater ist außer sich. Ludwig Herrnstadt war das Kind einer großen, armen Familie gewesen. Die hatte Geld gesammelt, um wenigstens einen der ihren zu unterstützen, damit er »etwas werden« konnte. Die Wahl war auf Ludwig gefallen und wurde für ihn eine schwere Verpflichtung, denn alle Verwandten beobachteten fortan seinen Weg, alle erwarteten Dank und Hilfe in der Not. Ludwig Herrnstadt hielt sich daran, wurde »vorbildlich« und hat dasselbe wohl auch von den Söhnen erwartet. Nichts da – jetzt kommt der Bruch an die Oberfläche, Zeit und Geld sind verschwendet, aber ein zweites Studium wird es nicht geben, nicht für diesen Sohn!
Rudolf wird ab sofort in der Wohnung der Eltern wohnen und in eine Fabrik gehen. Er soll sein Geld selbst verdienen. Er soll sehen, wie schwer das ist. Ende.
Für eine bürgerliche Familie, wo familiäre Probleme gerne vertuscht wurden, eine ungewöhnliche Lösung. Man sieht daran den maßlosen Zorn des Älteren, aber auch, dass er den Sohn nicht fallen lässt. Es ist eher ein letzter Erziehungsversuch. Und auch dieser scheitert.
Nicht etwa daran, dass Rudolf kneift. Nein, er zieht nur andere Konsequenzen, als dem Vater lieb ist. Denn bei aller Renitenz war Ludwig Herrnstadts ältester Sohn offenbar ein sensibler Junge. Das hatte der Alte wohl übersehen in seinem Zorn, und dieser Junge war tief erschrocken.
Scherzhaft hat er später gesagt, er habe die Pressearbeit von ganz unten gelernt, nämlich schon bei der Papierherstellung im Zellstoffwerk Krappitz.
Weniger launig betrachtet muss es ein Höllensturz gewesen sein. Aus dem Studentenleben zurück nach Hause, aus den Biergärten in die Fabrik. Was er dort gesehen hat, schien unvorstellbar:
Das dunkle, schwarze Arbeiterelend!
Menschen, die gar nichts anderes kannten als das, ja die dankbar waren dafür, dass sie diese Arbeit überhaupt machen durften, Menschen, die ihre Kinder hierherschickten, Kinder! Dass so etwas überhaupt möglich war! Dass sein Vater, der Sozialist, für solche Unternehmer noch arbeitete, für sie verhandelte und Verträge abschloss!
Rudolf muss keine schwere Arbeit machen, er soll in die Werkzeugausgabe, er kann lernen, noch ist sein Leben nicht ganz verpfuscht, noch kann er auch wieder gehen, aber darf man das eigentlich? Die Ärmeren, Schwächeren einfach im Stich lassen?
Herrnstadt hat, das wird sein Leben erweisen, eine Begabung zur Freundschaft. Seine Freunde vergisst er nie, was er für sie tun kann, das tut er, überall, wo er ist, wird er Freunde gewinnen, also vermutlich auch dort in Krappitz. Wie kann er sie alle zurücklassen? Dort!
Von 1922 bis 1924 beginnt sein Tag früh um fünf mit dem Gang zum Bahnhof. Freund Lothar sieht er nur selten, der schläft noch, wenn er schon auf dem Weg ist zu Kugelkochern, Säuretürmen, Kalklauge, Essig- und Schwefelsäure und Holz, sehr viel Holz. Und während er Zangen und Nägel heraussucht aus Werkzeugschränken, hört Lothar in Breslau Vorlesungen. Auch daran denkt Rudi, wenn er im Vorortzug der Proleten zum Zellstoffwerk Krappitz fährt. Morgens und abends rattern die Räder unter ihm, und da sitzt er und träumt oder sinnt auf Großes.
Nein, er muss sie zurücklassen, wenn er geht, er darf sie nur nicht vergessen. Nein, auch das Erinnern wäre zu wenig, billig wäre es, nein, es dürfte eine solche Fabrik gar nicht erst geben, solch eine Arbeit, oder wenn es nicht anders geht, dann eben besser bezahlt, viel besser bezahlt! Denn es ist doch die schlechteste Arbeit, dankbar müssten die anderen sein, dass jemand das überhaupt tut, sich dankbar erweisen, natürlich.
So fährt Rudi sein Stückchen Eisenbahn hin und her am östlichen Rande des Deutschen Reiches, zwei Jahre lang, morgens und abends. Zwei Jahre, in denen die Zeitungen voll sind mit Meldungen unerhörtester Art. Die Nachbarstadt Kattowitz liegt nun in Polen, dort erscheinen ganz neue Zeitungen, die suchen Leute, und Polen wiederum grenzt jetzt an Sowjetrussland, dort haben die Arbeiter die Betriebe übernommen, sie dulden das nicht mehr, was er täglich sieht, sie lassen sich nicht mehr ausbeuten, solche Nachrichten kommen in Gleiwitz an.
Die Verhältnisse umstürzen – das wär’s! Nicht ewig sich aufhalten mit Reformen, Regierungsbeteiligungen, was haben die Väter denn damit erreicht? Wenn die Verhältnisse so sind, so elend, dann haben sie gar nichts erreicht, dann sind sie beteiligt am Unternehmergewinn, die Väter, wie können sie dann Sozialisten sein, er streitet sich nur noch mit seinem Vater, wenn er zurück ist, am Abend, Rudi. Unfähig, Liebe und Zorn zu verbergen.
Dabei ist er eher lyrisch als politisch, ein junger Mann, der die Fabrik überstehen muss, den täglichen Schock und die Angst vor dem Leben, ein Junge, der Rilke liest, Bernhard Kellermann – Yester und Li: »Ginstermann kam spät in der Nacht nach Hause. Es mochte zwei Uhr sein. Vielleicht auch drei Uhr. Vielleicht auch später. Langsam, ganz langsam war er durch die Straßen gewandert.«
Und hier endet das Märchen von Gleiwitz.
Gehört es noch rein, dass Rudolf Verse schreibt in dieser Zeit, und die Frage, wem er die zeigt? Im Winter 2004 bekam ich die Antwort darauf. Da traf ich Lothars Tochter Christiane, eine Dame von über siebzig Jahren, und ihr erster, mir unvergesslicher Satz hieß: Sie haben alle geschrieben!
– Sie kannten sich alle, sie waren alle befreundet und sie haben alle geschrieben!
– Wer, »alle«?
– Unsere beiden Väter, meine Mutter, meine beiden Brüder und Gottfried Bermann und Susi Kochmann auch, und der Sohn von einem Fabrikbesitzer, er hieß wohl Hermann mit Vornamen. Gottfrieds Vater war der Medizinalrat Bermann und Susi Kochmanns Vater war der Justizrat Kochmann. Es war eine Clique! Sie trafen sich im Café Schnapka!
– In Gleiwitz?
Natürlich in Gleiwitz. Susi, Gottfried und Rudi waren jüdisch, aber Religion habe gar keine Rolle gespielt. Es sei ein ganz freies Klima gewesen, damals in Gleiwitz, ganz frei und ganz links.
Und als dann Revolution in Berlin war, in Russland auch, dazu noch die Kämpfe um Kattowitz, da könnte ich mir wohl denken, wie das unsere Väter beschäftigt hat. Und geschrieben hätten die Freunde in allen Formen: Gedichte, Dramen, Zeitungsartikel, und natürlich seien sie immer verliebt gewesen!
– Susi Kochmann war damals das schönste Mädchen von Gleiwitz, und Ihr Vater war heiß verliebt in sie!
– Mein Vater?!
– Rudi, ja.
Aber Gottfried Bermann ebenso, denn Justizrat Kochmann und Medizinalrat Bermann hätten im gleichen Hause gewohnt, woraus Gottfried abgeleitet habe, dass er Susi sowieso heiraten werde.
Aber 1921 kamen wegen der andauernden Kämpfe Völkerbundtruppen nach Oberschlesien. Ein italienischer Oberst wurde im Haus einquartiert, und in den verliebte sich Susi und ist doch tatsächlich Frau Renzetti geworden und nach Rom gezogen. 1934 sei sie als Frau des Militärattachés Renzetti zurück nach Deutschland gekommen. Aus dieser Zeit müsste es ein Titelbild der Berliner Illustrierten Zeitung geben, da küsse Hitler der Frau des italienischen Botschafters die Hand.
– Da können Sie sich vorstellen, wie die gelacht haben, die Freunde! Der Justizrat Kochmann war doch der Synagogenvorsteher von Gleiwitz! Gottfried Bermann sei noch Jahre danach untröstlich gewesen über Susis Hochzeit, bis er die Verlegertochter Tutti kennengelernt habe, und mit der sei er dann emigriert.
– Das war doch nicht etwa der Verleger Bermann Fischer?
– Doch, doch. Einer aus der Schnapka-Clique.
Wir saßen in einem kleinen Haus am Griebnitzsee, vor den Fenstern ein Garten mit Obstbäumen, Schnee auf den Ästen, und vor diesem verschneiten Gartenbild hörte ich die Geschichten von der Jugend der Zwanzigerjahre in Gleiwitz, die ich schon längst vergessen hatte. Hier waren sie immer noch da, denn all die Einfälle und Streiche einer vergangenen Zeit hatte sich die Clique ihr Leben lang immer wieder erzählt: Der Hermann, dessen Nachnamen Christiane vergessen hatte und der Industrieller geworden war, ihr Onkel Erich Skubella, der Kunstmaler geworden war, der Onkel Walter, der Architekt geworden war, der Onkel Alfred, der Zahnarzt, ihre Mutter Elsbeth, die Journalistin geworden war, und ihr Vater natürlich, der Außenminister und Kunstsammler Lothar Bolz.
Und da spazierte auch Rudi herum, Rudi, der so laut lachen konnte. »Rudi, komm runter, Grimassen schneiden!«
Ich bin ein Dichter!
Mein Vater hat viel und gerne erzählt – und wiederum gar nichts. Passend zu seinen so verschiedenen Lebenszeiten. Erzählt wurde auf den Spaziergängen. Es gab Lieblingsthemen und Redeverbote. Gleiwitz war ein Lieblingsthema, die Arbeit für den Nachrichtendienst der Roten Armee stand unter Redeverbot, und die Empfindlichkeiten, die Schmerzen, die Liebe, wie war es damit? Mal so und mal so.
Die erzählte Zeit von Gleiwitz geht hier zu Ende, denn zwei Jahre Krappitz, – dann ist Rudolf volljährig und soll eine Fabrik in der Lausitz leiten, aber das will er nicht, er will schreiben, und Lothar ist volljährig und macht sein Examen. Irgendwann danach muss Rudi zu Lothar gezogen sein, wo sie eine Sportzeitung herausgaben.
Die erste Sportzeitung in Oberschlesien – davon hat mein Vater mir noch erzählt, schmunzelnd und immer noch stolz, und dass sie beide in einem Zimmer gewohnt hatten und gehungert und es habe tatsächlich eine erste Ausgabe gegeben, aber mehr eben auch nicht.
Danach trennen sich die Wege. Lothar will nun doch lieber Anwalt werden und wird Referendar bei Ludwig Herrnstadt. Das hat mein Vater nicht mehr erzählt.
Also hat es ihm wehgetan. Ist Lothar nun der geliebte Sohn? Lothar an Rudis Stelle?
Der alte Herrnstadt war Lothars großes Vorbild gewesen, das Studium von den Eltern erspart für den einzigen Sohn, der Beruf ein sozialer Aufstieg, die Kanzlei eine tolle Startmöglichkeit. Und der alte Herrnstadt? Ob er den Sohn herausfordern will oder den letzten Kontakt nicht verlieren oder einfach den Lothar schätzt?
Vater und Sohn schenken sich jedenfalls nichts.
Rudolf geht nach Berlin. Er will sich selber erschaffen. Das hat er immer erzählt.
Was hat er geschrieben in Berlin? Wovon hat er gelebt? Wen hat er kennengelernt? Die Antworten waren undeutlich.
Als ich dann weiterfragte, nannte er doch berühmte Namen – mit Thomas Mann habe er einen Briefwechsel geführt, mit Walter Serner war er bekannt, und den alten Rowohlt habe er auch getroffen. Der hätte ihn als Autor in seinem Verlag haben wollen, die Werbung aber mit den Worten gekrönt, Herrnstadt werde von jetzt an ein Rennpferd sein, auf das er setzen werde. Gemessen an der beim Erzählen hochgezogenen Augenbraue meines Vaters war’s das dann wohl gewesen.
Wer nun an wessen Ansprüchen gescheitert war, erfuhr ich nicht. Mehr dagegen über den bürgerlichen Literaturbetrieb, den es früher einmal gegeben hatte, wo aus Gefühlen eine Ware gemacht werden musste oder eben ein Pferdchen auf das man mal setzt, probeweise.
Womit auch klar war: Er wollte das Pferdchen nicht sein.
Aber wovon hat er gelebt – der Dichter?
1996 – die DDR war gerade zusammengebrochen – traf ich den Dramaturgen Jochen Ziller in München. Wir kannten uns aus dem Henschelverlag, dem einzigen Theaterverlag der DDR, man musste ihm als Dramatiker angehören oder man hatte gar keinen Theaterverlag.
Ziller also lebte nun in München und war Leiter des Drei-Masken-Verlages geworden. Damals in München versuchte er, mich für seinen Verlag zu gewinnen, und dafür hielt er mir stolz eine vergilbte Karteikarte unter die Nase.
Es stand darauf Rudolf Herrnstadt, Uhlandstraße 106, Lektor, und dass er 200 Mark Vorschuss für die Theaterstücke Flucht von St. Helena und Ulrik Lamont bekommen hatte. Datiert war das Ganze auf 1925. »Also«, sagte Ziller, »komm in den Verlag deines Vaters!«
Von Theaterstücken hatte mein Vater erzählt, einmal sogar mehrere Titel genannt, ein Eigenname konnte durchaus darunter gewesen sein. Sollte das dieser verstiegene Name Ulrik Lamont gewesen sein?
1996 in München war das ja wirklich egal. Immerhin hatte er mir nichts vorgemacht, eher untertrieben. Wie immer, wenn es um ihn selbst ging, um seine Leistung.
Wann hatte er den Traum vom Dichten aufgegeben? Wann hatte er angefangen als Journalist?
Er hat es nicht erzählt, aber immer betont, dass es die beste Zeitung von allen gewesen sei, für die er sich entschieden habe – das Berliner Tageblatt. Über die Zeitung aber meistens nur geäußert, dass er dort alles gelernt hat, was ein Journalist braucht, und berühmt gewesen sei für sein schallendes Lachen.
»Der kann aber lachen!« Besonders die Setzer hätten das immer gesagt. Auf meine erstaunte Frage, was das denn für ein Lachen gewesen sein soll, wurde unwillig etwas gemurmelt. Kein Wunder, dass die Frage nicht gut ankam – ich hatte dieses Lachen noch niemals gehört.
Einmal erzählte er auch, dass er beim Tageblatt niemanden gekannt hätte und sich deswegen etwas ausgedacht habe, um anzukommen. Und zwar hätte er in wochenlanger Arbeit eine ganze Nummer des Berliner Tageblattes selber geschrieben, auf den Tag genau: die Sportberichte, den Wirtschaftsteil, Ausland, Feuilleton und Theaterkritiken, sogar ein Stückchen Fortsetzungsroman. Alle Beiträge, jedes Genre, die Sportberichte und den Leitartikel zuletzt, und so sei er mit einer eigenen Ausgabe des Tages in der Chefredaktion erschienen und habe nach Theodor Wolff verlangt.
Wenn mein Vater von Theodor Wolff sprach, tat er das nie ohne Rührung, und als ich dann fragte, was an diesem Mann so besonders gewesen sei, murmelte er nur von tragischem Ende und linksliberaler Blindheit, und dass er ihn geliebt habe und umgekehrt sei es genauso gewesen. Dabei blieb es dann auch, mehr gab er nicht preis. Nur, dass er damals bei der Zeitung anfangen durfte, allerdings nicht als Journalist, sondern in der Setzerei, ganz von unten also. Auch Theodor Wolff war ein strenger Vater.
Sonst nichts Genaues. Im Gegenteil, wenn die Rede auf seine Jahre als »bürgerlicher Journalist« kam, hat er immer abgewinkt. Brillanter Journalismus – ja, aber was war schon ein »bürgerlicher Journalist«? Ein Mensch ohne große Ideale.
Was war er selber gewesen? Ein kommunistischer Journalist?
Ein Parteijournalist?
Als ich alt genug war, mit ihm über das Berliner Tageblatt zu reden, war er weder das eine noch das andere. Er war überhaupt kein Journalist mehr. Es war ihm verboten, in Zeitungen zu schreiben als Parteifeind, und er wurde alt. Dachte er nun anders über den »bürgerlichen Journalismus«? – Nein.
Hilfloses Schreiben ohne historischen Überblick.
Er dagegen hatte sich frühzeitig marxistisch gebildet, war der KPD beigetreten, und »bürgerlicher Journalist« zu sein war fortan sein Parteiauftrag gewesen, um so dem Nachrichtendienst der Roten Armee dienen zu können, der Sowjetunion also, das Vernünftigste, was man in dieser Zeit tun konnte – das etwa waren die Auskünfte, die er mir gab, als ich nach dem berühmten Berliner Tageblatt fragte. Brillante Journalisten, ja, aber was nutzte die ganze Brillanz, wenn der Faschismus vor der Tür stand, nein, sie nutzte gar nichts. Und bei diesem Urteil war es geblieben.
Es waren die frühen Sechzigerjahre, in denen wir diese Gespräche führten. Die letzten Jahre seines Lebens.
Auf manchem Spaziergang blieb er aber nun manchmal unerwartet stehen und wollte darüber reden, dass er drei verschiedene Leben gehabt habe, jedes grundverschieden vom anderen, und jedes Mal seien alle handelnden Personen für immer verschwunden!
Wie unbegreiflich das sei!
Wie Bruchschollen beschrieb er Warschau, Moskau, Berlin.
Alle diese Menschen, die er gekannt hätte, an ihren verschiedenen Schauplätzen, die hätten ja nichts miteinander zu tun gehabt, gar nichts!, und für alle Zeiten wüssten sie nichts voneinander.
Ich war zu jung, um zu verstehen.
Ich sah nur: Sie waren alle da. In seinem Kopf waren sie da, diese drei Schollen mit ihren Bewohnern, er selber war das Verbindungsstück.
Warum fuhr er nicht hin, nach Warschau, nach Moskau, er hätte bestimmt noch etwas gefunden, aber er wollte nicht.
Er rührte sich nicht von der Stelle, in seiner Verbannung.
Vorsicht wird der erste Grund gewesen sein.
Man konnte nicht wissen, zu was die Genossen noch fähig waren. Der zweite Grund war sein Stolz – und der dritte?
Vielleicht wollte er nicht mehr. Die wichtigsten der Akteure waren tot, die Liebsten.
Auch Theodor Wolff gehörte dazu. Da hätte er suchen können, wo er wollte, er hätte das, worüber zu reden gewesen wäre, nicht mehr besprechen können.
Nein, er tastete die so verschiedenen Teile seines Lebens nicht mehr an, fuhr nirgendwohin, suchte niemanden mehr.
Sollten die Brüche bleiben!
Für die, die ihm zugehört hatten allerdings, blieben die Brüche auch: Es hatte also einmal eine grandiose Zeitung mit einem grandiosen Chefredakteur gegeben, und gleichzeitig war das alles eben doch nur »bürgerlicher Journalismus«. Hilfloses Schreiben ohne historischen Überblick.
Ich glaubte ihm. Aber nicht wegen der politischen Begründung, sondern, weil es ja alles früher gewesen war, bevor es uns gab, die gerade jung waren, und somit entwertet, vorbei.
Kein Wunder, dass ich mich erst herabließ, nach seinen Artikeln zu suchen, als ich selbst angefangen hatte zu schreiben.
Es war in den späten Siebzigerjahren in der Berliner Stadtbibliothek, wo ich mir den Jahrgang 1931 mal einfach bestellt hatte, und dann unendlich viele gebundene Zeitungsbände vorfand, ein ganzes Regal voll für nur einen Jahrgang, und das war kein Missverständnis, kein falsch ausgefüllter Leihschein.
Das Berliner Tageblatt hatte eine Morgen- und eine Abendausgabe gehabt, eine Wirtschafts- und eine Sportausgabe, und manchmal auch noch ein Mittagsblatt – was für ein Reichtum!
Dazu der Witz der Formulierung, schon in den Überschriften, und wie schön das gesetzt war und welche berühmten Namen da auftauchten!
Gefasst darauf, tagelang suchen zu müssen in so viel Papier, schlug ich wahllos einen Band auf und fand den Namen Rudolf Herrnstadt ziemlich schnell auf einer Titelseite. Eine der größten deutschen Banken war zusammengebrochen, und er kommentierte Polens Reaktion darauf am 29. Juli in einem Leitartikel. Titel: »Der Mann auf dem Rennplatz«. Erste Sätze:
»Einen hat es in diesen Wochen gegeben, der die deutschen Ereignisse mit atemloser Spannung verfolgte: Polen.
Es benahm sich, da ihm im Spiel keine Rolle zufiel, wie der Zuschauer beim Pferderennen. Es schrie vor Erregung, wenn auch nur für sich, warf die Arme in die Luft, beschwor seinen Favoriten und schmähte dessen Gegner. Sein Monolog, untersucht man ihn näher, wird in der polnischen Historie kein Ruhmesblatt darstellen. Denn die Genugtuung über den Zusammenbruch der Danatbank zeugt weder von Verstand noch von Vornehmheit. Auch die Bemühungen, jeden Hilfsbereiten von Deutschland wegzudrängen, tun das nicht. Im Gegenteil. Die erstaunlichen Versuche, England und Amerika um ihrer Hilfsbereitschaft zu bedrohen, zeugen von einer übermenschlichen Unklugheit, und jenen Satz der Gazeta Warszawska: ›Die französischen Rentiers sollen wissen, dass ihre Ersparnisse, zu Deutschlands Rettung gegeben, verloren sind‹ – sollte sich einmal ein deutscher Journalist gegenüber Polen erlauben.
Mithin gibt Polen derzeit dem Kreis der Umstehenden Gelegenheit, sich abzuheben. Die eigene Ruhe, die eigene Gelassenheit zu beweisen. Nur der Tor ließe diese Gelegenheit vorübergehen. Der nüchterne Betrachter benutzt sie – um den Polen zu erklären, dass ihre leidenschaftliche Anteilnahme, wenn auch in der Form nicht restlos glücklich, so doch in der Sache berechtigt war. Dass ihr Schreck begründet, ihre Situation gefährdet ist.«
So ging es weiter, Satz für Satz nachweisend, warum gerade Polen am Versailler Vertrag festhalten muss – ja, das war brillant, und die allergrößte Klarheit war es auch, und paar Nummern später der nächste Artikel, diesmal eine volle Seite.
Ich werde nicht vergessen, wie ich rausging aus der Stadtbibliothek und vorbei am Außenministerium über den Schlossplatz lief, der ja damals Marx-Engels-Platz hieß und als Parkplatz glatt asphaltiert war. Es war ein Nachmittag im Sommer in Ostberlin und alles ringsherum war warm, still und leer.
So gut war er gewesen? So anerkannt?
Warum hatte er das nicht gesagt? Oder hatte ich nicht zugehört? Mir eine solche Sprache gar nicht vorstellen können?
Mir war klar, dass ich es nie schaffen würde, so zu schreiben, aber der nächste Gedanke hieß: Wo denn auch? In den Zeitungen der DDR?! Aber er hatte sie gegründet! Er war es doch gewesen! Wie passte das zusammen? Und so, nur noch den Kopf schüttelnd, lief ich durch diese stille Mitte von Berlin.
Auch das Redaktionsgebäude des Berliner Tageblatt habe ich damals gesucht und gefunden. Es stand zwischen Rasengrundstücken ganz nahe am U-Bahnhof Kochstraße, direkt an der Grenze, wo alles noch leerer und stiller war als am Marx-Engels-Platz. Unscheinbar, kaum zu erkennen: das Mosse-Haus. Drinnen ein Druckereibetrieb, gebohnerte Treppenstufen, leere Korridore.
Zehn Jahre später zerging die DDR wie Schnee in der Sonne. Der »bürgerliche Journalismus« kam zurück, der »Literaturbetrieb« auch, während nun Begriffe wie »Planwirtschaft« und »Volkseigentum« in ferne Vergangenheit sanken. Rudolf Herrnstadt war kein Parteifeind mehr, ja gar kein Feind, sondern ein Mann, der mehr Demokratie in der SED verlangt hatte – so war es in einem Buch zu lesen, das über ihn erschienen war.
Weitere zehn Jahre später war das nicht mehr so. Als sich der 17. Juni zum fünfzigsten Mal jährte, lief ein Film über ihn im Fernsehen: »Moskaus Kronprinz für die DDR«. Das war eine neue Form von Ulbrichts alter Behauptung, Herrnstadt habe im Auftrag der Sowjets Ulbricht ersetzen sollen.
Für die Sendung war dem Titel ein Fragezeichen angeheftet worden, eben weil es eine Behauptung war, und die Auftraggeber – und das waren Zeithistoriker – wussten es. Der Film zeigte immer wieder einen finsteren Mann, manchmal drohende Musik zu einem Foto, wie das halt so gemacht wird, wenn ein »Böser« erscheint, und ich hatte zu diesem Film beigetragen. Ich hatte der Regisseurin erzählt, was ich wusste, und sogar noch Leute in Moskau gefunden, die mit Herrnstadt zusammengearbeitet hatten. Gemeinsam waren wir dorthin gefahren, hatten einen greisen Spionageoffizier interviewt, und auf der Moskauer Hauptpost hatte ich per Einschreiben einen Brief an das Oberkommando der russischen Streitkräfte gesandt, mit der Bitte, mir Einblick in ihre Archive zu geben. Aber der Film, den die Regisseurin mir wie vereinbart im Rohschnitt vorgeführt hatte, war nicht der Film gewesen, der im Fernsehen gelaufen war, und hatte einen anderen Titel gehabt. Was dazwischen lag, war eine Veränderung durch die Auftraggeber. Das war eine klare Botschaft.
Die Geschichte wurde wieder einmal neu geschrieben, und was war schon ein kommunistischer Parteijournalist?
Ein Mensch ohne Individualität und eigene Meinung.
Ein Brief aus der Vergangenheit
Monate nachdem ich in der großen Moskauer Hauptpost meinen Antrag auf Einsicht in die Archive der Roten Armee per Einschreiben abgeschickt hatte, klingelte es in Berlin an meiner Tür. Ein Bote übergab mir ein Kuvert. Es enthielt einen freundlichen Brief aus dem Generalstab der Streitkräfte der Russischen Föderation. Eine Absage. Die Archive bleiben jedem verschlossen. Dazu ein ganzes Päckchen von Kopien.
Es waren Kopien von Zeitschriftenartikeln über die Arbeit des sowjetischen Nachrichtendienstes im Zweiten Weltkrieg aus den Jahren 1990 und 1995. Die Autoren waren die Generäle Pjotr Iwaschutin und Alexander Pawlow. Nichts Neues, so glaubte ich zuerst, aber dann doch, denn es lagen auch schreibmaschinenbeschriebene Blätter dabei, und der Schrifttyp kam mir bekannt vor. Es war die alte Remington portable, auf der mein Vater, solange ich ihn kannte, alles geschrieben hat.
Wir haben – so hieß es – einige Unterlagen herausgesucht, die Ihnen in Ihrer Arbeit weiterhelfen könnten. Ihr Vater trat dem Nachrichtendienst der Roten Armee im Jahr 1930 aus Überzeugung bei, und es folgte viel Lob für Mut und Bescheidenheit. Anderthalb Seiten.
Ich hielt zwei Briefe und einen Lebenslauf in der Hand. Mein Vater hatte geantwortet!
Lebenslauf.
Ich wurde am 18. März 1903 als Sohn des Rechtsanwalts Dr. Ludwig Herrnstadt in Gleiwitz im oberschlesischen Industriebezirk geboren. Mein Vater verdiente zu dieser Zeit monatlich etwa 1200 Mark, während der durchschnittliche Monatsverdienst eines oberschlesischen Industriearbeiters zwischen 80 und 150 Mark schwankte. Mein Vater gehörte zum jüdischen Sektor der gehobenen Bourgeoisie.
Väterlicherseits stamme ich aus einer Familie von Handwerkern und Fuhrleuten, die sich – in der Generation meines Großvaters – zu kleinen Kaufleuten entwickelten. Mütterlicherseits stamme ich aus einer reichen Kaufmannsfamilie, die bei der Ausbeutung des oberschlesischen Kohlenbeckens und der oberschlesischen Arbeiterschaft in den Jahren 1870 bis 1900 eine führende Rolle spielte. Die Familien meines Vaters und meiner Mutter verkehren bis heute nicht miteinander. Die Familie meiner Mutter sieht auf die meines Vaters herab. Die Familie meines Vaters verachtet die Familie meiner Mutter und beneidet sie zugleich.
Mein Vater war als Student (etwa 1894) in Berlin der Deutschen Sozialdemokratischen Partei beigetreten. Ich nehme an, dass seine Motive im Anfang ehrlich waren, später waren sie es nicht mehr […]
Vom Jahre 1912 bis zum Jahre 1921 besuchte ich das katholische (humanistische) Gymnasium in Gleiwitz. Ich lernte schlecht und uninteressiert, absolvierte es aber ohne Verzögerung. Im Frühjahr 1921 schickten mich meine Eltern zum Studium der Jurisprudenz nach Berlin, im Frühjahr 1922 nach Heidelberg. Oktober 1922 teilte ich meinen Eltern mit, dass ich das Studium nicht fortsetzen, sondern Schriftsteller werden wolle. Eine gewisse Fähigkeit, sich auszudrücken, verleitete mich zu der falschen Annahme, dass ich dichterische Talente besäße.
Als Antwort brachte mich mein Vater im Büro der »Oberschlesischen Zellstoffwerke« in Krappitz unter. Dort sollte ich lernen, um später im Rahmen des sogenannten »Hartmann-Konzerns«, dem diese Werke gehörten und zu dem mein Vater Beziehungen besaß, Industrieller zu werden. Von Herbst 1922 bis Herbst 1924 war ich in den »Oberschlesischen Zellstoffwerken« Lohnbuchhalter, Kassierer, Magazinverwalter und zum Schluss Sekretär der Direktion. Der enge Kontakt mit der Krappitzer Arbeiterschaft weckte mein Interesse für soziale Fragen. Da ich jedoch ohne jede theoretische Schulung war, blieb ich auf halbem Wege stecken. Ich betrachtete mich als Sozialist, nahm die Interessen der Arbeiterschaft gegen die Direktion wahr, verhöhnte den »Sozialismus« meines Vaters, zog aber keine weiteren Konsequenzen.
Im November 1924 verließ ich Krappitz und ging gegen den Willen meiner Eltern als »freier Schriftsteller« nach Berlin. Dort lebte ich von geringen Einkünften, die ich als Lektor eines dramatischen Verlages (Drei-Masken-Verlag) hatte, sowie von Unterstützungen meiner Eltern. Drei Jahre, vom Frühjahr 1925 bis Frühjahr 1928, vergeudete ich an dramatische Versuche. Ich war der Meinung, die neue, zeitgenössische Form des Dramas finden zu müssen. Als solche schwebte mir ein Drama vor, in dem nicht Individuen handeln, sondern Kollektive, in dem – mit den Mitteln der Schilderung von Einzelpersonen – der Prozess des Entstehens, Wirkens und Vergehens von Kollektiven gezeigt wird. Ich entsinne mich, einzelne Szenen bis zu 1100 Mal geschrieben zu haben, ohne das Ziel zu erreichen.
Inzwischen war ich Kommunist geworden, ohne dass ich sagen kann, durch welche besonderen Einflüsse. Ich weiß nur, dass meine Anteilnahme an der Arbeiterbewegung im gleichen Maße wuchs, in dem sich bei mir die Erkenntnis von der Hoffnungslosigkeit meiner dramatischen Versuche durchsetzte. Zweifellos hat das Studium theoretischer Schriften in dieser Zeit zu meiner [unleserlich] begriff ich damals noch nicht, dass es nicht genügt, kommunistisch zu wählen und in seinem Bekanntenkreise kommunistische Agitation zu treiben, sondern dass es nötig ist, sich zu organisieren.
Vom Frühjahr 1928 an war ich gezwungen, meinen Lebensunterhalt zur Gänze selbst zu verdienen. Ich suchte lange eine Stellung; schließendlich gelang es mir im Mai 1928, zur Arbeit im Berliner Tageblatt – zunächst als unbezahlter Hilfsredakteur – zugelassen zu werden. Von Juni 1928 an wurde ich als gelegentlicher Reporter nach Zeilen bezahlt, im Herbst 1928 als technischer (Umbruch-)Redakteur angestellt.
Das »linksdemokratische« Berliner Tageblatt war damals die einflussreichste bürgerliche Zeitung in Deutschland. Aus meiner Überzeugung brauchte ich keinen Hehl zu machen, da die Redaktion unter der Leitung von Theodor Wolff alle Überzeugungen so lange tolerierte, solange nicht der Verlag (Geldgeber) Einspruch erhob. Ich galt als »der Kommunist in der Redaktion«, aber man nahm das von der lächerlichen Seite, fragte mich, ob ich »durch die Beeinflussung von Notizen im Berliner Tageblatt die Weltrevolution beschleunigen wolle«, etc. Dadurch kam mir die Sinnlosigkeit meiner Lage, die mir im Geheimen schon lange ein Dorn im Auge war, immer deutlicher zu Bewusstsein.
Mein Entschluss, der Kommunistischen Partei beizutreten und die Arbeit im Bürgertum zu beenden, war die Folge einer Reihe von Zusammenstößen im Jahr 1929. Ich führe von diesen Zusammenstößen nur einen an, der mir am deutlichsten in Erinnerung blieb.
Als Antwort auf Forderungen der Arbeiterschaft legten die Ruhr-Industriellen – wenn ich nicht irre, im Mai 1929 – die Werke still und sperrten mehrere hunderttausend Mann aus. Zufällig fand ich, dass die geltende deutsche Verfassung einen Paragrafen enthält, demzufolge der Staat Industriebetriebe in eigene Verwaltung übernehmen kann, wenn die Industriellen erklären, dass sie selbst zur Weiterführung der Betriebe nicht imstande seien. Dieser Fall lag nunmehr vor. Am ersten Tage der Aussperrung erschien – gleichfalls zufällig – der frühere Reichsjustizminister Dr. Landsberg, der ein führendes Mitglied der SPD-Reichstagsfraktion war, in der Redaktion des Berliner Tageblatt, dessen Rechtsanwalt er war. Ich ließ mich bei ihm melden, zeigte ihm den Paragrafen der Verfassung und schlug ihm Folgendes vor: er solle mich autorisieren, im bürgerlichen Berliner Tageblatt mitzuteilen, dass die sozialdemokratische Reichstagsfraktion plane, von der Regierung die Anwendung dieses Paragrafen, also die zeitweise oder ständige Enteignung der Ruhrbetriebe, zu verlangen. Ich würde – mit oder ohne Einverständnis meiner Redaktion – diese Nachricht noch heute veröffentlichen und damit das Stichwort geben. Er solle dafür sorgen, dass der Vorwärts dieses Stichwort morgen aufgreife und dass die sozialdemokratische Fraktion tatsächlich diesen Antrag stelle. Durch die dann entfaltete Pressekampagne würde mindestens erreicht werden, dass die Unternehmer die Aussperrung schleunigst rückgängig machen. Landsberg sah mich an wie einen Halbirren und versprach schließlich nur, den »Gedanken der Vorwärts-Redaktion weiterzugeben«. Ich schrieb am gleichen Tag einen entsprechenden Bericht, der jedoch der Direktion des Verlages gleichzeitig hinterbracht wurde. Aber niemand – auch ich nicht – hatte daran gedacht, dass im gleichen Verlage noch andere Zeitungen erschienen, die die Korrekturabzüge der Berichte des Berliner Tageblatt regelmäßig zur Auswertung zugestellt erhielten. Eine dieser Zeitungen, die »Berliner Volkszeitung«, nahm meinen Bericht als Tatsache und veröffentlichte ihn noch am gleichen Tage über die ganze erste Seite. Die Wirkung war anders, als ich gehofft hatte. Am nächsten Tag fielen die bürgerlichen Blätter unter Überschriften wie: »Bolschewismus im Hause Mosse«, »Moskaus Hand in der Jerusalemer Straße« etc. über das Berliner Tageblatt her, – während der Vorwärts schwieg. Auch die sozialdemokratische Reichstagsfraktion rührte sich nicht, Landsberg war nirgendwo zu erreichen. Dagegen drohten die Unternehmerverbände dem Verlag mit der Entziehung der Inserate, sodass ich fristlos entlassen wurde. Wenige Tage später holte mich allerdings Theodor Wolff, der meine Ansichten nicht teilte, aber grundsätzlich auch nicht die des Verlages, erneut in die Redaktion.
Dieser Vorfall, sowie zahlreiche andere, dem Charakter nach ähnliche, überzeugten mich davon, dass Privataktionen lächerlich sind und dass ernsthafte Arbeit nur im Rahmen der Kommunistischen Partei geleistet werden kann. Meine Überzeugung wurde noch gefestigt durch eine Reise in die Sowjetunion, die ich im Rahmen des »Bundes der Freunde der Sowjetunion« im Oktober 1929 unternahm.
Außer mir waren zu dieser Zeit noch zwei Mitglieder der Redaktion des Berliner Tageblatt entschlossen, der Kommunistischen Partei beizutreten, der Redakteur P. A. Otte und die Sekretärin Theodor Wolffs, Ilse Stöbe (Alta). Als ihr Sprecher ging ich am 21. November 1929, zusammen mit P. A. Otte, ins Karl-Liebknecht-Haus, wo uns der damalige kommunistische Landtagsabgeordnete Gohlke empfing. Ich bat ihn, uns drei in die Partei aufzunehmen und darüber zu entscheiden, wo und in welcher Weise wir für die Partei arbeiten sollen. Gohlke erwiderte: »Wir können Sie sofort in die Partei aufnehmen und einer Zelle zuteilen wie jeden anderen, der um die Aufnahme ersucht. Aber ich bitte Sie, nicht auf der sofortigen Aufnahme zu bestehen. Sie können für uns nützlicher sein, wenn Sie keiner Zelle zugeteilt werden. Darüber gebe ich Ihnen Bescheid, sobald ich mit unserer politischen Instanz gesprochen habe.«
Auf den Bescheid Gohlkes warteten wir vergebens. Nach Wochen, etwa im Februar also, ging ich Gohlke im Liebknecht-Haus suchen, fand aber nur uninformierte Funktionäre. Inzwischen wurde ich – als Strafe – zum 1. April 1930 als Korrespondent der Zeitung in die Provinzstadt Breslau versetzt. Ich beschloss also [unleserlich] und mich an meinem neuen Aufenthaltsort an die dortige Parteiorganisation zu wenden. Im Mai 1930 wurde auf Betreiben Theodor Wolffs die Versetzung nach Breslau rückgängig gemacht, stattdessen wurde ich zum 15. Juni als Korrespondent nach Prag versetzt. Ich beschloss also, in Prag die dortige Parteiorganisation um Aufnahme zu ersuchen.
Am 18. Juni 1930 trug ich im Zentralgebäude der KPČ dem damaligen Chefredakteur der Rudé Právo meinen Wunsch vor. Er erwiderte fast mit den gleichen Worten, die mir Gohlke gesagt hatte. Ich musste also wieder warten. Als mir das ewige Warten unheimlich wurde, fuhr ich nach Berlin, suchte den damaligen Reichstagsabgeordneten Münzenberg in seiner Wohnung auf und erzählte ihm meine vergeblichen Versuche, in die Partei aufgenommen zu werden, und bat ihn um eine Intervention. Münzenberg versprach, für meine Aufnahme in die Partei zu sorgen, und bot mir außerdem eine Stellung als Redakteur an einer der von ihm geleiteten kommunistischen Zeitungen an. Ich nahm die Stellung an und fuhr nach Prag zurück, um dort meine Tätigkeit als bürgerlicher Korrespondent zu liquidieren.
Unmittelbar nach meiner Rückkunft besuchte mich ein Funktionär der KPČ, Ludwig Freund. Er teilte mir mit, dass ihn der Chefredakteur der Rudé Právo, der in der Zwischenzeit verhaftet gewesen sei, beauftragt habe, sich über meine Person zu orientieren. Ich erwiderte ihm, das sei bereits nicht mehr nötig, und erzählte ihm von meinem Besuch bei Münzenberg und meinem Übergang in die kommunistische Presse. Ludwig Freund erwiderte, er halte diese Lösung nicht nur für falsch, sondern für unzulässig. Ich müsse beim Berliner Tageblatt bleiben, um diese Stellung für die Partei auszunutzen. Er habe zufällig einen Bekannten in Prag, der mich an die einzig richtige Stelle weiterleiten werde. Auf die Frage, ob ich bereit sei, die Verbindung zu Münzenberg rückgängig zu machen, erwiderte ich: »Wenn Sie dafür garantieren, dass ich auch auf dem von Ihnen vorgeschlagenen Wege sofort in die Partei aufgenommen werde – ja.« Er garantierte dafür und machte mich mit einem Mann bekannt, der sich Albert nannte. Albert war der erste Funktionär der 5. Uprawlenje, den ich kennenlernte.
Albert gab mich an seinen Chef weiter, der damals in Wien saß. Der Wiener Chef gab mich an den Berliner Chef weiter, unter dem Berliner Chef begann ich die Arbeit.
Inzwischen war ich zum 1. Januar 1931 als Korrespondent des Berliner Tageblatt nach Warschau versetzt worden. Dort war ich – abgesehen von einer dreimonatlichen Entsendung als Korrespondent nach Moskau im Sommer 1933 – bis zum August 1939 tätig. Von 1931 bis 1936 arbeitete ich als Warschauer Korrespondent des Berliner Tageblatt; nach meiner durch die deutsche Judengesetzgebung erzwungenen Entlassung arbeitete ich von 1936 bis 1938 als zweiter Warschauer Korrespondent der tschechoslowakischen Regierungsagentur »Radio Central«; nach der Liquidierung der Tschechoslowakei arbeitete ich als gelegentlicher Warschauer Mitarbeiter schweizerischer und französischer Zeitschriften. Meine journalistische Arbeit wurde von 1936 ab immer mehr eine Fiktion, die Aufrechterhaltung dieser Fiktion immer schwieriger.
Meine tatsächliche Beschäftigung in Warschau ist der 5. Uprawlenje bekannt.
Für
Genosse Oberleutnant,
ich erhalte soeben einen Brief, in dem Alta mir mitteilt, dass und warum sie die Uprawlenje gebeten hat, für die nächsten Monate – bei voller Aufrechterhaltung der Arbeit für uns – von Berlin in die deutsche Stadt Eger übersiedeln zu dürfen, und in dem sie mich bittet, diesen ihren Wunsch zu unterstützen.
Mir ist nicht bekannt, ob die Uprawlenje hierüber bereits eine Entscheidung gefällt hat.
Ich möchte aber diesen Wunsch mit ganzer Kraft und Dringlichkeit unterstützen, und zwar aus folgenden Gründen, die Alta in ihrem Brief an mich ungenierter und vollständiger zum Ausdruck bringt, als sie es gegenüber unserem Mann in Berlin getan hat:
1. Alta hat ihre Stellung zum 1. Januar verloren. In Eger bietet sich ihr eine Stellung, die erstens als Deckmantel für unsere Arbeit geeignet ist, zweitens die nominelle Fortführung des journalistischen Berufes und der aus ihm für uns entspringenden Vorteile sicherstellt.
2. Der Gesundheitszustand Altas ist leider so schlecht, dass sie dem ärztlichen Befunde nach während der Wintermonate überhaupt aufhören musste zu arbeiten. Sie sollte stattdessen in dem – wenige Minuten von Eger gelegenen – Orte Franzensbad in dauernder Behandlung sein. Die Stellung in Eger ist die einzige Möglichkeit, die ärztliche Behandlung – wenigstens zu einem beträchtlichen Teil – fortzusetzen und gleichzeitig unsere Arbeit nicht zu unterbrechen.
3. Außer der Arbeit, die Alta von Eger aus ungeschmälert fortsetzen wird – sie wird jeweils nach drei Wochen acht Tage lang in Berlin sein –, bieten sich ihr in Eger und dem nahegelegenen Protektorat gewisse Werbemöglichkeiten, über die ich ihr direkt schreiben werde.
Angesichts der Person Altas kann nicht bezweifelt werden, dass dieser Vorschlag das Maximum dessen ist, was Alta bis zur Wiederherstellung ihrer Gesundheit machen kann. Die Gefahr wird – auch nach einer Übersiedlung Altas nach Eger – nicht darin bestehen, dass Alta notwendige Dinge unterlässt, sondern umgekehrt darin, dass sie – auf Kosten ihrer weiteren Einsatzfähigkeit – ihre Kräfte überanstrengt.
Da die Zeit eilt – der 1.1.41 steht schon bevor –, bitte ich Sie, Genosse Oberleutnant, Alta telegrafisch die Zustimmung zur Annahme der neuen Stellung in Eger zu geben, wenn nicht etwa inzwischen schon eine entsprechende Mitteilung ergangen sein sollte.
Zugleich möchte ich Ihnen für die Bemühungen danken, die im Oktober dazu führten, dass sich Alta doch noch nach Franzensbad begeben konnte.
Arbin
24.12.40
Liebe Eltern,