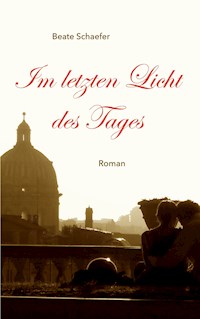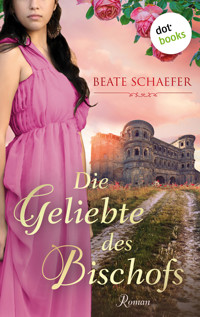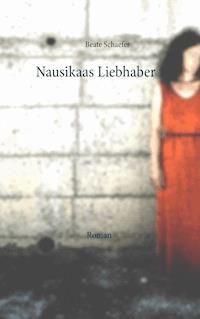Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Elise und Walter. Ein Liebespaar. Ein Elternpaar. Kein Ehepaar, und ohne bürgerliche Moral. Für die Nationalsozialisten waren die Prostituierte und ihr Zuhälter "Asoziale", "unwertes Leben", das es zu vernichten galt. Meine Großmutter Elise wurde zur Arbeit in einem Straßburger Wehrmachtsbordell gezwungen, mein Großvater Walter ins KZ-Dachau gebracht und 1942 in der Tötungsanstalt Hartheim ermordet. Während der NS-Staat im Krieg zum größten Zuhälter wurde, brachte er meinen Großvater für dieselbe Betätigung um. Das Schweigen meiner Eltern war das große Schweigen der Fünfziger- und Sechzigerjahre. Leute wie Walter, so die Überzeugung, seien völlig zu Recht im KZ gewesen, denn es waren ja "schlechte Menschen", deren Nachkommen sich für sie schämen mussten. Im Zuge meiner Recherchen wurde mir klar, dass diese von den Nazis verfolgten "Asozialen" zehntausende gewesen waren. Sie wurden nach dem Krieg von den "unwürdigen" zu den vergessenen Opfern. Die Originalversion von "Weiße Nelken für Elise" erschien 2013 im Verlag Herder, Freiburg. Für die vorliegende Taschenbuchausgabe wurde der Text von der Autorin überarbeitet und durch ein Nachwort des renommierten Publizisten Erik-Michael Bader ergänzt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 291
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Familiengeheimnis
Reise in die Erinnerung
1. Gummerland
2. Neuland
3. Brachland
4. Kinderland
5. Landnahme
6. Landei
7. Vaterland
8. Freudenland
9. StadtLandPuff
10. Landflucht
11. Landsknechte
12. Ohneland
13. Geisterland
14. Pommerland
15. Niemandsland
16. Autoland
Nachwort
Dank
Literaturverzeichnis
Autoreninfo
Familiengeheimnis
Ich war etwa zehn oder elf Jahre alt, als ich zum ersten Mal davon hörte. Die Erwachsenen – meine Eltern, meine Großtante Anna und ihr Mann sowie meine gastgebende Großmutter Elise und meine fast neunzigjährige Uroma Elisabetha – saßen im Wohnzimmer am für diese Gelegenheit ausgezogenen Esstisch und spielten nach einer üppigen Mahlzeit Kanasta. Dazu tranken sie Aquavit und rauchten, mein Vater Zigarre, die anderen, außer meiner Uroma, Zigaretten. Ich lag unterhalb der Rauchschwaden bäuchlings auf dem Teppich neben der riesigen mahagonifarbenen Schrankwand, in deren offenem Teil sich außer einem gusseisernen Schankgestell für eine Weinflasche, einem massiven gläsernen Esel, von dem ich damals noch nicht wissen konnte, dass er venezianischen Ursprungs war, und einer Reihe bunter, geschliffener Weingläser mit langen Stielen nur ein paar Bücher befanden, darunter zwei große, leinengebundene Bildbände über „Tiere der Urzeit“ und „Menschen der Vorzeit“. „Tiere der Urzeit“ mit den magischen Unterwasserlandschaften des Kambrischen Meeres, den Steinkohlenurwäldern und den Dinosauriern des Mesozoikums mochte ich lieber als das Buch über die Vormenschen. Ich war zwar gern bereit zu glauben, dass die Vorfahren jenes Araberhengstes, der zu Hause das Titelblatt meines Pferdekalenders zierte, hasengroße Sumpfbewohner gewesen waren. Was ich seit Neuestem ablehnte, war meine Abstammung vom Affen, seitdem mir der Chefgorilla im Frankfurter Zoo kürzlich direkt vor die Füße gekotzt hatte. Zwar trennte uns eine Panzerglasscheibe, aber ich war nach diesem Erlebnis keine Affenfreundin mehr, und wenn ich dann doch einmal im zweiten Bildband blätterte, grübelte ich darüber nach, weshalb es eigentlich heute noch Menschenaffen gab, während ich Eohippus, Mesohippus und Merychippus, die Vorfahren des Pferdes, nurmehr als Fossilien aus dem Frankfurter Senckenberg-Museum kannte. Die da oben am Tisch zu befragen, hätte nichts gebracht, denn mir war irgendwie klar, dass weder meine Omas noch die Großtante jemals einen Blick in diese Bücher getan hatten. Und meine Eltern fanden, dass ich sowieso viel zu viel nachdenken würde; sie hätten mich wahrscheinlich einfach rausgeschickt, „damit du mal an die frische Luft kommst“. Also rührte ich mich nicht und kehrte zurück zu Ramporhynchus und Brontosaurus, während oben am Tisch die Frauen bei den Witzen, die mein Großonkel erzählte, kreischend auflachten und Schnaps kippten, bis irgendeiner die letzten Karten auf den Tisch knallte und „Kanasta“ rief. Dann wurde das Blatt neu gemischt, und es ging wieder von vorne los. Von den Gesprächen, die geführt wurden, bekam ich nicht viel mit, sie interessierten mich auch nicht weiter. Bis an diesem Nachmittag die Worte fielen „mein Geschäft in Straßburg“. Ich wurde aufmerksam und löste den Blick von einem Meeressaurier, der dabei war, ein paar gepanzerte Fische zu jagen. Meine Großmutter hatte ein Geschäft in Straßburg gehabt? Ich wusste, dass Straßburg in Frankreich lag, wir waren im vergangenen Sommer dort gewesen, auf dem Weg nach Süden. Straßburg, Frankreich, Ausland, das fand ich spannend und ich lauschte aufmerksam, doch viel zu schnell wandte sich die Unterhaltung anderen Themen zu. Danach habe ich von diesem „Geschäft“ bei ähnlichen Gelegenheiten immer mal wieder gehört, doch eine gewisse Scheu, die mir von meinen Eltern meiner Großmutter gegenüber eingepflanzt worden war, hielt mich davon ab, Oma Elise einfach danach zu fragen.
Ein Mensch, für den ich mich in dieser Zeit mehr und mehr zu interessieren begann, war unbekannterweise mein Großvater Walter. Ich ließ nicht nach zu bohren, warum mein Papa nicht Samstag hieß wie sein Vater. Den Nachnamen Schäfer fand ich doof, ich hätte viel lieber Beate Samstag geheißen. Was mich auch verwirrte, war, dass Oma Elise weder Schäfer noch Samstag hieß, sondern Reger. Wer aber war Herr Reger gewesen, und wo war Walter Samstag? Man sagte mir nur, dass Walter meine Oma sitzengelassen hatte, als sie schwanger geworden war, und dass er schon lange tot sei.
Erst viel, viel später kapierte ich die Zusammenhänge: Meine Großmutter trug den Namen ihres Mannes Willi Reger, von dem sie aber geschieden war. Mein Vater trug ihren Mädchennamen, Schäfer, beziehungsweise den seines Großvaters, unter dessen Vormundschaft er aufgewachsen war. Aber als Kind waren mir diese Einzelheiten verborgen. Alles, was ich wusste, war also, dass Opa tot und dass Papa unehelich geboren war, und meine Großtante Anna, eine kleine, immer noch hübsche, blondierte Frau, die zeitlebens Stöckelschuhe mit zwölf Zentimetern Absatz trug und sie mich, solange meine Schuhgröße noch 36 betrug, manchmal anprobieren ließ, sagte einmal zu mir: „Dein Vater, das war unser kleines Bankertchen.“ Dabei strich sie mir über den Kopf und lachte ihr raues Zigarettenlachen.
Meine Eltern wollten, nachdem sie mich mit diesen Informationen versorgt hatten, nicht weiter darüber reden, ich aber war neugierig, wie alle Kinder, die spüren, dass es ein Familiengeheimnis gibt. Ganz abgesehen davon, dass ich in diesem Alter anfing, die Vorstellung zu genießen, vielleicht gar nicht die Tochter meiner Eltern zu sein. Ich wäre zu gern ein Adoptivkind gewesen und versuchte oft, meiner Mutter ein „Geständnis“ zu entlocken. Wenn ich nicht gerade davon träumte, eine Waise zu sein, fragte ich nach meinem Großvater. Wie hatte er ausgesehen? Warum hatte er Oma nicht geheiratet? Wieso war er so früh gestorben? Kinderfragen, die ohne Antwort blieben, obwohl wir ebenso regelmäßig, wie wir jeden Monat meine Großmutter und Urgroßmutter im Taunus besuchten, zu Walters uralter Mutter nach Mannheim fuhren. Doch niemand sprach in meiner Gegenwart jemals ausführlicher über ihn, ja, es kam kaum vor, dass einmal beiläufig sein Name fiel. Ein Foto von ihm konnte ich nirgendwo entdecken, weder in den alten Fotoalben bei Uroma noch in der kleinen „Ahnengalerie“ – gerahmten Schwarzweißfotos der Familienmitglieder dreier Generationen im Schlafzimmer meiner Eltern. Nervte ich zu sehr, hieß es: Der ist im Krieg umgekommen. Oder: Der ist an der Front erschossen worden. Als man mich wohl irgendwann für reif genug hielt, erfuhr ich schließlich: „Der Walter, das war ein schlechter Mensch. Der ist ins KZ Dachau gekommen und dort gestorben.“
Das muss für mich offenbar völlig plausibel geklungen haben, denn ich war mit dieser Information zufrieden und dachte danach jahrelang nicht mehr an meinen Großvater. Bis zu jenem Tag, vielleicht einem faulen Sonntag im Bett, vielleicht einem von ledrig duftenden Platanenblättern erfüllten Herbstnachmittag am Main, an dem ich mich, mittlerweile Anfang zwanzig, plötzlich an diese zwei Sätze erinnerte und mit einem Mal begriff, was sie eigentlich bedeuteten, wie menschenverachtend dieser Unsinn war, der mir da aufgetischt worden war. Denn kein Mensch war zu Recht im KZ gewesen. Ich schämte mich für meine Dummheit und begann zu dieser Zeit mit den ersten, zaghaften Recherchen.
Meine Scheu vor Elise war längst verflogen Im Gegensatz zu meinen Eltern mochte ich ihre Exaltiertheit, ihre schicken Kostüme in Weiß, Marineblau, in Hahnentrittmuster oder rosa-meliertem Bouclé, ihr intensives Parfüm, ihr zu lautes Lachen in Aufmerksamkeit heischenden Koloraturen, ihr dramatisch rollendes R, wenn sie erzählte – was sie gerne tat – immer mit großen Gesten und immer auf die Pointe bedacht. Als ich mit achtzehn von zu Hause auszog, suchte ich häufiger den Kontakt zu ihr. Sie war nach dem Tod meiner Urgroßmutter in eine kleine Hochhauswohnung im Nachbarkaff gezogen, und meine Eltern forderten mich auf, mich ein wenig um sie zu kümmern. Ich fand bald heraus, dass ich mich prima mit ihr gegen meine Eltern solidarisieren konnte. Sie hatte in allem andere Ansichten, als ich es von zu Hause gewohnt war, vor allem, was den Umgang mit Männern betraf. „Mir kommt keiner mehr ins Haus“, sagte sie oft. „Keinem wasch ich mehr die dreckigen Unterhosen.“ Aber sie erklärte mir, dass man als Frau immer eine Flasche Sekt im Kühlschrank haben müsse, und wenn der Postbote kam, bat sie ihn herein und trank morgens um elf mit ihm einen Schnaps. Faszinierend. Wenn meine Eltern sie kritisierten, nahm ich regelmäßig Partei für sie. Da ich ein Auto hatte, holte ich sie manchmal ab, fuhr mit ihr nach Frankfurt, ging mit ihr ins Café und stellte bald fest, wie viel sie mir über die Stadt erzählen konnte, in der ich immerhin geboren, wenn auch nicht aufgewachsen war, und in der ich jetzt studierte. Sie berichtete mir über ihre Kindheit in der Frankfurter Altstadt, vom Baden bei Mosler, von den Naziaufmärschen auf der Zeil, von ihrer Lehre als Friseuse, von ihrer kurzen Ehe mit dem Metzgergesellen Willi Reger, sie erwähnte auch ihr Geschäft in Straßburg, von wo sie während des Krieges regelmäßig Geld an ihre Eltern schickte, die ihr Kind aufzogen. Sie berichtete vom Leben in der Baracke bei Steinau, ausgebombt nach dem Krieg, von ihrer Arbeit in der Fabrik, von ihrer Liaison mit dem Fabrikbesitzer, von dem Geld, das sie verdienen musste, um ihren Sohn aufs Internat und aufs Gymnasium schicken zu können.
Wir freundeten uns also regelrecht an, und da ich zunächst Slawistik und Soziologie belegt hatte, kam Oma irgendwann auf die Idee, eine Silvesterreise in die Sowjetunion zu buchen. Ich war begeistert, und so flogen wir mit HapagLloyd und Aeroflot im harten Winter 1983, mitten in der letzten Phase der Aufrüstung, zusammen mit einer Reisegruppe nach Moskau, wohnten im Hotel Rossija, fuhren für ein paar Kopeken U-Bahn, gingen, ohne uns ums Programm zu kümmern, allein in die Tretjakow-Galerie, und fuhren schließlich mit dem Reisebus durch endlose, birkenbestandene Schneelandschaften in die alten Königs- und Klosterstädte Susdal, Wladimir und Sagorsk, um Silvester zu feiern.
Ich wollte ursprünglich Journalistin werden, jobbte aber nur als Redaktionsbotin und später als Redaktionsassistentin bei der FAZ. Eine Freundin, die Geschichte studierte und bereits am Historischen Museum Praktika machte, infizierte mich mit Neugier für das Schicksal der Frankfurter Altstadt. Zusammen mit Omas Erzählungen von Alt-Frankfurt weckte das mein historisches Interesse immer mehr. Als Elise und ich aus Moskau zurückkamen, bat ich sie um ein Tonband-Interview. Über mehrere Wochen verteilt, trafen wir uns, und ich zeichnete die Gespräche mit meinem alten Kassettenrekorder auf. Irgendwann fasste ich mir ein Herz und stellte endlich die Frage: „Sag mal, Oma, dein Geschäft in Straßburg, was war das eigentlich für ein Laden?“
„Ein Bordell“, kam die prompte, wenn auch etwas indignierte Antwort, als werfe sie mir vor, dass ich es nicht längst gewusst hatte. Und dann: „Jetzt bist du schockiert, nicht wahr?“ Natürlich beteuerte ich sofort, ich sei keineswegs schockiert. Peinliches Schweigen. Dann begann ich zu erklären, wie liberal ich sei und dass ich durch meine Lektüre mit allem Menschlich, allzu Menschlichem vertraut sei, kurz, ich beleidigte sie, indem ich behauptete, Verständnis für etwas zu haben, von dem ich überhaupt keine Vorstellung besaß. Ich war, das erkenne ich im Nachhinein, eine miserable Interviewerin, verklemmt, geradezu aufdringlich rücksichtsvoll, und behauptete dann wider alle Neugier, wider allen Respekt, dass ich mich ja viel mehr für ihre Kindheit in der Frankfurter Altstadt interessieren würde. „Nun ja“, sagte meine Oma fast enttäuscht, und es folgte eine weitere Anekdote. Aber da die Wahrheit nun einmal auf dem Tisch war, ließ sie es sich nicht nehmen, mir im Verlauf unserer Sitzungen mehr von ihrer Karriere als Prostituierte zu erzählen. Krampfhaft versuchte ich immer, so wenig Neugier wie möglich zu zeigen, anstatt ihrem offensichtlichen Bedürfnis gerecht zu werden, einmal frei von der Leber weg berichten zu dürfen. Sie war voller Selbstbewusstsein und Stolz auf ihre Kunst, mit Sexarbeit viel Geld zu verdienen. Anscheinend hatten in unserer Familie alle darüber Bescheid gewusst, nur vor den Kindern und natürlich vor der Außenwelt hatte man es streng geheim gehalten. Langsam begriff ich, weshalb das Verhältnis meines Vaters zu ihr so gespannt war. Er konnte sich kaum eine halbe Stunde in ihrer Gegenwart aufhalten, ohne zu explodieren. Das nahm manchmal grotesk-komische Züge an, wie bei einem Weihnachtsfest Mitte der Achtziger Jahre. Wir saßen nach dem Abendessen alle am Tisch – meine Eltern, mein Bruder, Oma Elise und ich. Mein Vater war gereizt, meine Mutter redete unaufhörlich, ich war gestresst, und irgendwann, als es um den Nachtisch ging, sagte Oma: „Ich möchte jetzt gern nach Hause“. Es gab ein kurzes Für und Wider, meine Mutter schlug vor, erst Eis zu essen, aber Elise beharrte auf ihrem Wunsch. Da sprang mein Vater auf, schrie: „Schluss! Aus! Beate, du fährst sie sofort nach Hause!“ Und mit Schwung wandte er sich dem schweren, breiten Vorhang zu, der das riesige Wohnzimmer von der Diele trennte, packte ihn, und riss ihn mit einem einzigen, mächtigen Ruck herunter. „Und das Ding hier konnte ich noch nie leiden!“, brüllte er und stand dann, den gesamten Vorhang in den Händen, da. Nach ein paar Sekunden erschrockenen Schweigens begann ich zu lachen, und auch meine Mutter lachte. Oma hingegen zitterte am ganzen Körper. Ich sagte: „Genial, wie im Theater.“ Da musste auch mein Vater grinsen. Oma wurde trotzdem heimgebracht. Sie war fix und fertig. Was ich damals noch nicht wissen konnte: Im Gegensatz zu mir und meiner Mutter hatte sie von Männern oft genug massive körperliche Gewalt erfahren. Mein Vater erschreckte mich mit seinen Ausbrüchen zwar, aber ich hatte keine richtige Angst vor ihm, weil ich wusste, dass er, sobald er Dampf abgelassen hatte, der freundlichste Mensch war. Doch für meine Großmutter muss dieser Moment schrecklich gewesen sein.
Mit diesen Lebenserfahrungen hing vielleicht auch zusammen, dass sie unsere Interviews, obwohl sie so gern von früher erzählte und bereit war, auch sehr frei über ihre Arbeit als Prostituierte zu sprechen, nicht verkraftete. Eines Tages – wir saßen am Küchentisch in meiner Studentenbude, und der alte Kassettenrekorder lief – erzählte sie mir von den Albträumen, die sie heimsuchten, seit sie begonnen hatte, mir ihr aus ihrem Leben zu berichten. Sie konnte nicht schlafen, war nervös und gereizt. „Ich kann dir das gar nicht so hart erzählen, wie ich das erlebt habe“, sagte sie einmal fast resigniert. Bald darauf brachen wir die Interviews ab. Heute wünschte ich, ich hätte nicht so schnell aufgegeben. Ein guter Journalist hätte gewusst, wie er sie bei der Stange hielt. Professionell und ein bisschen brutal. Aber ich hatte damals überhaupt nicht begriffen, worauf ich mich eigentlich eingelassen hatte, indem ich begann, in der Vergangenheit zu wühlen und gegen die Mauer des Schweigens, mit der sich meine Eltern mir und allen Außenstehenden gegenüber umgaben, zu klopfen.
Als 1987 ein Telefonanruf kam, in dem ein Kollege an der Klinik meinem Vater mitteilte, dass seine Mutter nach einer Gallenoperation unvermutet gestorben war, zitterte er am ganzen Körper. Nach der Beerdigung erwähnte er sie mir gegenüber nie wieder auch nur mit einer Silbe. In unserer Familie gab es ein neues Tabu, und das hieß: „Du sollst nicht über Elise reden. Es regt deinen Vater auf. Es verletzt ihn.“ Mir wurde klar, dass er jetzt auch seine Mutter endlich vergessen wollte, nachdem er schon seinen Vater jahrzehntelang totgeschwiegen hatte, um sich vor seinen Erinnerungen, vor seinen Sehnsüchten, seiner Wut und seiner Verlorenheit zu schützen.
Seit einigen Jahren beginnen Kriegskinder über ihre traumatischen Erlebnisse zu reden. Bücher erscheinen, in denen sich eine ganze Generation wiederfindet. Und auch die Enkel fangen an zu reden. So wie ich. Über Ängste, die sie sich jahrzehntelang nicht erklären konnten, über seltsame Albträume, über das Gefühl der Sinnlosigkeit und des eigenen Versagens, obwohl dafür von außen gesehen überhaupt kein Grund vorhanden wäre. Wohlstand, Bildung, Sicherheit allerorten. Meine Grundstimmung war, so weit ich zurückdenken kann, eine Art Basiskummer. Der bestand aus den Gefühlen Trauer, Einsamkeit, Angst und Scham. Dabei hatte ich liebevolle Eltern, die sich bemühten, mich (fast) ohne Schläge zu Freiheit und Selbstbestimmtheit zu erziehen, in meiner Familie wurde viel gelacht und gesungen und diskutiert, und ich wuchs in materieller Sicherheit, später nahezu im Luxus auf. Doch erst seit ich Bücher wie die von Sabine Bode, Anne-Ev Ustorf und Bettina Alberti kenne, fühle ich mich ernst genommen in der Ambivalenz meines Daseins, meinem Zerrissensein zwischen Lebenslust, Mut, Freude und dem oben beschriebenen Abgrund.
Es dauerte lange, sehr lange, bis ich meiner inneren Stimme folgte und begann, die Geschichte meiner Großeltern umfassend zu recherchieren. Ich wollte nicht mehr schweigen, entschloss mich zu einer Reise in die Erinnerung, forschte in Archiven und vor Ort, hörte mir die alten Kassetten mit den Interviews wieder an, und hatte unvermutet eine Menge Material angesammelt, das den Blick auf meine Großeltern, aber auch auf meine Eltern und auf mich veränderte.
Elise und Walter. Ein Liebespaar. Ein Elternpaar. Kein Ehepaar, und ohne bürgerliche Moral. Für den Aufbau des „tausendjährigen Reichs“ waren die Prostituierte und ihr Zuhälter nach Meinung der Faschisten unbrauchbar, und das von den Nazis bevorzugte Wort für Menschen wie sie war „asozial“ oder „antisozial“. Sie waren „Volksschädlinge“, „Gemeinschaftsfremde“, „unwertes Leben“ und somit ehrlos, rechtlos, sie wurden verwaltet, eingesperrt, und womöglich vernichtet. Wenn es nach den Nationalsozialisten gegangen wäre, gäbe es mich überhaupt nicht. Sittenlosigkeit und Verbrechertum galt als vererbbar. Mein Vater kam unter die Vormundschaft seiner Großeltern Elisabetha und Johann, weil mehrmals die Leute von der Fürsorge an der Tür geklingelt hatten. Sie wollten wissen, wer ihn gezeugt hatte, doch meine Großmutter schwieg eisern. Dass sie Hure war, war aktenkundig. Hätten sie die Wahrheit über den Vater des Kindes erfahren und das Vorstrafenregister von Walter Samstag gesehen, wäre der kleine Junge ins Heim gekommen, und wer weiß, was ihm sonst noch widerfahren wäre. Das Bordell in Straßburg, fand ich heraus, war eine Wehrmachtseinrichtung für die Soldaten der Besatzungsarmee gewesen – meine Großmutter war zur Arbeit dort gezwungen worden. Und mein Großvater trug im KZ den grünen Winkel der „Berufsverbrecher“.
Das Schweigen meiner Eltern war das große Schweigen der Fünfziger und Sechziger Jahre, in denen der Satz zum Standard gehörte, Leute wie mein Großvater seien völlig zu Recht im KZ gewesen, denn es waren ja „schlechte Menschen“, deren Nachkommen sich für sie schämen mussten. Über „diese Leute“ sprach man nicht, und „diese Leute“ – auch das ein Ergebnis meiner Recherchen – waren viele. Ihre Geschichten wurden in den von den Nazis gleichgeschalteten Tageszeitungen zur Abschreckung genüsslich ausgemalt. „So einer“ wie mein Großvater musste weg, gehörte in „Vorbeugungshaft“ – jedenfalls dachte die Mehrheit der Bevölkerung so –, und dass „Invorbeugungshaftnahme“ gleichbedeutend war mit der Einlieferung in ein KZ, nahm man gleichmütig zur Kenntnis.
Auch die Frauen in den Wehrmachtsbordellen und die Zwangsprostituierten der Konzentrationslager sahen nach dem Ende der Naziherrschaft, so sie überlebt hatten, zu, dass niemand von ihrer „Schande“ erfuhr, wobei das unbeschreibliche Elend der Frauen, die im KZ zur Prostitution gezwungen wurden, mit dem vergleichsweise „normalen“ Hurenleben in den staatlichen Soldatenpuffs gar nicht zu vergleichen ist. Auf die Idee, Entschädigungsansprüche zu stellen, kamen die Wenigsten. Das galt für die ehemals „Sicherungsverwahrten“ und „Asozialen“ ebenso. Sie wurden von den „unwürdigen“ zu den „vergessenen“ Opfern. Erst in jüngster Zeit beschäftigt sich die Forschung vermehrt mit dieser Verfolgtengruppe. Autobiografische Aufzeichnungen gibt es nur in ganz geringem Umfang und zumeist anonymisiert. Interviews mit heute noch lebenden Personen sind rar.
Meine Großeltern – das wurde mir irgendwann klar – waren keine Einzelfälle. Die Scham meiner Eltern ist die Scham in vielen anderen deutschen Familien. Das große Schweigen ist überall. Die Archivare, die mir bei der Recherche geholfen haben, erzählten, dass immer wieder Nachkommen ehemaliger KZ-Häftlinge zu ihnen kommen, um etwas über die Gründe der „Invorbeugungshaftnahme“ ihrer Angehörigen zu erfahren. Viele haben den Internationalen Suchdienst in Arolsen angeschrieben und, wie auch ich, ein Blatt bekommen, auf dem die Personalien des KZ-Häftlings, seine Häftlingsnummer, und der Hinweis „PSV“ – Polizeiliche Sicherungsverwahrung – zu lesen sind. Ins Archiv kommen dann Sohn, Bruder, Tochter, Schwester, Enkel oder Enkelin, in der Hoffnung, herauszufinden, dass es sich damals um die Verhaftung eines Unschuldigen gehandelt habe. Heute noch spielt es offenbar eine Rolle, ob jemand „zu Recht“ oder „zu Unrecht“ ins KZ gekommen ist. In all diesen Familien wurde jahrzehntelang geschwiegen, geleugnet, vertuscht, und man glaubt, das große Schweigen nur brechen zu dürfen, wenn es sich herausstellt, dass Opa oder Vater „ja gar nichts gemacht“ hat und damit ein „würdiges Opfer“ war. So wirkt die Ausgrenzungspolitik der Nazis noch bis in die Enkelgeneration fort, wenn wir nicht endlich anfangen, auch die ganz persönlichen Geschichten der verachteten, vergessenen und verdrängten Opfer zu erzählen. Opfer, die nie eine Lobby hatten, weil sie auch heute noch zu den Menschen am Rand der Gesellschaft zählen würden. Das schäbige Wort „asozial“, das die Nazis so gern verwendeten, um zwischen „guten Deutschen“ und „Gemeinschaftsfremden“ zu unterscheiden, hat auch heute noch Konjunktur – wir benutzen es gedankenlos und oft.
Während meiner Arbeit begriff ich schließlich auch noch etwas anderes: Dass ich, wenn ich die Geschichte von Elise und Walter aufschreiben wollte, auch von mir sprechen musste. Von dem Kind, das ich gewesen war, von der Erwachsenen, die beim Schreiben das Gefühl nicht loswerden würde, eine Verräterin zu sein. Elise war schon als Kind selbstbewusst. Nach dem Krieg war sie eine Frau, die ohne Umschweife „ich“ sagte, immer an ihren Vorteil dachte, oft über Geld redete, sich in Szene zu setzen, sich „zu zeigen“ wusste. Alles Verhaltensweisen, die auch heute noch in unserer Gesellschaft von Männern erwartet, bei Frauen aber als indezent verurteilt werden. So eine Frau ist unbequem, sie fällt auf, sie macht Patzer. Wenn Oma Alkohol getrunken hatte, kamen das Altstadtkind und das Straßenmädchen zum Vorschein, die derbe Sprache der Gasse brach sich Bahn, und der Frankfurter Dialekt wurde dominant. Männer wurden zu „Kerrrls“, Gesten wurden dramatisch, das Lachen schrill. Ich mochte Oma Elise – vielleicht gerade deswegen. Meine Eltern dagegen hätten sie, solange sie lebte, am liebsten versteckt. Sie sorgten beispielsweise dafür, dass meine streng katholischen Großeltern mütterlicherseits Oma Elise in einem Zeitraum von fünfundzwanzig Jahren nicht ein einziges Mal begegnet sind. Als sie tot war, wurde sie, wie vorher schon Walter, aus dem Familiengedächtnis gelöscht.
Mir war irgendwann klar, dass ich es falsch machen würde, egal, ob ich weiterhin schwieg oder ob ich das Familiengeheimnis preisgab, Nachforschungen anstellte, wildfremden Leuten von meinen Großeltern erzählte, die zu vergessen das Ziel meines Vaters gewesen war. Irgendwann fiel mir ein Satz ein, der mir nicht mehr aus dem Kopf ging: „Jemanden totzuschweigen, ist auch eine Art Mord“.
Und aus diesem Schweigen entsteht Schuld.
Schuld, die von Generation zu Generation weitergegeben wird. Davon bin ich mittlerweile überzeugt, und deshalb habe ich mich dafür entschieden, dieses Buch zu schreiben, auch wenn die intensive Begegnung mit meinen Großeltern und dem, was sie während der Nazi-Diktatur erleiden mussten, für mich ebenso schmerzhaft geworden ist, wie es das Vergessen für meinen Vater gewesen sein muss.
Reise in die Erinnerung
1. Gummerland
Die frühesten Geschichten, die ich erinnerte, waren Geschichten vom Krieg. Geschichten, die mir meine Urgroßmutter Elisabetha erzählt hatte, wenn ich, während die anderen nachmittags Kaffee tranken, mit unterdrücktem Bewegungsdrang neben der kleinen alten Frau auf dem Sofa saß und ihre unglaublich zarte Hand hielt, wie sie es gerne mochte. Sie roch immer so sauber. Nach Seife und Puder. Und ich hatte sie sehr, sehr gern, ohne ihr das anders zeigen zu können, als ihre Hand zu streicheln, neben ihr zu sitzen und ihr zuzuhören. Meine Oma Elise hatte ihr, weil Besuch da war, das feine weiße Haar in frische Wellen gelegt, die mit einem Haarnetz zusammengehalten wurden. Später würden wir zusammen die Drehscheibe gucken und dann die Hitparade mit Dieter-Thomas Heck, aber bis dahin lauschte ich den immer gleichen Geschichten. Vom ersten Weltkrieg, wie mein Ur-Opa eingezogen worden war und sie anfing mit Zeitungtragen, die kleinen Kinder immer dabei. Von der großen Inflation, bei der sie alles verloren hatten. Von der jüdischen Familie, bei der sie vor ihrer Ehe gearbeitet hatte und die in den Dreißiger Jahren emigriert war. „Gottseidank, dass meine Juden rübergemacht haben“, sagte sie dann jedes Mal. Von ihrem Sohn, der aus dem Norwegenfeldzug nicht mehr zurückgekommen war. Wie sie im Luftschutzkeller verschüttet worden waren, zusammen mit meinem Vater, wie sie danach als Ausgebombte ins Behelfsheim nach Steinau mussten. Wie sie noch einmal all ihre Ersparnisse verloren hatten durch die Währungsreform. „Ich hab viel mitgemacht“, sagte sie oft.
Einmal, da war ich schon etwas älter, da sagte ich zu ihr: „Oma, lass gut sein. Das hast du mir doch schon alles hundert Mal erzählt.“ Doch vom Tisch kam sofort eine scharfe Rüge. Wie ich dazu käme, der alten Frau das Erzählen zu verbieten! Also fügte ich mich und hörte alles noch mal von vorn.
Es konnten natürlich nicht die ersten Geschichten gewesen sein, die ich kannte, denn ich fing früh mit Büchern an, brachte mir mithilfe der Verse in einem Kinderbuch, die ich auswendig konnte, das Lesen bei, und ich bekam regelmäßig auch vorgelesen. Aus den Büchern meiner Kindheit jedoch erinnere ich heute höchstens die Bilder oder mal einen Vers. „Quäle nie ein Tier zum Scherz, denn es fühlt wie du den Schmerz.“ Die Geschichten meiner Urgroßmutter dagegen kann ich heute noch auswendig. Und ich höre immer noch ihre Stimme, mit der sie oft für mich seltsame Worte in ihre Erzählung einfließen ließ. Scheßlong, Schossee, Trottewar, mach keine Pradicke … Dass es sich um französische Begriffe handelte, die in der deutschen Alltagssprache um die vorige Jahrhundertwende gang und gäbe waren, lernte ich erst viel später. Mach keine Pradicke bedeutete so viel wie: Spiel dich nicht so auf. Aber das Wort, das mich am meisten faszinierte und mich immer zum Lachen brachte, war Gummer. „Was ist eine Gummer?“, fragte ich Oma Elise einmal. „E Gork“, antwortete sie auf gut Frankfurterisch, um sich dann rasch zu verbessern und in ihrem hoheitsvollen Tonfall, mit dem sie oft unterstrich, dass sie des Hochdeutschen mächtig war, hinzufügte: „Eine Gurke. In Biblis sagt man dazu Gummer.“
Lateinisch Cucumer, französisch Concombre, englisch Cucumber, und rheinhessisch eben Gummer. Biblis war Gummerland. Meine Recherchen erbrachten, dass seit 1882 in der fruchtbaren Rheinebene auf riesigen Flächen dicke, kurze Gurken angebaut und in der Fabrik in Biblis verarbeitet wurden. Im Sommer gab es ein Gurkenfest und eine Gurkenkönigin. Ansonsten war in dem kleinen Kaff mit seinen um die Jahrhundertwende etwa zweitausend Einwohnern nichts los.
Michael Schader, mein Ururgroßvater und Elisabethas Vater, stammte aus Heppenheim wie auch seine Frau, eine geborene Mischler, deren Wurzeln wiederum nach Marienburg bei Danzig zurückreichten. Ihr Mann war elf Jahre älter als sie und hatte erst im Alter von dreißig Jahren geheiratet. Nicht, dass er es sich hätte leisten können – er war in Biblis der sprichwörtliche arme Schneider. Die Familie lebte in großer Armut, was sicher mit dazu führte, dass von den zwölf Kindern aus dieser Verbindung, darunter die Zwillinge Karl und Adam, nur sechs überlebten. Nachdem Karl und Adam früh gestorben waren, wurden die beiden nächstgeborenen Söhne ebenfalls Karl und Adam genannt. Auch sie starben als Kleinkinder. Zwischen 1874, dem Geburtsjahr der zweitältesten Tochter, Eva, und 1883, dem Geburtsjahr des ältesten überlebenden Sohnes, Franz, starben der Familie insgesamt fünf Kinder weg. Ursache? Eine völlig geschwächte Mutter nach der Zwillingsgeburt, Mangelernährung, Kinderkrankheiten, schlechte Pflege. Elisabetha, am 19. April 1884 als Nummer acht geboren, wuchs klein und kränklich auf. „Wir haben zu sechst zwei Heringe geteilt gekriegt und dazu Pellkartoffeln. Manchmal gab’s auch Sauerkraut, das die Mutter mit den Füßen einstampfte.“
Bald nachdem sie eingeschult worden war, meldete sich ein maroder Backenzahn, und als die Schmerzen unerträglich wurden, brachte man das Kind zum Dorfarzt. Es stellte sich heraus, dass der Zahn völlig vereitert war, aber statt ihn einfach nur zu ziehen, brach ihr der unfähige Doktor gleich noch einen Teil des Kiefers heraus. Daran wäre sie fast gestorben und behielt zeitlebens ein schiefes Gesicht, und als sie nach langer Fehlzeit wieder in die Schule gehen konnte, musste sie den Spott der Mitschüler über sich ergehen lassen und die Schläge der Lehrerin, die ihr in schöner Regelmäßigkeit das Vierkantlineal über den Kopf zog, wenn sie eine Antwort nicht wusste.
Mit vierzehn hat Elisabetha mühsam Lesen, Schreiben und Rechnen gelernt, ist klein wie eine Zehnjährige, nicht dumm, aber in allem zurück. Ihre zehn Jahre ältere Schwester Eva ist längst nach Frankfurt abgehauen und dort in Stellung. Einmal, so geht die Erzählung, kommt sie zu Besuch und bringt ein Bündel mit. Das Bündel schreit. Ein Frankfurter Bierbrauer ist wohl der Vater, aber er will Eva nicht heiraten. Elisabetha, der kleinen Schwester, fällt die Aufgabe zu, sich um das Kind, einen Jungen, zu kümmern, so gut sie es eben versteht. „Der lag im Stroh“, erzählte meine Großmutter immer. „Vollgeschissen, Ungeziefer.“ Drei Jahre später stirbt der Kleine, doch im Sommer 1896 bringt Eva das nächste Bündel. Auch um dieses Kind kümmert sich Elisabetha. Sie gibt sich große Mühe, will sie doch verhindern, dass auch dieser kleine Neffe stirbt. Ressourcen sind knapp, aber der Junge ist kräftig und gedeiht zu ihrer Freude. Doch ihr Bruder Franz, der in Worms als Milchausträger arbeitet und jeden Morgen mit dem Fahrrad über die schwimmende Rheinbrücke fahren muss, hat andere Pläne mit ihr. Ein Goldschmied in Worms hat ihn gefragt, ob er nicht ein Mädchen kenne, das in Stellung gehen wolle, und er antwortet: „Ich hab ‚ne Schwester, die ist vierzehn, die täte so gern weggehen von zu Hause, aber die kann nicht kochen, die kann nicht putzen, die hat nichts gelernt daheim, weil sie lange krank gewesen ist.“ Der Goldschmied ist nichtsdestoweniger begeistert, und ich kann mir auch vorstellen, warum. Er bekommt ein fügsames, unterwürfiges Mädchen für wenig Geld, das seine Frau nach Belieben schikanieren kann. Also verlässt Elisabetha Gummerland und zieht über den Rhein, geht als Dienstmädchen nach Worms. Dort, erzählte sie immer, wurde sie anständig behandelt, hatte eine kleine Dachkammer für sich, bekam Kleidung und Schuhe, aber das bisschen Geld, das sie verdiente, nahm ihr die Mutter ab, mit dem Argument: „Du brauchst kein Geld, du kriegst ja alles gekauft.“
Nach zwei Jahren hat ihre Schwester Eva dann für sie etwas in Frankfurt in Aussicht: „Hör mal, da unten wird ein Mädchen gesucht – das sind zwar Juden, aber gute Leute –, und wenn du willst, bringe ich dich da unter. Die bezahlen dich hier nicht gut, in Frankfurt verdienst du mehr.“
Frankfurt – das erscheint der Sechzehnjährigen unendlich weit weg. Sie ist noch nie irgendwo anders gewesen als in Biblis und in Worms. Und nun soll sie gar mit der Eisenbahn fahren! Allein würde sie sich das nie trauen. Aber sie hat ja ihre große Schwester, die alles für sie organisiert. Und so bricht sie erneut auf, diesmal in eine noch ungewissere Zukunft als zuvor, lässt ihre Eltern, ihre Geschwister und ihre Zöglinge zurück – Eva hat bei ihrem letzten Besuch noch ein Bündel abgeliefert – und weiß nicht, ob sie Mutter und Vater je wiedersehen wird. Nach Frankfurt sind es nur sechzig Kilometer – für uns heute eine Fahrt von einer halben Stunde –, aber in jener Zeit erscheint es einem Mädchen ohne Geld als unüberwindliche Entfernung.
2. Neuland
Ich sehe ein Bild vor mir wie eine alte, ausgeblichene Schwarzweißfotografie. Im Spätsommer 1900 warten zwei junge Frauen in dunkler, schlichter Kleidung am Bahnhof in Biblis auf den Zug nach Frankfurt, denn seit ein paar Jahren ist der Ort durch die Riedbahn an die Mainmetropole angebunden. Neben ihnen auf dem Perron eine moderne Gaslaterne, gegenüber das zweistöckige Bahnhofsgebäude, darin ein Hotel mit dem ausgefallenen Namen „Zum schwarzen Walfisch“. Der Himmel ist bedeckt, man ahnt die flache Landschaft der Rheinebene, im Hintergrund die sanften Hügel der Bergstraße. Eva, die ältere der beiden Schwestern, ist Mitte zwanzig, aber sie wirkt viel reifer, ihr Blick ist nach innen gekehrt, vielleicht denkt sie an ihre zwei kleinen Kinder, die sie bei ihrer Mutter zurücklässt oder an ihren kürzlich an Tuberkulose verstorbenen Liebhaber. Oder an das Geld, das sie für die Zugfahrkarte ihrer Schwester Elisabetha ausgelegt hat, damit diese in Frankfurt bei Familie Adler in Stellung gehen kann.
In Elisabethas lebhaften, dunklen Augen schimmert neben Furcht tatsächlich auch so etwas wie Vorfreude; sie steht sehr aufrecht und ihre Hände umklammern den Schließkorb aus Weidengeflecht, denn darin ist alles, was sie besitzt: Unterwäsche, ein Kleid zum Wechseln, zwei Schürzen, ein Gesangbuch, ihr silberner Rosenkranz und ein schmaler goldener Ring, den sie nur Sonntags zur Kirche trägt. Er ist die Belohnung dafür gewesen, dass sie eines Nachts durch mutigen Lärm einen Dieb in die Flucht geschlagen hat, der durchs Dachfenster eingestiegen war, um den Laden ihres Wormser Dienstherren auszurauben.
Elisabetha ist noch nie mit dem Zug gefahren, und sie ist so aufgeregt, dass sie während der ganzen Reise kein Wort spricht. Gebannt schaut sie aus dem Fenster, den Korb auf dem Schoß. Dass sie Glück hat, überhaupt einen Sitzplatz auf den Holzbänken ergattert zu haben, weiß sie nicht; wahrscheinlich ist ihr nicht einmal klar, dass es im anderen Teil des Zuges Abteile gibt mit gepolsterten Bänken, Türen, die man schließen kann, und elegant gekleidete Reisende, deren Gepäck von Dienstboten transportiert wird und vor denen der Schaffner sich höflich an die Mütze tippt, ehe er die Fahrkarte kontrolliert.
Obwohl sie arm ist und nur ein Dienstmädchen auf dem Weg zu seiner neuen Herrschaft, besitzt sie jedoch Selbstbewusstsein. Sie lacht gern, und weil sie jung ist, mit glatter, fester Haut, fällt es kaum auf, dass ihr Gesicht etwas schief ist. Sie trägt ihr dunkelbraunes Haar adrett aufgesteckt; einen Hut besitzt sie nicht, und ihr Kleid ist altmodisch, stellenweise sogar geflickt.
Sie kennt die niedrigen, schäbigen Häuser von Biblis, und Worms war für sie schon eine große, wohlhabende Stadt. Mit dem, was sie in Frankfurt erwartet, hat sie nicht gerechnet.
Verloren steht sie einige Stunden später neben ihrer Schwester auf dem großen Bahnhofsvorplatz und schaut verwirrt auf die Droschken, die hohen Gebäude mit den prächtigen Sandsteinfassaden, die vielen Menschen, die es alle eilig zu haben scheinen.
„Fürchtest du dich?“, fragt ihre Schwester, als Elisabetha sich nicht vom Fleck rührt. Und als die Kleine nickt, meint die Ältere leichthin: „Tröste dich, das geht bald vorbei. Als ich hier ankam, war ich ganz allein. Du hast wenigstens mich für den Anfang. Alle vierzehn Tage hast du frei, dann hole ich dich ab und wir gehen spazieren oder Apfelwein trinken oder sogar tanzen. Kannst du überhaupt tanzen?“
Elisabetha schüttelt stumm den Kopf.
„Egal, dann bring ich’s dir bei. Du kannst Geld sparen. Kein Grund, alles nach Hause zu schicken, hörst du? Und wenn du Glück hast, findet sich auch bald ein fescher junger Mann … Aber wirf dich nicht weg, die Kerle nutzen es aus, wenn sie merken, dass ein Mädchen keine Erfahrung hat! Komm jetzt, die Adlers erwarten uns.“
Sie nimmt Elisabetha bei der Hand und zieht sie hinter sich her, bis das Mädchen sich fasst und folgsam neben ihr hertrottet. Sie gehen die Kronprinzenstraße hinunter, folgen der Weißfrauenstraße bis zur Münzgasse und sind bald mitten drin in der Frankfurter Altstadt mit ihren uralten Fachwerkhäusern, den engen, dunklen Gassen, den vielen kleinen Geschäften, Kneipen und Cafés, den Brunnen und kleinen Plätzen, den Händlern und Herumtreibern, den vielen Kindern und den geschminkten Frauen, die allein oder auch zu zweit in manch einem Hauseingang stehen.
An der Tür eines Hauses, in dem sich im Erdgeschoss ein Gold- und Silberwarengeschäft befindet, klingelt Eva. Gleich darauf erscheint eine gutmütig aussehende ältere Frau.
„Ach du meine Güte, was haben wir denn da für ein Püppchen!“, ruft Frau Adler, als sie Elisabetha sieht. „Komm rein, komm rein, du kleines zartes Ding. Recha!“, ruft sie nach oben. „Das Mädchen ist da!“