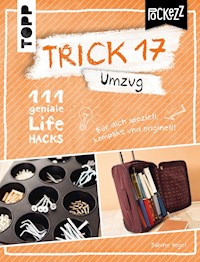Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Brunnen Verlag Gießen
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Ein aufwühlendes Buch über das Schicksal von behinderten Kindern und misshandelten Frauen in den Hochanden Perus und dem selbstlosen Einsatz der deutschen Krankenschwester Sabine Vogel. Das Elend behinderter Kinder und misshandelter Frauen in den Hochanden Perus macht Sabine "Bine" Vogel sprachlos. Kinder mit Behinderung werden aus Scham in Abstellkammern versteckt. Acht von zehn Frauen werden regelmäßig von ihren Männern misshandelt. Herausgefordert von der Not beschließt die gelernte Kinderkrankenschwester und Seelsorgerin zu helfen. 2014 gründet sie dafür den Verein und das Hilfsprojekt "casayohana" und bietet therapeutische Hilfe, vor allem für behinderte Kinder und misshandelte Frauen. Was sie antreibt ist der tiefe Wunsch, diesen Menschen zu vermitteln, dass sie von Gott geliebt und wertvoll sind und gesehen werden. Heute betreut sie gemeinsam mit ihrem Team etwa 200 Familien.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 269
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sabine Vogelmit Sebastian Roncal
„Weil Gott sie liebt“
Mami Bini und die Familienvon casayohana
Sabine „Bine“ Vogel ist 1970 in Creußen/Oberfranken geboren. Sie ist gelernte Kinderkrankenschwester und Kinderintensivschwester. Außerdem hat sie eine theologische Ausbildung absolviert und ist ausgebildete Seelsorgerin mit dem Schwerpunkt Kinder und Jugendliche. Seit 2010 lebt und arbeitet sie in den Hochanden von Peru. 2014 hat sie dort das Hilfswerk casayohana gegründet, das sie seitdem leitet.
Sebastian Roncal ist 1984 in Lima/Peru geboren. Nach seinem Studium der Kunstpädagogik und Philosophie absolviert er ein journalistisches Volontariat. Er lebt und arbeitet als freischaffender Autor/Filmemacher in Berlin.
©2023 Brunnen Verlag GmbH, Gießen
Lektorat: Stefan Loß
Fotos: casayohana
Umschlaggestaltung: Jonathan Maul
Satz: DTP Brunnen
ISBN Buch: 978-3-7655-3632-8
ISBN E-Book: 978-3-7655-7680-5
www.brunnen-verlag.de
Für
Annette und Matthias –meine Lieblingsmenschen
Für
mein Jeanettchen –für 31 Jahre treue Freundschaft
Inhalt
Prolog: Yohana – Das Mädchen in der Hütte
Kapitel 1: Wie ich wurde, was ich bin, und welche Rolle der liebe Gott dabei spielt
Kapitel 2: Gott – ein neues Kennenlernen
Kapitel 3: Auf zu neuen Ufern
Kapitel 4: In Peru
Kapitel 5: Zwischenstopp in Deutschland und Neustart in Peru
Kapitel 6: Das sterbende Mädchen – der Beginn von casayohana
Kapitel 7: „Warum ist die Gringa so nett zu uns?“
Kapitel 8: Die Männer und ihre Werte
Kapitel 9: casayohana wird casayohana
Kapitel 10: Seyda lernt Tanzen
Kapitel 11: casayohana wächst weiter – nicht nur in Peru
Kapitel 12: Familie Marcas und ihre behinderten Kinder
Kapitel 13: Hausbau mit Herausforderungen
Kapitel 14: Hilber aus der Ziegelei
Kapitel 15: Und dann kam Corona …
Kapitel 16: Grenzerfahrungen, die uns zu schaffen machen
Kapitel 17: Mariluz, „Mami Bini“ und warum ich mich irgendwann daran gewöhnt hatte
Kapitel 18: casayohana heute – unser „Apothekerschrank“
Kapitel 19: Was noch zu sagen wäre
PROLOG
Yohana – Das Mädchen in der Hütte
Woher kam dieses Geräusch? Es war ein Röcheln, so, als würde jemand nach Luft schnappen. Wen hatte Pastor Jacinto hinten in der Ecke versteckt? Wer sollte nicht gesehen werden? Es wurden doch immer alle vorgestellt, die zu Hause waren. Oder doch nicht? Ich bin gelernte Kinderintensivschwester und manche Geräusche versetzen mich augenblicklich in Alarmbereitschaft. So war es auch an diesem Nachmittag in der Hütte von Pastor Jacinto, hoch in den Anden Perus.
Auf der einen Seite der Hütte war ein ungebrannter Lehm-Ofen. Das Feuer darunter loderte. Darüber stand ein Topf. Der gestampfte Lehmboden war nicht fest und überall liefen die Meerschweinchen herum. Die Nager werden hier zum Verzehr gezüchtet und nicht wie bei uns in Deutschland als Haustiere. Wohnraum, Schlafraum, Küche und Stall – die Hütte war alles in einem. Wir saßen auf Baumstümpfen um das Feuer. Die Gastfreundschaft hier oben ist überwältigend. Die Menschen haben fast gar nichts. Aber das Wenige, was sie haben, teilen sie. Der Pastor hatte uns sein Gemeindehaus zur Verfügung gestellt. Wir waren unterwegs, um eine Schulung für Frauen einer kleinen evangelischen Kirche anzubieten. Jetzt genossen wir noch Pastor Jacintos Gastfreundschaft. Es gab Tee, Kartoffeln und eine Suppe.
Der Rauch des Feuers brannte in den Augen. Die Hütte hatte absichtlich keine Fenster und auch keinen Rauchabzug. Hier auf 4000 Metern Höhe ist es krach-kalt, und da es keine Heizungen gibt und Brennholz Mangelware ist, wird der Rauch, der beim Kochen entsteht, in der Hütte gehalten. Es war also stockdunkel, der Rauch stand in der Luft, aber es war einigermaßen warm.
Pastor Jacinto ist ein einfacher Mann. Er ist Bauer, wie jeder hier im Dorf, und zusammen mit seiner Frau und dem Rest der Familie verbringt er den ganzen Tag auf dem Feld. So sichern sie ihr Überleben. Er sah aus wie 70, war aber 37 Jahre alt, wie ich später erfahren sollte. Ihm fehlten viele Zähne und die harte Arbeit auf dem Feld lässt hier oben, nahe an der Sonne, die Haut schnell altern. Jacinto ist nebenberuflich Pastor, aber ob er schreiben oder lesen kann, weiß ich nicht. Theologie hat er jedenfalls nie studiert. Jemand aus der Kirche wird von den Brüdern ausgewählt, um die Gemeinde zu leiten. Er hatte sich wohl bewährt – Pastor Jacinto.
Wir saßen also in seiner Hütte und haben nicht viel geredet. Er konnte nur wenig Spanisch, ich sprach kein Quechua. Wir saßen einfach beieinander. Doch plötzlich hörte ich – hinten im Eck – das besagte Geräusch, dieses Röcheln. Ich konnte nichts sehen, da es in der Hütte ja duster war. Aber das Röcheln war mir vertraut. Kinder mit spastischen Lähmungen röcheln so, wenn sie Schleim im Rachen haben und ihn nicht selbst lösen können. Infantile Cerebralparese, kurz ICP, ist die medizinische Bezeichnung für eine solche Behinderung. In meiner Ausbildung habe ich damit Erfahrungen gemacht. Lag dort hinten jemand, der Hilfe brauchte? Ich wollte fragen, aber ich wusste nicht, ob ich Pastor Jacinto damit beschäme. Ich kannte die Kultur noch nicht gut genug. Erst später lernte ich, dass Kinder mit Behinderungen hier ein Fluch sind und Männer sich dafür schämen. Viele lehnen es ab, Vater eines solchen Kindes zu sein. Sie sagen, es sei von einem anderen Mann – die Frau sei fremdgegangen, viele verlassen gar die Familie. Eine Behinderung ist ein Zeichen der Schwäche – ein Makel, der zeigt, dass man kein richtiger Mann ist.
Und manche verstecken das Kind. Hatte Pastor Jacinto jemanden versteckt? Lag da hinten jemand?
Ich musste etwas sagen: „Mensch, Pastor Jacinto, du hilfst uns, gibst uns deine Kirche. Ich bin Kinderkrankenschwester. Hast du einen Angehörigen, dem ich irgendwie helfen kann?“ Ich merkte, dass ihn meine Frage überforderte. Es kämpfte in ihm. Soll er vor mir, der Gringa – so werden Weiße in Peru genannt –, den Schein wahren? Oder sollte ihm sein Ansehen egal sein und wäre die Liebe zu dem, was da dahinten lag, wichtiger? Dann stand er auf und führte mich in das dunkle Eck, aus dem die Geräusche kamen. Ich griff nach meinem Handy, um mit der eingebauten Taschenlampe etwas zu erkennen. Da stand ein selbst gezimmertes Gestell. Anstelle einer Matratze lagen alte Decken und ein Schaffell darauf. Es sah nicht gemütlich aus. Ich konnte ein Kind erkennen, vielleicht 80 cm groß und so um die fünf bis sechs Kilo schwer. Ich habe mich so erschrocken. Auf meine Frage, wie alt es ist, kam die leise Antwort: „Zwölf.“ Ich war fassungslos. Es gibt Bilder aus den Konzentrationslagern mit all diesen abgemagerten Menschen. Bilder, auf denen die Haut nur noch Knochen umhüllt. So sah das Kind im Bett aus. Dieser Moment hat mir das Herz zerrissen. Vor lauter Versteifung lagen die Knie an den Schultern. Und die Hände waren nach hinten geklappt. Das Kind war klatschnass von Speichel und Urin, denn die Familie hatte kein Geld für Windeln. Es stank wie die Pest. Als ich das Mädchen auf den Arm nahm, merkte ich, dass es eiskalt war. Pastor Jacinto strahlte: „Das ist Yohana. Ich habe letzte Woche geträumt, dass sie mit dreizehn über die Wiese laufen wird. Sie wird springen, singen und tanzen. Und jetzt kommst du und willst helfen. Das ist Gottes Geschenk.“ Ich stand da, mit meinem deutschen Krankenschwesterhirn, hab mir das Kind angeschaut und habe gedacht: „Gott ist groß. Das steht außer Frage. Der kann das. Aber nach menschlichem Ermessen, wenn wir es schaffen, dass Yohana nicht mehr friert, nicht mehr hungert, keine Schmerzen hat – vielleicht mal etwas wahrnimmt –, dann sind wir echt gut.“ Diese Gedanken habe ich für mich behalten. „Pastor Jacinto, wir schauen, was wir tun können.“ Das war alles, was ich sagen konnte.
Dass ich Yohana so in den Arm nehmen konnte, hat mich im Nachhinein überrascht. Während meiner Ausbildung musste ich auch den Bereich für Kinder mit ICP kennenlernen. Ich habe zu diesen Kindern keine Verbindung aufbauen können. Sie waren verkrampft, immer verschwitzt und verspeichelt und als 19-Jährige war es mir schwergefallen, das zu ignorieren. Ich hatte einfach keinen Zugang zu ihnen bekommen, hatte keine Liebe für sie empfunden. Vor Yohanas Bett hat sich das dann schlagartig geändert. Mein Herz zerfloss vor Liebe zu diesem Kind. Gott hatte einen Schalter umgelegt.
Yohana war nicht deshalb in diesem Zustand, weil Pastor Jacinto kein guter Vater war. Er hat sie geliebt, denn sonst hätte er sie nicht zwölf Jahre lang gepflegt und ernährt, auch wenn er sie aus Scham versteckt hat.
Dann erzählte er mir ihre Geschichte. Als Yohana ein Säugling war, fiel der Familie auf, dass sie wenig schrie. Aber an der Brust trank sie. Erst als das Mädchen mit drei Jahren abgestillt werden sollte und sie von der Konsistenz etwas festere Nahrung zugeführt bekam, verschluckte sie sich oft und litt dabei so heftig, als würde sie bald ersticken. Die Familie brauchte Zeit, um Geld zusammenzulegen, bis sie sich einen Arztbesuch in Andahuaylas leisten konnte. Ein halbes Jahr lang haben sie Geld gesammelt. Ein halbes Jahr lebten sie mit der Angst, dass Yohana erstickte. Als sie dann endlich den Termin hatten, gab es jedoch keine Diagnose, sondern nur eine Demütigung. Die Worte des Arztes waren schlimm, erinnerte sich Pastor Jacinto: „Er hat Yohana angeschaut. Dann hat er mich angeschaut. Dann wieder Yohana. Und dann kam er auf mich zu und hat mich von oben bis unten gemustert. Hat an mir gerochen und dann abfällig gesagt: „Na, woher kommst du? Wie viele Kinder habt ihr denn da oben? Acht, zehn, elf? Ach! Nimm sie mit und lass sie sterben.“ Diese Worte schlugen ein. Pastor Jacinto schämte sich, denn er hatte den Arzt mit solch einem Kind belästigt und seine Zeit vergeudet. Yohana würde nicht lange leben. Jacinto glaubte dem Arzt. Außerdem: Sie hatten ja gesunde Kinder. Auch damit hatte der Arzt recht.
Die Eltern gingen zurück nach Chaccrampa und dachten, dass ihre Tochter sterben würde. Doch bis das so weit war, sollte Yohana trotzdem umsorgt werden. Schließlich liebten sie ihre Tochter. Sie wollten sie nicht einfach sterben lassen. Nur, wie ernährt man ein dem Tod geweihtes Kind? Milch konnte sich die Familie nur ganz selten leisten. Brühe hat die Konsistenz von Milch, so ihre Überlegung. Und sie ist ja irgendwie nahrhaft. Dass die nötigen Vitamine, Mineralien, Eiweiße, die ein Kind wie Yohana braucht, nicht in der Brühe enthalten sind, wusste die Familie nicht. Woher auch? Sie taten aus Liebe das Beste. Das Kind bekam jeden Tag Brühe.
Yohana sollte leben – länger als gedacht. Wochen und Monate vergingen, Jahre zogen ins Land. So lange es noch ging und die Versteifungen noch nicht sehr fortgeschritten waren, wurde sie jeden Tag in einem Tuch auf dem Rücken auf das Feld mitgenommen. Dann wuchs sie und wurde zu groß, schwer und ihre Gelenke versteiften sich immer weiter, sodass der Aufwand nicht mehr zu stemmen war. Vor Sonnenaufgang stand die Familie auf, die Brühe wurde gekocht und Yohana wurde versorgt. Dann gingen alle auf die Felder ins Tal und Yohana blieb in der kalten Hütte, alleine, in ihrem Urin liegend, ohne die beruhigende Stimme der Eltern, ohne jegliche Stimulation. Nicht selten lag sie 12 Sunden allein in der dunklen Hütte. Den ganzen Tag ohne Bewegung. ICP-Kinder brauchen Bewegung – sie brauchen Physiotherapie. Sonst werden ihre Muskeln immer steifer. Doch woher hätte Pastor Jacinto das wissen können? Der Arzt hatte ihm nichts gesagt und Zugang zum Internet gab es nicht. Was hätte er tun sollen? Die Familie musste überleben. Abends um sechs Uhr – kurz vor Sonnenuntergang – kamen alle wieder heim. Und wie auch am Morgen gab es Brühe für Yohana.
Mach das mit einem gesunden Kind und es wird nach drei Jahren auch schwerstbehindert sein. Yohana lebte trotzdem weiter. Tagein, tagaus. Bis zu diesem Nachmittag, an dem ich sie kennenlernen durfte.
Ich habe dann mit Pastor Jacinto besprochen, wie wir helfen wollten. Seine Augen leuchteten, weil sich scheinbar noch nie jemand um Yohana gekümmert hatte. Sein Traum, Yohana würde bald auf der Wiese tanzen, springen und hüpfen, wurde für ihn greifbar. Was brauchte die Familie, wo konnten wir sie unterstützen? Als ich zu Hause angekommen war, baute ich gleich einen Stuhl für Yohana. Es gibt diese Gartenstühle aus Plastik, die man aufeinanderstapeln kann. Ich fand einen in Kindergröße, beklebte die Sitzflächen, Arm- und Rückenlehne mit Schaumstoff. Yohana sollte weich sitzen können. Ich besorgte eine Matratze und Kleidung. Milchpulver, Vitamine, Windeln und ein Radio mit Batterien, damit sie tagsüber wenigstens etwas Unterhaltung hatte.
Es war gerade Regenzeit und nicht alle Straßen waren befahrbar. Außerdem waren Sommerferien und wir hatten kein Programm. Erst sechs Wochen nach unserem Kennenlernen konnten wir wieder den Weg nach Chaccrampa zu Pastor Jacinto und Yohana antreten. Um vier Uhr morgens brachen wir in Andahuaylas auf. Das Auto war voll mit Sachen für das Kind. Noch ahnte ich nicht, dass diese Dinge keine Verwendung mehr finden würden. Als wir um acht Uhr an der Hütte von Pastor Jacinto ankamen, war es ungewöhnlich ruhig. Normalerweise kamen uns die Hunde und die Kinder entgegen. Sie konnten von Weitem sehen und hören, dass wir kamen. Es war ein Ereignis in dem sonst so selten besuchten Dorf. Aber nicht an diesem Tag. Wir stiegen den Berg zur Hütte hinunter, die ungefähr 200 Meter unterhalb der Straße lag. Trauer war in der Luft. Wir sind hineingegangen und in der Dunkelheit der Hütte leuchtete eine Kerze. Ich hörte Pastor Jacinto und seine Frau weinen. Und in ihrer Ecke lag Yohana, leblos. Sie war um 07:30 Uhr – eine halbe Stunde vor unserer Ankunft – an den Folgen der Mangel- und Fehlernährung gestorben.
Ich konnte es nicht fassen. Ich habe geheult – nur geheult. Und dann spürte ich, wie Wut in mir aufkochte. Ich war sauer – auf mich. Auf Gott. Auf die Regenzeit, die uns aufgehalten hatte. Ich war sauer auf die Kultur, die das zuließ. Warum habe ich nicht mehr gemacht. Warum habe ich nicht gequengelt: „Ich muss da hoch. Ich muss da hoch! Komme, was wolle.“ Ich war stinksauer. Der Tod von Yohana hätte doch verhindert werden können. Warum, Gott? Warum? Wir alle haben versagt.
Am nächsten Tag – wir hatten einen Sarg aus Andahuaylas kommen lassen, da es hier oben keine Bäume gab – saßen wir zusammen. Pastor Jacinto schaute mich an. Dann sagte er etwas, das ich nicht vergessen werde: „Hermanita Binecita (Schwesterlein Binchen), schau, wie groß Gottes Liebe ist. Er hat mich mit dem Traum, den er mir geschickt hatte, getröstet. Und jetzt ist Yohana bei ihm. Und sie läuft über die Wiese, sie singt und springt und tanzt. Und nichts tut ihr mehr weh.“
Aus diesem trauernden, zahnlosen Mund war das für mich die Predigt meines Lebens. Ich dachte: ‚Bine, du blöde Kuh. Du bist sauer auf Gott, obwohl du dieses Kind nur einmal gesehen hast. Du hattest es einmal in den Armen und der Papa, der 12 Jahre lang dieses Leiden ertragen hat und nach seinen Möglichkeiten alles getan hat, der sieht in dieser Tragik die Liebe Gottes. Du tickst wohl nicht richtig.‘ Dann habe ich Pastor Jacinto angeschaut, habe ihm zugestimmt und gefragt: „Sag mal, Pastor Jacinto, gibt es hier noch mehr Kinder mit Behinderungen?“ Er sagte „Ja, hier und da – da drüben ist auch eins.“ Dabei zeigte er mit seinen Armen in alle Himmelsrichtungen. Und plötzlich war mir klar, was ich hier zu tun hatte. Die Aufgabe hatte noch keinen Namen, aber ich wusste jetzt, wohin es ging. Ich wollte diesen Kindern mit Behinderung helfen. Ich hatte ihr Leiden gesehen und ich wollte helfen. Wie aus dieser Begegnung mit der kleinen Yohana und Pastor Jacinto „casayohana“ wurde, ein Zentrum, in dem heute über 200 Familien betreut werden – davon handelt dieses Buch.
KAPITEL 1
Wie ich wurde, was ich bin, und welche Rolle der liebe Gott dabei spielt
„Wenn du helfen kannst, dann hilf!“ – der soziale Papa und die fromme Pflichterfüllung
Creußen, die Kleinstadt, in der ich aufgewachsen bin, liegt zwischen Nürnberg und Bayreuth. Gelegentlich kam es vor, dass Wohnungslose – gerade im Winter – an unsere Tür geklopft haben und einen Schlafplatz suchten. Zuvor haben sie bei der evangelischen Kirche nachgefragt und der Pfarrer wusste, dass meine Eltern sehr sozial sind. Bei Herbert Vogel gab es immer einen Schlafplatz. Das wusste der ganze Ort. Es gab nur eine Regel – von meiner Mama eingefordert: Jeder kann bei uns übernachten, doch erst muss gebadet werden. Der Gast musste also in die Badewanne und wurde anschließend mit frischen Klamotten meines Vaters eingekleidet. Dann saß er bei uns am Tisch und hat mit uns gegessen. Wir fragten nach ihrem Leben, und die meisten erzählten gern. Wenn sich der Gast dann zum Schlafen in das Gästezimmer im Erdgeschoss, gleich neben den Wohnräumen meiner Großeltern, zurückgezogen hatte, kamen wir noch mal als Familie zusammen und beteten, dass, wer auch immer gerade bei uns übernachtete, uns nicht ausraubte. Vor allem für uns drei Kinder war das aufregend und eine Lektion: Wir ließen uns auf ein Wagnis ein, aber wir vertrauten auf Gott. Wir sind zu Bett gegangen in dem festen Glauben, dass Gott auf uns aufpasst. Und so war es auch. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass jemals etwas verschwunden wäre.
„Wenn du jemandem helfen kannst, dann denke erst gar nicht darüber nach, weswegen das jetzt gerade nicht gehen sollte. Mach einfach und Gott versorgt dich dabei.“ Das habe ich von meinem Vater gelernt. Er hat nicht nur geredet, er hat es gemacht. Er hat uns sein Pflichtbewusstsein vorgelebt. Er hat es nicht nur gepredigt, sondern er hat es gelebt. Ansonsten hätte ich mich damit noch schwerer getan, vor allem im fortgeschrittenen Kindesalter.
Unser Haus war immer ein offenes Haus. Ich habe es selten anders erlebt. Meinen Eltern, aber vor allem meiner Mutter war es wichtig, Menschen in Not zu helfen. Sie konnte auch mal alles stehen und liegen lassen, ob das Haus aufgeräumt oder geputzt war, spielte keine Rolle. Wenn jemand kam und Hilfe brauchte oder Hunger hatte, hatten sie immer ein offenes Ohr, eine weit geöffnete Tür und etwas auf dem Tisch. Ich habe es klasse gefunden, dass sich die Leute bei uns so wohlgefühlt haben. So hatten wir zum Beispiel oft gerade die Schulfreunde aus schwierigen Verhältnissen bei uns. Meine Mutter hatte ein ganz großes Herz für „nicht geliebte“ und einsame Menschen. Und oft saßen besonders an Feiertagen deshalb Fremde mit uns am Tisch. In Bayreuth gab es eine amerikanische Kaserne. Über die Feiertage hatten die Soldaten frei. Doch nicht alle hatten Familien hier und viele waren einsam. In einem Jahr gab es den Aufruf in der Zeitung, ob sich jemand vorstellen könnte, amerikanische GIs für das Fest aufzunehmen. Meine Eltern haben sich gemeldet und das führte zu skurrilen Situationen. Wir lebten ja im tiefsten Franken und ich war Vorschulkind. Ich habe noch nie vorher einen schwarzen Menschen gesehen. Und dann hatten wir einen zu Besuch. Ich habe den armen Mann angestarrt – ich habe ihn fixiert. Meine Mutter hat die ganze Zeit versucht, mir Zeichen zu geben. Sie hat mit ihren Augen gerollt. Ihr war das peinlich und sie wollte, dass ich wegschaue, aber ich konnte nicht wegschauen. Jahrzehnte später – in Peru – sollte mir diese Begebenheit wieder einfallen. Es half mir dabei, das Verhalten der Menschen, die noch nie einen Weißen gesehen hatten, zu verstehen.
Diese Menschen – fremde Menschen in der eigenen Wohnung – werde ich nie vergessen. Erlebnisse solcher Art haben mich geprägt – sind in mein Herz eingebrannt. Ich bin damit aufgewachsen und so wurde es selbstverständlich für mich, dass ich helfe, wo und wann immer ich kann. Bis heute treibt mich diese Einstellung an und führt mich in Abenteuer, in überraschend schöne Situationen, aber manchmal auch in Herausforderungen. Wenn ich jemanden in Not sehe – Leid vor meinen Augen erkenne – und die Möglichkeit habe zu helfen, dann tue ich das. Das hat mich hierhergebracht, auf 2.900 Meter über dem Meeresspiegel, mitten in die peruanischen Anden.
Die Knödel-Akademie
Wenn man mich als Kind gefragt hat: „Was willst du mal werden?“, habe ich gesagt: „Kinderkrankenschwester! Und einen Mann brauche ich nicht!“ Das mit dem Mann konnte ich damals noch nicht abschätzen. Der Berufswunsch allerdings war fest. Meine Mutter war Kinderkrankenschwester und ich wollte in ihre Fußstapfen treten. Schon mit fünf – sehr früh – wurde ich eingeschult. Das war eine Zeit lang Mode und mein Vater war Schuldirektor – der fand das damals gut. Aber dadurch habe ich auch jung meinen Schulabschluss gemacht. Mit 16 war ich zu jung. Kinderkrankenschwester durfte man erst ab 18 werden. Heute würde man ja sagen: Geh für ein Jahr ins Ausland, sammle Erfahrungen. Damals war das undenkbar. Ich wollte aber auch keine andere Ausbildung beginnen. Meine Mutter fand eine Berufsfachoberschule mit dem Schwerpunkt Hauswirtschaft für mich. Sie meinte: „Das schad ja nicht! Da lernste was.“ Eine Schule, auf der man lernt, Haushalt zu führen. Darauf hatte ich keine Lust. Das ist ja so lahm, dachte ich. So uncool. Zwei Jahre lang wirst du niemandem sagen, was du machst. Aber ich konnte auch nicht mit meiner Mutter diskutieren. „Das machst du jetzt.“ – So ihre Worte. Augen zu und durch, dachte ich damals.
Ich habe ein bisschen Gartenbau gelernt, ich hatte Stoffkunde und kann nähen, ich kann alles Mögliche reinigen. Ich kann alles Erdenkliche kochen. Ich habe in Großküchen und in Altenheimen Praktika gemacht. Kartoffelsalat für 120 Leute – kein Problem für mich. Und ein riesiger Berg Wäsche erschreckt mich auch nicht. Das ist zwar nicht der Traum meiner schlaflosen Nächte, aber ich kann es. Noch heute profitiere ich von dieser Zeit an der „Knödel-Akademie“, wie wir Schüler unter uns die Schule immer nannten.
Der frühe Tod meiner Mutter
Einen Tag nach meinem siebzehnten Geburtstag bekam meine Mama ihre Krebsdiagnose. Sie hatte schon länger starken Husten gehabt. Die Ärzte dachten, es muss eine Allergie sein, und haben sie daraufhin untersucht und behandelt. Doch an meinem Geburtstag ging es ihr so schlecht, dass sie sich am Tag darauf selber in die Klinik eingewiesen hat. Das Röntgenbild zeigte über drei Liter Wassereinlagerung in der Lunge. Das wurde abgepumpt und die nächsten Tage weitere diagnostische Untersuchungen vorgenommen. Es stellte sich heraus, dass sie einen ziemlich großen Lungentumor hatte. Außerdem war der Krebs bösartig. Es ging sehr schnell. Im Oktober wurde der Tumor entdeckt, dann hat sie sich sofort einer starken Therapie unterzogen. Diese musste allerdings unterbrochen werden, da sie sich im Krankenhaus eine Lungenentzündung eingefangen hatte. Als es dann wieder weitergehen sollte – kurz vor Weihnachten –, war es leider zu spät. Sie hatte Metastasen in den Knochen, man hat Einblutungen unter ihrer Haut gesehen. Es war zu spät. Und sie wusste das als Krankenschwester. Zusammen mit meinem Vater entschied sie, zu Hause sterben zu wollen. Aber wer sollte sie in der Zeit zu Hause begleiten? Meine Schwester absolvierte zu dem Zeitpunkt eine Krankenschwesterausbildung in Erlangen und mein Bruder hat auch weiter weg studiert. Mein Vater leitete eine Schule. Also haben wir im Familienrat gemeinsam überlegt und sind zu dem Schluss gekommen, dass ich mich um sie kümmern sollte. Für mich war es am einfachsten, für eine Zeit zu Hause zu bleiben. Und schließlich wollte ich sie ja auch pflegen. In unserem Wohnzimmer wurde ein Krankenbett aufgestellt und ich wurde angeleitet, wie und wann ich ihr Morphin verabreichen sollte. Tagsüber waren beide Omas bei uns und haben geholfen. Und dann kam die erste und einzige Nacht, in der ich mit Mama alleine war. Die Schmerzen wurden immer schlimmer. Stunde für Stunde.
Gegen zwei Uhr morgens waren die Schmerzen so heftig, dass ich sie fragte: „Mama, soll ich für dich beten?“ Sie konnte nicht richtig antworten. Sie hauchte ein leises „Ja“. Sie so leiden zu sehen, war für mich kaum zu ertragen. Und deswegen habe ich gebetet, dass Gott sie schnell zu sich holt. Es war für mich sehr wichtig, dass wir diese schweren Stunden zusammen hatten. Ich wollte nicht, dass sie geht. Aber gleichzeitig habe ich ihr Leiden gesehen. Die Arme waren ganz dünn abgemagert, der ganze Körper war abgemagert, ihr Bauch war aber voll mit Wasser – als wäre sie im siebten Monat schwanger. Die Schmerzen haben sie gequält. Ich wollte, dass sie erlöst wird, und mit aller Kraft bestätigte sie das Gebet, indem sie immer wieder „Amen“ hauchte. Amen. Amen. Mir wurde klar, meine Mutter hält sich an Gott fest, und gleichzeitig hatte ich die Erkenntnis: Der Tod ist nicht immer nur furchtbar, sondern er ist auch manchmal eine Erlösung. Sie hatte mir vorher schon mal gesagt: „Bine, das Einzige, was mir leidtut, wenn ich gehe, ist, dass ich nicht mehr bei euch bin. Ich gehe nach Hause. Und dann bin ich zu Hause. Mein Leiden wird weg sein.“ Der Tod als Erlösung – das habe ich bei diesem Gebet verstanden.
Die ganze Nacht war Mama unruhig. Erst gegen sieben Uhr morgens wurde sie ruhiger. Ich ging in den Keller, um einen Saft zu holen. Und als ich wieder hochkam, schnaufte sie, aber auf eine Art und Weise, wie ich es noch nie gehört hatte. Sie atmete immer flacher, dann kam eine Pause, dann wurde die Atmung wieder stärker. Heute weiß ich, dass das Cheyne-Stokesche-Atmung heißt und dass das die letzten Atemzüge vor dem Tod sind. Die Atmung wird immer flacher, die Abstände werden immer größer. Ich habe meine beiden Omas, die in der Wohnung unten waren, zu uns gerufen. Wir stellten uns um Mamas Bett und beteten alle drei abwechselnd, bis meine Mutter zum letzten Mal Sauerstoff in ihre Lunge sog und dann ausstieß. Das hört sich jetzt seltsam an, aber trotz des wahnsinnigen Schmerzes war ich dankbar. Ihr Leiden hatte ein Ende. Jetzt war sie frei.
Und dann war noch diese Nacht – die erste Nacht nach Mamas Tod. Weil alles so ungeahnt schnell ging, waren Annette und Matthias, meine Geschwister, noch auf dem Weg nach Hause. Ich habe mich so einsam gefühlt. Als wir drei noch kleiner waren, sind wir bei Gewitter immer zu Annette ins Bett gekrabbelt, erzählten uns Geschichten und fühlten uns stark zu dritt. Also legte ich mich in dieser Nacht in Annettes Bett, um nicht alleine zu sein und Trost zu finden. Ich zog mir ihre Decke über die Schultern, war aber trotzdem allein und habe geheult. Dann spürte ich plötzlich, wie jemand die Hand auf meine Schulter legte und sagte: „Mein Kind.“ Aber es war ja keiner da. Ich spürte, dass das Gott war, der mich tröstete. In den nächsten Tagen, als wir als Familie die Beerdigung organisierten, Freunde und Verwandte benachrichtigten, Blumen bestellten, Behörden informierten – immer wenn ich das Gefühl hatte, es wird mir alles zu viel, habe ich die Hand auf meiner Schulter gespürt und die Stimme gehört: „Mein Kind.“ Das hat mir die Sicherheit gegeben, die Gewissheit, dass ich nicht alleine war.
Weg von zu Hause – weg von Gott
Ich war achtzehn Jahre alt – meine Mutter war vor acht Monaten gestorben –, als für mich die Zeit kam, von zu Hause auszuziehen. Ich hatte Creußen noch nie für längere Zeit verlassen. Meine Kindheit war voller schöner Erinnerungen. Liebe gab es in diesem Haus genug. Aber nicht alles war rosig. „Was du machen kannst, mach!“, hat eben auch eine Kehrseite. Wir konnten nicht so einfach Nein sagen oder: „Das mache ich jetzt nicht. Darauf habe ich keine Lust.“ Das waren Sätze, die bei uns zu Hause selten fielen und erst recht nicht, wenn es um das Engagement in der Kirchengemeinde und in der Landeskirchlichen Gemeinschaft (LKG) ging.
Der Glaube, Gott, die Kirchengemeinde und die LKG spielten bei uns in der Familie eine wichtige Rolle. Montagabends war Chor oder Gebetsstunde, Dienstag Kinderstunde, Donnerstag Teeniekreis, Freitag Jugendkreis. Am Samstag dann Krankenhaus-Singen oder etwas anderes und am Sonntag Gottesdienst in der Kirche und abends „Stund“ in der LKG. Die Woche war voll mit Gemeindeaktivitäten. Alles für Gott, alles für den Nächsten. Und wenn ich mal nicht wollte – einfach müde war, dann sagte Papa: „Bete, Gott gibt dir die Kraft.“ Ein Nein war kaum möglich. Und wenn ich mal doch meinen Willen bekam, hatte ich gleichzeitig ein schlechtes Gewissen.
Gott war ein Gott, der von mir etwas erwartete. Er wollte, dass ich Leistung brachte. Und Gott war ein Gott der Kontrolle. Sein Blick lag immer auf mir. Ich habe nie wirklich an ihm gezweifelt. Aber ich kam an den Punkt, an dem ich dachte, dass Gott alles tut, um mich in Schach zu halten. Es gibt ein christliches Kinderlied, in dem die Zeile vorkommt: „Pass auf kleine Hand was du tust, denn der Vater immer Himmel schaut herab auf dich.“ Dieses Lied hatte ich ständig im Hinterkopf. In meiner Freizeit, in der Schule, bei den ersten Erfahrungen, die ich mit Jungs gemacht habe. Gott war dabei und hat kontrolliert und oft genug habe ich ihn enttäuscht. Klar, wir haben auch gehört: „Gott ist Liebe. Er macht frei.“ Aber ich habe das nicht gespürt. Ich habe immer gedacht: ‚Ich kann Gott nie gerecht werden.‘ Ich wusste irgendwann nicht mehr, wie ich meinen Glauben leben sollte. Und ich wusste auch nicht, ob ich überhaupt meinen Glauben weiter leben wollte.
Deshalb nutzte ich die Möglichkeit, von zu Hause wegzugehen. Ich wollte dieser Enge entfliehen und mich aus diesem Muster befreien. Ich habe mich mit meinem Papa zwar gut verstanden. Aber ich musste weg. Abgesehen davon: Meine Geschwister waren ja auch schon weg. Das Haus war leer. Und dazu kam noch, dass mich zu Hause alles an die letzte schwere Zeit mit meiner Mutter erinnerte. Ich wollte weit weg. Und so führte mein Weg ins Ruhrgebiet.
Das erste Mal alleine in die weite Welt – nach Oberhausen
Über unsere Landeskirchliche Gemeinschaft hatte ich gehört, dass es irgendwo in Oberhausen ein Krankenhaus geben sollte, in dem auch Schwestern aus unserem Gemeindeverband arbeiteten. Ich kannte das Ruhrgebiet nicht. Ich kannte das Krankenhaus nicht. Ich kannte gar nichts. Ich war jung und ja, auch ein bisschen naiv. Darf man ja sein in diesem Alter. Ich habe mich beworben und sie haben mich genommen. Das war gerade in der Zeit, als der Pflegenotstand ein Thema wurde. Und so bin ich das erste Mal in die weite Welt gezogen. In das Ruhrgebiet.
Bei uns in Franken sagt man immer: „Passd scho.“ Also: „passt schon.“ Das kann das größte Kompliment sein oder die größte Beleidigung. Auch wenn es überhaupt nicht passt und dein Gegenüber eigentlich gar nicht einverstanden ist. Wir sagen lieber „passd scho“ und vermeiden somit gerne Konflikte. In Oberhausen hingegen nimmt man kein Blatt vor den Mund. Da hörte ich plötzlich: „Ey Bine, ganz ehrlich: Das ist totaler Mist!“ Am Anfang meiner Zeit dort bin ich bei dieser Direktheit immer fast tot umgefallen. Aber langsam habe ich mich daran gewöhnt. Plötzlich konnte ich nämlich sein, wer und wie ich war. Und hier in der Ferne war ich auch nicht die Tochter von Herbert Vogel, dem Leiter der LKG, Kirchenvorstand und Schuldirektor. Ich hatte nicht den frommen Stempel, war an keine Normen gebunden und das war sehr gut. Zum ersten Mal keine Kontrolle. Ich stand nicht mehr unter Beobachtung. Partys, Alkohol, Jungs – alles fand viel freier statt. Nicht in Exzessen, einfach nur freier.
Und für alle, die jetzt glauben: Oh, jetzt kommt der Absturz – so krass war es nicht. Ich war immer noch in einem behüteten Umfeld. Es war ein evangelisches Krankenhaus und ich habe dort im Schwesternwohnheim gewohnt. Pflichtbewusst – wie sich das gehört – habe ich eine Gemeinde gesucht und war dort auch aktiv.
Bine, die Soziale I – Vorbilder, Liebe, Pflichterfüllung
„Wenn du helfen kannst, dann hilf!“ oder „Hilf einfach.“ Diesen Satz habe ich nicht in Creußen gelassen. Wie auch? Das sind Worte, die ein Teil von mir sind und sie führen mich immer wieder zu neuen Herausforderungen. Wobei es damals – im Ruhrgebiet – wohl eher die anderen waren, die durch mich herausgefordert wurden.