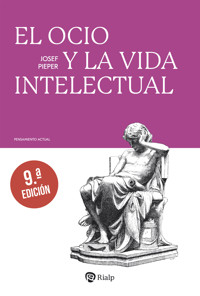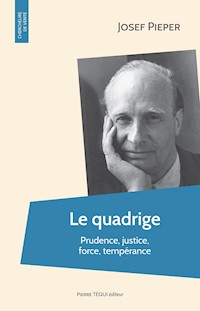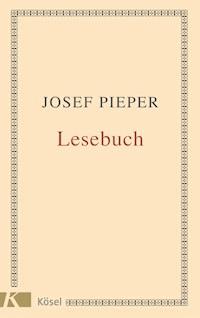8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kösel
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Diese Aufsätze, Reden, Tagebuchaufzeichnungen und Notizen sind der philosophierenden Weltdeutung zugewendet. Die Rede ist von Platon oder von Thomas, von Bach oder von Konrad Weiß, und doch geht es nie nur um das Historische und Vergangene; immer handelt es sich darum, wie der wirkliche Mensch seines wahren Reichtums teilhaftig wird und bleibt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 326
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
JOSEF PIEPER
Weistum ◆ DichtungSakrament
AUFSÄTZE UND NOTIZEN
HOCHLAND - BÜCHEREI
IM KÖSEL - VERLAG ZU MÜCHEN
Erste Auflage 1954
Copyright 1954 by Kösel-Verlag KG, München. Gesamtherstellung in den verlagseigenen Graphischen Werkstätten in Kempten
eISBN: 978-3-641-18009-6
www.randomhouse.de
»Die im Dahingang der Geschichte ausgeglühte Gestalt der philosophierenden Weltdeutung, die Antwort aller musischen Künste, die heilige Handlung als kultisches Begängnis – das sind die Gegenstandsbereiche, denen die interpretierende Bemühung dieser Aufsätze, Reden, Tagebuchaufzeichnungen und Notizen zugewendet ist. Ob aber von Platon die Rede ist oder von Thomas, von J. S. Bach oder von Konrad Weiß: es geht niemals um das bloß Historische und Vergangene; immer handelt es sich darum, wie der wirkliche Mensch seines wahren Reichtums teilhaftig werde und teilhaftig bleibe. – »Was immer Josef Pieper als philosophischer Denker anfasst, immer findet er die Goldader, die sich tief im tauben Gestein verbirgt. Das taube Gestein – das ist die Vergangenheits-Last, die sich auf Erkenntnisse gehäuft hat, das ist die Befremdung, die abhandengekommene Terminologien ausströmen, das sind unsere eigenen wattierten Vorurteile.«
Süddeutsche Zeitung
»Wer auch nur einen einzigen der zahlreichen Traktate Josef Piepers gelesen hat, kennt das für einen ,beamteten‘ Philosophen ungewöhnliche stilistische Niveau dieses Schriftstellers. Es ist, als trete man ins Freie, wenn man sich dem Zauber seiner klaren, unrhetorischen, ganz auf die jeweilige Sache eingestellten Sprache hingibt. Nie verliert er sich in Nebensächlichkeiten; immer wird der Kern der Dinge mit unpathetischem Ernst ins Wort verwandelt.«
Der Tagesspiegel
»Die kleinen Bücher Piepers bilden den Ausgleich zur heute überbordenden ,Erfolgsliteratur‘, weil sie in der Sprache des gesunden Menschenverstandes das Wesentliche aufzeigen, ohne welches alle Lebenstechnik leer und unbefriedigend bleibt.«
Robert Schnyder
»Die meisten Leser trauen ihm kaum zu, dass er spannend schreibt, und sie haben dafür ihre Gründe. Aber Pieger ist eine Ausnahme. Seine Themen gehen das Leben eines jeden an, seine Thesen sind dem Strom der Zeit so entgegengesetzt, dass sie sensationell wirken.«
Chicago Tribune
Meiner Mutter zum siebzigsten Geburtstag
Inhaltsverzeichnis
Über das Zuhören und die philosophierende Interpretation
Es pflegt nicht so zuzugehen, dass einer durch die Jahre seines Lebens hin, Schritt für Schritt, einen selbst gemachten Plan verwirklicht. Wohl aber mag es geschehen, dass einer nach einer Strecke Weges den Blick zurückwendet auf die eigene Arbeit und dass sich ihm, wenn es mit glücklichen Dingen zugeht, dennoch so etwas wie Vorbedacht und Folge darin zeigt. Zugleich freilich wird er dann auch dies gewahr: nicht er ist der Entwerfende gewesen, vielmehr ist er den Figuren eines fremden Planes gefolgt – eines doch wiederum so wenig fremden, dass fast gesagt werden müsste, er selber sei der Plan.
Drei solcher Figuren sind es, die sich abzuzeichnen scheinen in dem Vielerlei der Versuche, mit denen ich mich in den letzten zwanzig Jahren abgegeben habe. Ihre Gegenstände mögen als »Weistum«, »Dichtung« und »Sakrament« benannt werden. Der erste Name meint die geprägte, die im Gang der Überlieferung sozusagen ausgeglühte Gestalt, in welcher der nach den Gründen forschende Geist sich seine Funde gegenwärtig hält. »Dichtung« steht nicht allein für das in der Sprache eingekörperte, sondern für jegliches poiema, für jegliche formgewordene »Antwort« aller musischen Künste insgesamt. Und »Sakrament« umgreift den ganzen Bezirk des kultischen Begängnisses und der heiligen Handlung. – Alle drei Bereiche befinden sich dadurch untereinander in Kommunikation, dass in allen ausdrücklich die Wurzel und das Ganze von Welt und Dasein zur Rede steht.
Diese »Rede« freilich, diese vom Geräusch des Alltäglichen durchschnittlich überschrieene »Rede« wird nur unter einer bestimmten Voraussetzung vernehmlich. Der Mensch muss sich ihr auf eine besondere Weise zuwenden – sonst bleibt jene die Tiefe der Existenz betreffende Auskunft und also der Sinn von Weistum, Dichtung, Sakrament unkenntlich und verborgen.
Hierüber nun, welche Weise der Zuwendung gefordert sei – ist einiges Nähere zu sagen.
Ich gehe davon aus, dass eine Voraussetzung erfüllt ist: dass nämlich in allen dreien – in Weistum, Dichtung und Sakrament – eine Mitteilung enthalten sei, eine »Botschaft«, die aufzunehmen für den Menschen nicht allein lohnend, sondern geziemend, ja notwendig ist; dass er dessen bedürfe zu einem sinnvollen, wahrhaft menschlichen Leben. – Für das Sakrament trifft dies, wofern nur die Benennung zu Recht besteht, unbestritten und am ehesten zu. Was die Dichtung angeht, so muss eine schon von Platon aufgestellte Bedingung gemacht werden, eine Einschränkung: soweit sie das Werk »göttlicher« Dichter ist. Und natürlich kann, drittens, nicht jede philosophische Meinung beanspruchen, Weisheit und Weistum zu sein, mag sie auch, etwa durch die Brillanz der Formulierung oder auf irgendeine Weise sonst, im Gedächtnis der Menschheit haften geblieben sein. – Noch einmal also, es wird hier vorausgesetzt, dass all den Gestaltungen, die mit jenen drei Namen gemeint sind, das zukomme, was im anspruchsvollsten Sinn des Wortes »Größe« heißt, womit zugleich so etwas wie »letzte Gültigkeit«, »Reife«, »Verehrungswürdigkeit«, ja fast »Vollendung« ausgesprochen sein will.
Es scheint nun gar nicht schwer zu sein, die Haltung zu kennzeichnen, in welcher man sich angemessenerweise einer so gearteten »Botschaft« zuwenden wird. Es kann keine andere sein als die Haltung schweigender Aufnahmebereitschaft, die Haltung also des Empfangens, des Hörens, des Zuhörens. Das klingt wie etwas beinahe Selbstverständliches. Was aber gehört dazu, ein Zuhörender zu sein? Die Antwort hierauf versteht sich, wie mich dünkt, keineswegs von selbst.
Es mag einer mit höchster Aufmerksamkeit dem folgen, was ein anderer sagt – und doch hört er ihm nicht zu. Es ist schließlich ein Unterschied, ob ich dem Untersuchungsrichter Rede stehe, ob ich ein Nachtgespräch mit einem Freunde führe oder ob ich auf die Fragen eines diplomierten Psychologen antworte, der es darauf abgesehen hat, mich in einer »Exploration« zu »testen«. Kein Zweifel, in allen drei Fällen wird das Gesprochene aufmerksam zur Kenntnis genommen. Wer aber hört mir zu – so wie ich selbst, der Sprechende, es erwarte und wie jeder von uns es natürlicherweise erwartet, sogar vom Gegner?
Einen platonischen Dialog kann man lesen als ein Dokument der griechischen Sprache oder auch des athenischen Lebens zur Zeit des Sokrates. Erst recht kann man ihn lesen mit dem Blick auf die Geschichte des philosophischen Denkens: was nicht alles lässt sich aus einem Werk wie dem Dialog »Gorgias« an Auskunft entnehmen über die Sophistik. Natürlich ist der »Gorgias« ferner, wie jedes menschliche opus, eine biografische Urkunde; und auch unter diesem Aspekt kann er gelesen werden, also als ein Dokument der »Übergangszeit« von den frühen Dialogen zu denen der reifen Meisterschaft. Es kann, angesichts des den »Gorgias« abschließenden Mythos vom Gericht im Jenseits, die Frage erörtert werden, ob etwa diese sehr besondere Fassung der Geschichte von den drei Richtern aus der Orphik herrühre oder aus ägyptischen Totenbüchern. Es kann gefragt werden, wieso Platon überhaupt diesen Mythos an den Schluss des Gesprächs zwischen Sokrates und dem Machtpraktiker Kallikles gesetzt habe; und die Antwort mag dann lauten: »weil sein künstlerischer Sinn eines metaphysischen Hintergrundes als Komplement zu der heroischen Einsamkeit der sokratischen Seele und ihres Kampfes bedurfte«. Man kann es darauf anlegen, in der Lehre von der vorgeburtlichen Existenz der Seele vor allem ein Argument dafür zu sehen, dass also Platon, bevor er den »Menon« schrieb, in Süditalien die pythagoreische Tradition müsse kennengelernt haben. Und so fort. All dies sind Beispiele aus der gelehrten Platonliteratur. Und es sind ausnahmslos Beispiele für ein Nicht-Zuhören. Ich sage nicht, es sei unzulässig oder auch nur unwichtig, Fragen solcher Art zu stellen und zu erörtern; wie ich es auch nicht unter allen Umständen für unzulässig halte, dass ein Mensch »getestet« wird. Nur handelt es sich nicht gerade um »Zuhören«. Man sitzt nicht zu Platons Füßen, sondern man schaut ihm über die Schulter. Dass Platon aber von solchem Range sei, dass es sich zieme und sich lohne, ihm zuhörend zu Füßen zu sitzen – dies eben ist unsere Voraussetzung.
Nun ist leicht zu sehen, dass die hier gekennzeichnete Art, sich mit den Werken der Großen zu befassen, etwas äußerst Gebräuchliches ist.
Setzen wir einmal den vielleicht zu abstrusen Fall, nicht ich hätte die im Folgenden [auf S. 251] unter dem Titel »Die größere Welt« abgedruckte kleine »Meditation« geschrieben, sondern ein vor fünfhundert Jahren lebender, im Übrigen historisch wohlbekannter Autor. Nehmen wir weiter an, ein fleißiger Herausgeber hätte jenes winzige, bis dahin verschollen gewesene opusculum nicht allein zum ersten Mal an den Tag gebracht, sondern aufgrund der profunden Kenntnis des schon vorliegenden Werkes, der noch ungedruckten Korrespondenz und der gleichfalls noch ungedruckten Tagebücher unter Hinzuziehung von Vorlesungsverzeichnissen und Seminarprotokollen usw. nachgewiesen: dass die Arbeit auf eine sehr kurz befristete Aufforderung hin rasch niedergeschrieben worden ist [wodurch auch gewisse Unebenheiten der Gedankenführung verständlicher werden]; dass der Autor zur Zeit der Abfassung eine Hochschulvorlesung über die Gerechtigkeit gehalten hat; dass die Thematik »Friede« zwar durch den Anlass nahegelegt war, anderseits in dieser speziellen Formulierung sich dadurch erklärt, dass in einem etwa gleichzeitig anzusetzenden Vortragszyklus, als Beispiel für den Aufbau der scholastischen quaestio, der aus der Summa theologica des Thomas von Aquin entnommene articulus angeführt ist: »ob Eintracht und Friede dasselbe seien«. – Überhaupt wird gezeigt, dass die aus nicht ganz einsichtigen Gründen als »Weisheit der Alten« oder als »Ausspruch eines großen Magisters der abendländischen Christenheit« deklarierten Zitate samt und sonders Sätze des Thomas von Aquin sind; man findet sie in den der Edition beigegebenen Anmerkungen vollständig und mit genauem Stellennachweis wiedergegeben. Auch anscheinend Unerhebliches ist mit enormer Akribie aufgehellt; zum Beispiel wird aus Tagebuchaufzeichnungen, die von einer intensiven Dantelektüre sprechen, das sachlich ganz unmotivierte Zitat aus der Divina Commedia plausibel gemacht; gar nicht davon zu reden, dass bestimmte Eigenheiten im Wortschatz und in der Syntax [»Stimmigkeit«, »unauslotbar«, »ins Spiel kommen«] überzeugend als die individuelle Handschrift eben dieses Autors gedeutet sind. – Zweifellos dürfte eine solche »Interpretation«, die in ihrer Thematik, in ihrem Stil und in ihrer Zielsetzung gar nichts aus der Reihe Fallendes wäre, mit Recht eine respektable wissenschaftliche Leistung genannt werden. Und auch der Autor jenes unschuldigen opusculum müsste dem zustimmen. Freilich würde ich, an seiner Stelle, den Einwand nicht unterdrücken: es sei in dieser Deutung nicht ein einziges Anzeichen dafür zu entdecken, ob das inhaltlich Gesagte und also das eigentliche Anliegen der »Meditation« vernommen, ernst genommen und bedacht worden sei; mit einem anderen Wort, ob der Interpret seinem Autor überhaupt »zugehört« habe.
Wie aber würde konkret solches »Zuhören« zu denken sein, wodurch würde es sich unterscheiden, woran könnte man es erkennen? – Lassen wir das Maskenspiel, und sprechen wir wieder von Platon, etwa von seiner im »Menon« und im »Phaidon« formulierten Lehre, die Seele müsse schon vor dieser leibhaftigen Existenz gelebt und die Wesenheiten der Dinge geschaut haben. Wie könnte ich dieser Lehre »zuhören«? Ist es einem Menschen dieser Zeit, ist es einem Christen möglich, diese platonische Meinung noch inhaltlich ernstzunehmen? Ich glaube, ja. Übrigens ist Zuhören weder dasselbe wie Zustimmung noch setzt es sie voraus.
Vorausgesetzt ist jedoch, dass zunächst die zur Rede stehende Frage akzeptiert werde. Zuhören kann ich der Lehre von der Präexistenz der Seele nur, wenn ich die Frage, worauf diese Lehre eine Antwort sein will, im Ernst vollziehe – die Frage also, wie der allererste Anfang des menschlichen Erkennens zustande komme, der doch offenkundig vor aller hiesigen Erfahrung »immer schon« geschehene Anfang. Es ist das keineswegs eine Frage, auf die wir »inzwischen« eine einleuchtende und endgültige Antwort zu geben vermöchten. Wer also diese Frage nicht selber fragt, der kann nicht eigentlich dem »zuhören«, was Platon zu antworten hat: dass nämlich die bloße Empirie zu einer Lösung nicht hinreiche; dass, wie Sokrates es sagt, eine Hinwendung zu denen vonnöten sei, die »weise sind in den göttlichen Dingen«; dass endlich, aufgrund der »theologischen« Auskunft über die sowohl Vergangenheit wie Zukunft umgreifende Unsterblichkeit, angenommen werden dürfe, die Seele besitze vor aller Möglichkeit hiesiger Erfahrung, zeitlich früher und wesenhaft früher, bereits Zutritt zu dem Bereich, in welchem die Urbilder der Dinge zu Hause sind. – Niemand, der dies wirklich bedächte, würde auf den Gedanken verfallen, er sei Platon gegenüber in der Position, diesem Ahnherrn alles abendländischen Philosophierens über die Schulter blicken zu können.
Wirkliches Zuhören also ist an die Voraussetzung geknüpft, dass ich die Frage selbst nicht erst aus Platon [oder aus Aristoteles, aus Augustinus, aus Thomas – und so fort] übernehme, sondern dass dies Fragen sich zuvor schon entzündet hat und sich fortschreitend entfacht im Kontakt mit der mir unmittelbar begegnenden und also mit der jeweils »heutigen« Realität.
Dass dies so ist, zeigt sich alle Tage. Wer sich nicht für das »interessiert«, wovon die Rede ist, der kann nicht zuhören – jedenfalls nicht auf die Weise, wie es der Sprechende selbst, sozusagen von Natur, erwartet. Wer dem anwesenden Gesprächspartner so »zuhören« wollte, wie jener imaginäre Interpret seinem Autor, etwa vornehmlich auf den Sprechstil achtend, auf den Tonfall und das Mienenspiel, auf die Herkunft der verwendeten Bilder und Gedanken – der würde den Sprecher beleidigen und seine Würde verletzen. So seltsam es im ersten Augenblick vielleicht klingt, es ist dennoch wahr: kein Mensch, der unbefangen zu einem anderen spricht, kann wünschen, dass dieser andere es formell und ausschließlich darauf abgesehen habe, zu erfahren, was er, der Sprechende, denkt und sagt. Jedermann wünscht vielmehr, dass der Hörer seine Worte bedenke; das aber heißt: dass er das inhaltlich Gesagte messe an dem, was er für wahr hält. Selbst Widerspruch ist daher dem gesunden Sinn willkommener als jene Neugier, die den Sprecher als solchen meint. Die Würde des im Worte sich äußernden Menschen wird gerade dadurch gewahrt, dass der Blick des Hörers sich nicht auf ihn richtet, sondern auf den Sachverhalt, von dem die Rede ist. Sollte nicht auch dies in jenem Wort des Sokrates gemeint sein, das er im Angesichte des Todes den in der Gefängniszelle versammelten Freunden zuruft, denen sein Argument für die Unsterblichkeit noch nicht völlig einleuchten will, die sich aber scheuen, die untereinander flüsternd ausgetauschten Gegenargumente laut auszusprechen [»… wir wollten dich damit nicht beunruhigen, in deinem gegenwärtigen Unglück«], – in jenem zurechtweisenden Wort: »Kümmert euch nicht um Sokrates, kümmert euch um die Wahrheit«?
Bei Thomas von Aquin gibt es eine ähnliche Wendung. Sie setzt zwei Fragerichtungen einander entgegen: die eine gehe auf das, »was andere gedacht haben«; die Zweite richte sich darauf, »zu erfahren, wie die Wahrheit der Dinge sich verhält«. Dieser Ausspruch ist, wie man weiß, in Büchern und Abhandlungen viele Male zitiert worden. Man hat aber nur selten bemerkt, dass die volle Schärfe seiner Aussagekraft sich erst zeigt, wenn der sehr besondere Zusammenhang hinzubedacht wird, in dem er sich findet. Er findet sich nämlich in einem Kommentar [zu Aristoteles], in einem Buche also, das offenbar keine andere Absicht verfolgt, als herauszubekommen, was ein »Anderer« gedacht hat. – Dies bedeutet doch wohl, dass Thomas der Meinung ist, man könne also auf solche Weise zu erfahren suchen, »was andere gedacht haben«, dass dennoch das eigentliche Augenmerk zugleich darauf gerichtet bleibe, »zu erfahren, wie die Wahrheit der Dinge sich verhält«.
Wenn Thomas diese auf die Wahrheit der Dinge gerichtete Zuwendung »philosophisch« nennt, und wenn man mit einigem Recht die entgegengesetzte Fragerichtung [»was andere gedacht haben«] als die der Historie bezeichnen kann – so ist damit an die Frage gerührt, wie jene philosophische Betrachtungsart sich prinzipiell zu dieser historischen verhalte. Doch ist das ein neues Thema, auf das ich mich nicht einlassen werde.
Diese Bemerkungen haben nicht »Nutzen und Nachteil der Historie« überhaupt zum Gegenstand. Sie handeln vielmehr von einigen Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit, im Umgang mit den Großen, ein fruchtbares Zuhören und eine philosophierende Interpretation zustande kommen könne. Zu diesen Voraussetzungen gehört zweifellos auch ein gewisses Maß an historischer Kenntnis; es gibt historisches Wissen, wodurch das Zuhören erleichtert, intensiviert oder auch überhaupt erst ermöglicht wird. Dennoch handelt es sich dabei nicht um eine Proportion von solcher Art, dass, wenn die eine Seite zunimmt, notwendig auch die andere stärker werden müsste. Offenbar wussten die Alten, was sie sagten, wenn sie hier von einer Gegensätzlichkeit sprachen.
So ist es ein höchst bedenkenswertes Faktum, dass ein bis heute unübertroffener Aristoteles-Kommentar einen Mann zum Verfasser hat, der nicht allein kaum des Griechischen mächtig war, sondern auch keine Ahnung hatte von dem Zustandekommen etwa der aristotelischen Metaphysik, die er für ein einheitlich geplantes Buch hielt, während die Historie uns gelehrt hat, dass sie eine ziemlich zufällige Sammlung sehr verschiedenartiger Stücke sei. Dieser Mann ist Thomas von Aquin. – Nun gut, was soll hier »bedenkenswert« sein? Was »folgt« aus diesem Faktum? Wir wollen mit äußerster Vorsicht zu antworten versuchen. Natürlich ist zunächst zu bedenken, dass Thomas ein genialer Interpret ist und dass ihn überdies eine ungewöhnlich tiefe Wesensverwandtschaft mit seinem Autor Aristoteles verbindet. Natürlich ist ferner nicht zu bestreiten, dass Thomas vielleicht einen noch großartigeren Kommentar geschrieben hätte, wenn er sich statt auf eine schlecht und recht zureichende lateinische Übersetzung auf die kritische Oxforder Textausgabe von W. D. Ross hätte stützen können. Bedenkenswert aber ist offenbar vor allem dies: dass es nicht unmöglich ist, selbst einer nur undeutlich vernommenen Stimme wahrhaft zuzuhören; und dass dies primär auf »die Wahrheit der Dinge« gerichtete Zuhören, jener Undeutlichkeit zum Trotz, eine so tiefdringende Aufschließung und Erhellung nicht allein des Gehörten, sondern der Welt im Ganzen zur Frucht haben kann, wie sie sich mit der äußerst fortgeschrittenen Perfektion der historischen Textkritik kaum je einmal verbunden hat.
Es gibt aber noch ein weit bedenklicheres Faktum. Nicht nur scheint die genauere historische Kenntnis ein intensiveres, fruchtbareres Zuhören nicht schon ohne Weiteres zu ermöglichen oder gar zu begünstigen; sie kann ihm geradezu im Wege sein.
Aus den vom Bolschewismus beherrschten Ländern wird berichtet, dass die dort zugelassenen Ausgaben der Werke Platons oder Dantes mit einem Vorwort erscheinen, das dem Leser ein »historisches« Verständnis vermitteln und ihn zugestandenermaßen daran hindern soll, jene Werke »unmittelbar ernstzunehmen«. Natürlich wird man solche Erläuterungen nicht für wirkliche »Historie« halten. Dennoch ist, glaube ich, das tatsächlich Gesagte weniger entscheidend als die Ablenkung des Blickes, der, statt auf den Gehalt des Werkes, auf den Autor und die Bedingnisse der Aussage gerichtet ist. Entscheidend ist die Verhinderung des Zuhörens. – Ist aber diese Verhinderung nicht eine recht allgemeine Erscheinung? Gilt nicht für einen großen Teil des gelehrt-historischen Schrifttums über Homer, über Platon, über die Heilige Schrift, über die überlieferte Gestalt der Kulthandlung genau das gleiche: dass nämlich die rein hörende Zuwendung, der unmittelbare Mitvollzug, die wortlose Offenheit des Empfangens erschwert oder verhindert wird?
Es ist gewiss, dass hier Fragen ins Spiel kommen, die noch nicht einmal ausdrücklich gestellt sind, geschweige denn, dass sie beantwortet wären. Wie auch immer aber sie zu formulieren sein mögen, und wie auch die Antwort wird lauten müssen – der Fund unserer bescheidenen Überlegung bleibt davon unberührt:
Einzig wer auf die Weise die Großen liest, Platon, Vergil, Thomas, dass er nicht eigentlich danach fragt, »was andere gedacht haben«; nur wer sich auf solche Weise einem dichterischen oder auch einem heiligen Text nähert, dass er sich nicht eigentlich um den Autor, um die Textgeschichte, um den Erbgang der Materialien kümmert, sondern um die Antwort, das Licht, die Weisung, um die Wahrheit – nur der hört wirklich zu, er allein. Nur wer angesichts der zeitüberdauernden Gestalt von Weistum, Dichtung oder Sakrament den inneren Blick, schweigend und aufmerksam, auf die verborgene Wurzel der Welt und des Lebens richtet – nur der vermag der »Botschaft« ansichtig und teilhaftig zu werden.
I
Nicht nur die Heiligen, auch die Philosophen sagen: sowohl Gottes wie des Engels wie auch des Menschen äußerstes Glück und Seligsein sei, Gott zu schauen
THOMAS VON AQUIN
Erkenntnis und Freiheit
(1953)
Die Formulierung »Wissenschaft und Freiheit« zielt, hier und heute ausgesprochen, auf eine gegnerische Position. Sie ist gemünzt auf einen Gegner, der die Freiheit der Wissenschaft sowohl theoretisch verneint wie auch praktisch gefährdet, einschränkt, zerstört.
Wenn es aber mit dieser Gegnerschaft auf eine geistige Auseinandersetzung abgesehen ist, also nicht auf eine bloße »Demonstration« [der eklatante Bedeutungswandel dieses Wortes »Demonstration« hat eine untergründige Beziehung zum Thema!], dann ist es vonnöten, dass die gegnerische Position erkannt sei, nicht nur in ihrer konkreten Erscheinungsform, sondern in ihrer Wurzel. Erst dann nämlich ist Klarheit darüber zu erwarten, von welcher Art und von welcher Kraft das Gegenargument sein müsste, welches allein eine hinreichende Antwort sein kann, eine die innerste Meinung des Gegners treffende Widerlegung.
Dies ist nicht so generell und nicht so »rein akademisch« gemeint, wie es sich vielleicht zunächst anhört. – Seit den Anfängen des kritischen Schrifttums über den Bolschewismus ist es immer wieder gesagt worden: dass er, der Bolschewismus, keineswegs eine unvermittelt auftretende Absonderlichkeit sei, dass er vielmehr im Grunde »die geheime, verborgene Weltanschauung der bürgerlichen Gesellschaft« selbst offen ausspreche, zum Beispiel die Absolutsetzung der ökonomischen Tätigkeit; dass der Osten formell das Fazit ziehe aus dem, was der Westen tatsächlich denke; dass wir »in unserem wohlberechtigten Kampfe gegen den sowjetischen Sklavenstaat durch eines behindert« seien, dadurch nämlich, dass in unserer eigenen Gesellschaft die gleiche Tendenz lebendig sei. Das sind drei wahllos gegriffene Zitate – aus einem historisch-kritischen Werk über den Bolschewismus, aus einem Gefangenschaftsbericht, aus einer Streitschrift über die Freiheit. Zweifellos handelt es sich dabei um recht zugespitzte Formulierungen. Immerhin, sie geben zu bedenken, dass man sich in der geistigen Auseinandersetzung mit dem Bolschewismus auf eine einigermaßen verwickelte Situation gefasst machen muss.
Es könnte zum Beispiel geschehen, dass man sich, um der Widerlegung des Gegners willen, plötzlich genötigt sähe, die eigenen Voraussetzungen zu revidieren. Eine Erfahrung von dieser Art wird, wie ich glaube, tatsächlich demjenigen zuteil, der es unternimmt, der Indienstnahme der Wissenschaft durch den totalitären Arbeitsstaat auf den Grund zu gehen. Genauer gesprochen: wer sich gegen diese Indienstnahme wendet, durch welche die Freiheit der Wissenschaft angetastet wird – wer sich hiergegen wendet, nicht in der Weise des politischen Kampfes und des aktiven oder passiven Widerstandes, sondern in der Weise der geistigen Auseinandersetzung [einzig hiervon ist die Rede] –, der sieht sich Argumenten gegenüber, die er nicht anders entkräften kann, als indem er zugleich einige Vorstellungen korrigiert, die schon seit Langem, schon seit Jahrhunderten im Bereich der westlichen Zivilisation mit einer Art Selbstverständlichkeit akzeptiert worden sind. Es sind das Vorstellungen, die dem widersprechen, was bis dahin im Abendlande unangezweifelte Gültigkeit besaß; sie widerstreiten [heißt das] dem, was nicht allein die großen Lehrer der Christenheit – Augustinus nicht anders als Thomas von Aquin –, sondern auch Platon und Aristoteles gedacht haben. Diese alten und jene neuen Vorstellungen betreffen beide sehr präzis unser Thema, nämlich den Sinn von Erkenntnis überhaupt und den Zusammenhang von Erkenntnis und Freiheit.
Was ich also behaupten möchte, ist, in einem bejahenden Satze ausgedrückt, das Folgende: Gegen den Verfall der Freiheit der Wissenschaft, wie er sich im totalitären Arbeitsstaat vollzieht, kann, auf dem Felde der geistigen Auseinandersetzung, nur dann etwas ins Gewicht Fallendes ausgerichtet werden, wenn zugleich einige fundamentale Einsichten wieder realisiert werden, welche in der vor-neuzeitlichen Tradition des Abendlandes formuliert worden sind.
Von diesen Einsichten ist nun, notgedrungen einigermaßen summarisch, zu sprechen. – Eine von ihnen, die wichtigste, findet sich ausgesprochen in der aristotelischen Metaphysik. Auf den ersten Seiten dieses Buches, das ja wohl als eine der »kanonischen« Schriften des abendländischen Geistes bezeichnet werden darf – auf den ersten Seiten schon ist von der Freiheit der Erkenntnis die Rede. Doch muss ich präziser sprechen. Es ist da von einer bestimmten Erkenntnis, von einer bestimmten Erkenntnisbemühung oder Erkenntnisunternehmung gesagt: sie sei, unter allen anderen, auf die höchste Weise frei; ja sogar, sie allein sei frei zu nennen; und zwar sei dies »offenbar« so. Gemeint ist die Erkenntnis, die sich auf das Ganze der Wirklichkeit richtet, auf die Bauform der Welt insgesamt. Gemeint ist die Erwägung der Frage, was das sei: das Wesen und das Sein der Dinge, überhaupt und letzten Grundes. Es ist gemeint die aus der innersten Mitte des Geistes her in Gang gebrachte Zuwendung der Erkenntniskraft zur Gesamtheit dessen, was ist, zum Sinn und Urgrund des Totum alles Wirklichen; das heißt: die Zuwendung der Erkenntniskraft zu ihrem vollen und ungeschmälerten und durch nichts eingeschränkten Gegenstand. Es ist gemeint »Erkenntnis schlechthin«, die nicht auf etwas Einzelnes beschränkt bleibt, in deren Dynamik aber dennoch alle einzelnen Erkenntnisakte, die das Konkrete oder einen besonderen Aspekt der Wirklichkeit meinen, also auch die »wissenschaftliche« Erkenntnis, mithineingerissen sind. Gemeint ist, kurz gesagt, die Erkenntnisweise, die Aristoteles hier die »eigentlichst philosophische« nennt. Es zeigt sich, dass es sich also keineswegs dabei um etwas abgetrennt »Metaphysisches« handelt [Aristoteles kennt und gebraucht bekanntlich diesen Ausdruck überhaupt nicht]. Es handelt sich gerade um den in allen konkreten Erfahrungen und Schlussfolgerungen wirkenden, sie alle einbegreifenden und sammelnden Impetus der »Erkenntniskraft im Ganzen«, sich richtend auf den ihr gemäßen »Gegenstand im Ganzen«.
Diese Gestalt von Erkennen also ist es, von der Aristoteles sagt, sie allein sei frei. Die Frage ist: was heißt hier »frei«? Wir befinden uns durchaus an dem kritischen, an dem neuralgischen Punkt des Problems. »Frei«, so sagt Aristoteles [und damit formuliert er einen vermutlich uralten Gedanken, den zum Beispiel auch sein Lehrer Platon ausgesprochen hatte und der späterhin das ganze abendländische Denken beherrscht] – »frei« bedeutet hier so viel wie »nicht-praktisch«. Praxis besagt Realisierung von Zwecken; das Zweckdienliche ist das Praktische. Jene Erkenntnis aber, die sich auf den Urgrund der Welt richte, sie allein, »diene« nicht zu irgendetwas [das ist die Meinung]; es sei gar nicht einmal möglich und denkbar, sie auf irgendeinen »Gebrauch« zu beziehen: »sie allein nämlich ist um ihrer selbst willen da«. Ebendies nun: nicht für etwas Fremdes dazusein, sondern für sich selbst und um seiner selbst willen – eben dies nennt die Menschensprache »Freiheit«.
Es sind aber, in diesem unerhört konzisen [wenig mehr als zwanzig Zeilen langen] Abschnitt der aristotelischen Metaphysik, sogleich noch einige weitere Kennzeichnungen jener freien und nicht-praktischen Erkenntnis hinzugefügt, die man nicht auslassen darf. Aristoteles fügt Folgendes noch hinzu: die das Ganze der Welt ins Auge fassende Erkenntnis, einzig um ihrer selbst willen geschehend und insofern frei – diese Erkenntnis könne unmöglich dem Menschen ganz und gar gelingen; er bekomme sie nicht völlig in die Hand; sie sei also nicht etwas uneingeschränkt Menschliches, da doch der Mensch selber ein auf so vielfache Weise den Notdürften unterworfenes, ihnen dienstbares Wesen sei. Man müsse geradezu sagen: einzig Gott vermöge diese Erkenntnis völlig zu verwirklichen, wie es ja auch die göttliche Wurzel aller Dinge sei, worauf sie sich richte. Ebendarum aber habe keine andere Wissenschaft solchen Rang und solche Würde wie die philosophische Erkenntnis, obwohl sie alle notwendiger seien: necessariores omnes, dignior nulla [so heißt es im Latein der versio antiqua]. – Soweit Aristoteles.
Es ist hiermit der Grundriss einer Weltansicht gezeichnet, in welcher der Begriff »Freiheit der Wissenschaft« seinen Ursprung hat. Doch ist mit »Ursprung« nicht allein das historische Herkunftsverhältnis gemeint – wenngleich auch dies gesehen werden muss. Es ist in der Tat so, dass dieses zweite Kapitel der aristotelischen Metaphysik die beiden Begriffe »Freiheit« und »Wissen« zum ersten Mal in der abendländischen Geistesgeschichte miteinander in Zusammenhang gebracht hat. Thomas von Aquin hat, anderthalb Jahrtausende später, in seinem Kommentar zu diesem gleichen Kapitel die Definition der artes liberales formuliert [von diesem Terminus leitet sich bekanntlich der mittelalterliche Name der philosophischen Fakultät her: »Artistenfakultät«]. Und wenn, vor genau hundert Jahren, John Henry Newman in seinem schon klassisch gewordenen Buch »The Idea of a University« von »liberal knowledge or a gentleman’s knowledge« spricht, so stellt er sich damit ausdrücklich in die gleiche Tradition. – Wichtiger aber als die historische Herleitung scheint mir zu sein, dass der Begriff oder vielmehr der Anspruch »Freiheit der Wissenschaft« seine Legitimierung und seine innere Glaubwürdigkeit verlieren muss, wenn er abgetrennt wird von seinem Ursprung, nämlich von dem Fundament jener Weltansicht. Ebendies ist es, was, wie ich glaube, zu Beginn der Neuzeit geschehen ist.
Will man jene zugrunde liegende Weltansicht, die freilich eher noch eine Ansicht vom Wesen des Menschen ist und vom Sinn des menschlichen Daseins – will man sie auf einige knappe Sätze bringen, so wird man etwa das Folgende sagen müssen:
Erstens: Wie sehr auch der Mensch ein zunächst praktisches Wesen ist, darauf angewiesen, durch Indienstnahme der Weltdinge seinen Lebensbedarf herbeizuschaffen – sein eigentlicher Reichtum wird ihm dennoch nicht durch die technische Unterwerfung der Kräfte der Natur zuteil, sondem im rein theoretischen Erkennen von Wirklichkeit. Das Dasein des Menschen ist umso reicher, je tiefer die Wirklichkeit ihm zugänglich und erschlossen ist. Als ein Erkennender verwirklicht er sein Wesen am reinsten, sodass sogar seine letzte Vollendung und Erfüllung in einem Erkennen besteht; das Ewige Leben wird ein Schauen genannt, eine visio. – Dies ist nicht eine spezifisch christlich-theologische Vorstellung; sie findet sich ebenso bei Aristoteles, und auch Anaxagoras spricht sie auf seine Weise aus, wenn er auf die Frage »Wozu bist du geboren?« die Antwort gibt: »Zum Schauen von Sonne, Mond und Himmel« – womit er nicht die physischen Himmelskörper gemeint haben dürfte, sondern den Weltzusammenhang im Ganzen. Zweitens: Weil also der Mensch, theoretisch erkennend, am ehesten das tut, was er selber im Grunde und eigentlichst will [worin ja der Begriff »Freiheit« besteht: tun, was man selber will!] – darum ist nicht nur die Erkenntnis »frei« zu nennen, und zwar umso mehr, je mehr sie theoretisch ist; sondern: der Mensch selbst, auch er, ist umso mehr frei, je mehr er ein theoretisch Erkennender ist, auf Wahrheit gerichtet und auf nichts sonst. Hier stimmt die Erfahrung zu: wo immer einer sich, unabhängig von den unmittelbaren Lebenszwecken, rein erkennend der Wirklichkeit zuwendet; wo immer er, unbekümmert um Nutzen, Schaden, Gefahr, Tod, zu sehen und gar zu sagen vermag: »So ist es und nicht anders« [»Der Kaiser hat ja keine Kleider an«] – da ist in besonderem Sinn menschliche Freiheit realisiert. Frei zu machen: dies kommt, nach einem verehrungswürdigen Wort, gerade der Wahrheit zu.
Das ist im Abendland immer wieder neu formuliert worden. Auch Martin Heidegger spricht aus dieser gleichen Tradition, wenn er das Wesen der Wahrheit selbst in die Freiheit setzt.
Drittens: Es gibt Stufen der Erkenntnis – und also auch der im Erkennen realisierten Freiheit. Die höchste Stufe wäre dann gewonnen, wenn die Erkenntniskraft ihren vollen Gegenstand ganz und gar erfasste; zugleich wäre damit der äußerste Grad von Freiheit verwirklicht: der Mensch würde in vollendeter Weise das tun, was er eigentlich will. Das ist im Irrealis gesagt. Dies Ziel nämlich kann, in der leibhaftig-geschichtlichen Existenz des Menschen nicht erreicht werden – obwohl es die ganze Dynamik dieser gleichen Existenz in Gang hält. Das ist gemeint in dem aristotelischen Satz: die auf den Urgrund der Wirklichkeit im Ganzen gerichtete Frage sei »eine seit je und heute und für immer offene und weiter gefragte Frage« – wozu der mittelalterliche Kommentator Thomas von Aquin die tiefsinnige Anmerkung gemacht hat: gerade weil die Antwort nicht unser verfügbares Eigentum werden könne, gerade darum werde diese Weisheit um ihrer selbst willen gesucht [womit einschlussweise gesagt ist: wir können die endgültigen, die abschließenden Antworten, wie die exakte Wissenschaft sie gibt, nicht im vollen Sinn »um ihrer selbst willen«, nicht als etwas auf die höchste Weise in sich selbst Sinnvolles suchen].
An diesem Punkt ist etwas, wie ich glaube, sehr Einschneidendes gesagt über die Wissenschaft [im engeren Sinn]: Trotz der Exaktheit ihrer Antworten ist sie nicht die höchste Gewalt von Erkenntnis. Und auch in Bezug auf die Freiheit hat sie eine Mittelstellung, ja fast eine zweideutige Stellung inne. Dies zeigt sich in zwei Sachverhalten. – Punkt eins: Die Selbstbeschränkung des Menschen auf die im strengen Sinn wissenschaftliche Erkenntnis kann bedeuten, dass er die Offenheit für den uneingeschränkten Gegenstand der Erkenntnis verliert. Anders gesagt: es gibt eine besondere Form der geistigen Unfreiheit, deren Wurzel das ausschließliche Ideal der Wissenschaftlichkeit ist. – Punkt zwei: Es ist nicht wider die Natur der Wissenschaft, in Dienst genommen zu werden für Zwecke, die außerhalb ihrer selbst liegen; es geschieht der Wissenschaft kein Unrecht, wenn sie Aufgaben entgegennimmt aus dem Bereich der Praxis – sei dies die politische, die wirtschaftliche, die technische, die militärische Praxis. Hierdurch wird die Wissenschaft nicht schon zerstört; während die Philosophie, weil sie es mit dem Ganzen der Wirklichkeit, mit dem schlechthin um seiner selbst willen gesuchten Gegenstand von Erkenntnis überhaupt zu tun hat – die Philosophie würde durch eine solche Beauftragung eo ipso zerstört; man kann sie in Dienst zu nehmen meinen, aber siehe da: das in Dienst Genommene ist nicht mehr Philosophie. Freilich, es ist auch in der Wissenschaft, in ihrer innersten Zelle, ein Element, das nicht in Dienst genommen werden kann: dies ist das philosophische Element von theoria, die auf Wahrheit gerichtet ist und auf nichts sonst. Das heißt: die Wissenschaft hat, kraft ihres Wesens, dadurch Anspruch auf Freiheit, dass sie nicht-praktisch ist, sondern theoretisch.
Dies ist die Quintessenz aller bisherigen Auskünfte: die Freiheit der Erkenntnis ist aufs engste verknüpft, ja geradezu identisch mit ihrem theoretischen Charakter. Wer die Freiheit der Wissenschaft antastet oder zerstört, der kann dies nur tun, indem er ihren theoretischen Charakter antastet oder zerstört. Anderseits: wer den theoretischen Charakter der Erkenntnis preisgibt oder für unwesentlich erklärt gegenüber dem Charakter der Praktizierbarkeit, der begibt sich der Möglichkeit, den Anspruch auf Freiheit der Wissenschaft zu begründen.
In diese seltsame Lage sind wir gebracht worden durch einige Thesen, die zu Beginn der »neuen Zeit« aufgestellt worden und seitdem ein Bestandteil des modernen Bewusstseins geworden sind. Man kann sehr wohl zugeben, dass solche Thesen nicht ohne legitimen Anlass zutage getreten sind, und man kann dennoch der Meinung sein, dass sie falsch sind oder zum mindesten korrekturbedürftig. – Ich denke hier des Näheren an den Satz aus Descartes’ Discours de la Méthode: es müsse an die Stelle der alten theoretischen Philosophie eine neue, »praktische« treten, um uns in den Stand zu setzen, zu Herren und Eigentümern der Natur zu werden [par laquelle … nous pourrions … nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature] – welcher Gedanke fast wörtlich wiederkehrt in der These des amerikanischen Pragmatismus, dass alle menschliche Erkenntnis, im Rahmen der »intellektuellen Industrie«, Werkzeug-Charakter habe; dass die »Sicherung des Lebens und des Lebensgenusses das Ziel jeder Denkbemühung« sei; dass vor allem die Philosophie letztlich nicht auf die Erkenntnis der Welt ziele, sondern darauf, Wege zu finden, sie zu beherrschen. Ich zitiere noch eine dritte These: »Ein Wissenschaftler, der sich mit abstrakten Problemen befasst, darf niemals außer Acht lassen, dass das Ziel aller Wissenschaft in der Befriedigung der Bedürfnisse der Gesellschaft besteht.« Niemand wird behaupten wollen, es bestehe ein prinzipieller Unterschied zwischen der These von Descartes und Dewey einerseits und dem zuletzt angeführten Satz anderseits, der arglistigerweise aus der »Großen Sowjet-Enzyklopädie« entnommen ist.
In allen diesen Sätzen ist offenkundig der theoretische Charakter der Erkenntnis verneint. [Wer übrigens der Wirklichkeit ausschließlich in der Haltung »Wie werde ich Herr und Eigentümer?« gegenübertritt, der bringt es einfach nicht zuwege, rein theoretisch, d. h. um Wahrheit bekümmert und um sonst nichts, das Ganze der Welt und das Wesen der Dinge ins Auge zu fassen.] – Aber auch die Freiheit ist unmöglich geworden; genauer gesagt, es ist unmöglich geworden, sie mit einem glaubwürdigen Argument zu verteidigen.
Wenn die Wissenschaft im totalitären Arbeitsstaat in die Lage gekommen ist, unausgesetzt die inquisitorische Frage beantworten zu müssen: worin ihr Beitrag zum Fünfjahresplan bestehe – so ist das nichts anderes als die strikteste Konsequenz jenes Descartes’schen Satzes von der Philosophie des maître et possesseur de la nature.
Es deutet sich hier eine extreme Möglichkeit an, die unserer Erfahrung schon nicht mehr völlig fremd zu sein scheint. Wenn einmal die Gewissheit verlorengegangen ist, dass es die Erkenntnis der Wahrheit ist, welche den Geist eigentlich frei macht – wenn dies einmal vergessen ist, dann kann es vielleicht geschehen, dass der Begriff Freiheit selber dem Geiste fraglich und ungreifbar, ja unkenntlich wird: man weiß einfach nicht mehr, was damit gemeint ist. – So liest man mit Betroffenheit in den allerletzten Aufzeichnungen von André Gide die Eintragung: »Tausende sind bereit, ihr Leben hinzugeben, um einen besseren Zustand der irdischen Verhältnisse herbeizuführen: mehr Gerechtigkeit, eine gleichmäßigere Verteilung der irdischen Güter; kaum wage ich hinzuzufügen: mehr Freiheit – weil ich nicht genau weiß, was man darunter versteht.« – Doch mag die Frage, wie diese merkwürdige Notiz zu deuten sein möchte, hier auf sich beruhen bleiben. Es lag mir einzig daran, deutlich zu machen, dass der Begriff »Freiheit der Wissenschaft« aus einer vielleicht unvermutet tief reichenden Wurzel lebt, und dass ein so radikaler Angriff wie der, mit dem wir es heute zu tun haben, den Verteidiger nötigt, diesen Ursprung zu bedenken.
Es gibt einen denkwürdigen Satz, der diesen Ursprung, nämlich die äußerste Gestalt der Freiheit des Erkennenden, auf eine bewegende Weise beim Namen nennt. Der Satz ist denkwürdig vor allem wegen des Mannes und auch wegen der besonderen Situation, in der er ausgesprochen oder vielmehr niedergeschrieben worden ist. Der Mann ist eine in ausgezeichnetem Sinne abendländische Figur: ein Römer, der seine Studien in Athen gemacht hat und dann, am Hofe eines germanischen Fürsten, der heraufziehenden Epoche das Weisheitserbe der Antike zu übermitteln sucht: Boethius. Die Situation aber ist die des Gefangenen. Der eingekerkerte Boethius versichert sich, in der Erwartung der Hinrichtung, seiner letzten, unzerstörbaren Freiheit, indem er sagt: »Am freiesten ist die menschliche Seele notwendig dann, wenn sie sich bewahrt in der Betrachtung des göttlichen Geistes.«
Über das Verlangen nach Gewissheit
(1953)
Zur Würde des Wissens gehört Gewissheit: das ist ein alter Satz, mit dem es übrigens bei den Alten seine besondere Bewandtnis hat – wovon noch zu sprechen sein wird. Zunächst scheint dies völlig klar und selbstverständlich zu sein; ich »weiß« etwas erst dann wirklich, wenn ich es mit Sicherheit und verläßlich weiß, d. h. wenn ich Gewissheit habe. Und auch dies ist leicht deutlich zu machen: es handelt sich hier nicht um eine Sache, die etwa allein den Wissenschaftler anginge [wenn auch diesen in besonderer Weise]; nein, es steht des Menschen Verhältnis zur Wirklichkeit im Ganzen zur Rede. Wissen, Sehen, Kennen – das ist die Grundgestalt aller Wirklichkeitsbeziehung; alles geistige Weltverhältnis des Menschen wurzelt im Erkennen, in dieser Ur-Gebärde der Seinsergreifung und der Weltbemächtigung. Ich frage also, indem ich nach der Vollkommenheit des Wissens und Erkennens frage, zugleich nach der größeren oder geringeren Vollkommenheit des Weltverhältnisses, des Wirklichkeitskontaktes, der Seinsergreifung. Dies Verhältnis des Menschen zu seiner Welt ist dann »in Ordnung«, es hat dann seine endgültige Richtigkeit und Vollkommenheit, wenn es auf Gewissheit beruht, d. h. wenn ich der fundamentalen Sachverhalte, mit denen ich es zu tun habe, unumstößlich sicher bin; wenn ich sie untrüglich und völlig zuverlässig im Griff habe, wenn ich ihrer – heißt das – absolut gewiss bin. Zur Würde des Wissens gehört Gewissheit!
Ich sagte, mit diesem Satz habe es eine besondere Bewandtnis, was die Stellungnahme der Alten angehe. Die Sache ist einigermaßen verwirrend und nicht leicht zu verdeutlichen. Die Alten haben diesen Satz nicht geradezu abgelehnt, natürlich nicht; aber sie haben ihm eine Einschränkung von äußerster Wichtigkeit hinzugefügt.