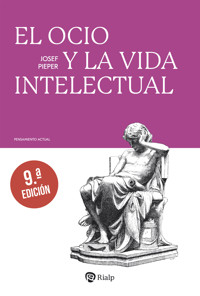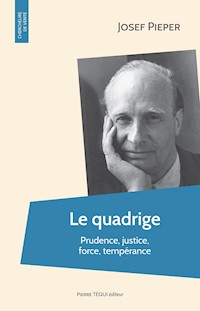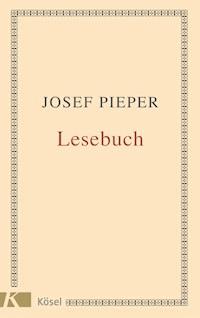2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kösel
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Die in diesem Band zusammengefassten Arbeiten verstehen sich durchweg als »notgedrungene Klärungsversuche, provoziert durch ›die Schwierigkeit, heute zu glauben‹«. Sie sprechen von der Realität des Sakralen, von der »irdischen Kontemplation«, der möglichen Zukunft der Philosophie, der »Kunst, nicht zu verzweifeln«, vom Zusammenhang zwischen Missbrauch der Sprache und Missbrauch der Macht. Das Buch ist nicht nur geprägt durch die Überzeugung, der Mensch könne nicht bloß dadurch zu Schaden kommen, dass er den Anschluss an die Zukunft versäumt, sondern auch dadurch, dass er das Unentbehrliche verliert und vergisst. Dennoch träfe der Versuch, es in die Rubrik »konservativ« einzuordnen, am Kern der Sache vorbei.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 364
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
JOSEF PIEPER
Über die Schwierigkeit heute zu glauben
Aufsätze und Reden
KÖSEL-VERLAG MÜCHEN
Über dieses Buch:
Die in diesem Bande zusammengefassten Arbeiten verstehen sich durchweg als »notgedrungene Klärungsversuche, provoziert durch ›die Schwierigkeit, heute zu glauben‹«. Sie sprechen von der Realität des Sakralen, von der »irdischen Kontemplation«, der möglichen Zukunft der Philosophie, der »Kunst, nicht zu verzweifeln«, vom Zusammenhang zwischen Missbrauch der Sprache und Missbrauch der Macht. Und die Reihe der darin aufgerufenen Zeugen reicht von Platon über die großen mittelalterlichen Lehrer bis zu Sartre und Garaudy. – Das »Heute«, die geistig-moralische Situation dieser unserer Zeit, wird, wie nicht anders zu erwarten, kritisch in den Blick genommen, diesmal vor allem unter dem Aspekt des scharfen Hegel-Wortes von den »Verwüstungen der Theologie«. Zwar ist das Buch, angesiedelt im Grenzbereich von geglaubter und gewusster Wahrheit, geprägt durch die Überzeugung, der Mensch könne nicht bloß dadurch zu Schaden kommen, dass er den Anschluss an die Zukunft versäumt, sondern auch dadurch, dass er das Unentbehrliche verliert und vergisst. Dennoch träfe der Versuch, es in die Rubrik »konservativ« einzuordnen, am Kern der Sache vorbei. Allerdings fordert das Buch den Leser zu der selbstkritischen Frage heraus: die Bewahrung oder Preisgabe von was eigentlich steht heute zur Diskussion?
eISBN 978-3-641-18010-2
© 1974 by Kösel-Verlag GmbH & Co., München. Gesamtherstellung: Graph. Werkstätten Kösel, Kempten
www.randomhouse.de
Inhaltsverzeichnis
Vorbemerkung
»Die Schwierigkeit zu glauben« gibt es natürlich nicht erst seit »heute«; sie besteht zu jeder Zeit; etwas anderes ist auch gar nicht zu erwarten. Schließlich verlangt die menschliche Vernunft kraft ihrer Natur nach Erfahrung und zwingender Argumentation. Glauben hingegen heißt: etwas als wahr und wirklich akzeptieren – nicht aufgrund eigener Einsicht in den Sachverhalt, sondern indem man sich auf seine Bezeugung durch jemand anders verlässt. Der freilich muss dem Glaubenden als ein nicht gleichfalls Glaubender gelten können, vielmehr als einer, der sieht und weiß. Im Fall des religiösen Offenbarungsglaubens verschärft sich die Schwierigkeit noch um eine ganze Dimension; denn der Zeuge und Bürge, auf dessen Wort er sich stützt, Gott selber, begegnet uns ja nicht unmittelbar. Weil aber trotz allem solcher Glaube selbstverständlich nicht ins Blaue hinein geschieht noch auch geschehen darf, darum wird es begreiflich, wieso auf diesem Felde Unstimmigkeit und Konflikt etwas nicht von vornherein Vermeidbares sind.
Dennoch hat »heute« die Schwierigkeit zu glauben ein besonderes Gesicht und auch neuartige Gründe. Dies ist der Punkt, von den »Verwüstungen der Theologie« zu reden. Die Formulierung ist zwar bereits anderthalb Jahrhunderte alt; sie stammt von Hegel, aus seinem letzten Lebensjahrzehnt. Das mit ihr Gemeinte aber besitzt gerade für den gegenwärtigen Augenblick eine beklemmende Aktualität. Das Wort zielt auf den aufgeklärten, biblisch gebildeten Agnostiker und auf eine ohne Glauben betriebene »Theologie«. Georges Bernanos hat sie im Titel eines fast prophetischen Romans bei ihrem wahren Namen genannt und sie als das bezeichnet, was sie wirklich ist, als »Betrug«. Und es ist eben dieser Betrug, der »heute« dem Durchschnittsmenschen die Chance des Glaubenkönnens hoffnungslos zu versperren droht.
Nun vermag ich natürlich nicht die Meinung Hegels zu teilen, jene durch eine Pseudo-Theologie angerichteten »Verwüstungen« könnten durch die Kraft der philosophischen Vernunft geheilt werden. Gleichwohl bin ich davon überzeugt, dass hier dem Philosophierenden ein Amt zufällt, das von niemandem sonst wahrgenommen werden kann. – Der von den großen Lehrern der Christenheit immer neu formulierte Gedanke von der Gnade, welche die Natur nicht zerstöre, sie vielmehr voraussetze und vollende – dieser in einer spezifisch theologischen Weltkonzeption gründende und daher von der modischen Pseudo-Theologie durchweg ignorierte Gedanke besagt ja zum Beispiel auch, die gläubige Annahme der Gottesoffenbarung sei an die Bedingung geknüpft, dass wir bestimmte, der natürlichen Vernunft erreichbare Wahrheiten im Bewusstsein lebendig realisieren, das heißt sie nicht nur zur Kenntnis nehmen, sondern sie auch wahrhaben wollen und sie so erst wirklich zu einem Teil unserer Lebenshabe machen.
Pseudo-Theologie bestimmt selbstmächtig die eigene Domäne und dünkt sich selbst genug. Wahre Theologie weiß sich auf die vorausliegende Norm der göttlichen Offenbarung verpflichtet und zugleich der Partnerschaft einer unabhängigen Befassung mit der natürlichen Realität bedürftig; in ihren innersten Bereich gelangt man ferner nur durch einen Vorhof. Wer den Sinn von Zeichen und Symbol nicht erfasst, kann niemals begreifen, was ein Sakrament ist; und nur wer eine Ahnung davon besitzt, was eine heilige Handlung ist, gewinnt Zugang zu einem Verständnis des Kultmysteriums der Christenheit.
In diesem Vorfeld, in der Region also der praeambula, und zwar der des Glaubens wie des Sakraments, ist die Aufgabe angesiedelt, der die folgenden Arbeiten verpflichtet sind. Fast ausnahmslos verstehen sie sich als notgedrungene Klärungsversuche, provoziert durch »die Schwierigkeit, heute zu glauben«.
Wahrscheinlich wird man finden, die dem Philosophierenden gesetzte Grenze sei manches Mal überschritten. Diesen Einwand nehme ich in Kauf. Recht hätte er allerdings nur dann, wenn die Grenzlinie zwischen dem Vorhof und dem Heiligtum nicht deutlich sichtbar bliebe. Zwischen Philosophie und Theologie zu unterscheiden ist notwendig; sie gegeneinander getrennt zu halten scheint mir nicht nur kaum möglich, sondern vor allem unerlaubt; dann nämlich werden beide gleichermaßen steril.
J. P.
Über die Schwierigkeit, heute zu glauben
Das Vertrackte an aller Erörterung von Gründen und Gegengründen im Felde des Glaubens erklärt sich dadurch, dass Glaube, genaugenommen, gar nicht auf Gründen, jedenfalls nicht auf formulierbaren Sachargumenten, beruht und also auch nicht durch solche Argumente erschüttert werden kann. Natürlich ist das eine einigermaßen missverständliche Ausdrucksweise; aber die Sache ist eben äußerst kompliziert. Einerseits geschieht Glauben, wenn es mit rechten Dingen zugeht, nicht ins Blaue hinein, selbstverständlich nicht. Anderseits ist die Entscheidung, zu glauben, auch nicht einfach der Schlusssatz einer Argumentation. Man ist niemals, etwa durch die Gesetze der Logik, genötigt, zu glauben. Glauben ist seiner Natur nach gerade nicht eine zwingende Schlussfolgerung. Wenn ich eine Rechnung durchführe, dann kann ich eines Augenblicks nicht anders, als das Resultat anzuerkennen; es ist mir einfach nicht möglich, ich bringe es gar nicht zustande, der wahren Erkenntnis, die sich mir da zeigt, Widerstand zu leisten. Aber dem Glaubenden zeigt sich der Sachverhalt, den er im Glauben akzeptiert, gerade nicht; da ist keine Nötigung durch die Wahrheit. Da ist wohl die Glaubwürdigkeit eines anderen, eben dessen, der mir versichert, es verhalte sich so, wie er sagt. Und diese Glaubwürdigkeit lässt sich natürlich auch nachprüfen, bis zu einem gewissen Grad. Jedenfalls kann es so viele Gründe geben für die Glaubwürdigkeit eines Zeugen, dass es unvernünftig wäre und übrigens auch unanständig [vielleicht], ihm nicht zu glauben. Dennoch: ich »muss« das nicht, ich muss ihm nicht schon glauben. Zwischen der klaren zwingenden Einsicht in die Glaubwürdigkeit eines Menschen einerseits und dem ihm wirklich entgegengebrachten Vertrauen und Glauben anderseits liegt ein völlig freier Willensakt, zu dem nichts mich zwingen kann und niemand – wie man mir ja auch die Liebenswürdigkeit eines Menschen noch so überzeugend und bezwingend vor Augen führen mag, ohne dass ich ihn darum schon lieben müsste. Man kann »widerwillig« zugeben, dass etwas sich so oder so verhält, aber man kann weder widerwillig lieben noch auch widerwillig glauben. Das steht schon bei Augustinus in seinem Johannes-Kommentar: nemo credit nisi volens – niemand glaubt, es sei denn freien Willens. Weil also Glauben seiner Natur nach auf Freiheit beruht und aus der Freiheit entspringt, darum ist er – wie übrigens auch das schlichte, noch gar nicht religiöse Einander-Glauben-Schenken im alltäglichen mitmenschlichen Umgang – ein in besonderem Sinn unaufhellbares Phänomen, etwas dem Geheimnis mindestens Benachbartes und Verwandtes.
Eben dies macht es begreiflich oder doch begreiflicher, warum es seine spezifische Misslichkeit hat, in bezug auf Glauben oder auch in Bezug auf Nichtglauben überhaupt von Gründen zu reden, von sachlichen Argumenten. Entscheidend ist in allem Glauben nicht der Sachverhalt, der sich dann mehr oder weniger zwingend begründen oder auch widerlegen ließe; entscheidend ist das Persönliche, die Begegnung, heißt das, der Person des Zeugen, der die Wahrheit eines Sachverhaltes verbürgt, mit der Person des Glaubenden, der sich, indem er den Sachverhalt akzeptiert, auf die Person des Bürgen verlässt. Das hat mit »Irrationalismus« nicht das mindeste zu tun. Es handelt sich allerdings darum, dass man sieht: eine Person und ihre Qualitäten, etwa ihre Glaubwürdigkeit, werden unserer Erkenntnis auf völlig andere Weise zugänglich und fassbar als etwa eine exakt zu messende Naturtatsache.
Sokrates hat einmal von sich gesagt, er traue sich zu, einen Liebenden unfehlbar zu erkennen. Woran erkennt man so etwas? Niemand, auch nicht Sokrates, hat auf diese Frage je eine durch rationale Nachprüfung erweisbare Antwort zu geben vermocht. Und dennoch würde er, Sokrates, zweifellos darauf bestehen, dass es sich beileibe nicht um ein bloß subjektives Gefühl handle, nicht um eine bloß irrationale Impression, vielmehr um objektive, in der Begegnung mit Realität zustande gekommene, wahre Erkenntnis. Aber: was ließe sich dafür an Gründen ins Feld führen, an Gründen, wohl zu bedenken, die einem anderen oder gar jedermann plausibel erscheinen könnten? Und so gibt es, höchst erwartbarerweise, auch beim Zustandekommen des Glaubens – Glauben heißt immer primär so viel wie: jemandem glauben – unabsehbar viele mögliche Weisen der Vergewisserung, die vielleicht allein für diesen bestimmten Einzelnen etwas bedeuten, während sie einem anderen, einem Dritten gar nichts besagen. Darum ist es durchaus begreiflich, was freilich auch immer wieder einmal vergessen wird, dass die Glaubensentscheidung natürlicherweise ihren Ort hat in der persönlichen Geschichte des Glaubenden selber. Dem einen wird, während er die Kathedrale von Rouen betrachtet, plötzlich die Gewissheit zuteil, die »Fülle« müsse das Signum der Gottesoffenbarung sein, während jemand anders, wie Simone Weil es von sich selber berichtet, die Christuswahrheit annimmt, als sie auf dem Gesicht eines jungen Kommunikanten erschüttert die Nähe Gottes aufleuchten sieht. Wer wollte es unternehmen, das Gewicht, die Gültigkeit solcher Gründe zu beurteilen? Dies, meine ich, sollte man sich deutlich gemacht haben, bevor man daran geht, nun dennoch, was natürlich sehr wohl sinnvoll möglich ist, von formulierbaren Argumenten zu sprechen – wobei vor allem von Gegenargumenten, von Einwänden, von Schwierigkeiten die Rede sein soll.
Der Generalnenner für eine ganze Gattung von Schwierigkeiten wider den Glauben scheint mir eine bestimmte Vorstellung von »kritischem Denken« zu sein oder vielmehr das Bewusstsein der Verpflichtung, in einem sehr bestimmten Sinne »kritisch« sein zu müssen, wofern man sich nicht einer intellektuellen Unredlichkeit und Unsauberkeit schuldig machen will. »Kritisch sein« bedeutet hier, das heißt für ein am Wissenschaftlichkeitsideal orientiertes Denken: nichts gelten zu lassen, nichts als wahr und wirklich anzunehmen, das sich nicht exakt erweisen lässt. Diese Normvorstellung ist für das Gemeinbewusstsein bereits so selbstverständlich geworden, dass ich mir gut denken kann, dass einer, der dies hört, sich verwundert fragt, wieso ein moderner, denkender Mensch sich jemals von dieser Forderung sollte dispensieren können. Was sonst könnte ihm als Haltung empfohlen oder zugemutet werden? Auf diese Frage würde ich folgendermaßen antworten: Solange einer als Wissenschaftler fragt und forscht, das heißt, solange er unter einem speziellen partikulären Aspekt einen klar abgegrenzten Teilbereich der Realität erforscht [indem er etwa den Erreger einer bestimmten Infektionskrankheit zu ermitteln sucht oder indem er festzustellen trachtet, was eigentlich, physiologisch gesehen, des Näheren geschieht, wenn ein Mensch stirbt] – so lange ist er in der Tat auf jene Normvorstellung von kritischem Denken verpflichtet. Er darf, falls er nicht etwas wissenschaftlich Unverantwortliches tun will, nichts gelten lassen, das sich nicht durch positive Nachprüfbarkeit ausweisen kann. Aber: so wenig diese wissenschaftliche Betrachtungsweise entbehrt werden kann, so wenig genügt sie zur Darlebung der vollen geistigen Existenz des Menschen. Der aus dem vollen Lebensimpuls des Geistes existierende Mensch fragt nämlich unstillbar nach dem Ganzen der Realität und nach dem Gesamtzusammenhang der Welt. Auch wenn er es zunächst mit einem ganz speziellen und ganz konkreten Phänomen oder Geschehnis zu tun hat – er will wissen, wie es damit unter jedem denkbaren Aspekt letzten Grundes bestellt ist. Es genügt ihm nicht, zu erfahren, was [zum Beispiel] im Tode physiologisch geschieht. Er will, soweit nur eben möglich, das »komplette Faktum« kennen, the complete fact, wie der Harvard-Philosoph Alfred North Whitehead es formuliert hat. Und wenn »kritisch sein« so viel besagt wie »besorgt sein, dass etwas Bestimmtes nicht geschehe«, dann richtet sich seine Sorge eben hierauf: dass nur ja kein Element der Realität zugedeckt, übersehen, vergessen, unterschlagen werde – was sehr wohl auch geschehen könnte durch die Selbstbeschränkung des Geistes auf das, was man exakt nachprüfen kann. Hier also kommt eine andere Gestalt von kritischer Haltung in Sicht, für welche »kritisch sein« vor allem heißt: sich nur ja kein Element des Wahrheitsganzen entgehen zu lassen und deswegen eher eine weniger exakte Vergewisserung in Kauf zu nehmen als eine mögliche Einbuße an Wirklichkeitskontakt.
Solche Offenheit für das Ganze ist allerdings eine anspruchsvolle und schwer zu realisierende Sache, nicht weil dazu besondere Bildungsanforderungen erfüllt sein müssten, sondern weil dazu eine Unbefangenheit der Seele vorausgesetzt ist, die viel tiefer schweigt als die sogenannte wissenschaftliche Objektivität. Vonnöten ist ein Sich-Auftun der geheimsten Antwortkräfte der Seele, über das vielleicht unser bewusstes Wollen gar nicht mehr verfügt. Der zutreffendste Name für diese Haltung, den es gibt, ist wahrscheinlich das biblische Wort von der simplicitas, von der Einfältigkeit des Auges, wodurch es dann geschehe, dass unser ganzer Leib im Licht sei.
Es versteht sich von selbst, dass solche Haltung nichts zu tun hat mit irgendeiner neutralen Passivität. Zu ihrer Realisierung ist im Gegenteil die uneingedämmte Energie des geistigen Lebensvollzugs und zugleich die äußerste seismografische Empfindlichkeit und Wachheit des Herzens gefordert. Denn es gibt unendlich viele verborgene, oft genug kaum kenntliche Möglichkeiten des Sichverschließens. Es gibt zum Beispiel einen Mangel an Offenheit, der, ohne dass irgendein Gestus der ausdrücklichen Abweisung oder der Verweigerung geschähe, im Grunde nichts anderes ist als einfach Unaufmerksamkeit! Gabriel Marcel ist der Meinung, in dieser unserer Zeit habe das Leben selber die Tendenz, solche Unaufmerksamkeit zu begünstigen und geradewegs zu erzwingen: eben die Unaufmerksamkeit, welche faktisch den Glauben wenn nicht unmöglich, so doch sehr unwahrscheinlich macht. Pascal hat uns zu verstehen gegeben, wie sehr wir hier aufgefordert sind, wachen Herzens Widerstand zu leisten gegen ungezählte, geheime und getarnte Möglichkeiten des Sichverschließens. In seinen Pensées gibt es den folgenden Aphorismus: »Wenn ihr euch keine Sorge darum macht, die Wahrheit zu erkennen, dann ist genug Wahrheit vorhanden, damit ihr in Frieden leben könnt. Wenn euch aber aus ganzem Herzen danach verlangt, sie zu erkennen, dann ist es nicht genug.« Man kann sich, nahezu guten Gewissens, allzu leicht beruhigen bei dem, was man schon weiß. Wer aber darauf aus ist, das Ganze vor den Blick zu bekommen und im Blick zu halten, der erwartet immer noch neues Licht. Die Wahrheit ist das Ganze; wir sehen jedoch von nichts das Ganze!
Was aber nun, wenn einer nicht glauben zu können meint oder einfach nicht glauben will? Was ist zum Thema »Unglaube« zu sagen? Bekanntlich pflegt die durchschnittliche Rede der Christenheit, wenn es sich um die Äußerungsform des »modernen Geistes« handelt, ein wenig rasch bei der Hand zu sein mit der summarischen Kennzeichnung »Unglaube« – während die große abendländische Theologie eher äußerste Vorsicht empfiehlt in der Verwendung dieser Vokabel.
Unglaube im strikten Sinn ist nämlich allein jener geistige Akt, in welchem jemand mit Überlegung einer Wahrheit die Zustimmung verweigert, die ihm hinreichend deutlich als Offenbarung, genauer gesagt, als Rede Gottes vor den Blick gekommen ist. Man wird vielleicht meinen, so etwas komme ja kaum einmal vor! Gibt es in solchem Sinn überhaupt Unglauben? Ich würde in der Tat hierauf antworten: der durchschnittliche Widerpart des Glaubens scheint wirklich viel mehr die tiefeingewurzelte Unaufmerksamkeit zu sein, von der Gabriel Marcel spricht, als der dezidierte Unglaube, der sie vielleicht selber zu sein vermeint.
Aber natürlich lassen sich auch Dutzende von durchaus handfesten, klar formulierbaren, intellektuellen Einwänden und Schwierigkeiten anführen, spezifisch moderne Schwierigkeiten, die es einem Menschen dieser unserer Zeit wenn nicht unmöglich, so doch sehr schwer machen können, zu glauben. Warum zum Beispiel, so lautet ein gewichtiges Gegenargument, warum sollte es um den empirischen Menschen so bestellt sein, dass er nicht auskommt mit dem, was ihm natürlicherweise zugänglich ist? Warum sollten wir auf Auskünfte angewiesen sein, die wir niemals auf ihre Wahrheit hin nachprüfen können, die wir also »glauben« müssen, falls wir ihrer überhaupt teilhaftig werden sollen? Man kann auf solche Fragen natürlich nur antworten, wenn man zugleich vom Wesen des Menschen spricht und von seiner wahren Situation im Ganzen der Realität. Wenn aber diese Situation so ist, dass er, der Mensch, sich von Natur im Kraftfelde einer schlechthin übermenschlichen Wirklichkeit befindet und dass ihm von dorther Weisung und Auskunft zuteil werden kann – wenn es so ist, lässt sich dann noch unangefochten behaupten, der Mensch lebe ein für alle Mal in seiner geschlossenen Welt? Anders ausgedrückt: Wenn der Mensch von Natur ein Wesen mit offenen Grenzen ist und wenn Gott ein redefähiges personales Wesen ist, dann gehört es eben damit zur Grundsituation des natürlichen Menschen, dass er von Gott angesprochen werden kann. Im Ernst realisiert, ist das allerdings eine diesen natürlichen Menschen schockierende Vorstellung. Es ist immer erschreckend, so heißt es einmal bei C. S. Lewis [in seinem Buch über das Wunder], dort etwas Lebendiges anzutreffen, wo wir ganz allein zu sein dachten. Hach, schreien wir dann, das ist ja lebendig! »Ein unpersönlicher Gott: schön und gut! Ein Gott des Wahren, Schönen und Guten hinter der eigenen Stirn: das ist noch besser! Eine gestaltlose Lebenskraft, aus der wir schöpfen können: das ist von allem das Beste! Aber Gott selber, der Lebendige, der am anderen Ende der Schnur zieht, der vielleicht mit ungeheurer Schnelligkeit auf uns zukommt, der Jäger, der König, der Bräutigam – das ist etwas ganz und gar anderes. Es kommt ein Augenblick, da Menschen, die in ›Religion‹ herumgestümpert und Gott ›gesucht‹ haben, plötzlich erschreckt zurückfahren: Angenommen, wir hätten ihn gefunden? Schlimmer noch, angenommen, er hätte uns gefunden? Das ist dann eine Art Rubikon. Der eine überschreitet ihn, der andere nicht. Aber wenn man ihn überschreitet, dann gibt es keine Sicherheit gegen Wunder.« So C. S. Lewis. Ich habe dem nur einen Satz hinzuzufügen: Wenn Gott wirklich gedacht wird als ein »Wer« und nicht als ein Was, als ein Jemand also, der reden kann, dann gibt es keine »Sicherheit« gegen Offenbarung. – Die einzig sinnvolle Antwort des Menschen aber auf Offenbarung ist: Glauben!
Freilich, es kann einer sehr wohl die göttliche Offenbarung für etwas »an sich« Mögliches halten, ohne dass er damit schon der Meinung sein müsste, sie habe tatsächlich stattgefunden. Aber Glaube hat natürlich nur dann Sinn, wenn Gott tatsächlich gesprochen hat, und zwar auf eine dem Menschen vernehmliche Weise. Aber in welcher Gestalt sollte eine solche göttliche Mitteilung überhaupt geschehen können? »Es geschah vom Himmel her eine Stimme« – das war für die Zeitgenossen Dantes zweifellos noch eine anschauliche Vorstellung, die unangefochten vollzogen werden konnte. Aber diese Unangefochtenheit ist dem Zeitgenossen Einsteins nicht nur unmöglich geworden, sie ist ihm auch nicht mehr erlaubt. Es gerät ihm allerdings auch nicht mehr so leicht, in den Fehler zu verfallen, Gott als ein innerweltliches Wesen zu denken, das sozusagen im »Raum nebenan« wohnt oder doch über den Wolken. Wir haben gegenüber dem mittelalterlichen Menschen die höhere Chance, die wahre Transzendenz Gottes, die dennoch gar nichts mit »Außerweltlichkeit« zu tun hat, adäquater vorzustellen – und mag sich die Bestürzung über die sogenannte »Abwesenheit Gottes« tausendmal selber als Atheismus verstehen.
Nun gut, aber bleibt dann noch eine Möglichkeit, ein an den Menschen gerichtetes Reden Gottes, Offenbarung also, überhaupt als ein konkretes, sich hier und jetzt zutragendes Ereignis zu denken? Thomas von Aquin, der letzte große Lehrer der noch ungeteilten abendländischen Christenheit, hat das Offenbarungsgeschehen auf eine Weise beschrieben, die, wie mir scheint, den Wandel der Weltbilder sehr wohl zu überdauern vermag. Jedenfalls ist in seiner Formulierung nichts »Mittelalterliches«. Offenbarung ist, so sagt er, die Mitteilung eines inneren Lichtes, wodurch die menschliche Erkenntnis befähigt wird, etwas zu gewahren, das ihr kraft des eigenen Lichtes nicht schon gewahrbar sei. Dieses Bild, so deutlich es ist, gibt dennoch zugleich zu verstehen, dass sich der allererste Augenblick dieses Mitteilungsvorganges allem Vorstellen und Begreifen entzieht, und zwar notwendig. Das erste blitzhafte Aufleuchten, das wir »Inspiration« nennen, das urplötzliche Auftreffen des Steines auf die noch regungslose Wasserfläche, dieses Eigentliche von Offenbarung liegt jenseits unserer Fassungskraft. Das gehört fast zum Begriff von Offenbarung dazu. Aber Mitteilung vollendet sich nicht schon darin, dass etwas gesagt wird. Das Gesagte muss auch gehört und aufgenommen werden von dem, dem es zugedacht ist. Zugedacht aber ist die Offenbarung »dem« Menschen, das heißt allen Menschen. Aber diese Ausstrahlung, diese Vollendung des Offenbarungsereignisses, so wie die Christenheit es versteht, trägt sich im Grunde auf die plausibelste Weise von der Welt zu, auf die gleiche Weise nämlich, wie auch sonst die Menschheit sich neue, bislang unbekannte Wahrheiten aneignet. Immer geht es doch so zu, dass einer, der geniale oder glückhafte Entdecker oder Erdenker, die ihm selber frisch zuteil gewordene Erkenntnis an die anderen weitergibt: durch Mitteilung, durch Veröffentlichung, durch Lehren, durch Überlieferung – und so fort.
Und es ist nichts Verwunderliches darin, dass diese gleiche Fügung und Struktur uns gleichfalls entgegentritt, wo immer eine heilige Überlieferung den Anspruch erhebt, eine göttliche Botschaft zu bewahren und darzubieten. Das ist gar nicht anders zu erwarten.
Die entscheidende, aber weitaus schwierigste Frage bleibt natürlich noch immer offen: wie nämlich und wodurch der Anspruch, wirklich göttliche Offenbarung, Rede Gottes also, zu sein, sich ausweisen könnte. Woran erkennt man, ob das, was da mit dem Anspruch auftritt, göttliche Offenbarung zu sein, wirklich göttlichen Ursprungs ist? Wenn es nicht möglich ist, hierauf zulänglich zu antworten, dann kann Glaube, das heißt ein Für-Wahr-Halten »auf das Wort Gottes hin«, schlechterdings nicht erwartet werden; ja, dann kann er auch nicht gerechtfertigt werden.
Ich möchte zum Schluss einige Bedingungen und Situationselemente namhaft machen, die vorweg bedacht sein müssen, wenn nicht schon der Versuch einer Antwort auf jene Frage ein von Anfang an hoffnungsloses Unternehmen sein soll.
Punkt eins: Die Erörterung der sozusagen klassischen Argumente [Wunder, Prophetie, Authentizität der biblischen Berichte, Kirche als geschichtliches Phänomen] ist zweifellos unentbehrlich. Diese Erörterung aber wird so gut wie sicher zu gar nichts führen, wenn sie nicht geschieht auf dem Grunde einer lebendig vollzogenen Meditation über die Situation des Menschen im Ganzen der Realität.
Punkt zwei: Man muss sich darauf gefasst machen, dass die hier geforderte Unbefangenheit und Offenheit, von der wir schon gesprochen haben, sich nicht bloß keineswegs von selbst herstellt, sondern dass sie im Gegenteil höchst erwartbarerweise ständig bedroht ist: durch die Interessen des um seine Autonomie besorgten Subjekts.
Punkt drei: Es ist mehr als unwahrscheinlich, dass die Erkenntnismittel des auf sich allein gestellten, isolierten Individuums ausreichend sein könnten zu einer standhaltenden Klärung dieser Sachverhalte. Es handelt sich hier, wie auch sonst bei den großen Gegenständen der Erkenntnis, um eine nicht anders als solidarisch zu bewältigende Aufgabe, für die sämtliche Formen und Funde der arbeitsteiligen menschheitlichen Erkenntnisbemühung genutzt und in Dienst genommen werden müssen – nicht allein freilich die Kraft des Fortschritts und der Entdeckung, sondern auch die der Erinnerung.
Noch ein Wort über die innere Lage des »Wissenden«, des Gebildeten, des Intellektuellen, der zugleich ein Glaubender zu bleiben wünscht. Wer eine bestimmte Stufe kritischen Bewusstseins erreicht hat, kann sich nicht davon dispensieren, die Gegenargumente zu durchdenken. Er muss sich ihnen stellen. In der großen Theologie hat man deswegen ihn – den kritisch Denkenden und zugleich Glaubenden – mit dem Märtyrer verglichen, dem Blutzeugen, der einfachhin standhält und die Wahrheit des Glaubens nicht preisgibt trotz der »Gegenargumente« der Gewalt. Es kennzeichnet die innere Situation des Glaubenden, dass die Glaubenswahrheit durch kein Vernunftargument positiv erwiesen werden kann; sie kann nur verteidigt werden! Auch gegen die eigenen Vernunftargumente gibt es letztlich keine andere Möglichkeit des Widerstandes als die der Verteidigung, nicht des Angriffs also, sondern des Standhaltens. Und man kann sich sehr wohl fragen, ob es nicht auch einmal für eine Zeit lang unvermeidlich werden könnte, dieses Standhalten, wie im Fall des Blutzeugen, in Gestalt schweigender Wehrlosigkeit zu leisten – natürlich nicht um irgendeines »charaktervollen« Starrsinns willen, nicht aus »Heroismus«, sondern damit wir nicht das verlieren und versäumen, was uns in der Offenbarung zugedacht und was allein in der Weise des Glaubens zu haben ist: die Teilhabe nicht nur am Wissen Gottes, sondern an seinem Leben selbst.
Sakralität und »Entsakralisierung«
Erster Blick auf das Phänomen
Was heißt »sakral«? – Wie immer beginnt die Antwort am besten möglichst nah am Anschaulich-Konkreten, mit einem Blick auf das Phänomen, auf das also, »was sich zeigt«.
Frankfurt, Ende Mai 1948. Zur Hundertjahrfeier der Nationalversammlung war die Paulskirche wiederhergestellt worden, inmitten der noch in Trümmern liegenden Stadt. Auch der eben gegründete Deutsche Schriftstellerverband hielt eine »Feierstunde« in der klaren Buntsandstein-Rotunde. Man kam, diskutierend und mit Maßen neugierig, aus dem strahlenden Vormittag hereinspaziert; nicht wenige rauchten ungeniert ihre Zigarette zu Ende oder zündeten sich eine an. Aber dann hieß es: Bitte nicht rauchen; wir befinden uns in einer Kirche! Mein Nachbar blickte überrascht auf: Wieso ist dies eine Kirche? Ich gab ihm recht: die Bauform allein jedenfalls genüge dazu nicht. Nach einer Weile nochmals der Nachbar: Und wenn es eine Kirche wäre, eine wirkliche – warum eigentlich nicht rauchen? – Ein Jahr danach, in Berlin-Treptow. Wiederum Einschärfung eines Rauchverbots: beim Eintritt in den riesigen Gedächtnispark für die gefallenen Soldaten der Roten Armee. – Und vor Kurzem, in Israel, geschah – diskret, aber sehr bestimmt – noch einmal dasselbe: im Restaurant unseres Hotels, als am Nebentisch amerikanische Gäste nach dem Dinner ihre Zigaretten hervorholten. Nosmoking, please! – But why not? – Nun, jetzt natürlich nicht um des Ortes willen, sondern wegen der Zeit; es war Freitagabend, der Sabbat hatte begonnen.
In all diesen Fällen, das ist völlig klar, spielt der Aspekt irgendwelcher Zweckmäßigkeit oder Behinderung, wie etwa im Hörsaal oder im Operationssaal, keine Rolle; noch weniger der Gedanke an Feuergefahr, wie im Flugzeug bei Landung und Start. Das Verbot enthält auch keinerlei generelle Abwertung, als sei Rauchen etwas, das sich eigentlich nicht gehört. Offenbar soll vielmehr eine Grenze kenntlich gemacht und ins Bewusstsein gerufen werden, die Scheidelinie, die einen besonderen Ort und eine nicht-gewöhnliche Spanne Zeit von dem durchschnittlich-beliebigen Irgendwo und Irgendwann abhebt und trennt.
Von dem, der die Schwelle zu diesem »anderen« Bereich überschreitet, wird ein Verhalten erwartet, das sich von dem sonst üblichen unterscheidet. – Wer eine Moschee betritt oder den ummauerten Bezirk eines indischen Tempels, zieht seine Schuhe aus. Möglicherweise ist, im letzteren Fall, die Grenze so strikt, dass der Nicht-Hindu in das innerste Heiligtum überhaupt nicht zugelassen wird. In der christlichen Kirche nehmen die Männer den Hut ab; das gleiche geschieht am offenen Grabe, aber auch, wenn die Nationalhymne gesungen wird. Der Jude hinwiederum bedeckt sein Haupt, nicht nur in der Synagoge, sondern wann immer er betet. Als ich in Tiberias das umfriedete Geviert der Grabstätte des Moses Maimonides betrat, lief mir der Wächter mit alarmierender Geste entgegen: ich habe ja keinen Hut auf dem Kopf!
Im gottesdienstlichen Raum herrscht vor allem Schweigen; lautes Rufen jedenfalls und Gelächter sind verpönt. Vor dem Markusdom in Venedig wird allzu unbekümmert gekleideten Touristen der Eintritt verwehrt. Auch das Instrumentarium der öffentlichen Neugier pflegt man an solchen Orten mit Misstrauen zu betrachten; in vielen christlichen Kirchen ist, wenigstens während des Gottesdienstes, das Fotografieren untersagt, nicht anders als in den Tempeln des orthodoxen Hinduismus; die Pueblo-Indianer von Neu-Mexiko nehmen es dem Besucher schon übel, wenn er sich mit der Kamera auch nur dem Einstieg zu ihrem unterirdischen Kultraum nähert.
Würde der Fremde, der Außenstehende, der Nichteingeweihte, die Frage stellen, was diese ihm vielleicht unverständlichen und manchmal recht beschwerlichen Verhaltensregeln sollen, so bekäme er die bei aller konkreten Vielfältigkeit im Grunde einhellige Antwort: der Sinn von alledem sei die Bezeugung von Ehrfurcht und Respekt. Respekt wovor? Vor etwas jedenfalls, das Huldigung und Verehrung fordert und verdient. Wenn er nun noch weiter fragte: von welcher Seinsart denn des genaueren dies Verehrungswürdige sei – dann ließen sich vermutlich die Antworten schon nicht mehr so leicht auf einen Nenner bringen. Immerhin würde man dem Frager übereinstimmend zu verstehen geben, es handle sich um etwas, das den Menschen in irgendeinem Sinne »heilig« sei [oder »heilig« sein sollte] – ob nun im Einzelnen von der »Majestät des Todes« die Rede wäre, von der Würde des Vaterlandes, von der Ehre der im Kriege Gefallenen oder geradewegs von der besonders dichten Präsenz des Göttlichen, wenn nicht gar Gottes selbst.
Jedenfalls aber läge all diesen Antworten die Überzeugung zugrunde, es gebe im Gesamtbestand der dem Menschen erfahrbaren, raumzeitlich bestimmten Welt einzelne ausgezeichnete und hervorgehobene Orte und Zeitspannen, herausragend aus dem, was überall und immer ist, und also von besonderer und ausnahmehafter Dignität.
Solche Ausgrenzung von etwas exzeptionell Verehrungswürdigem ist auch in der ursprünglichen Bedeutung der zugeordneten Worte völlig klar gemeint; das zeigt sich schon beim oberflächlichen Blättern in den Nachschlagewerken. – Hagios zum Beispiel, das griechische Wort für »heilig«, impliziert die Entgegensetzung zu koinós [= durchschnittlich, gemeinsam, gewöhnlich]. Und das den Göttern gehörende Stück Bodenfläche, auf dem der Tempel steht oder der Altar, heißt témenos, das aus dem sonstigen Gemeindebesitz eigens »Herausgeschnittene«. – Im Lateinischen bedeutet das Verbum sancire, wovon sanctus-heilig sich herleitet, gleichfalls so viel wie umgrenzen; »unter sanctio verstanden die alten Römer ursprünglich die Abgrenzung heiliger Orte und deren Schutz vor Verletzung und profaner Berührung«.1 – Was nun den heutigen Wortgebrauch betrifft, so lauten die Auskünfte nicht viel anders. Sacré ist das, was einem ordre des choses séparé2 angehört; und das Oxford Dictionary nennt unter den Bedeutungen von sacred auch: set apart. – Komplizierter und weniger durchsichtig ist allerdings der deutsche Sprachgebrauch. Nicht nur bieten sich uns sogleich mehrere Vokabeln an: heilig, geweiht, sakral; das einzelne Wort ist überdies nicht sonderlich eindeutig, auch nicht im philosophischen Sprachgebrauch. Wenn zum Beispiel Immanuel Kant den Begriff »Heiligkeit« formell definiert, dann will er darunter »die völlige Angemessenheit des Willens … zum moralischen Gesetze«3 verstanden wissen – was sich zunächst auch sehr präzis anhört. Doch nennt er wenige Zeilen weiter das moralische Gesetz selber »heilig« und stellt sich damit klar gegen die eigene Definition. Offenbar setzt sich hier eine ganz andere Bedeutung des Wortes »heilig« durch. Diese andere Bedeutung aber meint, nicht anders als die entsprechenden griechischen und lateinischen Worte, eben jene aus dem Kontinuum des alltäglich Gleichgültigen hervorragende, aus der Reihe fallende, sich gegen das Gewöhnliche deutlich abgrenzende Dignität, welche von seiten des Menschen mit Fug auch besondere Formen des Respekts verlangt.
Wo immer aber in solchem Sinn etwas »heilig«-gehalten wird, da ist man also, noch einmal, schon im voraus davon überzeugt, dass die Welt nicht einfachhin homogen ist, weder der Raum noch die Zeit. In diesem Punkt hat Mircea Eliade4 mit seiner Interpretation des Sakralen völlig recht, so fragwürdig seine Gesamtkonzeption im Übrigen auch ist. Eine heilige Stätte ist »anders« als alle Örtlichkeiten sonst. Und wenn Ostern und Weihnachten, der Sabbat und der Sonntag eine Spanne »heiliger« Zeit sind, dann heißt das: sie sind nicht »ein Tag wie jeder andere«. Das ist freilich erst eine negative Auskunft. Und natürlich bleibt noch zu fragen, wodurch denn die Besonderheit und das Ausgegrenztsein des »Heiligen« sich begründet und worin es selber positiv besteht.
Analogien
Wer sich heute auf die hier aufgeworfenen Fragen einlässt, befindet sich, wie man weiß, schon von Anfang an nicht mehr in einem Raum akademischer Windstille, sondern in der Kampfarena einer stürmischen öffentlichen Diskussion. Das Wort »Entsakralisierung« hat ja längst aufgehört, die sachlich deskriptive Bezeichnung für einen, allerdings rapid fortschreitenden, gesellschaftlichen Prozess zu sein; es ist der Name für eine programmatische Zielsetzung geworden, die sich zudem neuerdings auf »theologische« Argumente beruft. So wird etwa gesagt, Christus habe die ganze Welt geheiligt und folglich sei alles »sakral«. Andere bestehen darauf, er habe die Welt und den Menschen gerade zu ihrer wahren Weltlichkeit und Profanität befreit;5 so hat man geradewegs gesagt, »dass es bei uns Christen nichts Heiliges mehr geben kann und darf«.6 Wenn das so wäre, wenn wirklich, aus welchem Grunde auch immer, entweder alles gleichermaßen »heilig« oder alles gleichermaßen »profan« wäre, dann hätte in der Tat die Unterscheidung »heilig – profan« ihren Sinn verloren; sie wäre gegenstandslos geworden.
Das Wort »profan« habe ich übrigens bislang mit Bedacht vermieden. In seiner ursprünglichen Bedeutung ist, wie mir scheint, nicht der leiseste Beiklang von Abwertung; denn es besagt nichts weiter als das, was räumlich »vor« dem Heiligtum [fanum] liegt, vor seiner Tür, »draußen«. Doch hat sich bekanntlich der spätere Denkgebrauch recht weit von dieser Bedeutung entfernt. Und so ist einem inzwischen nicht mehr viel geholfen mit der – rein formal freilich noch immer zutreffenden – Ausrede von Roger Caillois, man könne das »Heilige«, le sacré, nicht anders definieren als durch die Entgegensetzung zum Profanen.7 Eines Augenblicks muss deklariert werden, was man selber sowohl mit dem Profanen wie mit dem Heiligen inhaltlich meint.
Diesen Augenblick möchte ich freilich noch ein wenig hinausschieben, indem ich vorweg, allzu summarisch vielleicht, zwei analoge Unterscheidungen zu bedenken gebe, die heute gleichfalls programmatisch infrage gezogen und attackiert zu werden pflegen. Ich meine einesteils die Unterscheidung zwischen Dichtung und Nicht-Dichtung, andernteils die zwischen Philosophie und Wissenschaft. – Was den ersten Punkt betrifft, so zielt zum Beispiel die »nicht-aristotelische Poetik« von Bertolt Brecht, nach welcher sich ihr Autor glücklicherweise selber niemals gerichtet hat, in letzter Konsequenz auf die Annullierung der Poesie. Die Frucht großer Dichtung, die reinigende Erschütterung im Ansichtigwerden der Unalltäglichkeitsdimension der Existenz, wird als Flucht in die Illusion denunziert; der Zuschauer soll, wie es bei Brecht heißt, »seine Zigarre nicht ausgehen lassen«, sondern kritisch wach bleiben für die politische Aktion der Weltveränderung. Es gibt – dies ist die Meinung – nichts als die Prosa des Klassenkampfes, von dem sich niemand dispensieren darf, und wäre es auch nur für eine Stunde. – Doch kann natürlich die »Prosa«, das ausdrücklich »Nicht-Poetische«, auch unter vielen anderen Flaggen segeln: Fünfjahresplan, Amüsement, Sensation, psychologische Empirie – und so fort.
Dem entspricht, im Felde der Wissenschaftstheorie, die – übrigens aus verwandter Haltung gespeiste – Negation der Philosophie. Philosophieren, das heißt die Bedenkung des Ganzen von Wirklichkeit und Dasein auf seine letztgründige Bedeutung hin, die Konfrontierung also des von Natur auf das Totum der Welt angelegten Geistes mit seinem wahren, freilich unergründlichen Gegenstand – dies alles habe, so wird behauptet, keinen Sinn; vielmehr finde die einzig legitime erkennende Befassung mit Wirklichkeit in Gestalt der exakten, durch nachprüfbare Resultate ausgewiesenen Wissenschaft statt; im Grunde sei, wie der frühe Rudolf Carnap sagt, alle menschliche Erkenntnisbemühung nichts anderes als »Physik«.8
Solche Stellungnahmen kommen gewöhnlich nicht aus heiterem Himmel; es ist vielmehr zu vermuten, dass sie nur die Antwort sind auf eine falsche Selbstinterpretation der Dichtung wie der Philosophie. Angesichts etwa der illusionären Idealisierung von Mensch und Gesellschaft, die den Schiller-Epigonen als »poetisch« galt, ist die Reaktion der Naturalismen und Verismen wie auch die von Bertolt Brecht mehr als begreiflich. Und das Insistieren auf der Erfahrungswurzel alles menschlichen Erkennens hat natürlich völlig recht gegen den fantastischen Anspruch der Philosophie, ein »Begreifen des Absoluten« [Hegel9] zu sein oder, wie Fichte10 sagt, die »Antizipierung der gesamten Erfahrung«.
Neuestens hat man den Versuch unternommen, sowohl die Dichtung wie die Philosophie neu zu definieren und so ihre Eigenständigkeit zu retten. Es wird zum Beispiel gesagt, was die Philosophie prinzipiell von der Wissenschaft unterscheide, sei die Tatsache, dass sie es überhaupt nicht mit der Realität zu tun habe, sondern ausschließlich mit der Sprache, in welcher die Wissenschaften über Realität reden. – Und Jean Paul Sartre11 schlägt vor, das alltägliche »prosaische« Sprechen, auch des »Schriftstellers«, als die einem bestimmten Zweck dienende Benutzung von Worten zu verstehen, während als »Dichter« derjenige zu gelten habe, der es gerade ablehnt, das Wort zu »benutzen« und sich seiner zu »bedienen«, der vielmehr das Wort selbst als einen Zweck und als ein in sich sinnvolles Ding behandelt – womit, so scheint mir, die Natur sowohl der Dichtung wie der Prosa verfehlt wird.
All dies hat, glaube ich, seine Analogie in der Interpretation von »heilig« [sakral] und »profan«. – Wie nämlich alles falsch wird, sobald man übersieht oder leugnet, dass Dichtung wie Prosa gleichermaßen ein Modus sind, Realität zur Sprache zu bringen, und dass in der Wissenschaft nicht anders als in der Philosophie der Versuch gemacht wird, den einen großen Gegenstand »Wirklichkeit« erkennend zu erfassen, so greift man genau ebenso am Kern der Sache vorbei, und zwar notwendigerweise, wenn man die Unterscheidung »heilig – profan« nicht gleichfalls begreift als eine Entgegensetzung innerhalb einer beide Glieder umfassenden Gemeinsamkeit. Wäre es zum Beispiel wirklich so, dass [wie man aufgrund einer fragwürdigen Interpretation der »mythisch-archaischen« Weltansicht behauptet] das Heilige und das Profane einander gegenüberstehen wie »zwei von Grund auf heterogene Welten« [E. Durkheim12], wie »Kosmos« und »Chaos«, wie das »Reale« und das »Irreale« [oder »Pseudo-Reale«], durch eine »Kluft« voneinander getrennt [M. Eliade13]; wenn es also keinerlei solidarité du sacré et du profane [J.-P. Audet14] gäbe; wenn nicht, anders ausgedrückt, auch die »vor« dem Portal des Heiligtums liegende Welt als von Schöpfungs wegen »gut« und als in gewissem Sinne selber »heilig« gelten kann; wenn die unsinnige Simplifizierung15 recht hätte, wonach die Tatsache eines »heiligen« Raumes bedeuten soll, man könne also »draußen«»tun und lassen, was man will« – dann allerdings müsste man [sofern »man« Christ wäre] die Unterscheidung in der Tat als unannehmbar ablehnen.
Und falls nun noch, außerdem und überdies, das »Heilige« primär charakterisiert sein soll durch distanzierende Prachtentfaltung, hieratische Starre, Fremdartigkeit der Formen [und so fort], dann wird der Ruf nach »Entsakralisierung« so unvermeidbar wie begreiflich. Und es kann nicht überraschen, dass der französische Jesuit P. Antoine,16 ansetzend mit der problematischen Begriffsbestimmung von Mircea Eliade und dann auf eine höchst anfechtbare Weise das Beispiel ständig leerer kleinstädtischer Kathedralen ausbeutend, zu dem Schluss gelangt, die Kirche [als Bau] sei keineswegs ein »heiliger«, sondern ein rein »funktionaler« Raum. Durch solche Argumentation ist dann aber nicht bloß das [zunächst allein gemeinte] Pseudo-Sakrale getroffen und verneint, sondern die ganze Erstreckung des Begriffs »sakral«, auch das im legitimen Sinn und in Wahrheit Sakrale selbst.
Freilich, was ist das »in Wahrheit« Sakrale?
Nicht Gott ist »sakral«
Über einen Punkt muss sogleich zu Anfang Klarheit geschaffen werden; sonst bleibt alle weitere Erörterung hoffnungslos ungenau. Wer von etwas »Heiligem« spricht, und zwar, wie es hier geschieht, in der Entgegensetzung zum Profanen, der kann damit sinngemäß nur die Beschaffenheit eines Stücks hiesiger Weltwirklichkeit benennen wollen und nicht etwa die Wesensart Gottes. In dieser Hinsicht ist der lateinische und der davon sich herleitende Wortgebrauch weit deutlicher als der unsere. Obwohl natürlich Gott, und Gott allein, im äußersten und absoluten Sinne »heilig« ist, wird man ihn dennoch niemals mit den Namen sacer, sacré, sacred, »sakral« bezeichnen – womit dann sogleich auch das andere klar ist: dass der Bereich des Nicht-Sakralen nicht als etwas schon kraft Definition Gottverlassenes oder gar Widergöttliches verstanden werden kann.17 Die Worte »heilig« und »sakral« sollen also im Folgenden weder die unendliche Vollkommenheit Gottes noch auch die sittliche Größe eines Menschen bezeichnen; sie besagen vielmehr, dass gewisse empirisch vorfindbare Dinge, Räume, Zeiten, Handlungen die besondere Eigentümlichkeit besitzen, auf eine aus der Reihe des Durchschnittlichen herausfallende Weise der göttlichen Sphäre zugeordnet zu sein. Auch ein Mensch kann übrigens in solchem Sinne »heilig« genannt werden; doch dann ist gleichfalls nicht seine [vielleicht wirklich vorhandene] moralische Untadeligkeit gemeint, sondern wiederum jene besondere Zuordnung zur göttlichen Sphäre, seine »Geweihtheit«, seine »Sakralität«.
Von dieser ausnahmehaften Zuordnung zur übermenschlichen Sphäre, von dieser ausdrücklich nicht überall und nicht immer anzutreffenden »Dichte« der Präsenz des Göttlichen her versteht sich dann ohne Weiteres auch die Grenze, die das in solchem Sinn »Heilige« vom »Profanen« scheidet und trennt. »Profan« heißt eben der Bereich des Durchschnittlichen, dem dieser Ausnahmecharakter nicht zukommt; »profan« bedeutet beileibe nicht schon notwendig so viel wie »unheilig« – obwohl es natürlich das ausdrücklich Unheilige gleichfalls gibt, das dann zugleich auch ein Äußerstes an Profanität repräsentiert. Immerhin kann man mit einem gewissen Recht sagen, alles Brot sei »heilig« [weil gottgeschaffen, weil lebenspendend – und so fort] oder: jedes Stück Erde sei »geweihter Boden« – man kann, sage ich, sehr wohl so sprechen, ohne deswegen schon bestreiten zu müssen, dass es außerdem und dennoch ein auf völlig singuläre Weise »heiliges Brot« gebe und einen in unvergleichlichem Sinne »geweihten« Bezirk.
Hier werden bereits einige von den Bedingungen benennbar, die erfüllt sein müssen, wenn irgendein Verständnis sowohl für das Sakrale wie auch vor allem für die damit unmittelbar gegebene Ausgrenzung aus dem Durchschnittlich-Alltäglichen überhaupt soll erwartet werden können. Diese Bedingungen sind offenbar nicht nur dann nicht erfüllt, wenn einer die Realität einer übermenschlichen, göttlichen Sphäre einfachhin leugnet. Sondern auch wenn einer bestreiten wollte, dass es so etwas geben könnte wie eine an bestimmte Orte, Zeiten, Menschen, Handlungen gebundene, ausnahmehafte und, wie Karl Barth sagt, »datierbar« gewordene »Dichte« der Präsenz Gottes, dann wäre er eben damit gleichfalls blind für das Phänomen, von dem wir hier reden. Und vermutlich ist vor allem diese schwer zu kurierende Blindheit im Spiel, wann immer die »Entsakralisierung«, ganz gleich mit welchen Argumenten, zum Programm erhoben wird.
Doch steht zunächst noch dieses Phänomen des Sakralen selber zur Erörterung.
Actio sacra
Wir reden sprachgebräuchlich von »heiligen Stätten«, »heiliger Zeit«, »heiliger Handlung«, »heiligen Zeichen« – und so fort. Der neue Ordo Missae spricht sogar, was sicher manchem wenig gefällt, von »heiligen« Gefäßen und Gewändern [de vasis sacris, de sacris vestibus]. Und es ist nun zu fragen, ob die Sachverhalte, die in dieser noch beträchtlich zu erweiternden Reihe aufgeführt sind, samt und sonders gleichen Ranges sind. Oder gibt es hier Primäres und Sekundäres, Ursprunghaftes und Abgeleitetes? Hierauf ist, meine ich, mit einem klaren Ja zu antworten. Und zwar besitzt innerhalb des Bereichs der Sakralität die »heilige Handlung« offenbar den Vorrang und die höhere Repräsentanz. Das kommt bereits in dem alten Satz zum Ausdruck: »Heilig, sacrum, heißt etwas kraft seiner Hinordnung auf den kultischen Gottesdienst, ad cultum divinum«18 – ein Satz, der durch Ethnologie und Religionsphilosophie ebenso bestätigt wird wie durch die theologische Interpretation des Alten und des Neuen Testaments.19
Wenn es überhaupt eine besondere Präsenz des Göttlichen in der geschichtlichen Menschenwelt gibt, dann ereignet sie sich, das ist die Meinung, am dichtesten in der »heiligen Handlung«; und erst kraft der Hinordnung auf sie werden dann auch Personen, Orte, Zeiten, Geräte »heilig« genannt.
Was also ist eine »heilige Handlung«? – Es dürfte, scheint mir, noch immer schwer sein, in unserer westeuropäischen Zivilisationsgesellschaft jemanden aufzutreiben, der schlechterdings nicht wüsste, wie das ungefähre Erscheinungsbild eines liturgischen Gebetsgottesdienstes aussieht, jenes Vorgangs also, den das Zweite Vatikanische Konzil20 eine »in hervorragendem Sinn ›heilige Handlung‹«, actio sacra praecellenter, nennt. Es ist zum Beispiel jedermann vertraut, dass eine »heilige Handlung« nicht bloß ausgeführt, erledigt oder abgewickelt, sondern »zelebriert«, gefeiert wird. Das Wort celebrare bedeutet, wie kürzlich gezeigt worden ist, »von der frühesten Zeit der klassischen Latinität bis in die christliche Liturgiesprache hinein« das Gleiche, nämlich den Vollzug eines durch das Gemeinwesen auf unalltägliche Weise begangenen Tuns.21 Als sozialer Vollzug ist die »heilige Handlung« ferner, im Unterschied etwa zu einem rein innerlichen Akt des Gebetes, der Gottesliebe, des Glaubens, ein leibhaftiger Hergang, der sich in sichtbaren Formen, in der vernehmlichen Sprache von Anrede und Bescheid, in körperlicher Aktion und symbolischer Gebärde, in der Besonderheit von Gewändern und Geräten, in Verkündigung und Gesang, aber auch im gemeinsamen Schweigen darstellt – wobei dem getanen Akt des Liturgen der analoge, »lesende« Akt mitvollziehenden Zuschauens entspricht.22
Die Frage allerdings, die gerade dem ernsten, nachdenkenden Betrachter angesichts, sagen wir, eines festlichen Choralamtes in der Abtei von Maria Laach in den Sinn kommen mag, besagt: ob dies zweifellos sehr eindrucksvolle Geschehen in Wahrheit mehr sei als ein mit hoher Kunst aufgeführtes Mysterienspiel, ein großartig inszeniertes religiöses Drama, aber im Grunde eben doch ein bloßes Schauspiel, leeres Zeremoniell, »Theater«. – Merkwürdigerweise hat auch Thomas von Aquin einen ähnlichen Einwand gegen die eigene Position formuliert; er fragt sich, ob nicht das Theatralische der symbolischen Handlung mit der »Ehrenhaftigkeit« des Gottesdienstes unvereinbar sei – worauf er die Antwort gibt: es sei tatsächlich der Dichtung wie dem Kult gemeinsam, das der ratio nicht einfachhin Fassliche in sinnlichen Bildern darzustellen.23