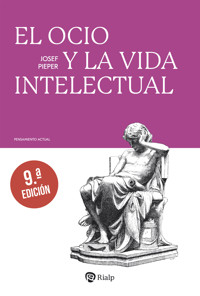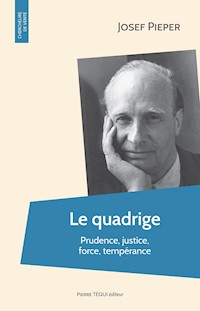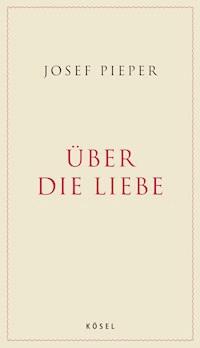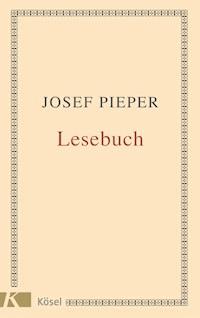
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kösel
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Rund 50 Aufsätze um Wahrheit, Freiheit und die richtige Lebensführung versammelt dieses Lesebuch, und in jedem einzelnen ist Josef Pieper als Denker wie als Mensch ganz gegenwärtig.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 289
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Josef Pieper Lesebuch
Vorwort Hans Urs von Balthasar
Kösel-Verlag München
Auswahl und Anordnung der Texte: Josef Pieper
3. Auflage 1990 © 1981 by Kösel-Verlag GmbH & Co., München Gesamtherstellung: Kösel, Kempten Umschlag: Günther Oberhauser, München Foto gegenüber S. 3: Hilde Schürk-Frisch
eISBN 978-3-641-18248-9
www.randomhouse.de
www.randomhouse.de
Vorwort
In jedem seiner dichten kleinen Bücher ist Josef Pieper als Denker wie als Mensch ganz gegenwärtig und legt sich so unverborgen aus, dass ein Buch über ihn kaum einen Sinn hätte. Mir hat es sein wundervolles Nachwort zu C. S. Lewis’ Werk »Über den Schmerz« besonders angetan; es trägt die Überschrift: »Über die Schlichtheit der Sprache in der Philosophie«. Er zeigt dort, dass die Einzelwissenschaften, die immer vom Sinn des Seins im Ganzen abstrahieren, sich eine präzise Sprache leisten können (oder sich damit begnügen müssen), während der Philosoph, der das »heilig öffentlich Geheimnis« (Goethe) des Seins im Ganzen und seiner Bedeutung betrachtet, sich am besten an die immer auch aus der Weisheit der unbewusst philosophierenden Menschen gewachsene Sprache hält. »Das Wort der gewachsenen Menschensprache fasst mehr Realität als der künstliche Terminus.« Und es folgt die erstaunliche, aber richtige Aussage: »Nicht allein Laotse, Platon und Augustin, sondern auch Aristoteles und Thomas kennen, so unwahrscheinlich es klingen mag, keine eigentliche Fachterminologie.« Diese Namen bürgen dafür, dass die von Pieper gemeinte Schlichtheit – »sie ist das Siegel der Glaubwürdigkeit« – keineswegs »die plane oder gar triviale ›Leichtverständlichkeit‹« meint.
Warum nicht? Weil die Methode jeder Wissenschaft dann richtig ist, wenn sie sich von ihrem Gegenstand her bestimmen lässt. Die Geschichte oder die Psychologie haben eine andere Weise, exakt zu sein, als etwa die Physik oder die Biologie. Dieser fundamentale Satz ist für Pieper immer Ausgangspunkt geblieben: Annahme und Geltenlassen des Gegebenen, wie es sich gibt, in seiner eigenen Wahrheit, Gutheit und Schönheit, ist Voraussetzung dafür, etwas von ihm zu erfahren. Und wenn wir auf den Menschen übergehen, so kann man an ihm ablesen, wann und wie er sich in der ihm eigenen Wahrheit und Richtigkeit, Vollkräftigkeit (virtus) darstellt: die Kardinaltugenden, wie Pieper sie in seinen berühmten vier Büchlein nach Platon und Thomas neu interpretiert, sind nichts als das Sich-Geben des Menschen, des Abbilds des absoluten Seins.
Wie aber gibt sich die Wirklichkeit, das »heilig öffentlich Geheimnis«, das wir nach Goethe »ohne Säumnis« ergreifen sollen? Immer als ein Mehr als was erfassbar ist, immer als ein »unaustrinkbares Licht«. Am Erlebnis eines sich mir schenkenden liebenden Du erfahre ich, dass dieses Mehr, nämlich die Freiheit des sich öffnenden Andern, nicht greifbar ist, obschon sie sich mir in der Hingabe ja nicht entzieht.
Piepers Kenntnis der Philosophiegeschichte ist universal; auch wenn er nie damit prunkt, kann er mit einem ins Schwarze treffenden Zitat aus einer beliebigen Periode sein Gemeintes erklären und stützen. Aber er ist weit entfernt, Halbwahres gelten zu lassen; nach dem Gesagten hat er ein klares und scharfes Nein gesagt – und sich damit zum Unzeitgemäßen gestempelt – gegenüber dem Philosophiebegriff Descartes’ und Bacons, nach denen das Wissen »uns zu Herren und Eigentümern der Natur machen« soll, die Theorie sich an der herstellenden Praxis misst. Nicht als dürfte und sollte der Mensch nicht schaffen, aber erst wenn er vorgängig empfangen hat. Sonst stellt er sich – folgerichtig atheistisch – an die Stelle des Schöpfergottes. Deshalb muss Pieper auch Nein sagen zum bewunderten angeblichen Höhepunkt der modernen Philosophie, zu Hegel, wenn dieser daran mitarbeiten möchte, dass die Philosophie »dem Ziel näherkomme, den Namen ›Liebe zum Wissen‹ ablegen zu können und wirkliches Wissen zu sein«. Absolutes Wissen, worin das Geheimnis des Seins hineinverschwunden ist in die von der Vernunft beherrschte dialektische Methode. Was ist bei unsern Nachhegelianern aus diesem dämonischen Griff nach dem göttlichen Wissen geworden? Entweder das leere Geklapper von Logistik, das hermetische Getuschel über Hermeneutik oder die letztlich spießbürgerliche Unterwerfung des Wissens unter den Staat (Hegel), das Volk (Hitler), die Wirtschaft und Gesellschaft (Marx, Stalin, der Amerikanismus).
Wo sich nichts mehr »gibt« und von sich her »eröffnet«, nichts mehr von sich her sich »überliefert«, wo also der Ursprung nicht mehr bedacht wird, da ist auch keine Eröffnung auf Zukunft mehr möglich. Nur wenn Philosophie als liebende Sehnsucht nach dem Immer-Mehr im Geheimnis des Seins den Menschen unbedingt auf den Weg setzt, erhält die von Pieper immerfort bedachte Öffnung der Zukunft, als Hoffnung, allererst eine Grundlage.
Ein Letztes, das Pieper auch zu einem der Unzeitgemäßen macht, die ja zumeist die Notwendigsten sind. Wenn Philosophie nur dadurch möglich ist, dass sich Sein »immer schon«, wenn auch im Geheimnis, erschlossen hat, dann hat Philosophie auch immer schon mit Theologie zu tun. Für die Griechen war das selbstverständlich: Philosophie war suchendes Wissen nach dem absoluten Urgrund der Welt. Wie ist es nur möglich, dass Philosophie heute von dieser Höhe herabgesunken ist und sich unter den Spezialwissenschaften eingereiht und gemeingemacht hat? Deshalb vielleicht, weil sich christliche Theologie als die – ebenfalls speziale – »Wissenschaft« von der Selbsterschließung des göttlichen Urgrunds in Christus etabliert hat? Aber dies doch wohl erst seit einer rationalistischen Spätscholastik und den Auswirkungen Descartes’, während für die Väter und die Hochscholastik das »Staunen« des Philosophen vor dem »heilig öffentlich Geheimnis« immer die Grundlage und Voraussetzung der christlichen »Liebe« zu dem im Alten und Neuen Bund sich ganz hingebenden Gott geblieben war. »Liebe« nicht primär »zu«, sondern zuvor »Liebe von her«: wie der gnädige, treue, barmherzige Bundesgott Israels schließlich vollkommene Liebe vom antwortenden Menschen einfordert, so fordert Jesus als der auf Gott Durchsichtige, Gott Auslegende eine (wahrhaft staunende!) Liebe für sich: »Liebst du mich mehr als diese?«»Wenn ihr mich liebt, dann haltet mein Gebot«: nämlich das der Liebe, in der (allein) sich jetzt die höchste Einsicht in das Absolute öffnet. Haben die Theologen überlegt, was für eine »wissenschaftliche« Methode ein Gegenstand braucht, der höchste Liebe für sich einfordert? Sicher keine, die ihn zu beherrschen sucht.
Pieper hat die unvermeidliche, immer schon bestehende Vermählung der Philosophie mit der Theologie ungescheut mitgefeiert. Seine Werke bewegen sich alle in dem einzig konkreten Raum unserer Welt, in dem der Philosoph nicht umhin kann, sich mit der Selbsterschließung des Seins in Jesus Christus positiv oder negativ auseinanderzusetzen. In diesem konkreten Raum haben alle echten christlichen Denker unseres Jahrhunderts gelebt: Marcel und Eliot, Lewis und Siewerth, um nur diese zu nennen. Wer dies Konkrete zerfällt, in eine in sich geschlossene Philosophie und eine sich selbst genügende Theologie, ist weder Philosoph noch Theologe, so sehr eine solche Aussage den modernen »Fach«-Leuten gegen den Strich gehen mag.
Wir schulden Josef Pieper großen Dank, dass er uns in seinen unzeitgemäßen Betrachtungen das für unsere Zeit Notwendigste unermüdlich neu sagt.
Hans Urs von Balthasar
Inhaltsverzeichnis
Menschliches Richtigsein
1
Das Äußerste
Der letzte große Magister der noch ungeteilten abendländischen Christenheit, Thomas von Aquin, hat die menschliche Tugend als das ultimum potentiae bezeichnet, zu Deutsch: als das Äußerste dessen, was einer sein kann. Mancherlei wohlbekannte Schiefheiten, die sich in unserer Vorstellung mit dem Worte »Tugend« zu verknüpfen pflegen, lässt diese knappe Sentenz, wie sogleich klar ist, gar nicht erst aufkommen; es ist auch nicht der Mühe wert, groß davon zu reden. Dagegen lohnt es sich durchaus, einige begriffliche Elemente genauer zu bedenken, die jene Definition in sich birgt und vielleicht auch, beim ersten Hinblicken, ein wenig verbirgt.
Wer, zum Beispiel, vom ultimum redet, vom Letzten und Äußersten also, der hat bereits mitgedacht, dass es auch ein Vorletztes und ein Erstes gebe. Und damit ist zugleich über den Menschen einiges gesagt: dass sein durchschnittliches Leben zwischen diesen verschiedenen Realisierungsstufen angesiedelt sei, angelegt zwar auf das Äußerste des Seinkönnens, es aber nicht notwendig auch erreichend; dass der Mensch, allgemeiner gesprochen, im Kern ein Werdender sei, jedenfalls nicht ein einfachhin so oder so beschaffenes Wesen, nicht etwas rein statisch Vorhandenes, sondern geschehendes Sein, dynamische Realität – wie übrigens der gesamte Kosmos auch. Natürlich ist dies nicht eine unterscheidend christliche Konzeption. Der griechische Dichter Pindar hat sie, schon vor mehr als zweitausend Jahren, in den berühmten Satz gefasst: Werde, was du bist – womit das in der Tat verwunderlich Scheinende gesagt ist, dass wir nicht schon seien, was wir dennoch sind. Hiervon ist auch die theologische Lebenslehre der Christenheit überzeugt, wenn sie allein dem Menschen wahre Tugend zuspricht, der das Äußerste dessen realisiert, was zu sein ihm möglich ist.
Etwas spezifisch Christliches allerdings zeigt sich in der Antwort auf die Frage, wie der allerfrüheste Anfang dieses Selbstverwirklichungsvorgangs zu denken sei. Offenkundig ist ja der Beginn vorgegeben; es ist nicht so, als setze der Mensch, wenn er in Freiheit das Gute tut, seinen Fuß zum ersten Mal auf einen noch niemals betretenen oder gar überhaupt noch nicht gebahnten Weg. Vielmehr ist alles sittliche, das heißt auf Entscheidung und Verantwortung gegründete menschliche Tun eine bloße Fortsetzung und Weiterführung von etwas, das längst begonnen hat und im Gang ist. Lange bevor er sich frei entscheidet, will »es« bereits mit dem Menschen auf das ihm gemäße Ziel hinaus; wie ein abgeschossener Pfeil ist er schon unterwegs. Die christliche Theologie spricht hier zwar von einem »naturhaften« Wollen, von einem uns »von Natur« innewohnenden impetus, dem wir »folgen«, wenn wir das Gute tun. Doch ist diese Rede von der »Natur« des Menschen und seinem »naturhaften« Wollen nur etwas Vorläufiges und sozusagen Provisorisches. Man begreift sie erst dann richtig, wenn man die menschliche »Natur« als den Inbegriff dessen versteht, das mit dem Menschen kraft der Erschaffung gemeint ist. Im Akt der Erschaffung ist der Mensch durch Gott auf den Weg gesetzt worden, an dessen Ende jenes »Äußerste« steht, das im vollen Sinn »Tugend« heißen kann: die Verwirklichung des in der Kreatur eingekörperten göttlichen Entwurfs.
Wer dies bedenkt, mag den fast unerfüllbaren Anspruch ahnen, den der Begriff »Tugend« besagt. Und vielleicht wird ihm plötzlich das gezielte Wort des Neuen Testaments etwas weniger rätselhaft: »Niemand ist gut – außer Gott allein« [Mk 10,18].
2
Ein totes Wort?
Vor der Französischen Akademie ist vor einigen Jahren eine Rede über die Tugend gehalten worden, und zwar durch Paul Valéry. In dieser Akademie-Rede heißt es: »Tugend, meine Herren, das Wort Tugend ist tot«. Es ist dahin gekommen, dass das Wort »Tugend« »nur noch im Katechismus, in der Posse, in der Akademie und in der Operette anzutreffen ist«. – Diese Diagnose ist ganz unbestreitbar richtig. Man darf sich jedoch nicht allzu sehr darüber wundern. Zu einem Teil handelt es sich hier um eine durchaus natürliche Erscheinung, um das natürliche Schicksal der »großen Worte«. Anderseits: warum sollen in einer entchristlichten Welt nicht dämonische Sprachgesetzlichkeiten wirksam sein können, kraft deren dem Menschen das Gute »sprachgebräuchlich« als lächerlich erscheint? Und endlich und vor allem darf man, abgesehen von dieser letztgenannten durchaus ernstzunehmenden Möglichkeit, nicht vergessen, dass die christliche Moral-Literatur und Moral-Verkündigung es dem Durchschnittsmenschen nicht immer leicht gemacht hat, den echten Sinn des Begriffs und der Wirklichkeit »Tugend« zu gewahren.
Tugend bedeutet nicht die »Bravheit« und »Ordentlichkeit« eines isolierten Tuns oder Lassens. Sondern Tugend bedeutet: dass der Mensch richtig »ist«, und zwar im übernatürlichen wie im natürlichen Sinne. – Hier liegen zwei gefährliche Möglichkeiten der Verkehrung des Tugendbegriffes innerhalb des christlichen Gemeinbewusstseins selbst: erstens die Möglichkeit des Moralismus, der das Tun, die »Verrichtung«, die »Übung« isoliert und verselbstständigt gegen das lebendige Dasein des lebendigen Menschen; und zweitens die Möglichkeit des Supranaturalismus, der den Bezirk des natürlich wohlgeschaffenen Lebens, des Vitalen und der natürlichen Anständigkeit und Sauberkeit entwertet. – Tugend also ist, ganz allgemein, seinsmäßige Erhöhung der menschlichen Person; sie ist die Erfüllung menschlichen Seinkönnens – im natürlichen und im übernatürlichen Bereich. Der tugendhafte Mensch »ist« so, dass er, aus innerster Wesensneigung, durch sein Tun das Gute verwirklicht.
3
»Sollen«
Allem voraus und zuvor muss eine Voraussetzung klar und akzeptiert sein, die Überzeugung nämlich, dass der Mensch überhaupt etwas »soll«, dass, anders gesagt, in seinem Tun und Verhalten nicht alles Faktische sowieso schon richtig ist und gut. Es ist sinnlos, einem Schwein zureden zu wollen, es möge sich wahrhaft »wie ein Schwein« benehmen und verhalten. Aber die rüde Verszeile von Gottfried Benn »Die Krone der Schöpfung: das Schwein, der Mensch« – dass so etwas überhaupt gesagt werden und dass es auf grausige Weise zutreffend sein kann: schon das zeigt, dass der Mensch das wahrhaft Menschliche im Felde des Faktischen erst noch zu realisieren hat, das heißt, dass er, indem er existiert, etwas »soll«. Natürlich kann man das auch weniger aggressiv formulieren als Gottfried Benn. Zum Beispiel so: »Das Feuer tut Wahrheit und Richtigkeit notwendigerweise, nicht aber so der Mensch, wenn er das Gute tut« – das ist ein Satz aus Anselm von Canterburys Dialog über die Wahrheit. Damit ist zweierlei ausgesagt: dass der Mensch frei ist [einerseits]; und: dass mit dem Menschen, über seinen Kopf hinweg und ohne dass er gefragt worden wäre, etwas gemeint ist [anderseits]. Genau dies Letztere ist es, wogegen etwa aller Existentialismus sich wehrt, der ja, weit über den Bereich einer philosophischen Fachrichtung hinaus, die durchschnittliche Lebensanschauung des Menschen dieser Zeit bestimmt; genau das meint J. P. Sartres berühmter Satz: »Es gibt keine menschliche Natur«! Wer nicht anerkennt, dass der Mensch auf völlig andere Weise homo sapiens »ist«, als das Wasser gleich H2O »ist«; dass vielmehr der Mensch erst werden muss, was er ist [und es also nicht schon eo ipso »ist«!]; dass man von allen Wesen sonst in der Welt im Indikativ sprechen kann, in simplen Aussagesätzen, vom Menschen aber, wenn man sein Eigentliches treffen will, nur im Imperativ – wer das nicht sieht oder nicht wahrhaben will, für den hat es begreiflicherweise gar keinen vertretbaren Sinn, vom »Sollen« überhaupt zu sprechen und also eine Sollenslehre eigens darzulegen, sei dies nun die Tugendlehre oder etwas anderes dieser Art.
4
Sieben Sätze
Die abendländische Lebenslehre hat den Inbegriff dessen, was der Mensch »soll« in sieben Sätzen ausgesprochen:
Erstens: Der Mensch, sofern er das mit ihm Gemeinte realisiert, ist einer, der sich – im Glauben – der Rede Gottes hörend öffnet, wann immer sie ihm vernehmlich wird.
Zweitens: Der Mensch ist nur dann richtig, wenn er sich – in der Hoffnung – auf eine Erfüllung spannt, die in dieser leibhaftigen Existenz nicht zu haben ist.
Drittens: Der zur Vollendung strebende Mensch ist einer, der – in der Liebe [caritas] – teilnimmt an der unendlichen Bejahungskraft des Schöpfers selbst und es, mit allen Kräften seiner Existenz, gut findet, dass es Gott, die Welt und ihn selber gibt.
Viertens: Der Mensch kann nur dann richtig sein, wenn er sich den Blick für die Wirklichkeit nicht trüben lässt durch das Ja oder Nein des Willens; er macht, umgekehrt, sein Beschließen und Tun abhängig von der ihm zu Gesicht kommenden Realität. Er ist dadurch klug, dass er gewillt ist, die Wahrheit zu tun.
Fünftens: Der gute Mensch ist vor allem gerecht, das heißt, er versteht sich darin, Mit-Mensch zu sein. Er besitzt die Kunst, auf solche Weise mit den Anderen zu leben, dass jedem zuteil wird, was ihm zusteht.
Sechstens: Der Mensch, der klug und gerecht ist, weiß, dass es zur Verwirklichung des Guten in dieser Welt des Einsatzes der Person bedarf. Er ist – in der Tapferkeit – bereit, um der Wahrheit und Gerechtigkeit willen Nachteile und Verwundungen in Kauf zu nehmen.
Siebentens: Zum Richtigsein des Menschen gehört die Tugend des Maßes und der Zucht, wodurch er sich schützt gegen die Selbstzerstörung durch Genuss.
5
Dreiströmiges Leben
Das übernatürliche Leben im Menschen ist dreiströmig: Im Glauben kommt die über alle natürliche Erkenntnis – »nicht nur des Menschen, sondern auch der Engel« – hinausragende Wirklichkeit Gottes in den Blick. Die Liebe bejaht – um seiner selbst willen – das im Glauben verhüllt sichtbar gewordene Höchste Gut. Die Hoffnung ist die vertrauend auslangende Erwartung der Ewigen Glückseligkeit in der schauend-umfangenden Teilhabe am dreifalitgen Leben Gottes; die Hoffnung erwartet das Ewige Leben, das Gott selber ist, aus Gottes eigener Hand, sperat Deum a Deo.
Das existentielle Zueinander dieser drei – Glaube, Hoffnung, Liebe – lässt sich zusammengefasst in drei Sätzen aussprechen:
Der erste Satz lautet: Glaube, Hoffnung und Liebe werden der menschlichen Natur als übernatürliche Seinsneigungen [habitus], alle drei zugleich, eingesenkt; zugleich mit der Gnadenwirklichkeit, dem gemeinsamen Seinsgrund alles übernatürlichen Lebens.
Der zweite Satz: In der Ordnung der akthaften Entfaltung dieser übernatürlichen Seinshaltungen ist der Glaube früher als Hoffnung und Liebe, und die Hoffnung ist früher als die Liebe.
Und umgekehrt: In der schuldhaften Unordnung der Auflösung geht zuerst die Liebe verloren, dann die Hoffnung, der Glaube zuletzt.
Und drittens: In der Rangordnung der Vollkommenheit hat die Liebe den ersten Platz, der Glaube den letzten, die Hoffnung steht zwischen beiden.
6
»So ist es und nicht anders«.
Wenn einer mich fragt: »Glaubst du das?« – Was eigentlich will er dann des Näheren von mir wissen? Jemand gibt mir eine Nachricht zu lesen oder liest sie mir vor, eine Nachricht, die er selber anscheinend für verwunderlich hält, für unwahrscheinlich; und dann blickt er mir ins Gesicht und fragt: »Glaubst du das?« Offenbar will er wissen, ob ich die Nachricht für zutreffend halte, für wahr und das darin Berichtete für wirklich passiert, für Realität.
Für mich gäbe es, rein abstrakt betrachtet, mehrere Möglichkeiten einer Antwort, nicht nur »Ja«, nicht nur »Nein«. Ich könnte etwa die Schultern hochziehen und sagen: Ich weiß nicht, es kann stimmen; aber es kann, finde ich, ebenso gut nicht stimmen. Ich könnte auch möglicherweise sagen: Nun, ich denke schon, dass die Sache ihre Richtigkeit hat, obwohl ich natürlich nicht absolut sicher bin, dass es nicht auch anders sein könnte. Vielleicht sage ich auch mit völliger Bestimmtheit: Nein, ich nehme nicht an, dass die Nachricht stimmt; was dann, positiv formuliert, so viel heißen würde wie: Ich halte die Mitteilung für falsch, für einen Irrtum, vielleicht für eine Lüge.
Mein »Nein« könnte allerdings auch etwas ganz anderes noch bedeuten, nämlich Folgendes: Du fragst mich, ob ich glaube, was da gesagt wird. Du wirst lachen, ich glaube es nicht, und doch sage ich: Die Nachricht stimmt! Ich habe nämlich den hier berichteten Vorfall zufällig selber gesehen, mit eigenen Augen. Ich glaube nicht, dass es stimmt, sondern ich weiß es. Und endlich gibt es natürlich noch die Möglichkeit, dass ich nach einer Weile sage: Ja, ich glaube, dass es sich genauso verhält, wie es da geschrieben steht. Das allerdings werde ich vielleicht erst sagen, nachdem ich mich vergewissert habe, wer der Berichterstatter ist oder in welcher Zeitung die Nachricht steht.
Übrigens sind hiermit unversehens die vier sozusagen klassischen Grundgestalten der Stellungnahme zu einem Sachverhalt aufgeführt: Zweifeln, Meinen, Wissen, Glauben. Das Nichtglauben [die Nachricht ist eine Lüge] lassen wir jetzt auf sich beruhen, da es ja im Grunde eine positive Stellungnahme ist, die dann wiederum des Näheren die Form von Meinen oder Wissen oder Glauben haben kann.
Der Wissende und der Glaubende haben eines gemeinsam. Sie sagen beide: Ja, so ist es, und nicht anders. Beide halten den Sachverhalt, der da berichtet wird, ohne Vorbehalt für wahr.
In einem anderen, sehr wichtigen Punkte allerdings unterscheiden sich Wissen und Glauben, der Wissende und der Glaubende, ganz und gar: der Wissende hat Einblick in den Sachverhalt, von dem die Rede ist; der Glaubende dagegen kennt den Sachverhalt aus eigenem nicht! – Aber wieso kann er dann sagen: So ist es, und nicht anders?
Hier steckt die ganze Problematik des Begriffs »Glauben«, und nicht nur des Begriffs, auch der Praxis »Glauben«: die theoretische Schwierigkeit, wie man sich die Aktstruktur von Glauben vorstellen soll, und die praktische Schwierigkeit, wie man Glauben als lebendigen Akt zustandebringen, verantworten, rechtfertigen kann.
Meine Antwort auf die Frage wieso der Glaubende sagen könne: so ist es, und nicht anders – meine Antwort ist: Er kann das sagen, weil er sich auf einen anderen verlässt, der ihm den Sachverhalt verbürgt. Anders also als der Wissende hat der Glaubende es nicht nur mit einem Sachverhalt zu tun, sondern außerdem und vor allem mit einem Jemand, mit der Person des Zeugen, dem der Glaubende vertraut.
7
Teilhabe am Wissen
Glauben heißt: teilhaben an der Erkenntnis eines Wissenden. Wenn es also niemanden gibt, der sieht und weiß, dann kann es mit Fug auch niemanden geben, der glaubt. Ein Sachverhalt, den jedermann kennt, weil er offen zutage liegt, kann ebensowenig Gegenstand des Glaubens sein wie einer, den niemand kennt – und der also auch von niemandem bezeugt werden kann. Glaube kann sich nicht aus sich selbst legitimieren, sondern allein daraus, dass ein Jemand existiert, der das zu Glaubende aus eigenem kennt, und dass es eine Verbindung mit diesem Jemand gibt.
Damit ist mehreres gesagt, vor allem dies: Glauben ist seiner Natur nach etwas Zweites. Wo immer sinnvollerweise geglaubt wird, da ist jemand anders, auf den sich der Glaubende stützt; und dieser andere ist nicht wiederum ein Glaubender. Sehen und Wissen sind demnach das in der Rangfolge Frühere und Höhere. Das ergibt sowohl die nüchterne Befragung des menschlichen Denk- und Sprachgebrauchs wie auch die Interpretation des Glaubensbegriffs der abendländischen Theologie. Weder hier noch dort bleibt Raum für jene romantische Absolutsetzung, die den Glauben als etwas Äußerstes und Höchstes deutet, das nicht mehr überboten werden könne. Bei Newman steht der einigermaßen aggressive Satz zu lesen: »Der Glaube muss sich schließlich auf Schauen und Vernunft zurückführen lassen können – wenn wir es nicht mit den Phantasten halten wollen«.
Die Rangordnung also, an deren erster Stelle nicht Glauben steht, sondern Sehen und Wissen – diese Rangordnung wird in der überlieferten Lehre vom Glauben nicht nur nicht angetastet, sondern ausdrücklich bestätigt. Visio est certior auditu, sagt Thomas; Sehen ist mehr als Hören. Das heißt: im Selbersehen ist mehr an Kontakt zur Realität verwirklicht, mehr an Wirklichkeitshabe als in dem Wissen, das auf Hören beruht.
Dies freilich bedarf sogleich einer wichtigen Ergänzung, man könnte auch sagen: einer Korrektur. Der eben angeführte Satz aus der Summa Theologica ist unvollständig zitiert; er beginnt so: Ceteris paribus visio est certior auditu …; unter sonst gleichen Bedingungen ist Sehen mehr als Hören. Das heißt: wenn beide Möglichkeiten mir gleichermaßen offenstehen, wenn ich die Wahl habe – dann wähle ich das Wissen aufgrund von Sehen und nicht das aufgrund von Hören.
Aber vielleicht steht es um den Menschen so, dass er nicht oder nicht immer wählen kann? Was ist zu tun, wenn die Entscheidung so lautet: entweder überhaupt kein Zugang zu einem bestimmten Sachverhalt oder ein Wissen aufgrund von Hören; entweder eine unvollkommene Kenntnis also oder überhaupt keine Kenntnis? Es bleibt, wie gesagt, völlig unangetastet bestehen, dass ceteris paribus Selbersehen mehr ist als Hören. Was aber, wenn Selbersehen unmöglich ist? Soll man, statt einen weniger vollkommenen Zugang zur Realität in Kauf zu nehmen, lieber auf jeden Zugang überhaupt verzichten? Genau das ist die Frage, vor welcher jeder steht, der sich zu entscheiden hat zwischen Glauben und Nicht-Glauben.
Setzen wir den Fall eines Naturforschers, der sich um das Jahr 1700 die Aufgabe gestellt hätte, die »Blütenstaub«-Körner bei den ihm bekannten Pflanzen zu beschreiben. Zweifellos wäre er sehr wohl imstande gewesen, mit bloßem Auge und mithilfe einfacher Lupen nicht wenig durch »Selbersehen« herauszufinden. Er hätte freilich möglicherweise auch den Besuch eines Fachgenossen bekommen können, der bei Antony van Leeuwenhoek in Delft solchen Blütenstaub unter einem der ersten Mikroskope betrachtet hatte. Dieser Besucher hätte ihm etwa berichtet, die schwarzen Körnchen, die einem beim Abstreifen einer Mohnblüte in der Hand bleiben, seien in Wahrheit äußerst regelmäßig durchstrukturierte geometrische Gebilde von immer wiederkehrender Gestalt, klar unterscheidbar von den Pollenkörnern aller anderen Blütenpflanzen – und so fort. Nehmen wir des Weiteren an, dass jener Mann keine Möglichkeit gehabt hätte, selber durch ein Mikroskop zu sehen, und dass sein Besucher nichts erzählt hätte, als was er wirklich wahrgenommen hatte. Würde er unter dieser Voraussetzung nicht einfachhin mehr Wahrheit, und das heißt, mehr Realität zu fassen bekommen, wenn er sich nicht darauf versteifte, allein das für wahr und wirklich zu halten, was er selber mit eigenen Augen sähe, sondern wenn er es fertig brächte, dem Besucher zu »glauben«? Wie also steht es in solcher Situation mit der Rangordnung zwischen dem Kenntnishaben aufgrund von Selbersehen und dem Kenntnishaben aufgrund von Hören? Hat nicht nun doch das Hören und Glauben den Vorrang?
Dies ist der Punkt, endlich den noch immer nicht vollständig angeführten Satz von Thomas unverkürzt zu zitieren: »Unter sonst gleichen Bedingungen ist Sehen mehr als Hören; wenn aber der, von dem man hörend etwas erfährt, weit mehr zu erfassen vermag, als was man selber sehend zu Gesicht bekommt, dann ist Hören mehr als Sehen«. Natürlich ist das zunächst gemünzt auf den Glauben im theologischen Sinn. Aber es gilt für allen Glauben sonst auch, dessen Chance darin liegt, dass der Glaubende eines Wissens teilhaftig wird, über das er von sich aus nicht schon verfügt.
Ein Spruch aus Hesiods »Werken und Tagen« zielt auf den gleichen Sachverhalt. Das Weisesein mit dem Kopf von jemand anders, so etwa heißt es da, sei zwar geringer als das Selberwissen, aber es wiege unendlich mehr als der sterile Hochmut dessen, der die Unabhängigkeit des Wissenden nicht zustande bringt und zugleich die Abhängigkeit des Glaubenden verachtet.
Wenn es dem Menschen verwehrt wäre, mit seiner natürlichen Kraft ein irgendwie geartetes Wissen davon zu gewinnen, dass Gott existiert; dass er die Wahrheit selbst ist; dass er tatsächlich zu uns gesprochen hat, und was diese göttliche Rede sagt und meint – dann ist Offenbarungsglaube als ein sinnvoller menschlicher Akt gleichfalls nicht möglich [als einen menschlichen Akt aber versteht die Theologie auch den Akt des »übernatürlichen«, »eingegossenen« Glaubens: wir selber sind es, die glauben!]. Zugespitzt formuliert: wenn alles Glaube sein soll, dann gibt es überhaupt keinen Glauben.
Genau dies meint die alte Vorstellung von den praeambula fidei; die Voraussetzungen des Glaubens sind nicht ein Teil von dem, was der Glaubende glaubt; sie gehören vielmehr zu dem, was er weiß oder zum mindesten muss wissen können. Dass es dabei, entsprechend dem durchschnittlichen Lauf der Dinge, immer nur wenige sind, die das an sich Wißbare wirklich wissen, ist eine andere Sache und jedenfalls kein ins Gewicht fallender Einwand gegen die Gültigkeit des Satzes: cognitio fidei praesupponit cognitionem naturalem, der Glaube setzt eine nicht wiederum glaubende, auf jemand anders sich verlassende, sondern eine aus eigenem wissende Erkenntnis voraus.
Nirgendwo allerdings steht geschrieben, diese cognitionaturalis müsse immer oder primär in der Weise des rationalen, schlussfolgernden Denkens gewonnen sein. – »Glaubwürdigkeit« zum Beispiel ist eine Person-Qualität, die folglich nur auf solche Weise erkannt wird, wie auch sonst die Erfassung einer Person sich zuträgt; und natürlich hat auf diesem Felde das syllogistisch argumentierende Denken nicht allzu viele Möglichkeiten. Wenn wir den Blick auf einen Menschen richten, dann gibt es einerseits die Chance einer so raschen, tiefdringenden und unmittelbaren Erkenntnis, wie sie jeder noch so exakt messenden Konstatierung von Naturtatsachen fremd ist; anderseits ist solche »intuitive« Erkenntnis vielleicht weder nachprüfbar noch zu beweisen. Sokrates hat von sich selbst gesagt, er vermöge einen Liebenden sogleich zu erkennen. Woran erkennt man so etwas? Niemand, auch nicht Sokrates, hat auf diese Frage je eine durch Nachprüfung erweisliche Antwort zu geben gewusst – obwohl er anderseits unbeirrt darauf bestehen würde, es handle sich nicht um bloße Impression, sondern um objektive, das heißt, in der Begegnung mit der Realität zustande gekommene, wahre Erkenntnis.
Natürlich soll, vor allem im Bereich der religiösen Wahrheit, die Unerläßlichkeit und das Gewicht einer rational nachprüfbaren Argumentation [etwa für die Existenz Gottes, für die historische Authentizität der Bibel – und so fort] nicht im mindesten bestritten werden. Aber es leuchtet mir ebenso sehr ein, dass man hat sagen können, wer immer es unternehme, den Glauben gegen die Argumente des Rationalismus zu verteidigen, müsse vielleicht, bevor er auf diese Argumente sich einlasse, die Frage erörtern: »Wie erfassen wir eine Person?«
8
Mitteilung von Wirklichkeit
Nach der Auskunft der Theologie kann das im christlichen Glauben eigentlich Geglaubte in zwei Worten ausgesprochen werden; diese beiden Worte sind: »Trinität« und »Inkarnation«. Es ist der »allgemeine Lehrer« der Christenheit, der sagt, der ganze Inhalt der christlichen Glaubenswahrheit lasse sich zurückführen auf die Lehre vom Dreieinigen Gott und die Lehre von der in Christus exemplarisch verwirklichten Teilhabe des Menschen am Leben Gottes.
Nun aber hat es mit diesem im Grunde einheitlichen Inhalt der Gottesoffenbarung die Bewandtnis, dass die darin augesagte Realität auf besondere Weise eins ist mit dem Akt der Aussage und auch mit der Person des Aussagenden selbst. So etwas ist kaum sonst in der Welt anzutreffen. Das »kaum« soll den Platz frei lassen für die vermutlich einzige Ausnahme, für den Fall nämlich, dass ein Mensch, zu einem anderen gewendet, sagt: Ich liebe dich. Auch diese Aussage hat primär nicht den Sinn, einen objektiven, vom Sprecher abtrennbaren Sachverhalt zur Kenntnis von jemand anders zu bringen; es handelt sich vielmehr um eine Selbstbezeugung; und der bezeugte Sachverhalt realisiert sich eben darin, und einzig darin, dass er auf solche Weise ausgesprochen wird. Dem entspricht, dass auch der Partner auf keine Weise sonst der liebenden Zuwendung des anderen inne werden kann, es sei denn dadurch, dass er das Gesagte hörend in sich einlässt. Natürlich kann ihm das Geliebtwerden auch einfach widerfahren, wie einem unmündigen Kinde; »erfahren« aber kann er es nur auf die Weise, dass er die Liebe des anderen in ihrer worthaften Bezeugung vernimmt und »glaubt«; einzig so wird sie ihm wahrhaft präsent und zuteil.
Auf höherer Stufe gilt genau das Gleiche von der göttlichen Offenbarung. Indem Gott zu den Menschen spricht, lässt er sie nicht sachhafte Tatbestände erkennen, sondern er schließt ihnen sein eigenes Wesen auf. Der Sachverhalt aber, der den wesentlichen Inhalt der offenbarenden Aussage bildet, dass nämlich den Menschen eine Teilhabe am göttlichen Leben zugedacht und angeboten, ja bereits verwirklicht sei – dieser Sachverhalt besitzt seine Realität in nichts anderem als darin, dass er von Gott ausgesprochen wird; dadurch, dass Gott ihn offenbart, ist er wirklich. Es ist nicht so, dass die »Inkarnation« zunächst einmal »sowieso« als Faktum vorläge und dass dann die Offenbarung nachträglich davon Kunde gäbe. Sondern Menschwerdung Gottes und Christusoffenbarung sind eine und dieselbe Wirklichkeit. Wiederum entspricht dem auf der Seite des Glaubenden, dass ihm, indem er die Botschaft des sich selbst offenbarenden Gottes als wahr akzeptiert, die darin kundgetane Teilhabe am göttlichen Leben wirklich geschieht und zuteil wird; es gibt, abgesehen vom Glauben, gar keine andere Weise, wie er ihrer sonst sollte teilhaftig werden können. Das Wort »Mitteilung« gewinnt hier seine ursprüngliche Bedeutung zurück. Göttliche Offenbarung ist nicht Kundgabe eines Berichts über Wirklichkeit, sondern »Mitteilung« der Wirklichkeit selbst – welche Mitteilung freilich allein den Glaubenden erreicht.
9
Hoffen – aufgrund von was?
Jedermann weiß, dass der Lebens-»Erfolg« schlechthin, das Gelingen der Existenz im Ganzen seit je mit dem Namen »Heil« bezeichnet worden ist. Es ist das Heil, worauf »die« Hoffnung zielt. Worin aber besteht das Heil? Diese Frage, das ist von Anfang an klar, kann sinnvollerweise nur erörtert werden, wenn man bereit ist, die letzten Stellungnahmen ins Spiel zu bringen. Wer dies vermeiden will, hat schon darauf verzichtet, vom Gegenstand menschlicher Hoffnung im Ernst zu sprechen.
Die großen Lehrer des christlichen Abendlandes haben die Hoffnung unbeirrbar eine »theologische Tugend« genannt. Darin steckt etwas tief Beunruhigendes, worüber nicht leicht ins reine zu kommen ist. Denn damit ist gesagt: es sei zwar nicht das Mindeste einzuwenden gegen das Recht der innergeschichtlichen Hoffnungen, beileibe nicht; dennoch aber sei der Mensch selber nicht schon dadurch in Ordnung, dass er auf natürliches Gedeihen hoffe, und wäre hiermit so Großes gemeint wie der Friede in der Welt und die gerechte Ordnung unter den Völkern. Es ist gesagt, dass einzig die Hoffnung auf das gottgeschenkte Heil, auf das Ewige Leben, den Menschen von innen her richtig mache. [Ebendies meint ja der Begriff »Tugend«: Richtig-sein.] Man muss die gespannte Fügung dieser These wahrnehmen. Sie richtet sich nicht allein gegen einen rein innergeschichtlichen Aktivismus, der behauptet, es bleibe keine Hoffnung, wenn wir nichts mehr tun können; sondern auch gegen die bloße Jenseitigkeit eines geschichtslosen Supranaturalismus, der die politische Menschenwelt defätistisch preisgibt. Die Beunruhigung, die durch jene These vom »theologischen« Charakter der Hoffnung in Gang gebracht worden ist, bestimmt noch die gegenwärtige Entgegensetzung Marxismus-Christentum. Das Beunruhigendste aber ist die Entschiedenheit, mit der die schon von Platon geahnte Einsicht realisiert wird: dass die »größte Hoffnung« nur unter der Voraussetzung der Einweihung in die Mysterien sich erfülle.
In diesem Bezirk wird auch eine andere, wichtigere Frage beantwortbar – nicht »Hoffnung – auf was?«, sondern »Hoffnung – aufgrund von was?«. Das heilige Buch der Christenheit hat die Antwort in der Weise der Verneinung gegeben: »Die« Hoffnung ist nichtig, »wenn Christus nicht auferstanden ist.«
10
Die Verborgenheit von Hoffnung und Verzweiflung
Es gibt eine Verzweiflung, der man es nicht leicht ansieht, dass sie Verzweiflung ist. Und es gibt eine Hoffnung, die dem oberflächlichen Blick geradezu als Verzweiflung erscheinen kann, obwohl sie auf eine höchst triumphale Weise Hoffnung ist. Ebendies nenne ich die »Verborgenheit« sowohl der Hoffnung wie auch der Verzweiflung. Ich sage nicht, jegliche Hoffnung und jegliche Verzweiflung sei notwendig und immer verborgen; ich sage nur, dass sowohl die Hoffnung wie auch die Verzweiflung in solcher dem ersten Blick nicht kenntlichen Gestalt auftreten könne. Und davon soll im Folgenden die Rede sein.