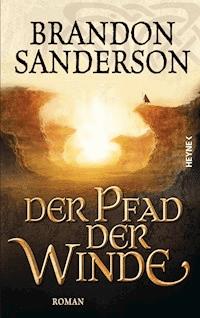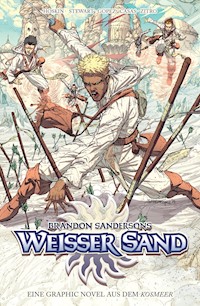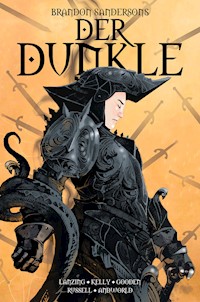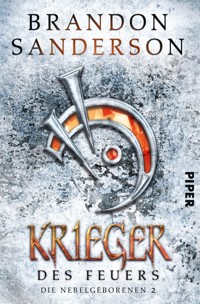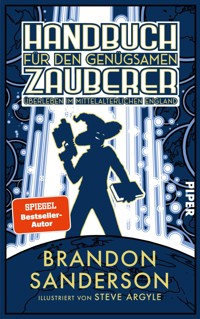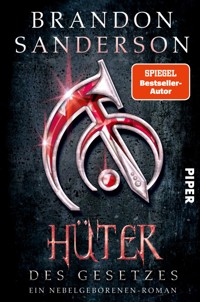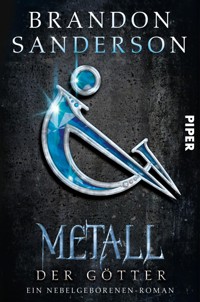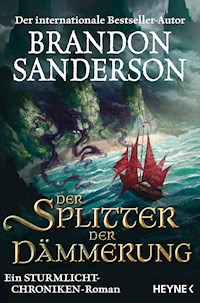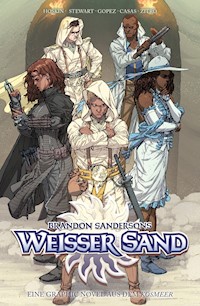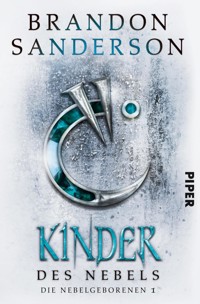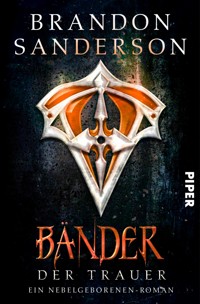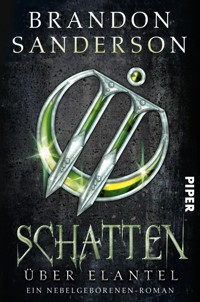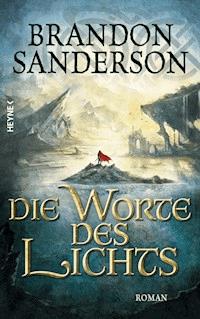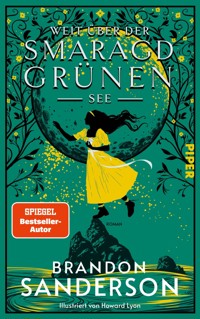
21,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 21,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Schon immer lebt Tress auf ihrer kargen Insel mitten in der smaragdgrünen See. Ein Ort, an dem die aufregendsten Dinge die Tassen sind, die Tress sammelt, und die ihr Seeleute aus fernen Ländern mitbringen. Ihre Lieblingsbeschäftigung ist es, den Geschichten ihres Freundes Charlie zu lauschen, der langsam mehr als ein Freund für sie wird. Als Charlie während einer gefährlichen Reise verschwindet, beschließt Tress, ihr Schicksal in die eigene Hand zu nehmen und zieht aus, ihren Liebsten zu retten. Zahlreiche Gefahren warten auf sie – darunter Piraten, fremde, tödliche Meere und eine böse Hexe. Wird Tress über sich hinauswachsen und ihre große Liebe retten können? Mit dem Crowdfunding für seine »Secret Projects« erreichte Brandon Sanderson Anfang 2022 180.000 Leser:innen weltweit und nahm eine Rekordsumme von über 40 Mio. US-Dollar ein. »Weit über der smaragdgrünen See« ist das erste dieser besonderen Bücher, das nun in deutscher Übersetzung erscheint.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Entdecke die Welt der Piper Fantasy!
www.Piper-Fantasy.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Weit über der smaragdgrünen See« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
Übersetzung aus dem amerikanischen Englisch von Simon Weinert
© Dragonsteel Entertainment LLC 2023
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »Tress of the Emerald Sea«, Dragonsteel Entertainment, American Fork 2023
© der deutschsprachigen Ausgabe:
Piper Verlag GmbH, München 2023
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: Guter Punkt, München, nach einem Entwurf von Dragonsteel Entertainment, LLC, 2023
Coverabbildung: Howard Lyon
Redaktion: Alexander Groß
Illustrationen: Howard Lyon
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Widmung
Dank
Teil 1
1
2
3
4
5
Teil 2
6
7
8
9
10
11
12
Teil 3
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Teil 4
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Teil 5
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Teil 6
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
Epilog
Nachwort
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Für Emily,die meine ganze Liebe hat.
Dank
Was für ein Ritt!
Als ich mich aus einer Laune heraus hinsetzte, um dieses Buch zu schreiben, hatte ich keine Ahnung, wo das alles enden würde. (Lest auf jeden Fall das Nachwort am Ende des Buches, in dem ich über meine Inspirationen spreche und das vielleicht etwas zu viele Spoiler enthält, um es an den Beginn zu setzen.)
Für die vier Bücher der »Secret Projects«-Kickstarter-Kampagne von 2022 hatte ich mir etwas Besonderes vorgestellt, aber mein Team ist deutlich über das Geforderte hinausgegangen. Weit über der smaragdgrünen See ist ein absolut umwerfendes Buch geworden. Ich weiß, dass sich viele von euch das Audiobook anhören werden, das sicher auch seine eigenen künstlerischen Meriten hat – aber wenn ihr Gelegenheit habt, in dem gedruckten Buch zu blättern, dann tut das. Denn es ist irre.
Als Erstes gebührt deshalb Howard Lyon ein Dankeschön. Ich hatte mir diese Bücher als Kataloge der von uns ausgewählten Grafiker*innen vorgestellt, in denen sie sich austoben und tun konnten, was sie wollten. Howard hat so viel aus diesem Buch gemacht. Das Cover, die Vorsatzblätter, die Illustrationen – schlicht die gesamte Gestaltung verdankt ihm alles. Danke, Howard, dass du bereit warst, dieses gewaltige Projekt zu stemmen. Du hast das fantastisch gemacht.
Izaac Stewart ist unser Art-Direktor bei Dragonsteel, und ohne ihn wäre das alles nicht zustande gekommen. Rachael Lynn Buchanan war unsere Grafikassistentin. Bill Wearne von American Print and Bindery hat trotz Papierknappheit zuverlässig für den Druck gesorgt. Vielen Dank, Bill. Und ich möchte auch allen Menschen in der Lieferkette danken, von den Papierfabriken bis zu den Lieferanten der Cover- und Umschlagmaterialien, der Druckerei, der Buchbinderei und den Paketboten.
Der COO von Dragonsteel ist Emily Sanderson. Unsere Lektoratsabteilung besteht aus Peter Ahlstrom, Karen Ahlstrom, Kristy S. Gilbert und Betsey Ahlstrom. Kristy Kugler war für die Redaktion verantwortlich. Unser betriebswirtschaftliches Team besteht aus Matt »Machst du das jetzt in jedem Buch, Brandon?« Hatch, Emma Tan-Stoker, Jane Horne, Kathleen Dorsey Sanderson, Makena Saluone und Hazel Cummings. Adam Horne, Jeremy Palmer und Taylor Hatch bilden unser Team für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit.
Diese Leute bekommen nicht genug Anerkennung für all die sagenhaften Sachen, die sie machen, um meine Projekte umzusetzen. Bei dieser Kickstarter-Kampagne war ich mehr denn je auf ihren Enthusiasmus und ihre tollen Ideen angewiesen. (Zum Beispiel hatte Adam schon vor einigen Jahren die Idee mit den Subskriptionskisten.) Es war eine Menge Arbeit, das alles zu konzipieren und umzusetzen, deshalb sagt meinem Team persönlich Danke, wenn ihr Gelegenheit dazu habt.
Und natürlich gebührt ein besonderer Dank meinem Versand- und Veranstaltungsteam. Kara Stewarts Crew hat viele Überstunden gemacht, um die Bücher an euch zu versenden. Ein Applaus für Christi Jacobsen, Lex Willhite, Kellyn Neumann, Mem Grange, Michael Bateman, Joy Allen, Katy Ives, Richard Rubert, Sean VanBuskirk, Isabel Chrisman, Tori Mecham, Ally Reep, Jacob Chrisman, Alex Lyon und Owen Knowlton.
Ich möchte mich bei Margot Atwell, Oriana Leckert und den anderen Mitarbeiter*innen von Kickstarter bedanken. Außerdem bei Anna Gallagher, Palmer Johnson, Antonio Rosales und der übrigen BackerKit-Crew.
Bei diesem Buch hat uns Jenna Beacom unglaublich mit ihrem Sensitivity Reading geholfen. Solltet ihr jemals für ein Buch Hilfe beim Schreiben einer gehörlosen Figur und der Repräsentation gehörloser Menschen brauchen, dann wendet euch an Jenna. Sie wird euch helfen, alles richtig zu machen.
Unsere Alpha-Leser*innen bei diesem Projekt waren Adam Horne, Rachael Lynn Buchanan, Kellyn Neumann, Lex Wilhite, Christi Jacobsen, Jennifer Neal und Jay Allen.
Unsere Beta-Leser*innen waren Mi’chelle Walker, Matthew Wiens, Ted Herman, Rob West, Evgeni »Argent« Kirilov, Jessie Lake, Kalyani Poluri, Bao Pham, Linnea Lindstrom, Jory Phillips, Darci Cole, Craig Hanks, Sean VanBuskirk, Frankie Jerome, Giulia Costantini, Eliyahu Berelowitz Levin, Trae Cooper und Lauren McCaffrey.
Zu den Gamma-Korrekturleser*innen gehörten überdies noch Joy Allen, Jayden King, Chris McGrath, Jennifer Neal, Joshua Harkey, Eric Lake, Ross Newberry, Bob Kluttz, Brian T. Hill, Shannon Nelson, Suzanne Musin, Glen Vogelaar, Ian McNatt, Gary Singer, Erika Kuta Marler, Drew McCaffrey, David Behrens, Rosemary Williams, Tim Challener, Jessica Ashcraft, Anthony Acker, Alexis Horizon, Liliana Klein, Christopher Cottingham, Aaron Biggs und William Juan.
Last but not least muss ich mich bei all jenen von euch bedanken, die das Projekt auf Kickstarter unterstützt haben. Ich hatte es nicht auf den ersten Platz abgesehen – und schon gar nicht auf das Doppelte davon. Ich wollte nur etwas anderes machen, etwas Interessantes und Aufregendes. Eure Unterstützung bedeutet mir fortwährend so unglaublich viel. Danke!
Brandon Sanderson
1
Das Mädchen
Auf einem Felsen mitten im Ozean lebte ein Mädchen.
Der Ozean war nicht so, wie ihr euch das vorstellt.
Und auch der Felsen war nicht so, wie ihr ihn euch vorstellt.
Das Mädchen jedoch könnte durchaus so sein, wie ihr es euch vorstellt – falls ihr es euch nachdenklich, mit leiser Stimme und einer übergroßen Freude am Sammeln von Tassen vorgestellt habt.
Wenn Männer das Mädchen beschrieben, sagten sie häufig, seine Haare hätten die Farbe von Weizen. Andere meinten, sie hätten eher die Farbe von Karamell oder manchmal auch die Farbe von Honig. Das Mädchen fragte sich, weshalb Männer Frauen so oft mit Essbarem beschrieben. In diesen Männern steckte ein Hunger, dem es lieber aus dem Weg ging.
Der Ansicht des Mädchens nach reichte »hellbraun« als Beschreibung völlig aus – allerdings war der Farbton nicht das Interessanteste an diesen Haaren. Sondern vielmehr deren Eigenwilligkeit. Allmorgendlich zähmte das Mädchen sie unter heroischen Anstrengungen mit Bürste und Kamm, legte ihnen ein Haarband als Maulkorb an und verschnürte sie zu einem straffen Zopf. Doch stets entkamen ein paar Strähnen und wehten frei im Wind, um allen Vorbeigehenden eifrig zuzuwinken.
Bei seiner Geburt hatte das Mädchen den unvorteilhaften Namen Glorf bekommen (keine Vorwürfe, bitte; es war ein Familienname), doch den Namen, mit dem es jedermann rief, hatte es seinen widerspenstigen Haaren zu verdanken: Tress. Dieser Spitzname – Locke – bezeichnete nach Tress’ eigener Einschätzung das Interessanteste an ihrer Person.
Man hatte Tress einen gewissen unbeirrbaren Pragmatismus anerzogen. Das ist ein verbreiteter Makel unter jenen, die auf kargen, leblosen Inseln leben, die sie nie verlassen können. Wenn man jeden Tag von schwarzem Stein begrüßt wird, färbt das durchaus auf die Lebenseinstellung ab.
Die Insel hatte ungefähr die Form eines krummen Greisenfingers, der aus dem Ozean ragte und zum Horizont zeigte. Sie bestand ganz aus unwirtlichem schwarzem Salzstein und war groß genug, um einem größeren Städtchen und der Villa eines Herzogs Platz zu bieten. Die Einheimischen nannten die Insel zwar Felsen, aber auf den Karten hieß sie Diggenspitze. Niemand wusste mehr, wer Diggen war, doch anscheinend war er ein kluger Kerl gewesen, denn er hatte den Felsen rasch wieder verlassen, nachdem er ihn getauft hatte, und war nie wieder zurückgekommen.
Abends saß Tress oft auf der Veranda des elterlichen Hauses, schlürfte salzigen Tee aus einer ihrer Lieblingstassen und blickte aufs grüne Meer hinaus. Genau, ihr habt richtig gehört, das Meer war grün. Und überdies war es nicht nass. Darauf kommen wir noch zurück.
Während des Sonnenuntergangs grübelte Tress über die Leute nach, die in ihren Schiffen den Felsen aufsuchten. Niemand, der noch ganz richtig im Kopf war, hätte im Felsen eine touristische Attraktion gesehen. Der schwarze Salzstein war bröckelig und drang überall ein. Außerdem machte er so gut wie jede Landwirtschaft unmöglich und verseuchte irgendwann auch die Erde, die man von woanders heranschleppte. Das einzig Essbare, was auf der Insel wuchs, stammte aus Kompostbehältern.
Auf dem Felsen befanden sich zwar Brunnen, die Wasser aus tiefen Grundwasservorkommen pumpten – das wiederum die hier anlandenden Schiffe benötigten –, doch die Maschinen für die Salzminen würgten einen anhaltenden Strom schwarzen Rauchs in die Luft.
Insgesamt war die Atmosphäre getrübt, der Boden armselig und die Aussicht deprimierend. Oh, und habe ich schon die tödlichen Sporen erwähnt?
Diggenspitze lag in der Nähe des Grünen Mondpreises. Ihr müsst wissen, dass der Ausdruck »Mondpreis« diejenigen Orte bezeichnet, wo die zwölf Monde von Tress’ Planet in ihren erdrückend tiefen stationären Umlaufbahnen am Himmel hingen. Ein jeder der zwölf Monde ist so groß, dass er zu jeder Zeit ein Drittel des Himmels ausfüllt, egal wohin man auch reist. Er beherrscht das Sichtfeld wie eine Warze am Augapfel.
Die Einheimischen verehrten diese zwölf Monde als Götter, und ich stimme euch gerne zu, dass das lächerlicher ist als alles, was ihr so verehrt. Man erkennt jedoch leicht, woher dieser Aberglaube kam, wenn man die Sporen bedenkt, die – wie bunter Sand – von den Monden herunterrieselten.
Sie regneten von den Monden herab, und der Grüne Mondpreis war noch aus fünfzig oder sechzig Meilen Entfernung sichtbar. Näher wollte man einem Mondpreis auch nicht kommen – jener großen, schimmernden Fontäne bunter Stäubchen, die pulsierten und überaus gefährlich waren. Die Sporen füllten die Ozeane der Welt aus, schufen riesige Meere nicht aus Wasser, sondern aus außerirdischem Staub. Schiffe fuhren auf diesem Staub, wie sie hier auf Wasser fahren, und das sollte euch nicht allzu ungewöhnlich vorkommen. Denn schließlich: Wie viele andere Planeten habt ihr schon bereist? Vielleicht segelt man auf ihnen allen über Pollenmeere, und eure Heimat ist in Wahrheit der Sonderling.
Die Sporen waren nur dann gefährlich, wenn sie nass wurden. Was ein ziemliches Problem darstellte, wenn man die Nässe bedenkt, die selbst aus einem kerngesunden menschlichen Körper allenthalben austritt. Die geringste Wassermenge ließ die Sporen explosionsartig keimen, und das Ergebnis reichte von unangenehm bis tödlich. Atmete man zum Beispiel grüne Sporen ein, so bewirkte der eigene Speichel, dass einem Ranken aus dem Mund wuchsen – oder in interessanteren Fällen wuchsen sie in die Nebenhöhlen und um die Augen nach draußen.
Die Sporen ließen sich durch zwei Dinge inaktiv machen: Salz und Silber. Deshalb störten sich die Bewohner von Diggenspitze nicht so sehr am salzigen Geschmack des Wassers und der Speisen. Sie lehrten ihre Kinder den unvergleichlich wichtigen Merksatz: Silber und Salz gebieten dem Mörder Einhalt. Ein akzeptables kleines Gedicht, wenn man ein Barbar ist, den unreine Reime oder auch solche, die sich gar nicht reimen, erfreuen.
Wie dem auch sei, angesichts der Sporen, des Rauchs und des Salzes versteht man vielleicht, warum der König, dem der Herzog diente, ein Gesetz brauchte, das der Bevölkerung verbot, vom Felsen wegzuziehen. Oh, er nannte Gründe, die mit bedeutungsschweren militärischen Phrasen wie »unverzichtbare Arbeitskräfte«, »strategische Versorgungslage« und »sicherer Ankerplatz« daherkamen, aber alle kannten die Wahrheit. Der Ort war so unwirtlich, dass ihn sogar der Rauch deprimierend fand. Regelmäßig legten Schiffe für Instandsetzungsarbeiten an, um Abfälle für die Kompostbehälter abzuladen und frisches Wasser an Bord zu nehmen. Doch alle hielten sich strikt an das Gesetz des Königs, wonach keine Einwohner von Diggenspitze von der Insel weggebracht werden durften. Niemals.
Und so saß Tress abends auf den Stufen der Veranda und blickte den davonsegelnden Schiffen nach, während Sporensäulen vom Mondpreis herabrieselten und die Sonne hinter dem Mond hervorkroch und sich auf den Horizont zuschob. Tress schlürfte salzigen Tee aus einer mit Pferden bemalten Tasse und dachte: Eigentlich ist das ganz schön. Mir gefällt es hier. Und ich glaube, es ist in Ordnung für mich, mein ganzes Leben hierzubleiben.
2
Der Gärtner
Womöglich hat es euch überrascht, diese letzten Sätze zu lesen. Tress wollte auf dem Felsen bleiben? Es gefiel ihr dort?
Wo blieb ihre Abenteuerlust? Ihre Sehnsucht nach fremden Ländern? Ihr Fernweh?
Nun, wir sind in der Geschichte noch nicht so weit, dass ihr Fragen stellen dürftet. Also behaltet sie bitte freundlicherweise für euch. Nichtsdestotrotz müsst ihr verstehen, dass dies eine Geschichte über Leute ist, die sowohl das sind, was sie zu sein scheinen, als auch das, was sie nicht zu sein scheinen. Gleichzeitig. Eine Geschichte der Widersprüche. Oder in anderen Worten: Es ist eine Geschichte über Menschen.
Was Tress angeht, so war sie keine gewöhnliche Heldin – weil sie nämlich außerordentlich gewöhnlich war. Tress hielt sich für durch und durch langweilig. Sie mochte ihren Tee lauwarm. Sie ging immer pünktlich ins Bett. Sie liebte ihre Eltern, stritt sich gelegentlich mit ihrem kleinen Bruder und warf ihren Abfall nicht auf die Straße. Sie konnte ganz gut sticken und hatte ein Händchen fürs Backen, besaß aber ansonsten keine bemerkenswerten Fertigkeiten.
Sie lernte nicht heimlich fechten. Sie konnte nicht mit Tieren sprechen. Sie stammte nicht insgeheim von einem Königsgeschlecht oder von Göttern ab, auch wenn ihre Urgroßmutter Glorf angeblich einmal dem König zugewunken hatte. Sie hatte auf dem Felsen gestanden, und er war in etlichen Meilen Entfernung vorbeigesegelt, weshalb Tress das nicht gelten ließ.
Kurz gesagt: Tress war eine normale Jugendliche. Das erkannte sie daran, dass die anderen Mädchen oft von sich behaupteten, dass sie nicht wie »alle anderen« seien, und nach einiger Zeit schlussfolgerte Tress, dass die Gruppe »aller anderen« einzig aus ihr bestehen musste. Die anderen Mädchen hatten ganz offensichtlich recht, denn sie wussten sich einzigartig zu machen – sie waren so gut darin, dass sie es gemeinsam taten.
Im Allgemeinen war Tress rücksichtsvoller als die meisten Leute, und sie mochte niemandem Umstände machen, indem sie um etwas bat, was sie wollte. Sie sagte nichts, wenn die anderen Mädchen über sie lachten oder sich Witze über sie erzählten. Schließlich hatten sie dabei so viel Spaß. Es wäre unhöflich gewesen, ihnen diesen zu verderben, und anmaßend, wenn sie von ihnen verlangt hätte, damit aufzuhören.
Manchmal sprachen die ungestümeren Jugendlichen über Abenteuer auf fremden Ozeanen. Diese Vorstellung fand Tress beängstigend. Wie hätte sie ihre Eltern und ihren Bruder verlassen können? Außerdem hatte sie ihre Tassensammlung.
Tress hielt ihre Tassen in Ehren. Sie besaß edle Porzellantassen mit Lasurmalereien, Tontassen, die sich rau anfühlten, und Holztassen, die grob und abgenutzt waren.
Ein paar Seeleute, die Diggenspitze häufiger anfuhren, wussten um ihre Leidenschaft, und manchmal brachten sie ihr Tassen aus allen zwölf Ozeanen mit, aus fernen Ländern, in denen die Sporen Berichten zufolge purpurfarben, himmelblau oder sogar golden waren. Den Matrosen gab sie im Tausch für ihre Mitbringsel Pasteten, deren Zutaten sie sich mit dem Hungerlohn kaufte, den sie beim Fensterputzen verdiente.
Die Tassen, die die Seeleute ihr mitbrachten, waren oft abgenutzt und leicht beschädigt, doch das störte Tress nicht. Eine Tasse mit einer Macke oder einer Delle hatte eine Geschichte. Tress liebte sie alle, denn die Tassen brachten die Welt zu ihr. Wann immer sie aus einer ihrer Tassen trank, stellte sie sich vor, sie könnte Speisen und Getränke ferner Länder schmecken und die Menschen, die sie gemacht hatten, vielleicht ein wenig verstehen.
Jedes Mal, wenn Tress eine neue Tasse erwarb, ging sie mit ihr zu Charlie, um sie ihm zu zeigen.
Charlie behauptete, der Gärtner der Herzogsvilla an der Spitze des Felsens zu sein, doch Tress wusste, dass er in Wahrheit der Sohn des Herzogs war. Charlies Hände waren weich wie die eines Kindes und gar nicht schwielig, und er war besser genährt als alle anderen im Ort. Seine Haare waren stets sauber frisiert, und obwohl er seinen Siegelring abnahm, wenn sie sich begegneten, blieb an der Stelle ein etwas hellerer Hautstreifen zurück, der verriet, dass er ihn sonst trug – und zwar an dem Finger, an dem Mitglieder der Königsfamilie ihn trugen.
Außerdem wusste Tress nicht, welchen »Garten« Charlie hätte pflegen sollen. Schließlich befand sich die Villa auf dem Felsen. Früher einmal hatte ein Baum auf dem Gelände gestanden, aber der war vernünftigerweise vor ein paar Jahren eingegangen. Immerhin standen ein paar Topfpflanzen herum, sodass Charlie so tun konnte als ob.
Zu ihren Füßen wirbelte grauer Staub im Wind, als sie den Pfad zum Palast hinaufschritt. Graue Sporen waren tot – die Luft rings um den Felsen war so salzig, dass die Sporen eingingen –, aber Tress hielt trotzdem den Atem an, wenn sie durch die Staubwolken eilte. An der Gabelung lief sie nach links – der Pfad rechts ging zu den Minen – und folgte den Serpentinen, die zum Überhang hinaufführten.
Hier kauerte die Villa wie ein korpulenter Frosch auf seiner Wasserlilie. Tress wusste nicht genau, weshalb der Herzog hier oben residierte. Er war dem Industriedunst an dieser Stelle noch näher, aber damit einher gingen weniger Besucher, und das gefiel ihm womöglich. Der Aufstieg war anstrengend – da die Mitglieder der herzoglichen Familie ihre Kleider jedoch so gut ausfüllten, fanden sie vielleicht, dass ihnen die sportliche Betätigung guttat.
Fünf Soldaten bewachten das Grundstück – auch wenn momentan nur Snagu und Blei Dienst hatten – und erfüllten ihre Pflicht aufs Beste. Schließlich war es schrecklich lange her, dass ein Mitglied der herzoglichen Familie Opfer einer der unzähligen Todesgefahren geworden war, denen man sich auf dem Felsen ausgesetzt sah. (Diese Gefahren beinhalteten Langeweile, gequetschte Zehen und Sich-an-Obstauflauf-Verschlucken.)
Den Soldaten hatte Tress natürlich Pasteten mitgebracht. Während diese aßen, überlegte sie, ob sie den beiden ihre neue Tasse zeigen sollte. Sie war ganz aus Blech und hatte eingravierte Buchstaben, die nicht von links nach rechts liefen, sondern von oben nach unten. Aber nein, sie wollte die beiden nicht damit belästigen.
Die Wachen ließen sie durch, obwohl heute nicht der Tag war, an dem sie die Fenster der Villa putzte. Sie fand Charlie hinter dem Haus, wo er mit dem Schwert Fechten übte. Kaum hatte er sie bemerkt, legte er die Waffe weg und nahm hastig seinen Siegelring ab.
»Tress!«, sagte er. »Ich dachte, heute wäre nicht dein Tag!«
Charlie war eben siebzehn geworden und damit zwei Monate älter als sie. Er verfügte über verschwenderisch viele Lächeln, und Tress kannte ihre sämtlichen Bedeutungen. Das breite mit den vielen Zähnen, das er ihr nun präsentierte, bedeutete zum Beispiel, dass er wirklich glücklich war, einen Vorwand zu haben, mit den Fechtübungen aufzuhören. Er mochte das Fechten nicht so sehr, wie sein Vater glaubte.
»Schwertfechten, Charlie?«, fragte Tress. »Gehört das denn zu den Aufgaben eines Gärtners?«
Er hob das schmale Schwert auf. »Das? Ach, das ist ein Gartenwerkzeug.« Er hieb damit auf eine der Topfpflanzen auf der Terrasse ein. Die Pflanze war zwar noch nicht eingegangen, aber der Umstand, dass Charlie ihr ein Blatt entzweihieb, würde ihre Chancen, sich noch einmal zu erholen, bestimmt nicht verbessern.
»Gartenarbeit«, sagte Tress. »Mit einem Schwert.«
»So arbeitet man auf der Königsinsel«, erklärte Charlie. Er schlug noch einmal zu. »Dort herrscht immer Krieg, weißt du. Wenn du mal genauer überlegst, ist es ganz natürlich, dass die Gärtner lernen, die Pflanzen mit Schwertern zu stutzen. Man will ja nicht unbewaffnet überrumpelt werden.«
Er war kein guter Lügner, doch das war einer der Gründe, weshalb Tress ihn mochte. Charlie war authentisch. Er log sogar auf authentische Art. Und weil er so ein schlechter Lügner war, konnte man ihm seine Lügen auch nicht übel nehmen. Sie waren so offensichtlich, dass sie besser waren als die Wahrheit anderer Leute.
Er ließ sein Schwert noch einmal grob in Richtung der Topfpflanze herabsausen, sah Tress an und zog eine Augenbraue hoch. Sie schüttelte den Kopf. Er bedachte sie mit einem Grinsen der Marke »Du hast mich zwar erwischt, aber ich kann’s nicht zugeben« und rammte das Schwert in die Blumenerde im Topf. Dann ließ er sich auf das niedrige Gartenmäuerchen fallen.
Eigentlich sollten sich Herzogssöhne nicht fallen lassen. Deswegen konnte man Charlie durchaus als einen jungen Mann von außergewöhnlichen Gaben bezeichnen.
Tress setzte sich neben ihn und stellte sich ihren Korb auf den Schoß.
»Was hast du mir mitgebracht?«, fragte er.
Sie holte eine kleine Fleischpastete heraus. »Taube«, sagte sie. »Mit Möhren. Und Thymian in der Soße.«
»Eine edle Kombination«, erwiderte er.
»Ich glaube, dass der Sohn des Herzogs widersprechen würde, wenn er hier wäre.«
»Der Sohn des Herzogs darf nur Speisen zu sich nehmen, die Namen mit schrägen ausländischen Akzenten über den Buchstaben haben«, sagte Charlie. »Und es ist ihm nicht gestattet, seine Schwertübungen zu unterbrechen, um etwas zu essen. Was für ein Glück für mich, dass ich nicht er bin.«
Charlie biss einmal ab. Sie hielt nach seinem Lächeln Ausschau. Und da war es, das Lächeln der Freude. Sie hatte einen ganzen Tag lang gegrübelt, was sie aus den Zutaten, die auf dem Hafenmarkt im Sonderangebot gewesen waren, backen könnte, um dieses besondere Lächeln zu ernten.
»Was hast du sonst noch mitgebracht?«, fragte er.
»Gärtner Charlie«, sagte sie, »du hast eben eine kostenlose Pastete bekommen, und jetzt maßt du dir an, noch mehr zu wollen?«
»Anmaßen?«, sagte er mit vollem Mund. Er stieß mit der freien Hand gegen ihren Korb. »Ich weiß, dass da noch mehr drin ist. Heraus damit.«
Sie grinste. Den meisten anderen Leuten würde sie damit keine Umstände machen wollen, aber Charlie war anders. Sie zeigte ihm die Blechtasse.
»Aaah«, sagte Charlie, legte die Pastete zur Seite und nahm die Tasse ehrfürchtig in die Hände. »Die ist ja mal etwas Besonderes.«
»Weißt du etwas über diese Schrift?«, fragte sie begeistert.
»Das ist Altirialisch«, sagte er. »Die Irialis sind verschwunden. Das ganze Volk: Puff! Von einem Tag auf den anderen war ihre Insel ausgestorben. Das war vor dreihundert Jahren oder so, es hat sie also niemand gesehen, der heute noch am Leben wäre, aber angeblich hatten sie goldene Haare. So wie deine, von der Farbe des Sonnenlichts.«
»Meine Haare haben nicht die Farbe von Sonnenlicht, Charlie.«
»Deine Haare hätten die Farbe des Sonnenlichts, wenn Sonnenlicht hellbraun wäre«, sagte Charlie. Man hätte behaupten können, dass er wortgewaltig war. Insofern als die Worte oft gewaltig mit ihm durchgingen.
»Ich wette, dass diese Tasse eine interessante Geschichte hat«, sagte er. »Geschmiedet für einen adligen Iriali am Tag, bevor er – und sein Volk – von den Göttern dahingerafft wurde. Die Tasse blieb auf dem Tisch zurück, und die erste arme Fischerin, die danach auf die Insel kam und das entsetzliche Verschwinden eines ganzen Volkes entdeckte, hat sie mitgenommen. Sie hat die Tasse ihrem Enkel vererbt, der ein Pirat wurde. Der hat seine erbeuteten Schätze tief unter den Sporen vergraben. Und dann, nach Äonen in der Finsternis, wurde sie nun wieder entdeckt, um in deine Hände zu gelangen.« Er hielt die Tasse hoch, damit sich das Sonnenlicht in ihr spiegelte.
Tress lächelte, während er sprach. Manchmal, wenn sie die Fenster der Villa putzte, hörte sie Charlies Eltern, wie sie mit ihm schimpften, weil er so viel redete. Sie meinten, dass es albern und nicht standesgemäß sei. Sie ließen ihn nur selten ausreden. Tress fand das jammerschade. Denn gewiss, er geriet manchmal ins Reden, aber sie hatte irgendwann begriffen, dass er Geschichten auf eine Weise liebte, wie sie Tassen liebte.
»Danke, Charlie«, flüsterte sie.
»Wofür?«
»Dafür, dass du mir gibst, was ich will.«
Er wusste, dass sie weder Tassen noch Geschichten meinte.
»Immer«, erwiderte er und legte seine Hand auf ihre. »Immer was du willst, Tress. Und du kannst mir immer sagen, was es ist. Ich weiß, dass du das bei anderen Leuten normalerweise nicht tust.«
»Was willst du denn, Charlie?«, fragte sie.
»Ich weiß es nicht«, gab er zu. »Bis auf eine Sache. Eine Sache, die ich nicht wollen sollte, die ich aber will. Stattdessen sollte ich Abenteuer wollen. Wie in den Geschichten. Kennst du diese Geschichten?«
»Diejenigen mit den holden Maiden?«, fragte Tress. »Die immer entführt werden und nicht viel zu tun bekommen, außer herumzusitzen? Vielleicht hier und da mal um Hilfe schreien?«
»Ich denke, dass das wohl durchaus passiert«, sagte er.
»Warum sind es immer holde Maiden?«, fragte sie. »Gibt es unholde Maiden? Oder soll das ›holt‹ heißen wie in ›Holt-das-Essen-Maiden‹? So eine Maid könnte ich sein. Ich kann gut Essen machen.« Sie verzog das Gesicht. »Ich bin froh, dass ich nicht in einer Geschichte bin, Charlie. Ich würde ganz sicher als Entführte enden.«
»Und ich würde wahrscheinlich ruckzuck sterben«, sagte er. »Ich bin ein Feigling, Tress. Das ist die Wahrheit.«
»Unsinn. Du bist einfach nur ganz normal.«
»Hast du … gesehen, wie ich mich in Gegenwart des Herzogs benehme?«
Sie verstummte. Denn sie hatte es gesehen.
»Wenn ich kein Feigling wäre«, fuhr er fort, »könnte ich dir Sachen sagen, die ich dir so nicht sagen kann. Aber Tress, wenn du entführt werden solltest, dann würde ich dir trotzdem helfen. Ich würde mir eine Rüstung anziehen, Tress. Eine glänzende Rüstung. Oder vielleicht auch eine matte Rüstung. Ich glaube, wenn jemand entführt werden würde, den ich kenne, würde ich mich nicht damit aufhalten, die Rüstung zu polieren. Glaubst du, dass die Helden sich damit aufhalten, ihre Rüstungen zu polieren, solange Leute in Gefahr schweben? Das klingt für mich nicht sehr hilfreich.«
»Charlie«, sagte Tress, »hast du denn überhaupt eine Rüstung?«
»Ich würde schon eine finden«, versprach er ihr. »Ich würde mir etwas einfallen lassen, bestimmt. In der richtigen Rüstung wäre selbst ein Feigling mutig, oder? In diesen Geschichten kommen eine Menge Toter vor. Bestimmt könnte ich mir von einem von denen …«
Aus der Villa ertönte ein Schrei, der ihr Gespräch unterbrach. Es war Charlies meckernder Vater. Soweit Tress es beurteilen konnte, bestand die Aufgabe des Herzogs auf der Insel einzig darin, Leute anzuschreien, und diese Aufgabe nahm er sehr ernst.
Charlie sah in die Richtung, aus der der Schrei gekommen war. Er wirkte jetzt angespannt, und sein Lächeln verblasste. Doch nachdem sich das Geschrei nicht genähert hatte, richtete er den Blick wieder auf die Tasse. Der besondere Augenblick war dahin, aber ein anderer trat an seine Stelle, wie Augenblicke es meist zu tun pflegen. Nicht ganz so vertraulich, aber immer noch wertvoll, weil es Zeit war, die sie mit ihm verbrachte.
»Tut mir leid«, sagte er leise, »dass ich mit so dummen Sachen wie von Toten geklauten Rüstungen angefangen habe. Aber ich mag, dass du mir trotzdem zuhörst. Danke, Tress.«
»Ich mag deine Geschichten«, erklärte sie, nahm die Tasse und drehte sie um. »Glaubst du, dass etwas von dem, was du über die Tasse gesagt hast, wahr ist?«
»Es könnte wahr sein«, antwortete Charlie. »Das ist das Tolle an Geschichten. Aber schau dir diese Schrift an – da steht, dass sie einst einem König gehört hat. Sein Name steht gleich da.«
»Und du hast diese Sprache gelernt …«
»… auf der Gärtnerschule«, sagte er. »Für den Fall, dass wir Warnhinweise auf den Packungen bestimmter gefährlicher Pflanzen entziffern müssen.«
»So wie du auch gelernt hast, das Wams und die Hose eines Adligen zu tragen …«
»… weil ich dadurch zu einem ausgezeichneten Köder werde, sollten Meuchelmörder auftauchen und den Sohn des Herzogs umbringen wollen.«
»Na gut. Aber warum nimmst du dann den Ring ab?«
»Äh …« Er blickte erst auf seine Hand, dann in ihre Augen. »Tja, ich will wohl nicht, dass du mich mit jemand anderem verwechselst. Mit jemandem, der ich nicht sein will.«
Dann lächelte er sein schüchternes Lächeln. Sein Lächeln der Marke »Bitte spiel mit, Tress«. Denn der Sohn des Herzogs konnte sich nicht öffentlich mit dem Fensterputzmädchen einlassen. Ein Adliger jedoch, der sich als Gemeiner ausgab? Der niedere Geburt vortäuschte, um die Untertanen seines Reichs kennenzulernen? Nun, das erwartete man geradezu. Es passierte in so vielen Geschichten, dass es praktisch eine feste Einrichtung war.
»Das«, sagte sie, »klingt vollkommen logisch.«
»Nun denn«, sagte er und griff wieder zur Pastete. »Erzähl mir, was du heute so getrieben hast. Ich muss es wissen.«
»Ich habe auf dem Markt nach Zutaten gestöbert«, berichtete sie und steckte sich eine entfleuchte Locke hinters Ohr. »Ich habe ein Pfund Fisch gekauft – Lachs von der Eriksinsel, wo es viele Seen gibt. Poloni hat ihn runtergesetzt, weil er meinte, er würde bald schlecht werden, aber das war eigentlich der Fisch im Fass daneben. Deshalb habe ich ein richtiges Schnäppchen gemacht.«
»Faszinierend«, sagte er. »Niemand bekommt einen Anfall, wenn du auftauchst? Die rufen nicht ihre Kinder dazu und zwingen dich, ihnen die Hände zu schütteln? Erzähl mir mehr. Bitte, ich will wissen, wie du gemerkt hast, dass der Fisch nicht schlecht war.«
Da er weiterbohrte, berichtete sie ihm von den banalen Einzelheiten ihres Lebens. Jedes Mal, wenn sie ihn besuchte, zwang er sie dazu. Im Gegenzug hörte er ihr zu. Das war der Beweis, dass seine Freude am Reden kein Makel war. Denn er war genauso gut im Zuhören. Zumindest bei ihr. Charlie fand ihr Leben aus unerfindlichen Gründen sogar interessant.
Beim Erzählen war Tress warm. Das war oft so, wenn sie ihn besuchte – wegen des Aufstiegs und der Höhe, in der sie der Sonne näher war; deshalb war es hier oben wärmer. Ganz klar.
Allerdings war gerade Mondschatten, und die Sonne versteckte sich hinterm Mond, sodass es ein paar Grad kälter war. Und heute hatte sie gewisse Lügen satt, die sie sich selbst erzählte. Vielleicht gab es noch einen anderen Grund, weshalb ihr warm war. Und der lag in Charlies jetzigem Lächeln, und ihr war klar, dass es auch an ihrem eigenen lag.
Er hörte ihr nicht nur zu, weil ihn das Leben der Bauern faszinierte.
Sie besuchte ihn nicht nur, weil sie seine Geschichten hören wollte.
Vielmehr ging es im tiefsten Grunde gar nicht um Tassen und Geschichten. Sondern um Handschuhe.
3
Der Herzog
Tress hatte festgestellt, dass ein hübsches Paar Handschuhe ihre tägliche Arbeit um einiges besser machte. Sie meinte damit aber die guten Handschuhe aus weichem Leder, die sich beim Tragen an die Hand anschmiegten. Diejenigen, die nie steif werden, wenn man sie gut einölt und nicht in der Sonne liegen lässt. Diejenigen, die so bequem sind, dass man sich die Hände wäscht und dann erstaunt feststellt, dass man sie noch anhat.
Das vollkommene Paar Handschuhe ist unbezahlbar. Und Charlie war wie ein gutes Paar Handschuhe. Je länger sie Zeit mit ihm verbrachte, desto richtiger fühlte sich ihre gemeinsam verbrachte Zeit für sie an. Desto heller wurden selbst die Mondschatten, und desto leichter wurden ihr ihre Lasten. Sie liebte interessante Tassen, aber das lag zum Teil auch daran, dass ihr jede Tasse einen Vorwand lieferte, ihn zu besuchen.
Was da zwischen ihnen spross, fühlte sich so gut, so wundervoll an, dass Tress davor zurückschreckte, es Liebe zu nennen. Denn dem Gerede der anderen Jugendlichen nach zu schließen, war »Liebe« etwas Gefährliches. Deren Liebe schien sich um Eifersucht und Verunsicherung zu drehen. Um leidenschaftliche Brüllwettbewerbe und ebenso leidenschaftliche Versöhnungen. Sie war weniger wie ein gutes Paar Handschuhe, sondern eher wie heiße Kohlen, an denen man sich die Finger verbrannte.
Liebe hatte Tress schon immer Angst gemacht. Doch als Charlie erneut seine Hand auf ihre legte, war ihr heiß. Sie spürte das Feuer, vor dem sie sich stets gefürchtet hatte. Die Kohlen steckten also doch in ihr, nur eingeschlossen – wie in einem guten Ofen.
Sie wollte sich in seine Hitze stürzen, alle Logik über Bord werfen.
Charlie erstarrte. Sie hatten sich schon oft berührt, gewiss, aber jetzt war es anders. Dieser Moment. Dieser Traum. Er lief rot an, ließ seine Hand allerdings, wo sie war. Irgendwann nahm er sie doch weg, fuhr sich mit den Fingern durch die Haare und grinste verlegen. Weil er Charlie war, verdarb das den Augenblick nicht, sondern machte ihn nur umso liebenswerter.
Tress suchte nach den vollkommenen Worten. Es gab eine ganze Reihe von Sätzen, die Kapital aus dem Augenblick geschlagen hätten. Sie hätte sagen können: »Charlie, könntest du die eine Weile halten, während ich hier ein wenig herumspaziere?«, und ihm dabei erneut die Hand reichen.
Sie hätte sagen können: »Hilfe, ich bekomme keine Luft. Dein Anblick hat mir den Atem geraubt.«
Sie hätte sogar etwas ganz Verrücktes sagen können wie: »Ich mag dich.«
Doch stattdessen sagte sie: »Uuuuh, habe ich warme Hände.« Darauf ließ sie ein Lachen hören, bei dem sie sich verschluckte, weshalb sie aus purem Zufall den Schrei eines See-Elefanten nachahmte.
Man hätte behaupten können, dass Tress wortgewaltig war. Insofern dass ihre Worte die Angewohnheit hatten, ihr gewaltig in die Quere zu kommen.
Zur Antwort lächelte Charlie sie an. Ein wundervolles Lächeln, das immer zuversichtlicher wurde, je länger es anhielt. Dieses Lächeln hatte sie noch nie zuvor gesehen. Es bedeutete: »Ich glaube, dass ich dich liebe, Tress, ungeachtet des See-Elefanten.«
Sie erwiderte das Lächeln. Dann sah sie, über seine Schulter hinweg, den Herzog am Fenster stehen. Hochgewachsen und aufrecht. Er trug uniformartige Kleidung, die so wirkte, als wäre sie mit den vielen Orden auf seiner Brust an ihm festgesteckt.
Er lächelte nicht.
Tatsächlich hatte sie ihn bisher nur einmal lächeln sehen, und zwar während der Bestrafung des alten Lotari – der hatte versucht, der Insel als blinder Passagier auf einem Handelsschiff zu entkommen. Das schien das einzige Lächeln des Herzogs gewesen zu sein. Vielleicht hatte Charlie den gesamten Vorrat der Familie aufgebraucht. Wie dem auch sein mochte, wenn der Herzog auch kein Lächeln hatte, so machte er das dadurch wett, dass er viel zu viele Zähne zeigte.
Der Herzog verschwand im Dunkel des Hauses, doch sein Schatten schwebte noch über Tress, als sie sich von Charlie verabschiedete. Auf ihrem Weg die Stufen hinunter machte sie sich auf Schreie gefasst. Doch stattdessen trat eine unheimliche Stille ein. Die angespannte Stille nach einem Blitz.
Davon angetrieben, eilte sie hinunter und nach Hause, wo sie ihren Eltern nuschelnd mitteilte, dass sie müde sei. Sie ging in ihr Zimmer und wartete darauf, dass die Stille enden würde. Dass die Soldaten anklopften und zu erfahren verlangten, warum das Mädchen, das die Fenster putzte, sich erdreistet hatte, den Sohn des Herzogs zu berühren.
Doch als nichts dergleichen geschah, wagte sie zu hoffen, dass sie zu viel in die Miene des Herzogs hineingelesen hatte. Dann fiel ihr das einzige Lächeln des Herzogs wieder ein. Danach plagten sie die ganze Nacht hindurch Befürchtungen.
Sie stand früh auf, bändigte ihre Haare in einem Pferdeschwanz und trottete zum Markt. Hier durchstöberte sie die Waren vom Vortag und die schon fast verdorbenen Zutaten nach für sie Erschwinglichem. Obwohl es noch früh war, herrschte auf dem Markt hektischer Betrieb. Männer fegten tote Sporen vom Pflaster, während Leute in plappernden Trauben zusammenstanden.
Tress wappnete sich für die Neuigkeiten und kam zu dem Schluss, dass nichts schlimmer sein konnte als die furchtbare Angst, die sie die ganze Nacht gehabt hatte.
Sie irrte sich.
Der Herzog hatte bekannt gegeben: Er und seine Familie würden die Insel noch heute verlassen.
4
Der Sohn
Verlassen?
Die Insel verlassen?
Man verließ die Insel nicht.
Tress wusste sehr wohl, dass das nicht unbedingt stimmte. Königliche Beamte konnten die Insel verlassen. Der Herzog verließ die Insel gelegentlich, um dem König Bericht zu erstatten. Außerdem hatte er sich die ganzen Orden damit verdient, dass er an einem fernen Ort, wo die Leute ein bisschen anders aussahen, ebenjene umgebracht hatte. In diesen Kriegen hatte er offenbar recht heldenhaft gekämpft – das erkannte man daran, dass viele seiner Soldaten gestorben waren, er aber überlebt hatte.
Doch noch nie hatte der Herzog seine Familie mitgenommen. »Da der Erbe des Herzogs volljährig geworden ist«, hieß es in der Bekanntmachung, »soll er den diversen Prinzessinnen der zivilisierten Ozeane zum Zweck einer Verlobung vorgestellt werden.«
Nun, Tress war tatsächlich ein pragmatisches Mädchen. Und deshalb zerriss sie ihren Einkaufskorb nur in Gedanken vor Wut in kleine Stücke. Sie dachte nur darüber nach, ob es angemessen wäre, lauthals zu fluchen. Sie erwog nur beinahe, zur Herzogsvilla hinaufzustürmen und zu verlangen, dass der Alte es sich noch einmal anders überlegte.
Stattdessen machte sie benommen ihre Besorgungen und verlieh ihrem plötzlich in die Brüche gehenden Leben mit dieser vertrauten Tätigkeit einen Anschein von Normalität. Sie fand Knoblauch, den sie sicher würde brauchen können, einige Kartoffeln, die noch nicht allzu verschrumpelt waren, und sogar etwas Getreide mit Kornkäfern, die so groß waren, dass man sie herauslesen konnte.
Gestern wäre sie mit dieser Ausbeute zufrieden gewesen. Heute konnte sie an nichts anderes denken als an Charlie.
Es erschien ihr so unglaublich ungerecht. Sie hatte sich eben erst eingestanden, was sie für ihn empfand, und schon wurde alles auf den Kopf gestellt? Sicher, man hatte ihr diesen Schmerz prophezeit. Liebe ging nicht ohne Schmerzen ab. Das war das Salz im Tee – doch sollte da nicht auch ein wenig Honig hineingehören? Sollte da nicht auch noch – wagte sie zu hoffen – Leidenschaft dazugehören?
Sie sollte anscheinend sämtliche Nachteile einer Romanze abbekommen, ohne auch nur einen der Vorteile zu genießen.
Leider machte ihr Pragmatismus sich nun bemerkbar. Solange sie sich etwas hatten vorspielen können, war die Wirklichkeit nicht in der Lage gewesen, sich ihrer zu bemächtigen. Doch die Tage der Selbsttäuschung waren vorbei. Was hatte sie denn geglaubt, was passieren würde? Dass der Herzog ihr seinen Sohn zum Mann geben würde? Was glaubte sie denn, was sie jemandem wie Charlie zu bieten hatte? Im Vergleich mit einer Prinzessin war sie nichts. Stellt euch nur einmal vor, wie viele Tassen die sich leisten kann!
In der vorgespielten Welt ging es beim Heiraten um Liebe. In der Wirklichkeit ging es um Politik. Ein Wort, das mit unzähligen Bedeutungen aufgeladen war, auch wenn sich die meisten davon auf eine einzige reduzieren ließen: Es ist eine Sache des Adels – und, wenn auch widerstrebend, der Reichen. Nicht der Bauern.
Nachdem sie mit ihren Einkäufen fertig war, machte sie sich auf den Heimweg. Zu Hause bekäme sie wenigstens das Mitgefühl ihrer Eltern. Doch anscheinend vergeudete der Herzog keine Zeit, denn sie bemerkte eine Prozession, die sich zum Hafen hinunterbewegte.
Tress machte kehrt und ging auf einem anderen Weg wieder zurück, sodass sie kurz nach der Prozession dort ankam. Schon wurde das Gepäck der Familie auf ein Handelsschiff geladen. Niemandem war es gestattet, die Insel zu verlassen. Es sei denn, man war jemand. Tress fürchtete, dass sie keine Gelegenheit mehr haben würde, mit Charlie zu sprechen. Dann fürchtete sie, dass sie diese Gelegenheit bekommen würde, er sie aber nicht mehr sehen wollte.
Gnädigerweise entdeckte sie ihn am Rand der Menschenmenge, wo er sich suchend umschaute. Kaum hatte er sie bemerkt, eilte er zu ihr. »Tress! O Monde! Ich hatte schon Angst, ich würde dich nicht mehr rechtzeitig finden.«
»Ich …« Was hatte sie gesagt?
»Holt-Essen-Maid«, sagte er, sich verneigend. »Ich muss Abschied nehmen.«
»Charlie«, sagte sie sanft. »Versuche nicht, jemand zu sein, der du nicht bist. Ich kenne dich.«
Er verzog das Gesicht. Er trug einen Reisemantel und sogar einen Hut. Der Herzog fand Hüte ungebührlich und nur auf Reisen statthaft. »Tress«, sagte er etwas leiser. »Ich fürchte, dass ich dich angelogen habe. Siehst du … ich bin nicht der Gärtner. Ich bin … ähm … der Sohn des Herzogs.«
»Unglaublich. Wer hätte gedacht, dass Charlie der Gärtner und Charles, der Sohn des Herzogs, ein und dieselbe Person sind, wo sie doch auch noch gleich alt sind, gleich aussehen und die gleichen Kleider anhaben?«
»Äh, ja. Bist du wütend auf mich?«
»Wut ist auch dabei«, sagte Tress. »Sie steht an siebter Stelle, genau zwischen Verwirrung und Müdigkeit.«
Hinter ihnen marschierten Charlies Vater und Mutter auf das Schiff. Ihre Diener folgten ihnen mit den letzten Gepäckstücken.
Charlie sah auf seine Füße hinab. »Anscheinend soll ich verheiratet werden. Mit der Prinzessin irgendeines Landes. Was hältst du davon?«
»Ich …« Was sollte sie sagen? »Ich wünsche dir alles Gute?«
Er hob den Blick und sah ihr in die Augen. »Immer, Tress. Erinnerst du dich?«
Es fiel ihr schwer, aber nach ein wenig Herumtasten fand sie die Worte, die sich in irgendeiner Ecke versteckten und ihr ausweichen wollten. »Ich wünschte«, konnte sie sagen, nachdem sie die Worte gepackt hatte, »dass du das nicht tun würdest. Heiraten. Jemand anders.«
»Oh?« Er blinzelte. »Wirklich?«
»Ich meine, ich bin sicher, dass sie sehr nett sind. Die Prinzessinnen.«
»Ich glaube, das gehört bei denen zum Beruf«, sagte Charlie. »Weil … hast du gehört, was sie in den Geschichten tun? Amphibien wiederbeleben? Eltern davon in Kenntnis setzen, dass ihre Kinder ins Bett gemacht haben? Man muss schon verhältnismäßig nett sein, um das zu tun.«
»Ja«, sagte Tress. »Ich …« Sie holte tief Luft. »Mir wäre es trotzdem lieber … wenn du keine von ihnen heiraten würdest.«
»Na gut, dann tue ich es eben nicht«, erwiderte Charlie.
»Ich glaube nicht, dass dir etwas anderes übrig bleiben wird, Charlie. Dein Vater will dich verheiraten. Das ist Politik.«
»Ah, aber weißt du, ich habe eine Geheimwaffe.« Er nahm ihre Hände und neigte sich zu ihr heran.
Hinter ihm trat sein Vater in den Bug des Schiffes und blickte finster herab. Charlie jedoch lächelte schief. Es war sein Lächeln der Marke »Schau, wie raffiniert ich bin«. Er lächelte meist so, wenn er nicht sonderlich raffiniert vorging.
»Was … für eine Geheimwaffe, Charlie?«, fragte sie.
»Ich kann unglaublich langweilig sein.«
»Das ist keine Waffe.«
»In einem Krieg vielleicht nicht, Tress«, sagte er. »Aber bei der Brautwerbung? Da ist es so tödlich wie das schärfste Rapier. Du weißt doch, dass ich kein Ende finde und immer weiter und weiter reden kann.«
»Ich mag, dass du kein Ende findest, Charlie. Dass es immer weitergeht, macht mir gar nichts aus. Das gefällt mir manchmal richtig.«
»Du bist ein besonderer Fall«, sagte Charlie. »Du bist … nun ja, das klingt ein bisschen dumm … aber du bist wie ein Paar Handschuhe, Tress.«
»Wirklich?«, sagte sie, sich verschluckend.
»Ja. Nimm es nicht als Beleidigung. Ich meine, wenn ich Fechtübungen machen muss, dann trage ich diese Handschuhe, und die …«
»Ich weiß«, flüsterte sie.
Vom Schiff rief Charlies Vater herunter, er solle sich beeilen. Da wurde Tress bewusst, dass Charlies Vater ebenso verschiedene finstere Blicke hatte wie Charlie verschiedene Lächeln. Was der gegenwärtige in Bezug auf sie aussagte, gefiel ihr gar nicht.
Charlie drückte ihre Hände. »Hör zu, Tress. Ich verspreche dir, ich werde mich nicht verheiraten lassen. Ich werde diese Königreiche bereisen und unerträglich langweilig sein, sodass kein Mädchen mich haben will. In so vielem bin ich nicht gut. Beim Fechten gegen meinen Vater habe ich noch nie einen Punkt gemacht. Bei förmlichen Abendessen verschütte ich Suppe. Ich rede zu viel, sodass sogar mein Lakai – der dafür bezahlt wird, dass er zuhört – sich alle möglichen Gründe einfallen lässt, um mich zu unterbrechen. Neulich habe ich ihm die Geschichte vom Fisch und der Möwe erzählt, und er tat so, als hätte er sich den Zeh angeschlagen, und …«
Der Herzog rief noch einmal herüber.
»Ich kann das, Tress«, betonte Charlie. »Und ich werde es tun. Bei jedem Halt suche ich eine Tasse für dich aus, in Ordnung? Wenn ich die jeweilige Prinzessin dann zu Tode gelangweilt habe – und mein Vater beschlossen hat, dass wir weiterziehen müssen –, sende ich dir die Tasse zu. Als Beweis, verstehst du?« Er drückte noch einmal ihre Hände. »So werde ich es machen und nicht nur, weil du zuhörst. Sondern weil du mich kennst, Tress. Du hast mich immer schon gesehen, wenn andere mich nicht gesehen haben.«
Er begann sich abzuwenden, um endlich auf seines Vaters Rufe zu reagieren. Doch Tress ließ ihn nicht los, klammerte sich an seine Hände. Sie wollte nicht, dass es endete.
Charlie schenkte ihr ein letztes Lächeln. Und auch wenn er offensichtlich versuchte, sich zuversichtlich zu geben, kannte sie sein Lächeln gut genug. Dieses hier war sein unsicheres, sein hoffnungsvolles, aber besorgtes.
»Auch du bist mein Paar Handschuhe, Charlie«, sagte Tress zu ihm.
Dann musste sie ihn loslassen, damit er die Laufplanke hinauftraben konnte. Sie hatte ihm schon genug Umstände gemacht.
Der Herzog scheuchte seinen Sohn unter Deck, als das Schiff sich von den toten Sporen rings um den Felsen entfernte und auf den grünen Ozean hinausfuhr. Wind fuhr in die Segel, und das Schiff steuerte auf den Horizont zu, eine Spur verwirbelten Smaragdstaubs hinter sich zurücklassend. Tress erklomm den Weg nach Hause und sah dem Schiff von der Klippe aus nach, bis es nur noch die Größe einer Tasse hatte. Dann die Größe eines Flecks. Dann verschwand es.
Dann fing das Warten an.
Man sagt, Warten sei die schlimmste Folter des Lebens. »Man« heißt in diesem Fall Schriftsteller, die nichts Nützliches zu tun haben und sich deshalb ihre Zeit damit vertreiben, sich Sachen auszudenken, die man sagen könnte. Wer arbeitet, kann euch indes versichern, dass es vielmehr ein Luxus ist, Zeit zum Warten zu haben.
Tress hatte Fenster zu putzen. Mahlzeiten zu kochen. Einen kleinen Bruder zu hüten. Ihr Vater, Lem, hatte sich von dem Unfall in den Minen nie ganz erholt, und obgleich er helfen wollte, konnte er kaum gehen. Er half Tress’ Mutter Ulba, die den ganzen Tag Socken strickte, die sie an Matrosen verkauften. Weil sie aber Wolle anschaffen mussten, war der Gewinn mager.
Deshalb wartete Tress nicht, sondern sie arbeitete.
Dennoch empfand sie eine große Erleichterung, als die erste Tasse ankam. Sie wurde ihr von Hoid dem Schiffsjungen zugestellt. (Ja, das bin ich. Woran habt ihr es gemerkt? Vielleicht am Namen?) Eine schöne Porzellantasse, die keine einzige Macke hatte.
An diesem Tag hellte sich die Welt etwas auf. Tress konnte Charlie fast reden hören, als sie den beiliegenden Brief las, in dem bis ins kleinste Detail sein Verhalten gegenüber der ersten Prinzessin beschrieben wurde. Mit heldenhafter Eintönigkeit hatte er der Reihe nach die Geräusche genannt, die sein Magen nachts in den verschiedenen Liegepositionen machte. Da das noch nicht gereicht hatte, hatte er des Weiteren erklärt, dass er seine abgeschnittenen Zehennägel aufhob und ihnen Namen gab. Das hatte gereicht.
Kämpfe weiter, mein geschwätziger Liebster, dachte Tress, als sie am nächsten Tag die Fenster der Villa schrubbte. Sei tapfer, mein nur ein wenig unfeiner Krieger.
Die zweite Tasse war aus reinem rotem Glas, hoch und schlank, und sie wirkte, als passte mehr Flüssigkeit hinein, als tatsächlich der Fall war. Vielleicht stammte sie aus einer besonders knausrigen Schenke. Die dazugehörige Prinzessin hatte er abgeschreckt, indem er ihr in der allergrößten Ausführlichkeit erzählt hatte, was er gefrühstückt hatte und dass er die einzelnen Klümpchen des Rühreis gezählt und nach ihrer Größe geordnet hatte.
Die dritte Tasse war ein gewaltiger, massiver Zinnhumpen, der einiges wog. Vielleicht stammte er aus einem der Orte, die Charlie erfunden hatte und an denen die Leute Waffen bei sich tragen mussten. Tress war sich sicher, dass sie einen Angreifer mit diesem Humpen locker hätte ausschalten können. Diese Prinzessin hatte sich nicht in der Lage gesehen, ein ausgedehntes Gespräch über die Vorzüge verschiedener Interpunktionszeichen zu ertragen, von denen Charlie einige selbst erfunden hatte.
Der vierten Sendung war kein Brief beigelegt, nur eine kleine Zeichnung: zwei behandschuhte Hände, die sich berührten. Auf die Tasse war ein Schmetterling gemalt, darunter ein roter Ozean. Tress fand es eigenartig, dass der Schmetterling sich nicht vor den Sporen fürchtete. Vielleicht war er gefangen und gezwungen, über den Ozean in seinen Tod zu fliegen.
Die fünfte Tasse kam nie.
Tress wollte es herunterspielen, redete sich ein, dass das Paket irgendwo aufgehalten worden war. Schließlich drohten den Schiffen, die durch die Sporen segelten, zahlreiche Gefahren. Piraten oder … ihr wisst schon … Sporen.
Doch die Monate schleppten sich dahin, einer langweiliger als der andere. Jedes Mal, wenn ein Schiff im Hafen anlegte, eilte Tress hinunter und fragte nach Post.
Nichts.
Das ging monatelang so, bis ein ganzes Jahr seit Charlies Abreise vergangen war.
Dann endlich eine Nachricht. Allerdings nicht von Charlie, sondern von seinem Vater, und zwar an die gesamte Stadtbevölkerung. Der Herzog würde endlich wieder nach Diggenspitze zurückkehren, und er würde seine Frau mitbringen, seinen Erben … und seine neue Schwiegertochter.
5
Die Braut
Tress saß an ihre Mutter gelehnt auf der Veranda und beobachtete den Horizont. In der Hand hielt sie die letzte Tasse, die Charlie ihr geschickt hatte. Diejenige mit dem suizidalen Schmetterling.
Ihr lauwarmer Tee schmeckte nach Tränen.
»Das war nicht besonders praktisch«, flüsterte sie ihrer Mutter zu.
»Das ist die Liebe nur sehr selten«, erwiderte ihre Mutter. Sie war eine stämmige Person mit einem fröhlichen Leibesumfang. Vor fünf Jahren noch war sie schlank wie ein Schilfrohr gewesen. Doch dann hatte Tress gemerkt, dass sie von ihren Mahlzeiten immer etwas für ihre Kinder abgeknapst hatte – und von da an hatte Tress das Einkaufen übernommen und dafür gesorgt, dass das Geld länger reichte.
Am Horizont erschien ein Schiff.
»Ich weiß nun endlich, was ich zu ihm hätte sagen sollen.« Tress schob sich Haare aus den Augen. »Als er gegangen ist. Ich habe ihn einen Handschuh genannt. Das ist nicht so schrecklich, wie es klingt. Er hat mich auch Handschuh genannt, weißt du? Jetzt, nachdem ich ein Jahr Zeit hatte, darüber nachzudenken, habe ich begriffen, dass ich etwas mehr hätte sagen können.«
Ihre Mutter drückte ihr die Schulter, während das Schiff unaufhaltsam näher kam.
»Ich hätte sagen sollen«, flüsterte Tress, »dass ich ihn liebe.«
Ihre Mutter begleitete sie, als sie wie eine Soldatin, die an vorderster Front dem Kugelhagel entgegengeht, zum Hafen hinuntermarschierte, um das Schiff zu begrüßen. Ihr Vater mit dem schlechten Bein blieb zurück – und das war gut so. Denn sie hatte Angst, dass er eine Szene machen würde, nachdem er die letzten Monate über den Herzog und seinen Sohn heftig geschimpft hatte.
Tress jedoch brachte es nicht über sich, Charlie Vorwürfe zu machen. Es war nicht seine Schuld, dass er ein Herzogssohn war. Das hätte wirklich jedem passieren können.
Eine Menschenmenge hatte sich versammelt. Der Herzog hatte schriftlich eine Feier bestellt – und er brachte Speisen und Wein. Was immer die Menschen von einer neuen künftigen Herzogin auch denken mochten, kostenlosen Alkohol ließen sie sich bestimmt nicht entgehen. (Denn schon immer waren Geschenke das Geheimnis von Popularität gewesen. Das und die Macht, jeden zu enthaupten, der einen nicht leiden kann.)
Tress und ihre Mutter kamen ganz hinten in der Menge zu stehen, doch Holmes der Bäcker winkte sie auf seine Treppe hinauf, von wo sie besser sehen konnten. Er war ein freundlicher Mann, hob stets die Brotkanten auf und verkaufte sie Tress für ein paar Pfennige.
Und so hatte Tress eine gute Sicht auf die Prinzessin, als diese an Deck erschien. Sie war schön. Rosige Wangen, schimmerndes Haar, ein feines Gesicht. Sie war so vollkommen, dass nicht einmal die besten Maler der Ozeane sie auf einem Porträt noch hätten verschönern können.
Charlie war es doch noch gelungen, Teil einer Geschichte zu werden. Mit ein bisschen Anstrengung konnte Tress sich für ihn freuen.
Als Nächstes war der Herzog zu sehen. Er winkte, um den Leuten zu zeigen, dass sie nun jubeln sollten. »Ich präsentiere euch«, rief er, »meinen Erben!«
Da stieg ein junger Mann an Deck und stellte sich neben die Prinzessin. Und das war ganz eindeutig nicht Charlie.
Dieser junge Mann war ungefähr so alt wie Charlie, aber sechseinhalb Fuß groß und hatte ein so kantiges Kinn, dass andere Männer vermutlich neidvoll darauf blickten. Muskeln wölbten sich an seinem Körper – Tress hätte schwören können, dass sein Hemd um Gnade flehte, wenn er den Arm hob.
Was unter den zwölf Monden soll das denn?
»Nach einem bedauerlichen Unfall«, verkündete der Herzog der verstummten Menge, »sah ich mich gezwungen, meinen Neffen Dirk zu adoptieren und ihn zu meinem neuen Erben zu bestimmen.« Er hielt kurz inne, damit die Menge die Nachricht verdauen konnte. »Er ist ein ausgezeichneter Fechter«, fuhr der Herzog dann fort, »und antwortet auf Fragen mit Antworten, die aus nicht mehr als einem Satz bestehen. Manchmal benutzt er sogar nur ein einziges Wort! Außerdem ist er ein Kriegsheld. Er hat zehntausend Mann in der Schlacht von Seeklo verloren.«
»Zehntausend?«, sagte Tress’ Mutter. »Meiner Treu, das sind viele.«
»Wir werden nun Dirks Hochzeit mit der Prinzessin von Dormanz feiern!«, rief der Herzog und reckte seine Hände in die Höhe.
Die Menge war noch immer verwirrt und gab keinen Laut von sich.
»Ich habe dreißig Fässer mitgebracht!«, brüllte der Herzog.
Die Menge jubelte. Und so wurde doch noch eine Feier daraus. Die Leute aus der Stadt führten den Zug hinauf zum Bankettsaal. Sie lobten die Schönheit der Prinzessin und staunten, dass Dirk im Gehen so gut das Gleichgewicht hielt, wo doch sein Körperschwerpunkt irgendwo in der Nähe des Brustbeins liegen musste.
Tress’ Mutter erklärte, dass sie sich für Tress umhören würde, und folgte der Menge. Als Tress jedoch aus ihrem Schockzustand wieder herausfand, bemerkte sie, dass Flik – einer der Diener des Herzogs – ihr vom unteren Ende der Laufplanke winkte. Er war ein freundlicher Mann mit riesigen Ohren, die den Eindruck machten, als warteten sie nur darauf, Reißaus zu nehmen und davonzufliegen.
»Flik?«, flüsterte sie. »Was ist passiert? Ein Unfall? Wo ist Charlie?«
Flik sah zu dem Menschenzug hinauf, der sich zum Bankettsaal bewegte. Der Herzog und seine Familie hatten sich ihm angeschlossen und waren inzwischen so weit entfernt, dass jeder finstere Blick aufgrund von Windwiderstand und Schwerkraftabnahme seine Wirksamkeit verloren hatte.
»Er wollte, dass ich Euch das hier gebe«, sagte Flik und reichte ihr einen kleinen Beutel. Als sie ihn nahm, klimperte es darin. In dem Säckchen befanden sich Keramikscherben.
Die fünfte Tasse.
»Er hat sich so sehr bemüht, Frau Tress«, flüsterte Flik. »Ach, Ihr hättet ihn sehen sollen, den jungen Herrn. Er hat alles Erdenkliche getan, um diese Frauen abzuschrecken. Er hat sich siebenundachtzig verschiedene Arten von Sperrholz und ihre Verwendungsmöglichkeiten eingeprägt. Er hat jeder Prinzessin, der er begegnet ist, in aller Ausführlichkeit von den Haustieren seiner Kindheit erzählt. Er hat sogar über Religion gesprochen. Ich dachte, im fünften Königreich hätten sie ihn schließlich besiegt, denn die dortige Prinzessin war gehörlos, aber der junge Herr ist hergegangen und hat sie beim Abendessen angekotzt.«
»Er hat sich erbrochen?«
»Direkt in ihren Schoß, Frau Tress.« Flik sah sich nach beiden Seiten um und bedeutete ihr dann, ihm zu folgen, während er ein Gepäckstück vom Anleger wegtrug. Er führte sie an eine etwas abgelegenere Stelle. »Aber sein Vater ist ihm auf die Schliche gekommen, Frau Tress. Hat gemerkt, was der junge Herr im Schilde führte. Da ist der Herzog richtig wütend geworden. Richtig, richtig wütend.« Er zeigte auf die zerbrochene Tasse in dem Beutel, den sie hielt.
»Ja, aber was ist mit Charlie passiert?«, fragte Tress.
Flik schaute weg.
»Bitte«, flehte Tress. »Wo ist er?«
»Er ist in die Mitternachtssee gefahren, Frau Tress«, antwortete er. »Direkt unter Thanasmias Mond. Die Zauberin hat ihn gefangen genommen.«
Bei diesen Namen lief es Tress kalt über den Rücken. Die Mitternachtssee? Das Reich der Zauberin? »Warum sollte er so etwas tun?«
»Nun, ich glaube, weil sein Vater ihn dazu gezwungen hat«, antwortete Flik. »Die Zauberin ist nicht verheiratet. Und der König wünscht sich schon lange, dass sie keine gar so große Bedrohung mehr darstellt. Deshalb …«
»Der König hat Charlie zu ihr geschickt, damit er versucht, die Zauberin zu heiraten?«
Flik gab keine Antwort.
»Nein«, sagte Tress, als sie begriff. »Er hat Charlie zu ihr geschickt, damit er stirbt.«
»Ich habe nichts dergleichen gesagt«, beteuerte Flik im Weggehen. »Falls jemand fragen sollte: Ich habe nichts dergleichen gesagt.«
Benommen setzte sich Tress auf einen der Pfähle im Hafen. Sie lauschte den sich regenden Sporen, ein Geräusch wie rieselnder Sand. Selbst auf einer so abgelegenen Insel wie der ihrigen wusste man über die Zauberin Bescheid. In regelmäßigen Abständen sandte sie Schiffe auf Plünderfahrt im Grünen Meer aus, und es war unglaublich schwer, sich gegen sie zu wehren. Ihre Festung lag irgendwo in einer der entlegensten Ecken der Mitternachtssee verborgen, dem gefährlichsten Meer von allen. Und um dorthin zu gelangen, musste man das Karminmeer überqueren, ein unbewohntes Meer, das nur geringfügig weniger gefährlich war.
Dass Charlie von der Zauberin gefangen genommen wurde, war ungefähr so, als wäre er auf einen der Monde gegangen. Tress konnte sich nicht auf das Wort eines Einzelnen verlassen. Nicht bei einer solchen Sache. Sie wagte es nicht, die anderen mit Fragen zu belästigen, aber sie lauschte, als die Diener den neugierigen Hafenarbeitern, die eilig das Schiff entluden, damit sie sich den Feierlichkeiten anschließen konnten, Neuigkeiten zuflüsterten. Sie erzählten alle eine ähnliche Geschichte. Ja, Charlie war in die Mitternachtssee geschickt worden. Der Herzog und der König hatten es gemeinsam beschlossen, deshalb musste es eine gute Idee gewesen sein. Schließlich musste ja mal jemand versuchen, die Zauberin von ihren Plünderungen abzuhalten. Und Charlie war … ähm … aus bestimmten Gründen … der offensichtlichste Kandidat.
Was sich daraus folgern ließ, entsetzte Tress. Der Herzog und der König hatten gemerkt, dass Charlie schwierig war, und ihre Antwort darauf war, ihn loszuwerden. Bereits wenige Stunden nachdem die Nachricht vom Verschwinden von Charlies Schiff eingetroffen war, hatten sie Dirk als Erben eingesetzt.
In den Augen der Adligen war das eine elegante Lösung. Der Herzog bekam endlich einen Erben, auf den er stolz sein konnte. Der König bekam mit Dirks Braut eine vorteilhafte Eheallianz mit einem anderen Königreich. Und alle konnten der Zauberin ein weiteres Todesopfer vorwerfen, um die öffentliche Meinung zugunsten eines neuerlichen Krieges zu beeinflussen.
Nach drei Tagen wagte es Tress schließlich, Brunswick – den Verwalter des Herzogs – um weitere Informationen zu bitten. Da er ihre Pasteten mochte, gestand er ihr, dass sie eine Lösegeldforderung von der Zauberin bekommen hatten. Doch der Herzog in seiner Weisheit hatte darin sogleich einen Trick erkannt, mit der sie weitere Schiffe in die Mitternachtssee locken wollte. Der König hatte Charlie offiziell für tot erklärt.
Tage vergingen. Tress musste erkennen, dass es niemanden kümmerte, und war wie betäubt. Man nannte es Politik und ging zur Tagesordnung über. Obwohl der neue Erbe den Verstand eines labbrigen Stücks Brot besaß, war er beliebt, sah gut aus und war sehr gut darin, das Leben anderer Leute zu opfern. Während Charlie … nun ja, Charlie gewesen war.
Tress brauchte Wochen, um sich ein Herz zu fassen, und ging dann zum Herzog, um ihn zu bitten, das Lösegeld zu zahlen. Etwas derart Kühnes war für sie sehr schwierig. Sie war nicht feige, aber anderen Leuten Umstände zu machen … nun, das tat sie nun mal nicht. Aber von ihren Eltern angefeuert, machte sie sich auf den langen Weg und brachte leise ihre Bitte vor.
Der Herzog nannte sie daraufhin eine »haselnussbraune Aufwieglerin« und verbot ihr, irgendwo in der Stadt Fenster zu putzen. Fortan war sie gezwungen, zusammen mit ihren Eltern Socken zu stricken, womit sie viel weniger Geld verdiente.
Die Wochen vergingen, und Tress verfiel in Teilnahmslosigkeit. Sie fühlte sich weniger wie ein menschliches Wesen als wie ein verwesender Mensch.
Das Leben auf dem Felsen kehrte für alle rasch zur Normalität zurück. Niemand kümmerte es. Niemand unternahm etwas.
Bis Tress, zwei Monate nach der Rückkehr des Herzogs, eine Entscheidung traf. Es gab durchaus eine Person, die es kümmerte. Und natürlich oblag es dieser Person, etwas zu unternehmen. Jemand anderem konnte Tress schließlich keine Umstände machen.
Sie würde Charlie alleine retten müssen.
6
Die Inspektorin
Nachdem Tress diese Entscheidung getroffen hatte, löste sich in ihr ein Knoten – als hätte sie es endlich geschafft, eine störrische, verfilzte Haarlocke auszukämmen.
Sie würde es tun. Sie hatte keine Ahnung, wie, aber sie würde einen Weg finden, die Insel zu verlassen, das schreckliche Karminmeer zu überqueren, zur Mitternachtssee zu gelangen und Charlie zu retten. Sicher, das Überwinden jedes einzelnen dieser Hindernisse schien gleichermaßen unmöglich. Aber immerhin weniger unmöglich als die Vorstellung, den Rest ihres Lebens ohne ihn zu sein.