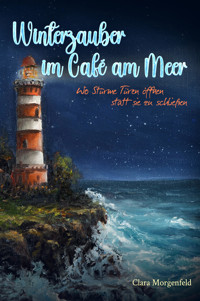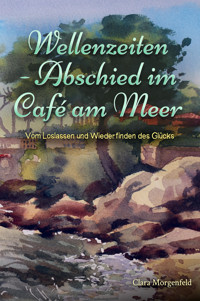
9,99 €
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein Jahr ist vergangen, seit Lina Bergmann mit dem „Kalender voller erster Male“ ihr Leben neu geordnet hat. Das Café am Meer in Sandhagen atmet in ruhigem Rhythmus – ein Ort zwischen Himmel und Wasser, an dem Geschichten verweilen, bis sie wieder hinausgetragen werden. Doch in Lina regt sich Unruhe: Ein Gefühl von Vollendung. Es ist Zeit, loszulassen. Wellenzeiten – Abschied im Café am Meer erzählt von den sanften Bewegungen des Lebens: vom Ende, das ein Anfang ist, vom Vertrauen ins Weitergehen und vom Mut, Räume an andere zu übergeben. Als Lina beschließt, das Café an Sima – die junge Köchin mit Herz und Neugier – zu übergeben, beginnt eine Reise voller Erinnerungen, Begegnungen und leiser Abschiede. Auf einer Fahrt entlang der Küste spürt Lina den Spuren ihrer Vergangenheit nach, findet in alten Briefen und Orten Antworten auf Fragen, die sie nie gestellt hatte. Währenddessen wächst in Sandhagen etwas Neues: Sima entdeckt ihre eigene Stimme im Café, Finn hält das Leben mit seiner Kamera fest, Hella bereitet ihr letztes Konzert vor, und Paul, der Imker, segnet mit ruhigen Worten den Übergang. Als das „Fest der Wellen“ näher rückt, versammelt sich das ganze Dorf. Es wird ein Tag voller Licht, Musik, Wind und Dankbarkeit – der Moment, in dem Lina das Café, ihre Geschichte und ihr Vertrauen in andere Hände legt. Ihr letzter Gang führt sie hinaus aufs Meer, in dem Wissen, dass nichts verloren geht – es verändert nur die Richtung. Ein Jahr später öffnet Sima zum ersten Mal als Wirtin die Tür. Der Duft von Vanille und Salz erfüllt den Raum, Kinderlachen klingt über die Terrasse, und Finns Kamera summt leise – ein Herzschlag aus Bildern. Das Café lebt weiter, als Ort der Begegnung, Erinnerung und Hoffnung. Mit poetischer Sprache, Wärme und Tiefe führt Wellenzeiten die beliebte Café-am-Meer-Reihe zu ihrem stillen, leuchtenden Abschluss. Es ist ein Roman über das Meer als Spiegel des Lebens – über Kreisläufe, Generationen, Liebe und das leise Glück, das bleibt, wenn man loslässt. „Das Meer hat kein Ende – nur Richtungen.“
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Wellenzeiten - Abschied im Café am Meer
–
Vom Loslassen und Wiederfinden des Glücks
Clara Morgenfeld
Erste Auflage 2025
© 2025 Clara Morgenfeld
Alle Rechte vorbehalten
Wenn der Wind sich dreht - Die erste Stille
Der Morgen war stiller als sonst. Nicht die vertraute Stille eines friedlichen Tagesbeginns, sondern eine andere – tiefer, aufmerksamer, fast als hielte selbst das Meer den Atem an. Lina stand barfuß in der Küche des Cafés, das Holz unter ihren Füßen noch kühl vom nächtlichen Wind, und hörte dem Tropfen der Kaffeemaschine zu. Ein gleichmäßiges Geräusch, das sonst Geborgenheit bedeutete. Heute klang es wie eine Erinnerung.
Draußen hing Nebel über den Dünen. Die Sonne versuchte zaghaft, ein paar Strahlen durch die feuchte Luft zu schicken, und das Licht flimmerte auf der Fensterscheibe, als wolle es sich vergewissern, dass es noch willkommen war. Lina legte die Hand auf den Rahmen, fühlte die feinen Risse im Lack, die sie seit Monaten überstreichen wollte, und lächelte. Manche Dinge alterten schön.
Sie hatte schon früh wachgelegen, noch bevor die Möwen über dem Hafen kreisten. Ein Gefühl, das sie nicht benennen konnte, hatte sie aus dem Schlaf gezogen – wie eine unsichtbare Hand, die an ihrem Herzen zupfte. Es war kein Schmerz, eher eine Ahnung. Etwas wollte sich verändern. Nicht laut, nicht dramatisch. Nur ein leises, klares „Jetzt“.
Der Duft von frisch gebrühtem Kaffee breitete sich aus, vermischte sich mit der kühlen Luft, mit dem Salz und den Resten des gestrigen Kuchens. Lina nahm eine Tasse aus dem Regal, die mit der kleinen Muschel am Henkel – ihre Lieblingstasse, seit Mimi sie ihr vor Jahren geschenkt hatte. Sie schenkte sich ein, nahm den ersten Schluck und schloss die Augen. Der Geschmack war vertraut, aber auch er schien sich verändert zu haben. Vielleicht war es sie selbst, die anders schmeckte.
Ein Windstoß ließ die Tür klirren. Das Café erwachte langsam: ein Holzstuhl knarrte, irgendwo fiel ein Löffel zu Boden. Lina stellte die Tasse ab, zog die Strickjacke enger um sich und ging zur Tür. Draußen standen die Kräutertöpfe schief, die Nacht hatte Regen gebracht. Ein paar Blätter klebten am Geländer, und zwischen den Ritzen der Terrasse glänzte Wasser wie flüssiges Glas.
Sie beugte sich, richtete die kleinen Schilder mit den Namen der Pflanzen: Salbei, Minze, Zitronenmelisse. Die Schrift war verblasst, aber sie konnte jedes Wort fühlen, als hätte sie sie eben erst geschrieben. Über dem Meer kräuselten sich kleine Wellen, zogen Linien, die sich immer wieder lösten und neu formten. „Wellenzeiten“, hatte Paul einmal gesagt, „sind die Stunden, in denen das Meer und die Seele dieselbe Sprache sprechen.“ Damals hatte sie gelacht, jetzt verstand sie.
Ein Fahrrad rollte vorbei – der Bäcker auf seiner morgendlichen Runde, ein kurzes Nicken, ein „Moin“. Sonst niemand. Selbst die Möwen hielten Abstand. Es war, als würde der ganze Ort noch schlafen. Nur sie stand da, in der Stille, zwischen Kaffeeduft und Meeressalz, und spürte: Etwas verabschiedet sich. Vielleicht sie selbst, von einer Zeit, die zu Ende ging.
Drinnen auf dem Tresen lag ein Briefumschlag. Beige, leicht wellig, mit einem blauen Siegel. Sie hatte ihn gestern Abend gefunden, zwischen alten Bestellungen und Notizen – Mimis Handschrift, unverkennbar. „Für später“, stand darauf, nichts weiter. Lina hatte ihn noch nicht geöffnet. Vielleicht, weil sie ahnte, dass „später“ heute war. Aber noch konnte sie nicht. Noch nicht.
Sie setzte sich an den großen Holztisch am Fenster, sah hinaus auf die stille Bucht. Die See war glatt wie poliertes Silber. Ein paar Segelboote lagen träge vor Anker, ihre Masten wie Bleistiftlinien im Dunst. Hinter ihr tickte die alte Uhr, die Ben vor Jahren repariert hatte. Das Café war erfüllt von kleinen Geräuschen – der Atem eines Hauses, das lebte.
Lina strich über das Holz des Tisches, fühlte die Kerben, die Geschichten trugen: Kratzer vom Sommerfest, Spuren von Kinderhänden, Wachsflecken von Hellas Geburtstagskerzen. All das war hier. Ein gelebtes Leben, gesammelt in diesem Raum. Und doch – die Stille wuchs.
Sie nahm den Brief, hielt ihn ans Licht. Das Siegel schimmerte mattblau. Ihre Finger zitterten leicht, als sie die Kante nachfuhr. Mimis Schriftzug war rund, ungeduldig, voller Leben. „Für später.“ Vielleicht hatte Mimi geahnt, dass dieser Tag kommen würde – der Tag, an dem das Meer leiser, aber eindringlicher sprach.
Lina legte den Brief zurück. Noch nicht. Erst wollte sie den Tag atmen lassen.
Ein Windzug öffnete das Fenster einen Spalt, der Vorhang wehte sacht, und mit ihm kam das Geräusch der Brandung. Es war wie eine Antwort, sanft und unaufdringlich. Lina schloss die Augen. Die erste Stille war nicht Leere. Sie war Anfang.
Und irgendwo draußen, hinter dem Nebel, drehte sich der Wind.
Briefe im Morgengrau
Das Licht hatte sich verändert. Ein weicher Schimmer lag über dem Meer, als hätte jemand die Nacht langsam ausgewrungen und nur das Helle übriggelassen. Nebel zog sich zurück, und in den Tropfen an der Fensterscheibe spiegelte sich das erste Blau des Tages. Lina saß noch immer am Tisch, den Brief vor sich. Der Dampf aus der Kaffeetasse hatte sich längst verzogen, aber der Duft hing in der Luft wie ein Versprechen.
Sie streckte die Hand aus. Das Papier war rau und leicht vergilbt – Mimi hatte nie das glatte, moderne Briefpapier gemocht. „Zu glatt für echte Gedanken“, hatte sie immer gesagt. Lina lächelte. Sie konnte ihre Stimme hören, dieses warme, etwas kratzige Timbre, das jedes Wort in Musik verwandelte. Sie atmete tief ein, dann brach sie das Siegel.
Ein zarter Riss, kaum hörbar. Und doch klang er in ihr nach wie ein kleiner Blitz in der Stille.
Das Blatt war dicht beschrieben, die Tinte leicht verblasst. Die Schrift zog Wellen über das Papier, als hätte Mimi selbst in der Bewegung des Meeres geschrieben. Lina las:
„Meine liebe Lina,
Wenn du diesen Brief findest, dann ist die Zeit gekommen, dass du dich erinnerst, wer du geworden bist.
Das Café war nie nur ein Ort zum Bleiben, sondern einer, um Menschen anzuhalten – für einen Atemzug, für ein Stück Kuchen, für ein Gespräch, das etwas verändert. Du hast das verstanden, mehr als ich es je konnte.
Aber auch das Schönste will weiterwandern. So wie das Meer nie stehen bleibt, darfst auch du dich bewegen. Es wird der Tag kommen, an dem du spürst: Die Tassen sind nicht mehr deine, sondern die Geschichten, die darin leben. Dann geh.
Nimm dir Zeit, am Morgen zu schweigen. Höre auf den Wind. Und wenn du loslässt, tu es mit einem Lächeln, nicht mit einem Knoten im Herzen.
Ich danke dir für alles, was du gegeben hast, ohne es zu merken.
Deine Mimi.“
Lina legte das Blatt ab, die Finger noch an der Tinte. Der Brief duftete nach getrockneten Kräutern – vielleicht hatte Mimi ihn in einer ihrer alten Küchenschubladen aufbewahrt. Sie las die Zeilen erneut, leiser diesmal, flüsternd, als wollte sie sie in den Morgen hineintragen.
Das Meer draußen schien zuzuhören. Eine Möwe kreiste, rief kurz auf, dann wieder Stille.
In Linas Brust pochte etwas zwischen Wehmut und Klarheit. Mimis Worte waren kein Abschied, sie waren eine Öffnung. Eine Einladung. Sie nahm das Blatt und legte es neben die Tasse, streifte eine Haarsträhne aus dem Gesicht. Das Licht fiel nun schräg über den Tisch, ließ Staubpartikel tanzen – wie winzige Erinnerungen, die noch einmal sichtbar werden wollten.
Sie stand auf, ging ans Fenster. Der Nebel hatte sich fast ganz aufgelöst, die Dünen zeichneten sich scharf ab, dahinter glitzerte das Wasser. Über der Terrasse hing noch ein leichter Duft von Rosmarin und Salz. Lina öffnete das Fenster weiter. Der Wind griff in ihre Haare, spielte damit wie früher, als sie noch nicht wusste, ob sie bleiben oder wieder fliehen wollte.
Damals, in ihrem ersten Sommer hier, hatte Mimi ihr gesagt: „Wenn du still genug wirst, erzählt dir das Meer, was du als Nächstes tun sollst.“ Vielleicht war heute dieser Moment.
Hinter ihr knarrte die Treppe. „Du bist ja schon wach“, sagte Pauls Stimme. Er trat ein, die Jacke über der Schulter, den Geruch von Bienenwachs und Frühnebel in der Kleidung. „Seit einer Weile“, antwortete Lina und drehte sich zu ihm. Paul musterte sie, die Tasse, den Brief. Er nickte nur. „Mimi?“ Lina nickte. „Dann ist es wohl soweit“, sagte er. Kein Erstaunen, keine Frage – nur dieses tiefe Wissen, das Paul immer in sich trug.
Sie reichte ihm den Brief. Er las ihn schweigend, dann sah er hinaus auf das Meer. „Sie wusste immer, wann der Wind sich dreht.“
Lina lachte leise. Es war kein fröhliches Lachen, eher ein Zittern zwischen Dankbarkeit und Loslassen. „Ich glaube, ich hab es heute zum ersten Mal gespürt“, sagte sie. Paul legte ihr kurz eine Hand auf die Schulter. „Dann wird das Café dich ziehen lassen. Es weiß, wann jemand fertig erzählt hat.“
Er ging, so leise, wie er gekommen war. Die Tür fiel hinter ihm ins Schloss, und Lina blieb allein mit den Wellen, die langsam kräftiger wurden.
Sie faltete den Brief sorgfältig zusammen, legte ihn in die Schublade unter der Kasse – dorthin, wo Mimi früher ihre Rezepte aufbewahrt hatte. Ein Ort zwischen Alltäglichem und Heiligem. Dann nahm sie ein neues Blatt Papier und schrieb:
„Für später. Wenn jemand wissen will, wie man bleibt, ohne zu vergessen, wie man geht.“
Sie lächelte. Der Satz kam von allein. Vielleicht hatte Mimi ihn ihr diktiert, durch die salzige Luft, durch den Wind, der nun stärker wurde.
Draußen färbte sich der Himmel heller, das Grau ging in ein sanftes Gold über. Der Tag begann, und mit ihm etwas Neues, Unbenanntes.
Lina stellte die Fenster weit offen, atmete tief ein. Im Morgengrau lag eine Stimme, leise, vertraut, wie ein altes Lied:Du bist soweit.
Pauls Honig und Hellas Lied
Der Tag nahm Gestalt an, als die Sonne endlich über die Dünen kroch. Das Licht fiel in schmalen Bahnen durchs Fenster und brach sich auf den Gläsern in der Vitrine. Es war, als würden kleine goldene Funken über die Tische tanzen. Lina hatte das Café geöffnet, ohne wirklich darüber nachzudenken. Ihre Hände taten, was sie immer taten – sie polierte Tassen, stellte Teller bereit, zündete die Kerzen an. Nur ihr Inneres fühlte sich anders an, weiter, offener, wie ein frisch gelüfteter Raum.
Draußen klirrten Schritte auf dem Kiesweg. Paul kam den Pfad hinauf, einen Korb im Arm, den Hut tief in die Stirn gezogen. „Morgen, Lina!“ rief er. Seine Stimme war rau, aber freundlich – wie ein alter Holztisch, an dem schon viele gesessen hatten. „Morgen, Paul“, antwortete sie und trat hinaus.
Im Korb lagen Gläser mit goldgelbem Honig, der in der Sonne glitzerte. Jedes Glas trug ein handgeschriebenes Etikett: Frühtracht – Sandhagener Bienen. „Die Mädchen waren fleißig“, sagte Paul und stellte den Korb auf den Tresen. „Das ist die erste Ernte in diesem Jahr. Etwas wilder als sonst – zu viel Wind, zu wenig Raps. Aber ehrlich im Geschmack.“
Lina öffnete eines der Gläser, roch daran, und das Aroma von Blüten und Meer erfüllte den Raum. „Er riecht nach Sommer und Geduld“, sagte sie. Paul nickte zufrieden. „Geduld ist die halbe Süße, hab ich immer gesagt.“
Sie lachten kurz, das Lachen mischte sich mit dem Zwitschern der Spatzen vor der Tür. Lina goss ihm eine Tasse Kaffee ein, und sie setzten sich an den großen Tisch, an dem der Tag sonst begann – zwischen Notizbüchern, Blüten und Kaffeeflecken. „Du hast sie gehört, oder?“ fragte Paul nach einer Weile. „Wen?“ „Die Stille. Heute früh. Sie war lauter als alles andere.“ Lina nickte. „Ich glaube, sie war für mich.“ Paul sah sie an, als wolle er etwas sagen, tat es aber nicht. Stattdessen legte er einen kleinen Tontopf auf den Tisch. „Von mir. Für später.“ Lina öffnete den Deckel. Darin lag ein Stück Wabenhonig, in goldenes Papier gewickelt. „Wenn du’s brauchst“, sagte Paul nur. „Er erinnert an das, was bleibt.“
Die Türglocke klingelte, bevor Lina etwas erwidern konnte. Ein Schwung warmer Luft, ein Hauch von Parfum und Pfefferminze – Hella Bornstein war da. „Kinder, der Tag schmeckt nach Aufbruch!“ rief sie und breitete die Arme aus, als müsse sie den ganzen Raum umarmen. Ihr Schal flatterte, eine Wolke aus Rosenduft und Theaterluft folgte ihr.
„Guten Morgen, Hella“, sagte Paul trocken. „Oh, Paul, du klingst, als hättest du wieder die Nacht mit deinen Bienen verbracht! Stell dir vor, ich habe heute Morgen gesungen. Zum ersten Mal seit Wochen. Es klang, als würde jemand anders singen – älter, weiser, aber immer noch ich.“
Sie lachte, laut und herrlich ungeniert, und setzte sich auf den Barhocker. Ihre Augen glitzerten. „Was singst du denn?“ fragte Lina. „Etwas Neues. Etwas Altes. Ich weiß es selbst nicht. Es kam einfach.“ Sie trommelte mit den Fingern auf den Tresen, dann summte sie ein paar Takte – eine Melodie, die nach Meer und Erinnerung klang. Paul sah sie an, still, fast gerührt.
„Das ist schön“, sagte Lina leise. „Wie heißt das Lied?“ „Noch gar nicht“, sagte Hella. „Vielleicht ‘Wellenzeiten’? Ich hab’s mir aufgeschrieben – gestern Nacht, als der Wind um mein Fenster zog. Ich dachte: Wenn man nicht mehr singen kann, dann soll man wenigstens zuhören.“ Sie trank einen Schluck Kaffee, dann seufzte sie. „Aber heute kann ich wieder.“
Die Tür öffnete sich erneut. Diesmal kam Sima, mit einem Korb voller Kräuter und einem Lächeln, das selbst die Sonne heller machte. „Es riecht hier nach Glück und Bienen“, sagte sie. „Und Hella, du strahlst ja wie ein Festtag!“ „Ich bin ein Festtag, Liebling“, entgegnete Hella. „Aber sag – was trägst du da?“ „Frühkräuter fürs Frühstück. Minze, Giersch, ein bisschen Fenchel. Ich will ein neues Siruprezept probieren.“
Sima stellte den Korb ab, schob sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht und begann, die Kräuter auf dem Tresen zu sortieren. Der Duft von frischem Grün vermischte sich mit dem Honig und dem Kaffee – ein Aroma, das nach Anfang schmeckte.
„Hört ihr das?“ fragte sie plötzlich. Alle schwiegen. Draußen wehte der Wind leise über die Dünen, das Meer rauschte gleichmäßig. Doch irgendwo dazwischen klang etwas anderes – ein leises Summen, fast wie eine Melodie. „Das Meer summt mit“, sagte Hella andächtig. Paul grinste. „Oder meine Bienen sind übergeschnappt.“
Lina lachte – und das Lachen fühlte sich an wie ein tiefer Atemzug. Die Schwere des Morgens wich. Alles war da: der Duft, das Licht, die Menschen.
„Ich hab was gelesen“, sagte sie dann, ohne genau zu wissen, warum. „Von Mimi. Ein Brief.“ Paul und Hella schauten sie an, Sima hielt inne. „Was hat sie geschrieben?“ fragte Hella sanft. „Dass ich wissen werde, wann es Zeit ist. Und dass man gehen darf, wenn man bleibt – im Herzen.“ Einen Moment war es still. Dann legte Sima eine Hand auf Linas Arm. „Dann hat sie gewusst, dass du stark genug bist.“
Hella nickte. „Mimi hat immer gesehen, was andere erst später verstehen. Vielleicht hat sie das Meer darum so geliebt – weil es niemals fragt, ob man bereit ist.“ Paul stellte sein leeres Glas hin. „Sie war eine gute Frau. Und klug. Wenn sie gesagt hat, du bist soweit, dann bist du’s.“
Die drei hörten ihr zu. Selbst Sima ließ die Kräuter liegen und schloss kurz die Augen. Es war, als würde das Lied den Raum füllen, bis in die kleinsten Ritzen zwischen Holz und Herz. Draußen zog eine Wolke vorüber, das Licht veränderte sich, aber niemand bewegte sich.
Lina lächelte, ein stilles, warmes Lächeln. „Vielleicht fängt heute etwas an“, sagte sie. „Oder hört auf“, meinte Paul. „Oder beides“, fügte Hella hinzu und begann, wieder zu summen – dieselbe Melodie wie zuvor, nur leiser, tiefer.
Als Hella endete, sagte sie leise: „Das war für Mimi. Und für das, was kommt.“ Paul nickte. „Dann soll’s ein guter Tag werden.“
Lina trat ans Fenster. Über dem Meer lag nun klarer Sonnenschein, die Wellen funkelten. Im Hafen gluckste Wasser gegen die Holzpfähle, Möwen tanzten auf den Böen. Sie legte die Hand an die Scheibe und spürte das Leben draußen – unruhig, schön, ewig im Wandel.
„Ja“, flüsterte sie. „Ein guter Tag.“
Hinter ihr summte Hella weiter, Paul füllte Honiggläser, Sima schnitt Kräuter. Das Café atmete, ganz still, und in dieser Stille lag Musik.
Das Fläschchen im Regal
Der Nachmittag kam leise. Die Sonne stand schräg über den Dünen, und das Café duftete nach Kräutern, Zitronenschale und warmem Honig. Die Gäste waren gegangen – ein paar Radfahrer, zwei ältere Damen mit ihren Notizbüchern, die wie jedes Jahr im Frühling Gedichte über den Wind schrieben. Nur Lina war geblieben, um aufzuräumen.
Sie mochte diese Stunden zwischen Tag und Abend, wenn das Café wieder ihr gehörte. Wenn die Tische leer waren, die Stühle ordentlich, die Stimmen verklungen. Dann wurde alles still, so still, dass man die Gedanken hören konnte, die man tagsüber verdrängt hatte.
Sie wischte den Tresen ab, stellte die Gläser in Reih und Glied. Dabei summte sie Hellas Melodie nach – ein Lied, das nicht enden wollte, weil es sich wie ein Kreis anfühlte. Die Sonne streifte die Regale an der Rückwand, ließ die alten Marmeladengläser schimmern: Holunder, Apfel-Minze, Sanddorn. Zwischen ihnen, leicht im Schatten, stand etwas, das sie bisher kaum beachtet hatte – ein kleines Glasfläschchen mit Korken, halb versteckt hinter einem alten Foto.
Lina blieb stehen. Das Fläschchen war staubbedeckt, das Glas milchig. Darin schwammen winzige helle Körner, vielleicht Sand, vielleicht Samen. Um den Hals war eine verblasste Kordel gebunden, an der ein Stück Papier hing. Die Schrift darauf war kaum noch zu lesen, aber das erste Wort erkannte sie sofort: Mimi.
Ihr Herz machte einen kleinen Sprung. Sie nahm das Fläschchen vorsichtig aus dem Regal. Es war leichter, als sie gedacht hatte, und als sie es ins Licht hielt, glitzerte darin etwas – ein winziger, goldener Punkt zwischen den Körnern.
Das Papier flatterte in der Zugluft. Mit der Fingerspitze strich Lina die Buchstaben nach. „Für später – wenn das Meer ruft.“ Mehr stand da nicht. Kein Datum, kein Hinweis, keine Unterschrift. Nur diese sechs Worte.
Ein Lächeln glitt über Linas Gesicht, und zugleich stieg ein vertrauter Kloß in ihrer Kehle auf. Mimi und ihre rätselhaften Nachrichten. Sie erinnerte sich an jene Sommerabende, an denen Mimi kleine Dinge sammelte – Muscheln, getrocknete Blüten, Knöpfe, Steine. „Jeder Gegenstand ist ein Gedanke, der noch nicht fertig ist“, hatte sie gesagt. „Man muss ihn nur aufheben und warten, bis er spricht.“
Vielleicht war heute der Tag, an dem dieses Fläschchen endlich sprechen wollte.
Lina drehte es in den Händen. Der Sand darin schimmerte wie das Ufer bei Ebbe. Ein einzelnes Samenkorn war größer als die anderen, hell wie Bernstein. „Ein Samenkorn vom Meer“, murmelte sie. „Was hast du mir da gelassen, Mimi?“
Die Tür zum Garten stand offen. Draußen raschelte der Wind in den Kräutern, und irgendwo summte eine Biene – Pauls Mädchen, dachte Lina. Sie ging hinaus, setzte sich auf die Bank neben dem Rosmarinbusch. Der Himmel war klar, ein tiefer, ruhiger Ton von Blau, und die Luft schmeckte nach Salz.
Sie hielt das Fläschchen gegen das Licht. Es glitzerte, als finge es den Himmel ein.
Lina dachte an den Brief, den sie am Morgen gelesen hatte. „Wenn du loslässt, tu es mit einem Lächeln.“ Vielleicht war das hier Mimis Art, denselben Satz noch einmal zu sagen – anders, greifbarer.
Sie zog den Korken ab. Ein zarter Duft entwich, kaum wahrnehmbar, aber irgendwie vertraut – nach getrocknetem Seegras, Lavendel, ein Hauch von Vanille. Vorsichtig schüttete sie den Inhalt in ihre Hand. Die Körner waren feinkörnig, manche rund, manche kantig. Zwischen ihnen glänzte das bernsteinfarbene Samenkorn.
In der Ferne rauschte das Meer gleichmäßig, rhythmisch, wie ein Atem. Lina schloss die Hand um das Samenkorn. In dem Moment wusste sie, ohne nachzudenken, dass sie es pflanzen musste.
Sie stand auf, ging zum kleinen Beet neben dem Kräutergarten, wo Mimi früher ihre Lieblingsblumen gezogen hatte – Strandflieder, Kapkörbchen, Wildsalbei. Die Erde war noch feucht vom Regen der Nacht. Lina kniete sich hin, grub mit den Fingern ein kleines Loch, legte das Samenkorn hinein und bedeckte es sanft mit Erde.
„Für später“, flüsterte sie. Dann blieb sie eine Weile so, die Hände im Boden, das Herz still.
Sie dachte an all die Jahre im Café – an das erste Mal, als sie hier stand, überfordert und verloren, und an Mimis Stimme, die ihr Mut machte. An die Menschen, die kamen und gingen, an die Gespräche, das Lachen, die Musik. Alles war hier, in dieser Erde.
Hinter ihr knarrte das Gartentor. „Ich hab dich schon gesucht“, sagte Sima. Sie kam barfuß über den Kies, trug ein Glas Honig in der Hand. „Paul hat gesagt, du brauchst das vielleicht noch.“ Lina nickte und nahm es entgegen. „Danke. Ich glaube, ja.“
Sima sah das Fläschchen, das nun leer auf der Bank lag. „Mimis?“ „Mhm.“ „Und du hast es geöffnet?“ „Ja. Es war Zeit.“
Sima setzte sich neben sie. Einen Moment schwiegen sie. Dann sagte sie leise: „Weißt du, ich glaube, Mimi hat immer gewusst, dass du einmal etwas einpflanzen wirst, das du nicht mehr ernten musst.“ Lina lächelte. „Vielleicht ist das der Sinn.“
Sima nickte, sah aufs Meer hinaus. „Manchmal ist das Schönste, was man tun kann, etwas wachsen zu lassen, ohne zu wissen, was es wird.“
Sie blieben sitzen, bis die Sonne tiefer sank und das Licht golden wurde. Die Schatten der Kräuter fielen lang über den Boden, das Meer funkelte. Ein leichter Wind spielte in Linas Haaren, trug den Duft von Minze und Honig herüber.
„Weißt du, was komisch ist?“ fragte Sima schließlich. „Hm?“ „Ich hab heute früh geträumt, Mimi steht am Strand. Sie hat gewinkt, aber nicht mir – dir.“ Lina sah sie an, überrascht, dann lächelte sie leise. „Dann hat sie wohl gewusst, dass ich sie sehen würde.“
Sie blickte auf die kleine Stelle Erde, wo das Samenkorn lag. Nichts zu sehen, nur frischer Boden, eine Spur Dunkelheit im Sonnenlicht. Aber in ihr war plötzlich ein Frieden, so sanft, dass sie ihn fast nicht wagte zu fühlen.
„Komm rein“, sagte Sima schließlich. „Hella will heute Abend ein Lied singen. Für dich, glaube ich.“ „Für uns“, antwortete Lina. „Für das Café.“
Sie standen auf, nahmen die Gläser vom Tisch und gingen hinein. Das Fläschchen blieb auf der Bank liegen, das Papier flatterte leise im Wind. Eine kleine Biene setzte sich darauf, krabbelte kurz über die Schrift, dann flog sie davon – hinaus über die Dünen, hin zum Meer.
Und als Lina die Tür hinter sich schloss, fiel das letzte Licht des Tages genau auf die Stelle im Garten, wo das Samenkorn lag. Ein winziger Schimmer, kaum sichtbar, aber da – wie ein Versprechen, das den Abend überdauerte.
Ein Gedanke ans Meer
Der Abend kam in leisen Farben. Zuerst löschte das Licht die Ränder der Dünen, dann verschluckte der Himmel die Sonne, bis nur noch ein goldener Streifen am Horizont blieb. Das Meer glitt von Blau zu Grau, von Grau zu Silber, als würde es sich neu einkleiden für die Nacht.
Lina ging den schmalen Pfad hinunter zum Strand. Der Sand war kühl unter ihren Füßen, feucht vom Nachmittagsmeer, und jeder Schritt hinterließ eine Spur, die sofort wieder verwaschen wurde. Es war Ebbe – der Atem des Tages, der sich ausruhte.
Hinter ihr lag das Dorf, der Geruch von Holzfeuer und Abendbrot. Vor ihr nur Weite. Das Rauschen war gleichmäßig, wie ein Herzschlag, ruhig, alt, vertraut. Sie blieb stehen, ließ die Schuhe fallen, schob die Hände in die Jackentaschen und atmete tief ein.
Die Luft schmeckte nach Salz und Erinnerung. Sie dachte an Mimis Brief, an das Fläschchen, an das Samenkorn im Garten. Alles schien sich zu verbinden, leise, wie Fäden, die sich von selbst verknüpfen, wenn man aufhört, sie festzuhalten.
Ein Stück Treibholz lag vor ihr. Sie hob es auf – glatt, rund, von der See gezeichnet. Auf einer Seite schimmerte es heller, fast golden. Sie drehte es in den Händen, betrachtete die Maserung. „So alt wie eine Geschichte“, murmelte sie. „Vom Meer erzählt und wieder vergessen.“
Sie setzte sich auf den Sand, das Holz neben sich, und sah hinaus. Der Horizont war nur noch ein Schatten zwischen Himmel und Wasser. Möwen riefen irgendwo in der Ferne, ein Boot glitt lautlos vorbei.
Sie dachte an all die Abende, die sie hier gesessen hatte – mit Mimi, mit Ben, allein. Immer, wenn etwas zu Ende ging oder begann, kam sie hierher. Das Meer war ihr Kalender, ihre Uhr, ihr Beichtvater. „Du weißt es doch längst, oder?“ flüsterte sie in den Wind. Eine Welle kam heran, leckte an ihren Zehen und zog sich wieder zurück.
„Ja“, sagte sie. „Ich auch.“
Das war es. Kein großer Moment, keine Offenbarung, nur ein stilles Einverständnis. Etwas in ihr hörte auf, gegen das Unvermeidliche anzudenken. Sie würde gehen. Nicht morgen, nicht gleich – aber bald. Das Café würde bleiben. Sima, Finn, Paul, Hella – sie alle würden weitertragen, was begonnen hatte.
Sie legte das Treibholz in den Sand, neben sich, und begann, kleine Muster hineinzuzeichnen: Kreise, Wellen, Spuren. Jeder Kreis löste sich, sobald das Wasser kam, und sie zeichnete neue.
Ein Windstoß zog an ihrem Haar, und plötzlich sah sie ein Licht – weit draußen, über dem Wasser. Kein Leuchtturm, zu niedrig, zu flackernd. Vielleicht ein Boot. Oder etwas anderes.
Sie erinnerte sich an Mimis Worte: „Wenn du loslässt, tu es mit einem Lächeln.“ Und sie lächelte.
Langsam zog sie die Jacke enger, lauschte dem Wind, der über die Wellen strich. In seinem Klang mischte sich etwas, das fast wie eine Melodie klang – Hellas Lied vom Nachmittag, getragen über das Wasser, verweht, aber erkennbar. Lina schloss die Augen. Die Töne schwebten in ihr, und sie sah Bilder: das Café im Morgenlicht, Sima in der Küche, Pauls Hände, die Honiggläser füllen, Finns Kamera, die das Leben einfängt, und Hella, die lacht, als wüsste sie ein Geheimnis.
Das war ihr Zuhause – aber kein Ort, den man besitzen konnte. Nur einer, den man lieben durfte, solange man da war.
Sie stand auf. Das Meer hatte sich weiter zurückgezogen, und zwischen den glänzenden Sandflächen lagen kleine Pfützen, in denen sich der Himmel spiegelte. Lina ging langsam hindurch, die Füße im kalten Wasser, das sich anfühlte wie flüssiges Glas.
Am Ufer fand sie eine Muschel, groß und glatt. Sie hob sie auf und hielt sie ans Ohr, lächelte über sich selbst. Das Rauschen darin war immer dasselbe – und doch klang es heute anders. „Ich weiß“, sagte sie leise. „Ich hab’s verstanden.“
Sie steckte die Muschel in die Jackentasche. Vielleicht würde sie sie im Café aufstellen, neben das leere Fläschchen. Ein Zeichen für den Beginn des Abschieds, aber auch für das, was bleiben sollte.
Als sie sich umdrehte, sah sie, dass im Dorf die ersten Lichter angingen. Das Café war eines davon – ein warmer Schein hinter den Fenstern, der über den Strand hinausreichte. Sima musste die Lampen entzündet haben. Vielleicht saß sie mit Hella und Finn zusammen, vielleicht summte jemand das Lied.
Ein Gefühl von Frieden breitete sich in Lina aus, still und unerwartet. Sie hatte gedacht, Abschied würde wehtun. Aber jetzt fühlte es sich an wie ein ruhiges Einatmen, wie das Meer, wenn es zurückkehrt.
Sie ging langsam zurück, das Licht im Blick, Schritt für Schritt, bis der Sand wieder zu festem Boden wurde. Am Rande der Dünen blieb sie noch einmal stehen, sah zurück auf das Meer. Es glitzerte schwach im Abendlicht, ein riesiger, lebendiger Spiegel.
„Danke“, flüsterte sie. Dann drehte sie sich um und ging heim.
Vor der Tür des Cafés blieb sie stehen. Im Innern hörte sie Stimmen – Hella lachte, Sima sprach aufgeregt, Finn klickte mit seiner Kamera. Das Leben ging weiter, wie es sollte.
Lina öffnete die Tür. Der warme Duft von Kräutern und Gebäck empfing sie. „Da bist du ja!“, rief Sima und kam mit mehlbestäubten Händen auf sie zu. „Wir haben auf dich gewartet. Hella will gleich singen!“
Lina nickte, lächelte. „Ich war nur kurz am Meer.“ „Natürlich warst du das“, sagte Hella mit einem Augenzwinkern. „Das Meer lässt niemanden los, der einmal dazugehört hat.“
Sie lachten. Finn stellte sich neben den Kamin, die Kamera im Anschlag. „Nur einen Moment“, sagte er. „Ich will das festhalten.“ Lina sah ihn an, dann ins Objektiv. Das Klicken der Kamera war leise, fast ehrfürchtig.
In diesem Augenblick wusste sie, dass alles gut war – dass sie gehen konnte, weil das Café, die Menschen, die Geschichten bleiben würden. Das Meer hatte sie gelehrt, dass nichts wirklich endet. Es verändert nur seine Form.
Später, als sie allein in ihrem Zimmer stand, zog sie die Muschel aus der Tasche. Das Rauschen darin war schwach, aber deutlich. Sie legte sie auf den Fenstersims, neben das Glas mit dem Samenkorn und den Brief.
Dann löschte sie das Licht. Draußen flackerte das Meer in der Dunkelheit – und irgendwo, weit draußen, blinkte das kleine Boot. Lina legte sich hin und schloss die Augen.
Zum ersten Mal seit Wochen schlief sie ohne Gedanken ein.
Und draußen summte das Meer weiter – unermüdlich, vertraut, als würde es Wache halten über das Café, die Menschen und die Frau, die gelernt hatte, der Stille zu vertrauen.
Lichter über den Dünen - Simas neue Rezepte
Der Morgen duftete nach Zitronenmelisse und Vanille. Schon bevor Lina die Tür zum Café öffnete, hörte sie drinnen ein Rascheln, Klirren, das rhythmische Schaben eines Messers auf Holz. Sima war früh aufgestanden – früher als sonst. Durch das Fenster sah Lina die junge Frau am Küchentisch stehen, barfuß, das Haar zu einem unordentlichen Knoten gebunden, die Stirn konzentriert gerunzelt.
Neben ihr stapelten sich Kräuterbündel, Schalen mit Sanddornbeeren, Zitrusfrüchte, Gläser, Schalen, Holzlöffel – ein leises Chaos, das nach Leben roch.
Lina lehnte sich kurz an den Türrahmen, bevor sie eintrat. „Du hast ja die Sonne überholt“, sagte sie. Sima blickte auf, strahlte. „Ich konnte nicht schlafen. Mir ist ein Geschmack eingefallen – Sanddorn und Vanille, aber nicht süß, eher wie… Mut.“
„Mut schmeckt bestimmt interessant“, sagte Lina und lachte. „Ich will’s herausfinden.“
Sima schnitt weiter. Ihre Bewegungen waren flink, ungeduldig, doch mit einer gewissen Zärtlichkeit, als würde sie Musik spielen. „Ich hab gestern geträumt, dass Mimi mir in der Küche hilft“, sagte sie plötzlich. „Sie hat nichts gesagt, nur genickt, als ich das Sanddornmus gerührt habe.“ Lina nickte. „Dann gefällt ihr wohl, was du vorhast.“
Sima griff nach einem Topf, schüttete die Beeren hinein. Das leise Zischen, als sie Zucker und Wasser dazugab, klang wie das Meer in Miniatur. „Ich hab auch einen Sirup ausprobiert“, erklärte sie. „Mit Rosmarin und Limette. Für die Limonadenkarte. Ich dachte, wir könnten was Neues wagen, weißt du? Etwas, das nach Aufbruch schmeckt.“
Lina stellte zwei Tassen auf den Tisch. „Ich bin gespannt.“ „Nicht zu gespannt“, grinste Sima, „es ist noch nicht perfekt.“
Sie rührte, probierte, runzelte die Stirn, fügte ein bisschen Honig hinzu – Pauls Honig, goldgelb, dickflüssig. Der Duft breitete sich sofort aus, vermischte sich mit dem Zitrus und den Kräutern. Lina schloss die Augen. „Es riecht nach Sommer, obwohl’s noch Frühling ist.“ „Genau das will ich“, sagte Sima. „Ein Vorgeschmack auf das, was kommt.“
Die Fenster standen offen. Draußen glitzerte die Luft, Möwen kreisten über den Dünen. In der Ferne rief jemand den Fang vom Morgen aus – der Klang des Hafens, gemischt mit Wind und Salz.
Lina setzte sich an den Küchentisch. Auf der Arbeitsplatte lagen Simas Notizen – unzählige Seiten, Kritzeleien, Listen, Pfeile. Zwischen Rezeptnamen stand ein Satz, mehrfach unterstrichen: „Kochen ist, wenn Erinnerung Zukunft wird.“
Sie lächelte. „Das hast du geschrieben?“ Sima nickte verlegen. „Ich wollte aufschreiben, warum ich das mache. Es geht ja nicht nur ums Essen. Es geht darum, dass man in einem Geschmack eine Geschichte findet. Dass jemand sagt: ‚Das erinnert mich an…‘ – und plötzlich ist er wieder da, mitten in einem Moment, der längst vorbei ist.“
Lina sah sie an, und in diesem Blick lag eine Gewissheit, die fast weh tat: Hier stand die Zukunft des Cafés. Sima bemerkte den Ausdruck in ihrem Gesicht, hielt kurz inne. „Was ist?“ „Nichts“, sagte Lina, „ich hör dir nur gern zu.“
Sima lächelte schief. „Du klingst, als würdest du dich verabschieden.“ „Nein“, antwortete Lina sanft. „Ich höre nur, wie etwas weitergeht.“
Ein Moment der Stille. Dann begann Sima, den Sirup in Flaschen zu gießen. Das goldene Licht fiel durch das Fenster, traf die Flüssigkeit, und sie schimmerte wie Bernstein. „Ich will heute Abend eine Probe machen“, sagte sie. „Ein kleines Menü – nichts Großes. Vielleicht kommen Paul und Hella, und Finn filmt wieder. Ein Abend voller Sanddorn, sozusagen.“
„Ein schöner Titel“, meinte Lina. „Du solltest das auf die Tafel schreiben.“ „Mach du das. Es ist deine Idee.“
Sima sah überrascht auf. „Meine?“ „Natürlich. Du bist längst mehr als die Köchin hier, Sima. Du bist das Herz der Küche. Und vielleicht… noch mehr.“
Sima errötete, drehte die Flasche in der Hand. „Ich will nicht zu viel verändern.“ „Veränderung ist das, was das Café lebendig hält. Mimi hat es so gebaut. Ich hab’s nur geöffnet. Du gibst ihm neuen Atem.“
Sima schwieg, aber ihr Blick verriet ein stilles Leuchten.
Draußen begann der Wind, stärker zu werden. Die Dünen warfen lange Schatten, Möwen zogen tiefer. Der Tag war hell, doch das Licht hatte dieses goldene, weiche Flirren, das ankündigte, dass der Sommer nahte.
Lina stand auf, ging ans Fenster. „Weißt du“, sagte sie leise, „Mimi hat mir einmal erzählt, dass jeder Mensch ein eigenes Licht hat. Manche brennen still, manche tanzen. Du bist so eine, die tanzt – wie Sandstaub in der Sonne.“
Sima lachte, ein wenig verlegen. „Dann hoffe ich, ich fall nicht ins Meer.“ „Wenn du’s tust, trägt es dich. Das tut es immer.“
Die Uhr schlug zehn. Draußen fuhr ein Lieferwagen vorbei, Kinder lachten irgendwo am Deich. Das Leben kehrte zurück, Schritt für Schritt.
„Ich fahr gleich kurz zum Markt“, sagte Lina. „Will sehen, ob die Fischer schon zurück sind. Vielleicht bringen sie etwas mit, das du heute Abend brauchen kannst.“ „Bring mir, wenn’s geht, ein bisschen frischen Thymian. Und Sanddorn, wenn du welchen findest.“ „Mach ich.“
Sima wischte sich die Hände an der Schürze ab. „Lina?“ „Hm?“ „Danke. Dass du mich hier gelassen hast. Und dass du mir vertraust.“
Lina drehte sich um, lächelte. „Ich vertraue nicht. Ich sehe nur, was wächst.“
Dann nahm sie ihre Tasche, trat hinaus ins Licht. Vor ihr lag das Meer, ruhig, offen, ein Silberstreifen am Horizont. Die Sonne brannte mild auf die Dächer von Sandhagen, und über den Dünen schwebten winzige Staubpartikel im Wind – Lichter, die kamen und gingen.
Drinnen summte Sima weiter, rührte, probierte, notierte. Und während sie das tat, schien das Café mitzusingen – ein leiser, heller Ton, wie das Klingeln von Gläsern im Morgenlicht.
Ein Abend voller Sanddorn
Der Abend kam in Goldtönen. Die Sonne hing tief über den Dünen, und das Licht fiel wie flüssiger Honig über die Terrasse des Cafés. Der Himmel war klar, nur ein paar Wolken trieben wie vergessene Segel über das Meer. Die Luft schmeckte nach Salz, Sommer und einem Hauch Vanille.
Lina stellte die letzten Gläser auf die Tische. Sima hatte sie gebeten, alles schlicht zu halten – keine Tischdecken, nur Holz, Kräuter, und Kerzen in alten Marmeladengläsern. Auf jedem Tisch stand eine kleine Flasche mit dem neuen Sirup, das Etikett handgeschrieben: Sanddorn & Mut.
„Nicht schlecht, oder?“ sagte Sima, die aus der Küche kam, die Haare noch voller Dampf und Duft. „Ich glaube, Mimi hätte das gemocht.“ „Mimi hätte das gefeiert“, antwortete Lina und lächelte.
Paul kam als Erster, den Hut in der Hand, eine Flasche seines Honigs unter dem Arm. „Ich dachte, Honig passt zu Mut“, sagte er und zwinkerte. „Honig passt zu allem, was echt ist“, meinte Sima.
Kurz darauf erschien Hella, in einem weiten Tuch aus türkisblauer Seide, die im Wind flatterte. „Meine Lieben!“ rief sie. „Was für ein Abend! Der Himmel trägt mein Lieblingskleid!“ Sie trat auf die Terrasse, breitete die Arme aus und sog die Luft ein. „Wenn Glück duften könnte, dann so!“
Finn folgte, seine Kamera über der Schulter, die Haare vom Wind zerzaust. „Ich will das alles festhalten“, sagte er. „Das Licht, die Stimmen, die Farben – bevor es weiterzieht.“ Lina nickte. „Dann mach’s lebendig, nicht nur schön.“ „Das tu ich“, versprach er.
Die Gäste trudelten ein – Nachbarn, Stammgäste, Kinder, die um die Tische liefen und Möwen nachahmten. Sima brachte Schalen mit dampfendem Sanddornrisotto, kleine Teller mit Kräuterküchlein, Gläser mit goldgelber Limonade. Der Duft mischte sich mit dem Meereswind. Es war, als würde das Café atmen.
Lina beobachtete, wie Sima sich bewegte: frei, strahlend, mit einer Selbstverständlichkeit, die man nicht lernen konnte. Sie lachte, erklärte, probierte. Ihre Hände flogen über die Teller, ihre Augen leuchteten. Das Café hatte ein neues Herz – und es schlug laut und klar.
„Sag mal, was ist das da?“ fragte Hella und deutete auf ein Tablett mit kleinen Gläsern. „Sanddorn-Gelee mit Thymianblüten“, erklärte Sima. „Süß, aber mit Biss.“ Hella kostete, schloss die Augen und seufzte theatralisch. „Das ist nicht nur ein Geschmack, das ist eine Liebeserklärung!“
Alle lachten. Selbst Paul, der sonst selten laut lachte, schüttelte schmunzelnd den Kopf. „Na, dann heirat’s“, murmelte er und nahm einen zweiten Löffel.
Finn bewegte sich unauffällig zwischen den Tischen, filmte Hände, Gesichter, den Schimmer des Lichts auf Gläsern. Er blieb kurz bei Lina stehen. „Du siehst glücklich aus“, sagte er. „Bin ich“, antwortete sie. „Aber anders als früher.“ „Anders wie?“ „Ruhiger. Als würde das Glück nicht mehr wollen, dass ich es festhalte.“ Finn nickte langsam. „Ich glaub, so sieht’s auch aus.“
Aus der Küche drang Musik – eine alte Jazzplatte, die Sima von Hella geliehen hatte. Die Töne füllten den Raum, weich, tanzend, wie Wellen.
Als die Sonne den Horizont berührte, stellte Sima die letzte Platte auf den Tisch: eine große Schale mit Sanddorn-Creme, darauf Blütenblätter und Zitronenzesten. „Das ist der Abschluss“, sagte sie. „Für Mimi. Und für euch.“ Sie hob das Glas, und alle taten es ihr gleich.
„Auf das Café am Meer“, sagte Lina. „Auf das, was bleibt“, ergänzte Paul. „Und auf das, was kommt“, fügte Hella hinzu. Die Gläser klirrten, der Sanddornsirup schimmerte wie Bernstein im Licht.
Ein Windstoß kam vom Meer herüber, spielte mit den Kerzenflammen. Für einen Moment zitterten sie, doch keine erlosch. „Das Meer segnet uns“, sagte Hella leise.
Später, als die Dunkelheit über die Terrasse fiel, begannen die Kinder, Muscheln in Gläser zu sammeln, um „Laternen aus dem Meer“ zu basteln. Finn half ihnen, lachte, filmte, während Sima in der Küche Geschirr spülte und leise summte.
Lina saß still am Rand, auf der Bank neben der Tür. Von hier aus konnte sie alles sehen: das Licht der Kerzen, die Gesichter, die sich im Glanz der Gläser spiegelten, die Bewegung des Meeres dahinter. Alles, was sie je gewollt hatte, war hier – lebendig, leicht, frei.
Paul kam zu ihr, reichte ihr ein Glas. „Honigwein“, sagte er. „Etwas Neues. Ich probier mich auch mal aus.“ Sie nahm einen Schluck. Es schmeckte süß, warm, mit einem Stich von Wildkräutern. „Wie Sommer, der sich erinnert“, sagte sie. „Wie du“, meinte Paul.
Lina sah ihn an, wollte etwas erwidern, doch er hob nur leicht den Hut. „Manchmal erkennt man, wann ein Kreis sich schließt, Lina. Du bist gut darin, ihn nicht zu erzwingen.“
Hella begann zu singen. Kein großes Lied, kein Auftritt – nur eine Melodie, die sich wie Wind zwischen die Stimmen legte. Finn drehte sich um, die Kamera im Anschlag, aber dann senkte er sie wieder. „Manchmal reicht es, es zu hören“, sagte er.
Lina lauschte. Hellas Stimme war brüchig und schön zugleich, wie Salz auf Glas. Sima kam aus der Küche, wischte sich die Hände ab und setzte sich neben Lina. „Ich glaub, ich hab’s geschafft“, flüsterte sie. „Mehr als das“, antwortete Lina. „Du hast etwas geboren.“
Die Musik, das Meer, die Stimmen – alles verschmolz. Ein Abend voller Sanddorn, voller Licht, voller Herzschläge.
Als Hella endete, klatschte niemand. Es war kein Moment für Applaus, sondern für Stille. Diese Stille war warm und weit, wie das Meer nach Sonnenuntergang.
Dann erhob sich Lina, ging hinaus zur Terrasse. Das Wasser lag ruhig, das Licht der Kerzen spiegelte sich darin. Sie schloss die Augen, atmete tief, spürte den Wind.
Vielleicht, dachte sie, war Loslassen gar kein Ende. Vielleicht war es nur ein anderer Weg, bei allem zu bleiben, was man liebt.
Finns Kamera
Die Nacht war längst hereingebrochen, doch im Café flimmerte noch Licht. Die letzten Gäste waren gegangen, die Tische abgeräumt, das Summen des Abends verklungen. Nur in der Ecke bei der Theke saß Finn, die Kamera auf dem Tisch, den Laptop davor. Der Bildschirm war sein Meer, die Bilder seine Wellen.
Er spulte die Aufnahmen des Tages zurück: Lina, die Kerzen anzündet. Sima, die lacht, während der Sanddornsirup im Licht glüht. Paul, der mit verschränkten Armen dasitzt, still und zufrieden. Hella, die singt, die Augen geschlossen, als lausche sie einer Erinnerung. Das Café in goldenem Atem – das war der Moment, den er hatte einfangen wollen.
Er drehte den Lautstärkeregler hoch. Das Mikro hatte mehr eingefangen, als er erwartet hatte: das leise Klirren von Gläsern, das Flattern einer Tischdecke im Wind, Kinderlachen, das Rauschen des Meeres in der Ferne. Und Hellas Stimme. Sie füllte den Raum wie warmer Rauch, brüchig, ehrlich, echt.
Finn stoppte das Video und sah aus dem Fenster. Draußen lag die Bucht still. Nur ein paar Lichter im Hafen glommen noch. Er öffnete die Tür und trat auf die Terrasse. Der Wind war mild, das Meer dunkel und glatt wie Tinte.
Er hob die Kamera. Nicht um zu filmen, nur um sie in den Händen zu halten. Das Gewicht war vertraut. Die ersten Aufnahmen hatte er als Kind gemacht – mit Linas alter Digitalkamera, die sie ihm geschenkt hatte, als er dreizehn war. „Damit du das siehst, was bleibt, wenn man hinschaut“, hatte sie gesagt.
Damals hatte er geglaubt, Fotografie sei ein Trick, Zeit anzuhalten. Heute wusste er: Es war eher ein Gebet, sie zu verstehen.
Er drehte sich langsam, sah durchs Objektiv. Das Café leuchtete hinter ihm – ein kleines Universum aus Wärme und Erinnerung. In den Fenstern spiegelten sich die Kerzen, wie flackernde Sterne. Im Garten sah er den kleinen Fleck Erde, den Lina am Vortag umgegraben hatte. Ein kaum sichtbarer Punkt im Dunkeln, und doch wusste er, dass dort etwas wartete, unsichtbar und lebendig.
Er stellte die Kamera auf das Geländer, drückte die Aufnahme-Taste – ein stilles Video, ohne Ton, ohne Bewegung. Nur das Licht im Fenster, das sanfte Flackern, das Rauschen des Windes. Ein Bild vom Jetzt.
„Du arbeitest wieder zu spät.“ Die Stimme kam von hinten. Lina stand in der Tür, die Arme verschränkt, ein Schal um die Schultern. „Ich wollte nur…“, begann Finn. „…das Gefühl festhalten?“ Er nickte. Sie lächelte. „Manchmal reicht es, es zu spüren.“
Er drehte sich zu ihr. „Aber was, wenn es verloren geht?“ „Dann war es echt“, sagte sie. „Nichts Echtes bleibt ewig sichtbar.“
Finn setzte sich auf die Bank. Lina kam dazu, nahm die Kamera in die Hand, sah auf das Display. „Du hast ein gutes Auge“, sagte sie. „Aber weißt du, was du wirklich suchst?“ Er schwieg. „Nicht das Bild“, sagte sie leise. „Sondern die Wahrheit darin.“
Finn dachte nach. „Ich will zeigen, was zwischen den Momenten liegt. Dieses Gefühl, dass Zeit vergeht, aber etwas trotzdem bleibt. Wie… Wellen. Sie verschwinden, aber das Meer ist immer da.“
„Das ist schön“, sagte Lina. „Das hast du mir beigebracht.“ Sie sah ihn an, überrascht. „Ich? Wie denn?“ „Durch das Café. Durch alles hier. Ich hab gesehen, wie du Dinge nicht festhältst, sondern weitergibst. Wie du loslässt, ohne zu verlieren.“
Lina schwieg. Ihre Augen glänzten, aber sie lächelte. „Vielleicht ist das der Trick des Lebens.“
Ein Windstoß wehte vom Meer herüber. Die Lichter im Café flackerten. Finn hob wieder die Kamera, diesmal instinktiv. Er filmte, wie der Wind durch Linas Haare fuhr, wie das Licht auf ihrer Haut spielte, wie ihre Hand sich leicht über das Geländer legte. Kein Wort, kein Ton. Nur das. Als er die Aufnahme stoppte, war sie nicht mehr neben ihm. Sie war ein Teil der Szene geworden – wie das Meer, wie das Licht.
„Was machst du mit all den Aufnahmen?“ fragte Lina nach einer Weile. „Ich denk an einen Film“, sagte Finn. „Über das Café. Nicht als Werbung oder Dokumentation. Eher wie ein Brief. Für später.“ „Für später“, wiederholte sie und nickte. „Das passt.“
„Ich will zeigen, was dieses Haus war, bevor es sich verändert. Nicht als Abschied. Als Erinnerung, die atmet.“ „Dann fang an, Finn. Jetzt. Bevor der Sommer kommt.“
Er nickte. „Ich werd’s ‚Wellenzeiten‘ nennen.“ Lina lachte leise. „Dann passt der Titel doppelt.“
Im Hintergrund öffnete sich die Küchentür. Sima trat hinaus, das Haar im Nacken gebunden, eine Tasse Tee in der Hand. „Ich hab noch was von dem Sirup gemacht“, sagte sie. „Ihr müsst probieren.“ Finn nahm einen Schluck. Das Getränk war warm, zitronig, ein bisschen herb – wie Sonne in Flüssigkeit. „Das schmeckt nach Anfangen“, meinte er. Sima lächelte. „Dann ist es gelungen.“
Sie setzten sich zu dritt auf die Bank. Niemand sprach. Über ihnen glitzerte der Himmel, das Meer rauschte sacht, und vom Hafen her klang das leise Klirren von Seilen an Masten.
Finn stellte die Kamera auf die Stufe, drückte wieder „Aufnahme“. Er filmte nicht sie, sondern den Raum zwischen ihnen – die Luft, die sie verband. In der Linse spiegelte sich das Licht, das von innen nach außen drang, warm, fließend, echt.
„Weißt du, was ich glaube?“ sagte Sima leise. „Das Café hat ein Gedächtnis. Es merkt sich alles – Gerüche, Stimmen, Lachen. Vielleicht speichert es das in den Wänden.“ „Dann müssen wir aufpassen, was wir sagen“, scherzte Finn. Lina schüttelte den Kopf. „Nein. Wir müssen nur ehrlich sein.“
Wieder Stille. Nur der Wind sprach, das Meer, das Atmen des Ortes. Finn blickte auf die kleine Lampe über der Tür, die schwach flackerte. Er dachte an Mimis Geschichten, an die Briefe, an das Fläschchen im Garten. Er dachte an Lina, die das Café mit Herz geführt hatte, und an Sima, die es nun mit Licht füllte.
Er verstand, dass er nicht nur filmen wollte, was war, sondern was blieb. Nicht die Gesichter, sondern das Gefühl. Nicht den Ort, sondern den Geist, der ihn bewohnte.
Er drückte die Stopptaste. Der Bildschirm zeigte das letzte Bild: das Café im Dunkel, die Fenster wie warme Augen, das Meer dahinter schwarz und weit.
„Das ist es“, murmelte er. „Das ist die Geschichte.“
Lina legte eine Hand auf seine Schulter. „Dann erzähl sie.“
Sie gingen hinein, einer nach dem anderen. Die Tür schloss sich, das Licht erlosch nach und nach. Nur das Meer blieb hell, glitzernd im Mondschein – wie ein stilles Publikum, das alles gesehen hatte.
Stimmen vom Hafen
Der Morgen roch nach Salz, Diesel und nasser Schnur. Der Nebel hing flach über den Booten, und über den Masten zogen Möwen ihre Kreise, laut und ungeduldig. Lina und Finn gingen langsam über das Pflaster, das noch feucht vom Tau war. Der Hafen lag halb im Dunst, halb im Licht – wie eine Erinnerung, die noch nicht entschieden hatte, ob sie bleiben wollte oder gehen.
„Ich liebe diese Zeit“, sagte Lina. „Bevor alles richtig wach ist.“ Finn nickte. „Hier klingt selbst Stille nach Arbeit.“
Am Kai stand Rudi, der alte Fischer, in Gummistiefeln, die Hände tief in den Taschen. „Na, Lina!“, rief er. „Ich hab dich lang nicht mehr hier gesehen.“ „War viel los im Café“, antwortete sie. „Aber heute wollte ich mal wieder nach den Wellen schauen.“ Rudi grinste. „Die ändern sich nicht, nur wir.“
Er zog ein Netz an Bord, aus dem noch Tropfen fielen, und der Geruch von Tang stieg auf. „Und der Junge da?“, fragte er und nickte zu Finn. „Filmt alles, was sich bewegt“, sagte Lina. „Dann film mal mich, wenn ich mich nicht beweg’,“ lachte Rudi, „das ist seltener.“
Finn hob die Kamera und nahm ein paar Sekunden auf: Rudis wettergegerbtes Gesicht, seine Hände, das sanfte Schwanken des Bootes im Wasser. „Perfekt“, murmelte er. „Ein Gesicht wie Wind und Geschichte.“ „Dann nimm noch meine alten Stiefel dazu“, rief Rudi. „Die erzählen mehr als mein Mund.“
Lina lachte. Der Klang hallte über das Wasser, mischte sich mit den Stimmen der anderen Fischer. Die Männer riefen sich Zahlen zu, Preise, Fangmengen. Eine Möwe landete auf einer Kiste, wurde verscheucht, kehrte zurück. Es war das gleiche Leben, das sie vor Jahren hier gefunden hatte – roh, echt, laut, menschlich.
Sie ging ein Stück weiter, wo die Marktstände aufgebaut wurden. Die Verkäuferin vom Blumenstand nickte ihr zu. „Lina! Ich hab noch ein paar Mimosen für dich. Gelb wie Sonne im Glas.“ „Danke, Anke. Stell sie mir bitte beiseite, ich komm gleich vorbei.“
Am Fischstand schob Jan, Rudis Sohn, gerade die Kisten zurecht. „Na, Frau Caféchefin“, sagte er, „wieder auf Einkaufstour?“ „Nur auf Erinnerungstour“, erwiderte sie. „Dann nimm lieber nichts mit“, grinste er. „Erinnerungen verderben schnell, wenn man sie festhält.“ Sie schüttelte den Kopf. „Ihr im Hafen seid alle Philosophen geworden.“ „Wir hatten gute Lehrer“, sagte Jan und deutete auf das Meer. „Es redet jeden Tag mit uns.“
Finn filmte stumm weiter – Hände, Netze, Boote, Gesichter. Er suchte nicht das Spektakuläre, sondern das Unausgesprochene: wie die Sonne langsam durch den Nebel brach, wie ein Tropfen von der Rehling fiel und kurz aufblitzte, bevor er verschwand.
Ein alter Mann kam vorbei, zog einen Handkarren mit Muscheln. „Morgen, Lina. Du hast doch früher manchmal welche für deine Deko genommen, oder?“ „Stimmt“, sagte sie. „Hast du noch welche von den großen?“ „Da hinten, unterm Tuch.“ Sie hob das Tuch an. In einer der Schalen lag eine einzelne, große, fast weiße Muschel. Sie glitzerte, als hätte sie das Licht des Morgens eingesammelt.
„Was willst du dafür?“ „Für dich? Nichts. Nur, dass du mal wieder singst, wie früher.“ „Ich hab nie gesungen.“ „Dann fang an“, lachte er.
Finn hielt die Kamera darauf. „Das kommt in den Film“, sagte er. „Dann film die Muschel, nicht mich“, antwortete Lina. „Sie hat mehr zu sagen.“
Sie drehte sich um und ging langsam den Kai entlang. Die Sonne kam durch, löste den Nebel in Streifen auf, und das Wasser glitzerte. Überall hörte man kleine Geräusche: ein Hämmern, das Klirren einer Kette, das Tuckern eines Motors. Und dazwischen – Stimmen.