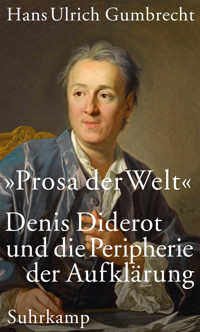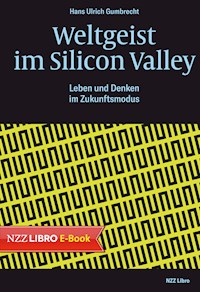
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Neue Zürcher Zeitung NZZ Libro
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Ein kritischer Blick auf Leben und Denken im Zukunftsmodus: Wenn Hegel heute lebte und sich die Frage nach dem Ort des Weltgeists erneut stellte, dann käme er am Denken der Programmierer vom Silicon Valley nicht vorbei. Palo Alto, Cupertino oder Mountain View heissen die unscheinbaren Ortschaften, in denen die radikal optimistischen Denker und Macher ihre technische Zukunft gerade erfinden. Diese jungen Seelen bilden das Intensitätszentrum einer neuen Welt, deren Vermessung und kritische Analyse eben erst begonnen hat. Direkt am Pazifik entsteht eine Denkkultur, die die philosophischen Traditionen alteuropäischen Zuschnitts mit dem amerikanischen Pragmatismus zur Konvergenz bringt. Hans Ulrich Gumbrecht, der fast 30 Jahre an der Stanford University lehrte, macht in seinem Buch diese neue Kultur fass- und erfahrbar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 311
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Weltgeist im Silicon Valley
Leben und Denken im Zukunftsmodus
Herausgegeben von René Scheu unter Mitarbeit von Manuel Müller
NZZ Libro
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2018 NZZ Libro, Schwabe AG
Der Text des E-Books folgt der gedruckten 1.Auflage 2018 (ISBN 978‑3‑03810‑374‑5)
Lektorat: Ulrike Ebenritter
Titelgestaltung: Katarina Lang, Zürich
Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werks oder von Teilen dieses Werks ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechts.
ISBN E-Book 978‑3‑03810‑394‑3
www.nzz-libro.ch
NZZ Libro ist ein Imprint der Schwabe AG.
Inhalt
Zunächst
Das Präsenztier
Der Weltgeist weht am Pazifik: Intensives Leben (und riskantes Denken) in Kalifornien
Impressionen aus dem Silicon Valley
Unsichtbar, aber real: Das Geheimnis eines Nichtorts
Steve Jobs oder Vom kalifornischen Totenkult
Charisma ist die Faktizität des Silicon Valley
Start-ups – die letzte Version des American Dream?
The Graduates of Silicon Valley
Neuer Reichtum ohne Skandal
Reflexionen über das Silicon Valley
Wohin steuern die Energiker?
So funktioniert Zukunftsintelligenz
Die Wahrheit entbirgt sich in der Elektronik
Das riskante Denken der Gegenwart
Die Dialektik der Mikroaggression
Suburbia: Lob der Peripherie
Konstellationen auf dem Globus
Unsere breite egalitäre Gegenwart
Die Weder-noch-Welt bleibt unheimlich
Die neue Internationale der Halbgebildeten
Das Denken wagen
Die Endlichkeit der Menschheit
Die nächste Katastrophe kommt ganz bestimmt
Wirklichkeitsdämmerung
Geschlechterdebatte: Jenseits der Gleichheit
Irritationen zwischen Amerika und Europa
Trump oder Von Sehnsucht und falscher Nostalgie
Amerika, hast du es (immer noch) besser?
Die Gewitterluft des amerikanischen Südens
Schöner, softer Sozialdemokratismus
Umwertung der Wirtschaftswerte
Zeit der Verstimmung
Die neue Sehnsucht nach Intensität
Gespräche
«Nachlassen geht nicht»: Hans Ulrich («Sepp») Gumbrecht unterhält sich mit René Scheu über siebzig Jahre Leben und Wirken.
«Das ist genau das Wort: Gelassenheit»: Gumbrecht und die Schweiz
«Wir erschaffen eine künstliche Superintelligenz, die selbst lernt»: Die jungen Wilden im Silicon Valley: René Scheu spricht mit Sam Ginn in Stanford.
«So denkt das Kind – aber nicht der reife Mensch»: Die Lehrer der jungen Wilden im Silicon Valley: René Scheu interviewt Robert P. Harrison in Stanford.
Biografische Daten
Quellen und Dank
Herausgeber
Autor
Zunächst
Das Präsenztier
Schwarzes T-Shirt, schwarzer Blazer aus Cord, Jeans, dazu als einzige kleine Extravaganz ein Paar hellbraune italienische Lederschuhe: Das ist die Berufskleidung des Romanisten und Philosophen Hans Ulrich Gumbrecht. So wie Mark Zuckerberg sich stets in ein weisses T-Shirt hüllt, so trägt Gumbrecht immerzu Schwarz. Silicon-Valley-Style. Eine solche grundlegende Entscheidung erleichtert einerseits das Leben, weil sie den Kopf frei macht für andere Belange. Andererseits wirkt sie stilbildend. Gumbrechts Gewandung erweist sich als cool, man könnte auch sagen: als sehr undeutsch und maximal antiprofessoral. In seinem Look verbirgt sich eine Pointe seines Lebens. Denn dieser Look erlaubt ihm, die wilden 1960er-Jahre der Bundesrepublik Deutschland in der unternehmerischen amerikanischen Gegenwart aufzuheben. Klar, das muss einem wie Gumbrecht gefallen. Wenn er kein Ironiker ist, so ist er doch ein «gambler», der mit den Erwartungen des Publikums zu spielen versteht.
Vor allem aber akzentuiert die schwarze Grundierung jenen Körperteil, der dem Betrachter sogleich auffällt, wenn er Gumbrecht zum ersten Mal begegnet: den markanten Kopf. Die weissen Haare, arrangiert in einer Mischung aus Bürstenschnitt und Wuschelfrisur, weisen in alle Richtungen. Dieser Mann ist voller Energie und Lebenskraft. Zwischen Nase und Oberlippe prangt wie ein Relikt aus vergangenen Tagen ein mächtiger Schnauz. Das Gesicht ist voller Furchen, die grünen Augen leuchten selbst dann, wenn sie kaum Schlaf gefunden haben. Coolness paart sich mit Strenge – und Anstrengung. Kaum hat sich der erste Eindruck gesetzt, beginnt Gumbrecht zu sprechen. Seine tiefe, sonore Stimme erzeugt einen Sog – und eine unheimliche Intensität. Gumbrecht ist erst ganz da, wenn er frei redet. Und wenn er redet, füllt er jeden noch so grossen Raum mit seiner Präsenz aus Physis und Phonetik. Die Leute hören ihm gebannt zu. Dann ist er in seinem Element, dann tritt er in Interaktion mit seinem Publikum, dann liest er in den Gesichtern der Zuhörer, dann berauscht er sich an sich selbst, dann läuft er zu Höchstform auf. In solchen Momenten scheint alles denkmöglich, die Fokussierung auf den Augenblick, in dem das Denken gerade stattfindet, ist total. Gumbrecht erweist sich als perfekte Stimmungsmaschine, als begnadeter Selbstbegeisterer, als ein Meister und Akteur des «hic et nunc». Was zählt, ist das, was hier und jetzt geschieht, was uns hier und jetzt berührt – und nichts ausserdem.
Damit steht Gumbrecht quer in der intellektuellen Landschaft all der Poststrukturalisten, die er persönlich kannte, deren Arbeit er schätzte und mit denen er immer wieder assoziiert wird. Doch diese Einordnung ist grundfalsch. Während die Poststrukturalisten alle Selbstgegenwart des Subjekts und alle Gegenwärtigkeit der Welt obsessiv und angestrengt als subjektive Illusion beziehungsweise Konstruktion zu entlarven versuchten, hält Gumbrecht stur an einer unmittelbaren Selbsterfahrung des Menschen fest, die stets einer konkreten Räumlichkeit und Zeitlichkeit bedarf.
Nehmen wir stellvertretend Jacques Derrida. Für ihn beruht die abendländische Metaphysik, die das Sein angeblich mit Präsenz gleichsetzt, auf dem System des «Sich-im-Sprechen-Vernehmens»,1 aus diesem «Phonozentrismus» folgen dann allerlei böse Dinge wie «Logozentrismus», «Ethnozentrismus» und «Phallozentrismus». Ganz anders Gumbrecht. Der grosse Gestus ist ihm zwar nicht fremd, doch bleibt er in seinen Exkursionen stets konkret, anschaulich, bodenständig. Was ihn an Derrida interessierte, ist deshalb weniger dessen Denken, Belesenheit oder Sprache als vielmehr die Aura. Und diese Aura eines bewundernswerten intellektuellen Gurus pflegte Derrida, daran erinnert sich Gumbrecht ganz genau, mit grosser Könnerschaft.2 Was zeigt: Der Mensch bleibt ein Präsenztier, das nur in einer je eigenen Umgebung funktioniert. Die Urszene der Gumbrechtschen Anthropologie lässt sich deshalb tatsächlich als altgriechische Seminarsituation ohne alle technischen Gadgets vergegenwärtigen: Einer hört sich selbst sprechen und tritt in Resonanz mit sich und seinem Publikum. Es ist dies eine Übung in angewandter, vorgeführter Geistesgegenwart. Ja, man kann sagen, dass Hans Ulrich Gumbrecht wie das perfekte Antidot zu Jacques Derrida und all seinen Jüngern wirkt: nicht Dekonstruktion, sondern Ambition, nicht relativieren, sondern imponieren, nicht das Parfum der Frivolität, sondern, wenn immer es möglich ist, echte, gelebte Intensität.
Nachdem die intellektuelle Revolution der französischen Philosophen eher spurlos an Gumbrecht vorüberging, scheint nun aber die Technik sein Verständnis des Menschen ernsthaft herauszufordern. Im digitalen Zeitalter wandelt sich das In-der-Welt-Sein in fundamentaler Weise: Alle starren wir auf einen Bildschirm – und sind dadurch mit allen zugleich lebenden Menschen auf dem Globus in Äquidistanz verbunden. Die Dimension der konkreten Räumlichkeit verschwindet. Alle kennen die merkwürdigen Alltagssituationen, zu denen dies führt: Man sitzt zusammen im selben Restaurant, also in unmittelbarer körperlicher Nähe, und kommuniziert über das Smartphone miteinander. Der Anwesende ist abwesend, der Abwesende anwesend. Wenn die Räumlichkeit schwindet, dann verändert sich auch die subjektive Erfahrung der Zeit. Im digitalen Zeitalter ist die Vergangenheit auf dem leuchtenden Bildschirm jederzeit abruf- und verfügbar, vergeht also gewissermassen nicht mehr; zugleich wirkt die Zukunft zunehmend entrückt, ja unvorstellbar – sie kommt, wenn überhaupt, nur noch als Katastrophenszenario in den Blick. Wir leben längst in einer «breiten Gegenwart der Simultaneitäten» (Gumbrecht), ohne dass wir Bedeutung und Tragweite dieser Entwicklung schon abschätzen könnten. Und wir mögen uns mit Gumbrecht ständig fragen: Was werden wir, was wird der heutige Mensch einst gewesen sein?
Das ist der Blick, mit dem sich Gumbrecht dem Geschehen seiner unmittelbaren kalifornischen Gegenwart zuwendet. Als er 1989 einen Ruf nach Stanford annahm, war ihm nicht bewusst, dass er ins Auge des Sturms zog. Doch machten ihm dies seine neuen, wirklich hervorragenden Studenten bald klar. Sie wollten keine akademischen Exerzitien absolvieren, sondern von den «humanities» fürs Leben lernen, um dieses Leben in den meisten Fällen durch Programmieren vor einem Bildschirm zu verändern. Und Gumbrecht entschloss sich, die Aufgabe anzunehmen, mit der ihn der Zufall bedachte: berührter und berührender Beobachter dessen zu sein, was sich um ihn herum im Silicon Valley ereignet, «hic et nunc».
Die digitale Revolution findet an einem ganz bestimmten Ort statt – und hat eine ganz eigene Geschichte. Damit bestätigt sie Gumbrechts Grundsatz, wonach Raum und Zeit zwangsläufig das menschliche Denken und Handeln bestimmen. Im Fall des Silicon Valley ist die Situation – in den Worten des Internetunternehmers Peter Thiel – durchaus paradox: «Die technologische Internetrevolution war eigentlich dazu gedacht, die Tyrannei des Ortes und der Geografie zu durchbrechen. Und doch fand alles hier an diesem Platz statt.»3 Wie ist das möglich? Wie kann es sein, dass auf einem kleinen Territorium zwischen den beiden Städten San José und San Francisco, die kaum 50 Kilometer auseinanderliegen, eine intellektuelle Intensität entsteht, die das Zusammenleben aller Menschen auf der Erde für immer affiziert und verändert? Ist es Zufall, ist es Planung, ist es Geschick? Was sind die treibenden Kräfte, wie genau ticken die Köpfe dieser hier und jetzt sozialisierten Menschen, wie sehen sie die Welt heute und morgen? Um die ganz spezifische Räumlichkeit und die besondere Zeitlichkeit des Silicon Valley dreht sich dieses Buch vor allem, alteuropäisch gesprochen: um den Geist des Silicon Valley, der längst zum Weltgeist geworden ist.
Zugleich liefert der Band Bausteine für die einzigartige Biografie eines «intellectuel sensible» an der Schnittstelle zwischen alter und neuer Welt, die erst noch zu schreiben ist. Impressionen vermischen sich mit Reflexionen, Irritationen mit Interventionen. Sie sind Ausdruck der Faszination, jene Gegenwart zu fassen, die unsere Zukunft bestimmen wird. Nichts bleibt, wie es ist – nur, was wird aus dem permanenten Wandel? Was ist vergangen, noch bevor es sich bewährt hat? Was wird sich bewähren, obwohl es sich erst in Ansätzen zu erkennen gibt? Peter Sloterdijk hat Gumbrecht einmal zu Recht einen «grossen Erinnerer» genannt.4 Dieser Sohn zweier Ärzte aus Würzburg schöpft aus dem reichen Fundus der Geistesgeschichte der letzten zweieinhalbtausend Jahre – und vermag deshalb in eigenwilliger Weise über die Berührung durch die Gegenwart zu schreiben, die unsere Zukunft sein wird, so als wäre sie bereits Vergangenheit. Daraus ergibt sich ein eigener Ton der Gelassenheit – und ein Duktus der konzentrierten Wahrnehmung. Gumbrecht ist in jeder Zeile seiner Texte ganz da: einerseits ganz bei sich, andererseits ganz in der Welt. Ausgerechnet er, der an der wohl technischsten und kapitalistischsten Eliteuniversität der neuen Welt lehrt, beweist damit, warum es die «humanities» mehr denn je braucht: Sie sind eine Lektion in freier, grosszügiger Lebenszugewandtheit, in der Vermittlung zwischen Bibliothek und Berührung durch die Welt. Darum könnte dieses Buch auch einen ganz anderen Titel tragen: Vom Nutzen und Vorteil der Geisteswissenschaften für das intensive Leben (und das jederzeit riskante Denken).
Aber das wäre schon wieder alteuropäisch gedacht. Denn Leben ist Denken «in actu». Und Denken ist Experimentieren «in actu». Wer will schon belehren, wenn es doch noch so viel zu begreifen gibt!
René Scheu, August 2018
1Siehe Jacques Derrida, Grammatologie, aus dem Französischen übersetzt von Hans-Jörg Rheinberger und Hanns Zischler, Frankfurt 1994, S. 19 ff. Siehe ebenfalls Jacques Derrida, Die Stimme und das Phänomen, aus dem Französischen übersetzt von Hans-Dieter Gondek, Frankfurt 2003, S. 103 ff.
2Vgl. die Anekdote mit Derrida auf dem Campus in Stanford, in diesem Band.
3Florian Schwab im Gespräch mit Peter Thiel: https://www.weltwoche.ch/ausgaben/2018-29/artikel/en-hypnotische-massenphanomene-die-weltwoche-ausgabe-29-2018.html (Zugriff: 1.8.2018).
4https://www.nzz.ch/feuilleton/man-darf-ihn-einen-gelehrten-helden-in-der-postheroischen-zeit-nennen-der-romanist-hans-ulrich-gumbrecht-hat-grund-zu-feiern-ld.1394415 (Zugriff: 1.8.2018).
Der Weltgeist weht am Pazifik: Intensives Leben (und riskantes Denken) in Kalifornien
Im kompakten Handbuchwissen gilt Georg Wilhelm Friedrich Hegel als Begründer jenes Denkstils, den wir bis heute Geschichtsphilosophie nennen. Damit ist die philosophisch fundierte Spekulation über Gesetzmässigkeiten vor allem in der Entwicklung des Geistes gemeint, die es dem begrifflich Versierten erlauben soll, aus der Analyse von Vergangenheit und Gegenwart verlässliche Blicke auf die Zukunft zu eröffnen. Wir beginnen allerdings erst wirklich, Hegels Projekt zu verstehen, sobald wir das Kompaktwissen um eine Stufe elementarer und also radikaler formulieren. Mehr als irgendein Philosoph in der westlichen Tradition hat er die Zeit in den Vordergrund seiner Philosophie gerückt. Denn wenn ein spezifisch intellektuelles (Hegel hätte gesagt: ein phänomenologisches) Verhältnis zur Welt die Forderung impliziert, tatsächlich alle Aspekte ihrer Gegenstände und Ereignisse zu erfassen, dann kann deren überkomplexe Gleichzeitigkeit allein im Nacheinander der Zeit-Dimension eine prägnante und dann auch plausible Ordnung finden. Eben diese Ordnung der Phänomene in der Zeit nennen wir Geschichte – und zwar erst seit dem frühen 19. Jahrhundert. Was Hegel also erfunden hat, ist – genau genommen – nicht die Geschichtsphilosophie in dem Sinn, dass die Welt, die man immer schon geschichtlich begriffen hatte, nun endlich aus philosophischer Perspektive erfasst wird. Seine Innovation bestand vielmehr in der Entwicklung einer neuen Philosophie der Zeit, die unseren Begriff von der Geschichte überhaupt erst geformt hat. Ohne Hegel gäbe es keine Geschichtsphilosophie im modernen Sinn.
Dabei erweist er sich mit seiner Konzentration auf Geist, Bewusstsein und Vernunft selbst als ein Kind der Neuzeit. Denn dieser gleichsam kopflastige Zugang lässt sich in tausend begrifflichen Verästelungen mindestens bis ins frühe 17. Jahrhundert zurückverfolgen – es genügt, den Namen Descartes zu nennen. Der menschliche Körper trat dadurch ebenso in den Hintergrund wie der Raum als jene Dimension, die aus der Gegenwart des Körpers in der Welt hervorgeht. So gesehen sollte es uns eigentlich überraschen, dass Hegel – obwohl Philosoph der Zeit – lebenslang von der Frage fasziniert war, an welchen ganz konkreten Orten der Weltgeist zu verschiedenen Momenten der Geschichte wirkte und sich verkörperte. Dafür ein konkretes Beispiel. Als Privatdozent an der Universität Jena beobachtete Hegel, wie der französische Kaiser Napoleon nach seinem Sieg über die deutschen Truppen durch die Stadt ritt. Daraufhin schrieb er voller Begeisterung an seinen Freund Friedrich Immanuel Niethammer:
«Den Kaiser – diese Weltseele – sah ich durch die Stadt zum Rekognizieren hinausreiten; – es ist in der Tat eine wunderbare Empfindung, ein solches Individuum zu sehen, das hier auf einen Punkt konzentriert, auf einem Pferde sitzend, über die Welt übergreift und sie beherrscht.»1
Wichtig – geschichtlich wichtig – ist an diesem Zitat und seinem ungewöhnlichen Eindruck von Unmittelbarkeit, dass Hegel Napoleon nicht als eine Allegorie oder als ein Symbol der «Weltseele» auffasst (in späteren Jahren sollte er das Wort «Weltgeist» vorziehen) und sich die Weltseele auch nicht gleichmässig über den Raum verteilt vorstellt. Vielmehr findet die Weltseele für ihn in Napoleon, in diesem konkreten Individuum und Körper, ihre «Konzentration» und in dessen Herrschaft ihre durchaus geistige Wirklichkeit und Wirksamkeit.
Auf räumliche Intuitionen dieser Art stossen wir allenthalben in Hegels Büchern und Vorlesungen. Seine Ästhetik zum Beispiel lässt die Kunst in Griechenland (vor allem in der griechischen Skulptur) des 5. Jahrhunderts vor Christus ihren Höhepunkt erreichen.2 Geradezu sprichwörtlich ist Hegels Anspruch geworden, der Weltgeist habe im preussischen Staat und mithin auch in seiner eigenen Philosophie zu sich selbst gefunden und so Geschichte zur Vollendung gebracht. An eben dieser abschliessenden Sicht, wonach die Geschichte an ihr Ende gekommen sei, hielten nach Hegels Tod im Jahr 1831 die sogenannten Rechtshegelianer fest, während die Linkshegelianer – unter ihnen der junge Karl Marx – für die eigene Gegenwart eine Zukunft offenhalten wollten. Selbst die Frage, wie sich denn der Weltgeist wohl in jenen Jahren zu den Vereinigten Staaten von Amerika verhalte, hat sich Hegel gestellt – ohne zu einer günstigen Diagnose zu gelangen.
«Europa warf seinen Überfluss nach Amerika hinüber, ungefähr, wie aus den Reichsstädten, wo das Gewerbe vorherrschend war und sich versteinerte, viele in andere Städte entflohen, die einen solchen Zwang nicht hatten und wo die Last der Abgaben nicht so schwer war. So entstand neben Hamburg Altona, neben Frankfurt Offenbach, Fürth bei Nürnberg, Carouge neben Genf. In gleicher Weise verhält sich Nordamerika zu Europa.»3
Trotz dieser wenig ermutigenden Vorgabe, die ja in einer gewissen Herablassung der europäischen Intellektuellen gegenüber der Kultur in den Vereinigten Staaten bis heute ihre Fortsetzung findet, habe ich mir als in Süddeutschland geborener Nordkalifornier (seit 1989) und als amerikanischer Bürger (seit 2000) eine gegenläufige Philosophie oder Mythologie der Gegenwart zurechtgelegt: Wenn Hegel heute lebte und die Frage nach dem Ort der Weltseele stellte, dann würde er sie im Silicon Valley verorten, im Zentrum der elektronischen Industrie zwischen San José im Süden und San Francisco im Norden.
Die potenziellen Affinitäten zwischen diesem Ort und Hegels Erleben des französischen Kaisers im Jahr 1806 erscheinen ebenso überraschend wie präzise. Da ist zunächst die räumliche «Konzentration» eines Wirkungszentrums, das «über die Welt übergreift» und in wenigen Jahren den Alltag (fast) aller Menschen und ihre Zukunftsmöglichkeiten nicht weniger tief greifend verändert hat als ihre Zukunftsbedrohungen. Zweitens lässt sich die Emergenz dieser Wirkung aus einer intelligenten Praxis beobachten: War es 1806 die strategische Kriegsführung des französischen Kaisers, so ist es heute das Programmieren (im Gegensatz zu dem eher flachen Silicon-Valley-Diskurs von der Erschaffung einer «besseren Welt» durch Elektronik). Des Weiteren ist da die Ausstrahlung dieser Energie, wie sie selbst wir Geisteswissenschaftler Woche für Woche in unserer «Philosophical Reading Group» an der Stanford University erlebt haben, vor allem wenn sich unter den Teilnehmern auf «Computer Sciene», «Electrical Engineering» oder «Symbolic Systems» spezialisierte Studenten finden. Und schliesslich muss die an Nietzsches Wille zur Macht erinnernde Entschlossenheit der besten Programmierer erwähnt werden, den heute schon konkret sichtbaren und auch bereits eingeschlagenen Weg zur Entwicklung einer Intelligenz zu verfolgen, die der menschlichen Intelligenz überlegen sein wird – und an die man ohne den Albtraum von einer möglichen Unterwerfung der Menschheit gar nicht denken kann. Bleibt die Frage: Wer würde Napoleons Rolle im kalifornischen Szenario unserer Gegenwart übernehmen? Setzt man voraus, dass der selbstgekrönte Kaiser tatsächlich mit strategischem Genie für seine militärischen Erfolge verantwortlich war, dann können ihn die Elon Musks, Peter Thiels und Mark Zuckerbergs von heute nicht ersetzen, weil sie sich längst nicht mehr auf dem Weg zur Entwicklung künstlicher Intelligenz befinden, sondern bestenfalls für ihre Inszenierung verantwortlich sind. Vielleicht war Steve Jobs der eine napoleonische Charakter in Nordkalifornien, weil er bis zu seinem Tod mit neuen Visionen und einem messianischen Glauben an ihre Verwirklichung die Welt in Atem hielt.
Der hegelianische Stellenwert des Silicon Valley ergibt sich jedenfalls ebenso deutlich aus dem menschheitsbedrohenden Potenzial der dort stattfindenden Entwicklungen wie aus den mehrheitlich als angenehm erfahrenen Veränderungen des Alltags, die uns die digitale Avantgarde beschert hat. Schon an der amerikanischen Ostküste freilich würde eine solche Beschreibung des Silicon Valley auf wenig Gegenliebe stossen, und in Europa, das weiss ich aus vielfacher eigener Erfahrung, muss sie entweder wie eine pure Provokation oder wie ein Symptom «typisch amerikanischer» Naivität wirken. Solche Naivität, höre ich die Skeptiker sagen, steht einem ehemaligen Europäer so schlecht wie ein Kleidungsstück in allzu grellen Farben. Ich halte dagegen, dass Hegel nicht gezögert hätte, sich auf das Denken des Silicon Valley als eine Chance einzulassen, um mutiges Denken in Europa wiederzubeleben.
Dabei kann ich in Anspruch nehmen, diese Position mit keinerlei Hintergedanken zu verbinden. Weder mein akademisches Fach noch meine Lebensform oder auch meine wirtschaftlichen Interessen nehmen mich in irgendeiner Weise positiv für das Silicon Valley ein. Ich besitze nicht einmal ein iPhone, keinesfalls um ein Zeichen intellektuellen Protests zu setzen, sondern weil beständige Unterbrechungen mit dem Schreiben als meiner zentralen Arbeitsform nicht kompatibel sind (und weil ich mir diese Distanz – so spät in meinem Berufsleben – ganz einfach leisten kann). Ausserdem benutze ich den Laptop, auf dem ich diese Worte schreibe, nicht anders als meine (schwere) elektrische IBM-Schreibmaschine in den 1970er-Jahren. Und an Silicon-Valley-Aktien ist aufgrund flagranter Finanzinkompetenz sowieso nicht zu denken. Schliesslich geht meine Begeisterung für das nördliche Kalifornien auf eine Zeit zurück, als der Name Silicon Valley – falls die Worte damals überhaupt schon gebraucht wurden – zum Vokabular einer Insidersprache gehört haben muss. Kurzum, ich denke bloss nach über das, was geschieht – aufgrund persönlicher Anschauung vor Ort.
1980 wurde ich als junger und international durchaus unbekannter Literaturwissenschaftler zum ersten Mal von der University of California Berkeley, die etwa eine halbe Autostunde von Stanford entfernt auf der anderen Seite der Bay of San Francisco liegt, zu einer Gastprofessur für ein Semester eingeladen. Ich sollte französische Literatur des Mittelalters lehren. Schon wenige Tage nach der Ankunft beklagte sich meine damalige Frau darüber, dass es mir – ganz gegen ihre sonstige, gar nicht immer positive Alltagserfahrung – offensichtlich die Sprache verschlagen hatte. So machte sie mich zu Recht darauf aufmerksam, wie sehr beeindruckt ich war. Aber wovon genau? Studenten und Kollegen auf dem Niveau von Berkeley hatte ich sicher noch nie erlebt. Doch das war es nicht. Intensiver begeisterte mich eine allgegenwärtige Freundlichkeit als Lebensform, die mehr als bloss höflich wirkte und in jeder Begegnung davon auszugehen schien, dass Freundschaft oder vielleicht sogar Liebe entstehen könnten (ich hielt das damals für ein sanftes Nachbeben des Summer of Love).
Zugleich verwandelte hier eine alle Konturen und Formen verstärkende Transparenz des Lichts mein Erleben der Welt. Davon zu reden, fand ich zuerst peinlich – so wie ich als Mitglied der sich so gern revolutionär gebenden Generation von 1968 überhaupt ein schlechtes Gewissen hatte angesichts solcher Begeisterung für das kapitalistische und optimistische Amerika. Aber musste es nicht gerade dieses Licht gewesen sein, das Kalifornien während des 20. Jahrhunderts immer wieder inspiriert hatte, in den grossen Zeiten von Hollywood, in der Hippiekultur und ihrer Musik während der 1960er-Jahre, ja selbst in einer erstaunlichen Zahl vor allem naturwissenschaftlicher Entdeckungen, dank derer die Universitäten der amerikanischen Westküste zu der akademischen Region mit den international meisten Nobelpreisen geworden sind? Es ist ein Licht, das unser Herz wärmt – und dennoch das Denken klärt.
Im folgenden Jahr lud mich Berkeley noch einmal zu zwei Seminaren ein, diesmal auf dem Gebiet der Literaturtheorie. Am Ende dieses Aufenthalts kam ein für mich wirklich überraschender Ruf auf einen Lehrstuhl für Allgemeine Literaturwissenschaft. Ich war 34 Jahre alt, fühlte mich sehr geehrt und stellte mir eine Fortsetzung meiner Arbeit in Berkeley als berufliche Erfüllung vor. Dennoch lehnte ich am Ende ab – und zwar ausschliesslich aus privaten Gründen, denn unsere Ehe mit inzwischen zwei Kindern war (möglicherweise auch wegen meines Kalifornien-Enthusiasmus) immer prekärer geworden. Den Brief mit der Absage in den Briefkasten zu stecken tat in einem konkret körperlichen Sinn weh, da ich zu wissen glaubte, wie einmalig diese Chance und wie irreversibel ihre Ablehnung sein musste. Doch glücklicherweise täuschte ich mich.
Als mir – gegen all meine früheren Erwartungen – Ende 1988 die Stanford University ein noch besseres Angebot machte, hatte sich mein privates Leben hinreichend verändert, dass ich mit gutem Gewissen den Entschluss fassen konnte, auszuwandern und Amerikaner zu werden. Möglicherweise hatte ich inzwischen auch ein markanteres akademisches Profil gewonnen, zum einen durch fünf internationale Kolloquien über Zukunftsthemen der Geisteswissenschaften, die ich am Inter University Center von Dubrovnik im damaligen Jugoslawien organisiert hatte, und andererseits durch meine institutionelle Initiative zur Gründung der sogenannten Graduiertenkollegs an deutschen Universitäten. Stanford war seit der Mitte des 20. Jahrhunderts von einer mittelguten zu einer der besten Universitäten in den Vereinigten Staaten (und also der Welt) aufgestiegen, litt aber in seinem neuen Status noch unter dem durchaus zutreffenden Image, eigentlich eine technische Universität inmitten der damals neuen Private-Computer-Industrie zu sein. Viel war schon von der Start-up-Idee die Rede, von dem paradoxen und hyperkapitalistischen Gedanken, dass sich grosse Firmen ihre eigene Konkurrenz finanzieren sollten, um sie im Erfolgsfall aufzukaufen, von dieser Vision, die ein ingenieurwissenschaftlicher Dekan aus Stanford zunächst allein zur Unterstützung seiner ehemaligen Studenten in Umlauf gebracht hatte – bevor noch der erste Chip gebaut war. Suchmaschinen gab es noch nicht, und selbst das Internet blieb eine vage Zukunftsvision, solange Faxapparate weiter als fortschrittliche Kommunikationstechnologie galten.
Mit den besten akademischen Absichten berief die Universität in jenen Jahren einige jüngere Geisteswissenschaftler von der amerikanischen Ostküste und aus Europa, die mit intellektuellen, aber auch hochschulpädagogischen Neuerungen auf sich aufmerksam gemacht hatten. Aber standen wir nicht trotz allem von Anfang an als Exoten im technologischen Kalifornien auf verlorenem Posten? Eine ermutigende Antwort auf diese nie explizit gestellte, aber im Silicon Valley bis heute kaum zu unterdrückende Frage kam dann für einige meiner Kollegen (vor allem für den schon früh in der Fachwelt berühmten Dante-Spezialisten Robert Pogue Harrison) und für mich ausgerechnet von der Philosophie des erst 1976 verstorbenen und in seinem Alltag so technophoben Martin Heidegger. Eine nicht akademische kalifornische Assoziation, die sich der Pflege des Meisterdenkers aus dem südwestdeutschen Dorf Messkirch annahm, gab es immerhin – so skurril sie anfangs auf mich wirkte, so sehr mochte immerhin eine stimmungsmässige Analogie zwischen Denker und Ort gegeben sein, weil ja Heidegger die Beschreibung von Situationen intellektueller Inspiration gern mit Metaphern des Lichts beziehungsweise der Lichtung garnierte.4 Ich hatte mir allerdings bis kurz vor Ende meiner Jahre in Deutschland wegen der nationalsozialistischen Wolke über seinem Leben tatsächlich verboten, Heidegger zu lesen. Nun erwarteten auf einmal meine Studenten, dass gerade ihr neuer Professor aus Deutschland mit seinen Texten vertraut sein müsste, und ich entdeckte zu meinem Glück, dass es – so weit weg von jenem Land, wo die Wunden der Naziverbrechen nicht vernarben können – leichter war, seine Texte zu lesen.
Freilich dauerte es dann einige Zeit, bis die Ahnung aufstieg, dass schon in den Grundelementen von Heideggers Philosophie die Möglichkeit einer Beziehung zur historischen Konzentration der Technik im Silicon Valley angelegt war. Von seinem akademischen Mentor Edmund Husserl hatte er die pessimistische Vermutung übernommen, dass in der neuzeitlich erkenntnispraktischen Grundkonstellation der Pole von Subjekt (Bewusstsein) und Objekt (Welt) angesichts ihrer wachsenden wechselseitigen Entfernung, ja Entfremdung die Gefahr eines definitiven Relevanzverlusts der Philosophie für alle lebensweltlichen Situationen stecken mochte. Heideggers entscheidende Reaktion auf dieses Problem ist in Sein und Zeit, seinem 1927 veröffentlichten, einzigen und epochemachenden Buch, entfaltet. Da die ontologische Distanz zwischen Subjekt und Objekt letztlich nicht zu überbrücken ist, ersetzte er das Konzept des Subjekts – die Form des abstrakten menschlichen Selbstbewusstseins – durch den neuen Begriff vom Dasein, der das räumliche Handeln und damit den menschlichen Körper einschliesst. Deshalb steht das Dasein der Welt nicht mehr einfach gegenüber, sondern wird zu einem Teil genau jener Welt, die dann nicht mehr allein aus gleichsam voneinander isolierten Objekten, sondern aus «Zeug» in einem jeweils eigenen, lebenspraktisch relevanten Bewandtniszusammenhang besteht.
Auf dieser Grundlage führte Heidegger eine Unterscheidung zwischen zwei grundsätzlich verschiedenen Verhältnissen des Menschen zur Welt ein. Dem traditionellen Subjekt-Objekt-Schema entspricht die «Vorhandenheit» (der Mensch steht vor der Welt, als würde er nicht zu ihr gehören und bliebe ihr äusserlich). Wenn der Mensch sich aber als «Dasein» versteht (wichtig ist hier der räumliche Verweis durch die Partikel «Da-»), dann ist ihm die Welt «zuhanden», das heisst immer schon in allen praktischen Situationen des Alltags vertraut. Dieses Verhältnis der Zuhandenheit entfaltet Heidegger in Sein und Zeit als «Existenzialontologie» in allen denkbaren Dimensionen und Ebenen. Dabei wird deutlich, dass der Begriff der Zuhandenheit das Verhältnis der Ingenieure zur Welt einschliesst. Sie streben – im Gegensatz zu den Naturwissenschaftlern – nicht nach definitiven Wahrheiten, sondern nach Weltverhältnissen, die praktisch fruchtbar sind und funktionieren. Hier zeichnet sich also schon eine erste Nähe von Heideggers Philosophie zur Welt der Technik ab.
Zuhandenheit als grundlegendes Weltverhältnis des Daseins wurde dann in den 1930er-Jahren zum Ausgangspunkt von Heideggers Kritik an der newtonschen Naturwissenschaft, dargelegt durch seinen Vortrag und späteren Essay über das «Zeitalter des Weltbilds». Im gängigen Begriff des Weltbilds entdeckt Heidegger zu Recht das Subjekt-Objekt-Schema wieder, was ihn vermuten lässt, dass die modernen Naturwissenschaftler «vor der Welt» stehen. So haben sie die Möglichkeit, fährt Heidegger fort, zwischen sich (als Subjekten) und der Natur (als der Welt der Objekte) einen «Vorhang aus Mathematik» zu hängen, der uns – existenziell – von der Natur entfernt. In seiner während der frühen 1950er-Jahre zweimal gehaltenen Freiburger Vorlesung «Was heisst denken?» kommt Heidegger auf diese Kritik an der modernen Naturwissenschaft zurück, um deutlichere Konsequenzen aus existenzieller Perspektive zu ziehen. «Waltete nicht […] das Sein des Seienden, im Sinne des Anwesens und damit der Gegenständigkeit der gegenständlichen Bestände, dann würden die Flugzeugmotoren nicht nur nicht laufen, sie wären überhaupt nicht. Wäre das Sein des Seienden nicht als Anwesen des Anwesenden offenbar, dann hätte niemals die elektrische Atomenergie zum Vorschein kommen […] können.»5 Nicht in komplizierten Beschreibungen elementarer Phänomene, so ist hier unterstellt, zeigt sich das Sein in seiner Vielfalt, sondern – heute vor allem – im Funktionieren der Technik. Technik, folgt daraus, sollten wir nicht allein und vielleicht nicht einmal primär im Hinblick auf ihre Funktionen und Leistungen betrachten, sondern als einen existenziellen und epistemologischen Ort, wo sich die Entbergung des Seins ereignen kann.
Neben seiner erstaunlich fundierten Kritik der modernen Naturwissenschaft machen uns solche Beispiele deutlich, wie der im Alltag technophobe Heidegger philosophisch in eine Nähe zu Technik und Technologie rückte, die er selbst möglicherweise zeit seines Lebens nicht in allen Konsequenzen zu erfassen vermochte. Während des Jahrzehnts zwischen Sein und Zeit und seiner Reflexion über das «Zeitalter des Weltbilds» gelangte Heidegger aber vor allem zu der neuen, heute oft als «postmetaphysisch» eingeordneten Konzeption eines Geschehens von Wahrheit, die (nicht nur) in meiner Sicht die viel diskutierte «Kehre» in seiner philosophischen Arbeit markiert.6 Denn die mit Sein und Zeit vollzogene Option für die Zuhandenheit (und gegen die Vorhandenheit), das heisst: für eine schon immer bestehende praktische Vertrautheit mit der Welt, kann zu einer Situation der Pluralität von jeweils alltäglich eingespielten Wahrheitsverhältnissen führen – wie die später tatsächlich interpretatorisch vollzogenen Verbindungen zwischen dem frühen Heidegger und Positionen wie der Spätphilosophie Wittgensteins in den Philosophischen Untersuchungen (und dem Pluraletantum-Begriff der Sprachspiele), dem «Pragmatismus» Richard Rortys oder den sogenannten Konstruktivismen (mit ihrer Vielfalt «sozialer Konstruktionen von Wirklichkeit») belegen.
Erst einige Jahre später zeichnete sich dann bei Heidegger eine wirklich neue Konzeption der Wahrheit ab, die zu der berühmten Kehre seines Denkens in Gestalt eines ebenfalls neuen Begriffs vom Sein führte – ohne dass uns allerdings klar ist, warum sich Heideggers Denken in dieser Richtung bewegte. Ab Mitte der 1930er-Jahre konzentrierte er sich tatsächlich zunehmend auf die «Selbstentbergung des Seins» als «Wahrheitsereignis». Ganz entgegen unseren scheinbar «natürlichen» Intuitionen soll es gleichsam in der Initiative des Seins liegen (mit dem wohl das seit Kant aus der westlichen Philosophie verbannte «Ding an sich» zurückkommt), sich zu zeigen – und sich in dieser Selbstentbergung paradoxerweise zugleich verborgen zu halten. Die Entbergung vollzieht sich ausdrücklich nicht als Leistung des Daseins oder gar des Subjekts. Zwar besteht eine Schuld (oder Pflicht) des Daseins darin, wie ein Katalysator zu wirken, damit es zum Wahrheitsereignis kommen kann, doch jede aktive Bemühung des Daseins in dieser Hinsicht lässt das Wahrheitsereignis von Anfang an nur unwahrscheinlicher werden.
Es geht, meine ich, um das Sein als ein Wahrheitsereignis, das sich dem Dasein zeigt, und insofern hat das Wahrheitsereignis eine Teilaffinität zur (nicht nur christlichen) Offenbarung. Doch während wir mit dem Begriff der Offenbarung stets einen positiven Ereignisgewinn für die Menschen verbinden, kann die Selbstentbergung des Seins im Wahrheitsereignis die Menschen auch zerstören (Heideggers Texte schliessen zumindest die Möglichkeit nicht aus, eine Menschheitskatastrophe wie den 6. August 1945 in Hiroshima als «Selbstentbergung der Energie» zu deuten – obwohl sie auf der anderen Seite nie so weit gehen, dies explizit zu postulieren). Dennoch soll es das Geschick des Menschen sein, Wahrheitsereignisse geschehen zu lassen, und dies kann ihm allein in einer Einstellung von Zuhandenheit und zugleich Gelassenheit gelingen, die eine praktisch-zielorientierte Perspektive auf das, was sich entbirgt, zu vermeiden hat. Noch einmal anders – und in einem weiteren Kontext – formuliert: Der Mensch hat als Dasein seinen Beitrag zur Selbstentbergung des Seins zu leisten, ohne zu wissen, welcher Instanz er diesen Beitrag schuldet und ohne einen Bezug des garantierten intellektuellen oder praktischen Nutzens für ihn selbst. Dies trifft auch und gerade auf die Produkte der Technologie zu. Aus einer Perspektive der Zuhandenheit entstanden (anders als die Erkenntnisse der Naturwissenschaften), haben sie einerseits eine Affinität zur Selbstentbergung des Seins als Wahrheitsereignis. Andererseits können aus der Technik erwachsende Wahrheitsereignisse existenziell sowohl bedrohlich (Hiroshima) als auch positiv intensitätssteigernd sein. Am Ende erweist sich Heidegger entgegen zahlreichen zugespitzten Deutungen als weder technophob noch technophil. Doch seine Kritik am Dispositiv des «Gestells», das heisst an der Tendenz, sich entbergendes Sein in Potenzialität zu verwandeln (etwa: Energievorräte anzulegen statt Energie sich entfalten zu lassen), deutet an, dass ihn das Sein vor allem als verändernde, vom Menschen nicht zu kontrollierende Kraft faszinierte.
Zu Recht haben Heidegger-Kenner gerade während der vergangenen Jahre immer wieder betont, dass sich eine eindeutige, definitive und sozusagen verpflichtende Auslegung der Konzeption von der Selbstentbergung des Seins aus den uns überlieferten Texten nicht gewinnen lässt. Was ich hier in Grundzügen vorstelle, ist also – bewusst und für mich unvermeidlich – eine Heidegger-Lektüre, die in der Nähe des Silicon Valley entstanden ist und tatsächlich unter den Studenten dieser Welt Resonanz gefunden hat. Resonanz nicht notwendig und gewiss nicht ausschliesslich im Sinn ihrer Anwendung auf das Silicon Valley, aber doch durch das Auslösen von Fragen, die zu diesem Ort und seiner Technologie führen. Wenn wir uns von Heidegger ermutigt fühlen, Wahrheitsereignisse eher von der gegenwärtigen Technologie als von den Naturwissenschaften (oder gar den Geisteswissenschaften) zu erwarten, dann liegt auch die Frage auf der Hand, welches Sein sich den elektronischen Produkten und im Prozess des Programmierens am Ende entbergen könnte. Solange die Antworten vor allem praxisorientiert waren (etwa «das Internet lässt Menschen aus verschiedenen Regionen des Planeten näher zusammenrücken» oder «das Internet entfremdet sie wechselseitig»), unterboten sie in ihrer Anthropozentrik das philosophische Potenzial der Technik. Eher fühle ich mich von Heidegger ermutigt, mir das sich-entbergende Sein als eine Dimension vorzustellen, die die menschlichen Fähigkeiten seiner Verarbeitung stets überfordert. Deshalb sollte man als mögliche Antwort auf die Frage, welches Sein sich in der elektronischen Technologie verbergen könnte, gewiss den extremen Gedanken an «singularity» nicht ausschliessen, wonach – gemäss dem Technoeuphoriker Ray Kurzweil – die menschliche Intelligenz bloss eine Stufe des Übergangs für eine Maschinenintelligenz darstellt, die sich zuletzt gegen die Menschen wenden könnte.
Wie die laute Debatte zwischen Mark Zuckerberg und Elon Musk jüngst deutlich machte, zeigt sich kein grösseres Risiko am Zukunftshorizont unserer Gegenwart als jene laufend beschleunigte Weiterentwicklung künstlicher Intelligenz, die die beteiligten Programmierer selbst als eine Bewegung von unwiderstehlicher Energie beschreiben. Und vielleicht war es auch deshalb – rückblickend gesehen – kein Zufall, dass wir gerade an der Stanford University im unmittelbaren Windschatten dieser Bewegung einen Begriff vom riskanten Denken kultiviert haben, den wir als Berufung der Geisteswissenschaften (im amerikanischen Englisch: «humanities») begreifen. Riskantes Denken soll jenes wesentlich kontraintuitive Denken sein, das an der Universität, aber nicht innerhalb anderer Institutionen des Alltags entsteht, weil es ihre Stabilität infrage stellen und so in Gefahr bringen kann. «Riskantes Denken» vollzieht sich als Alternative zur Alltagsvernunft – und nutzt die als Elfenbeinturm geschätzte und gerade nicht verteufelte Universität für diese Bewegung, weil es davon ausgeht, dass der praktische Alltag ohne seine eigene instrumentale Vernunft nicht zu bestreiten ist.
Ohne riskantes Denken andererseits kann es nicht zur Veränderung von Institutionen und Systemen kommen, was mitunter erklärt, warum die – immer noch vergleichsweise zurückhaltend besetzten – Geisteswissenschaften in Stanford neuerdings und beinahe plötzlich für die offensichtlich besten College-Studenten der technologischen Studiengänge attraktiv geworden sind. Viele von ihnen entscheiden sich freiwillig für Philosophie oder Vergleichende Literaturwissenschaft als Nebenfächer. Über ihre Pflichtveranstaltungen für den Haupt- und Nebenstudiengang hinaus (etwa in CS und CompLit, um Insidersprache zu gebrauchen) arbeitet diese junge Elite auch kreativ in Dimensionen der künstlichen Intelligenz und gründet daneben Start-ups, für die Ausrichtungen auf den Markt oder ökologisch-politische Ziele oft entscheidend sind. Man kommt also tatsächlich auf vier Dimensionen bei der Analyse der intellektuellen Dynamik dieser erstaunlichen jungen Leute. Akademisch sind sie gleichsam interdisziplinär zwischen ihren ingenieurswissenschaftlichen (1) und geisteswissenschaftlichen (2) Schwerpunkten. Weitgehend unabhängig von ihren laufenden Studienverpflichtungen verfolgen sie aber auch die Entwicklung künstlicher Intelligenz (gleichsam als Leidenschaft) (3) und den Ausbau von Start-ups als Grundlage ihrer finanziellen Zukunft (4).
Solche Studenten vor allem wird man fragen, wie sich das Raum-Paradox des Silicon Valley erklären lässt, genauer formuliert: warum gerade jene Technologie, die den Raum als existenziell relevante Dimension eingeklammert, wenn nicht eliminiert hat, nun schon über Jahrzehnte an den engen Ort zwischen San José und San Francisco gebunden geblieben ist (obwohl die meisten ihrer Angestellten für Google oder Cisco auch in Tallinn oder Hyderabad arbeiten könnten – und dürften). Eine erste empirische Bestätigung des Sachverhalts bleibt in den Antworten nie aus: Ja, sagen die jungen Spezialisten, wir wissen, dass wir «hier» wirklich besser programmieren («Code schreiben») als in Chicago, Atlanta, Mumbai oder Berlin. Aber womit genau assoziieren sie den inspirierenden Einfluss des Orts? Vor allem offensichtlich mit der lokalspezifischen Prämisse, dass nichts unmöglich oder ausgeschlossen sei (diese Prämisse ist noch um einen Grad radikaler ist als jene andere, dass alles möglich sei – weil der Satz «nichts ist unmöglich» ja auch all das einschliesst, was man sich noch nicht vorgestellt hat). «Alles ist möglich» bezieht sich vor allem auf das Wirklichwerden utopischer Visionen, die schon lange unsere Träume erfüllt haben, zum Beispiel die Erlösung der Menschen von ihrer Verpflichtung zur Arbeit. «Nichts ist unmöglich» hingegen schliesst darüber hinaus Szenarien ein, die unsere je gegenwärtige Vision überschiessen. Wirksam für die konkrete Arbeit, berichten die Protagonisten des Silicon Valley, wird diese Voraussetzung aber nicht als übergreifendes Vorzeichen der gesamten Gemeinschaft, sondern immer nur in kleinen Gruppen von ungefähr fünf bis zehn Personen, die täglich zusammenarbeiten, von Schritt zu Schritt dieser Arbeit keine Erfolgs- oder Fortschrittsmöglichkeit ausschliessen – und darin ermutigend, ja tatsächlich ansteckend für andere Gruppen sind.