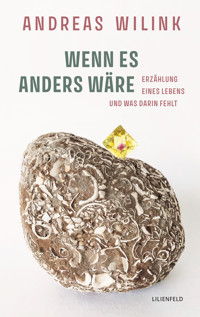
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Lilienfeld Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Das komplexe Verhältnis zu einem jüngeren Mann wird zum Anlass einer bis in die Kindheit zurückreichenden Selbstbefragung. Ein weites Panorama an Begegnungen und Freundschaften öffnet den Blick auf die unabänderlich wiederkehrenden Lebensmuster. Was fehlt hier? Und warum? Ein Selbstbild aus Begegnungen, Beziehungen und Bezügen: In den Höhen und Tiefen einer intensiven Freundschaft und Liebe zu einem jüngeren Künstler verdichtet Andreas Wilink die eigenen Charakterprägungen. Die Frage nach dem Woher und Warum führt zurück zu den Familienverhältnissen, die seinem Gefühlsleben für immer die Richtung gaben, zu all den sich nie ganz erfüllenden Lieben und zu Freundschaften, in denen sich das Eigene immer gespiegelt hat – von der Schulzeit bis in die Jahre seiner Arbeit als Journalist, die ihn sehr nah an berühmte Menschen und deren Schicksale brachte. Das Ergebnis ist eine sprachlich feinnervige und sehr persönlich erzählte Lebens- und Mentalitätsgeschichte vor dem Hintergrund der deutschen und internationalen Kulturwelt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 325
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ANDREAS WILINK
WENN ES ANDERS WÄRE
Erzählung eines Lebens und was darin fehlt
lilienfeldverlag
INHALT
PROLOG
NACHT DES KINDES
DIE ZWEITE HAUT
DER TÄNZER
DER ERSTE SCHRITT
DIE AUFLEHNUNG
DAZWISCHEN
FEUER UND FLAMME
FATUM
DIE BEFÜLLUNG
VIER FREUNDE
FRAU WELT
HOLY HOLY
DIE ERKALTUNG
DIE BILDER ALLE
TAG DES MANNES
SPIEGELBILD IM BRAUN-GELBEN AUGE
VATER-LOS I
VATER-LOS II
AN KREUZWEGEN
TRISTAN
BANG BANG
INSULANER
LÖWE-ZEIT
DIE UNTERLASSUNG
IN DEN STERNEN
I
II
III
IM LAND VON BRUDER MARTIN
GEHÄUTET
LAMENTO
DIE ZEREMONIE
DAS DURCHDREHEN DER SCHRAUBE
DIE VERBLENDUNG
UNTER BRÜDERN
EPILOG
Wenn ein Mensch dahin ist, nimmt erein Geheimnis mit sich: wie es ihm, gerade ihm – im geistigen Sinn zu leben möglich gewesen sei.
Hugo von Hofmannsthal, Buch der Freunde
Es ist komisch, aber ich kann eigentlichvon vielem in meinem Leben sagen, »beinah«.
Theodor Fontane, Effi Briest
PROLOG
Manchmal, wenn ich auf der Bühne, im Restaurant, im Vorübergehen einen dir ähnlichen jungen Mann sehe, mit einem wirbelnden Haarschopf, wie du ihn hast, oder mit einer mich an dich erinnernden Statur oder Silhouette, die mir ins Fleisch schneidet wie eine scharfe Kante von dünnem Papier, empfinde ich Beunruhigung, ja, auch Genugtuung, und schäme mich gleichzeitig dafür, ihn mit dir in Vergleich zu setzen und deine und seine Begabung, Emphase, Grazie, Aussehen, Persönlichkeit gegeneinander abzugleichen. Als würde der Vorrang, den du hast, durch den Maßstab, den ich anwende, verringert. Als könnte dein Herausgehobensein gekappt werden. Blödsinniger Befreiungsversuch. Gefangenschaft und Sehnsucht, gehören die denn, passen die denn zusammen?
NACHT DES KINDES
Lange Zeit schlafe ich bei meinem Großvater. Mein Bett ist eine Couch in einer Nische seines Wohn- und Arbeitszimmers. Diese smaragdgrüne Liege, in deren festen Stoff ein Rankenmuster lanzettförmiger Blätter eingewebt ist, bleibt tagsüber für meine Stofftiere reserviert. Sie grasen ohne zu fressen auf einer Wiese, die weder blüht noch welkt. Die Schiebetüren verbinden den großen Raum mit seinem Schlafzimmer, in dem auch die Hälfte des Ehebetts frisch bezogen wird, die seiner schon seit zwei Jahrzehnten nicht mehr lebenden Frau gehört hat. Das Pendant dazu ist die Familiengruft, deren unbelegte Hälfte darauf wartet, dass der Erde neue Nahrung zugeführt wird. Dunkle schwere Eichenmöbel umstellen das Bett. Ich lecke gern an dem matten Holz, es hat einen mir angenehm bitter-herben Geschmack. Oft, wenn ich aufwache und mich fürchte, husche ich, nachdem ich ganz leise einen Spalt der Schiebetür aufziehe, hinüber und schlüpfe auf der freien rechten Seite des Bettes unter die Decke. Im Winter ist es schöner, weil die wohlige Wärme belohnt für die Kälte unterwegs, weshalb ich den Gang Sekunde um Sekunde hinauszögere. Ab einem gewissen Zeitpunkt, ich weiß nicht mehr, wann und weshalb, ändert mein nächtliches Wandern sein Ziel, obwohl der Weg dorthin weiter, kälter und beängstigender ist. Ich verlasse beklommen, weil ich annehme, dass Opa es mir verargen und als Untreue betrachten würde, das Zimmer, durchquere, ohne Licht einzuschalten, den Flur, nehme schnell und stolpernd die nach einem Absatz eine Biegung machende Treppe hinauf zur ersten Etage, laufe ins Schlafzimmer meiner Eltern und lege mich zwischen sie. Als ich eingeschult werde, bekomme ich mein eigenes Zimmer.
Das ziegelrote kastenförmige Haus mit Walmdach steht im »Weder noch«. Das Dorf ist keins mehr, obwohl es noch Gehöfte, Weizen-, Roggen- und Maisfelder und Kuhweiden gibt, die von zwei Seiten an die Hecke unseres Grundstücks reichen. Die Allee – alle Kastanienbäume sind gefällt – wurde zur breiten, vielbefahrenen Straße ausgebaut, die die Verbindung zur nahe gelegenen niederländischen Grenze herstellt. Der ländliche Charakter ist gewichen, seit Neubauten, Ein- und Mehrfamilienhäuser, Lücken besetzen, sich vereinzelt Gewerbe breit macht und ein Supermarkt eröffnet hat, der die Stelle des Lebensmittelgeschäfts übernahm, in das ich vorher oft noch kurz vor Ladenschluss hinübergelaufen bin, weil irgendeine Zutat in der Küche gefehlt hat. Aber Stadt oder Vorstadt ist hier auch nicht. Ein Zwischenzustand. Die alte Gaststätte schräg gegenüber, in der Großvater nach dem sonntäglichen Kirchgang einen Schnaps trinkt, der Laden mit Haushaltswaren, in dem die Bauern die Ausstattung zur Ehegründung kaufen, die ehemalige Schule mit dem Kanonenofen, in der ich die erste und die zweite Klasse besuche, bevor wir in die neu erbaute wechseln, haben ihre Funktion ganz oder weitgehend verloren. An dem grasgenarbten Platz, der unseren umzäunten Vorgarten von der Straße trennt, hält der sogenannte »Holländerbus«, der die Strecke von drei Kilometern bis in die Bocholter Innenstadt befährt und den ich während der neun Jahre auf dem Gymnasium benutzen werde, wenn ich nicht mein Fahrrad nehme.
Der Dumme des Dorfes, harmlos und freundlich, heißt Bernhard. Er trägt eine abgenutzte Drillichjacke, zu weite Hosen, Schiebermütze und Holzschuhe. Großvater spricht mit ihm Plattdeutsch und erteilt ihm den Auftrag, er solle »uppassen«, während das Kind im Laufstall auf dem Rasen unter dem Kirschbaum spielt. Bernhard harrt stundenlang aus und bewacht mich, getreu und nicht anders als unser Hund Bobbie. Wehe, ein Fremder oder auch nur der Postbote kommt uns zu nahe. Bernhard kann wütend werden und mit einem seiner Holzschuhe nach dem Störenfried werfen. Einmal, als ich mir so viele Kirschkerne derart hoch in die Nase schiebe, dass sie feststecken, schreit er das Haus zusammen, und ich werde eilig ins Krankenhaus gebracht, wo man sie herausholt. Bernhard bekommt von Opa eine neue Joppe.
Das Erdgeschoss bewohnen Großvater mit einem separaten Wohn- und Schlafzimmer, meine Eltern und ich. Die geräumige Küche, den Wintergarten, das Bad benutzen wir gemeinsam. Im ersten Stock, in dem Margret, eine der drei älteren Schwestern meiner Mutter, mit ihrem Mann und Sohn lebt, liegt außerhalb ihrer abgeschlossenen Etage noch das Schlafzimmer meiner Eltern. An der Treppe, die weiter zum ausgebauten Dachboden führt, schließlich auch mein Zimmer, ebenfalls in einem »Weder noch«. Das Haus, 1930 von Großvater, dem Bezirksschornsteinfegermeister, für seine Familie mit sieben Kindern und für die Handwerkslehrlinge mit Kost und Logis geplant, ist für drei Parteien, trotz des vielen Platzes und des ausgebauten Dachs, nicht besonders gut geeignet. Der nach vorn hinaus gelegene Wintergarten mit den breiten und tiefen steinernen Blumenbänken, in denen die Pflanzen im Mutterboden wie in Beeten wachsen, ist der bevorzugte Aufenthalt. Die Küche mit eigenem Essbereich blickt in den rückwärtig gelegenen Garten, über den als Nebenkriegsschauplatz Streit entbrennt, wer ihn wie anlegt und pflegt. Auf der Eichenbank an der Küchenfensterfront sitze ich, um meine Schularbeiten zu machen: agricola, agricolae, agricolae, agricolam.
»Peiatz«, so sagt Großvater zu mir. Ein Kosename, in dem etwas von Eiapopeia wie auch von Frechdachs mitklingt. Das vollwangige Gesicht unter dem kurz gehaltenen dünnen weißen Haar und mit dem schmalen weißen, überhaupt nicht borstigen, sondern feinhaarigen Oberlippenbärtchen über dem mit harter Linie gezogenen Mund erhält durch die großen, braunen, in feuchter Wärme schwimmenden Augen den begütigenden Ausgleich zu seiner Strenge. Meine Mutter und ich haben die gleichen Augen. Die vier Töchter hängen zärtlich an ihm. Die beiden Söhne stehen zu ihm in achtungsvoller Haltung, die sich, als sie junge Männer geworden sind, zum Sicherheitsabstand vergrößert hat. Es gilt preußisch-protestantischer Gehorsam. Die Gesellen des Handwerkerbetriebs hatten vor den zwei Söhnen rangiert, erst recht vor dem jüngeren, dem Gymnasiasten, während der ältere in den gleichen Beruf eingetreten ist. Das »Herr Vater« war keine Floskel. Die mir, dem Enkel, geschenkte, allein mir geltende Zuneigung, obwohl es noch sieben weitere Enkelkinder gibt, kennen die Söhne von ihm nicht.
Großvater lässt mich zusehen, wenn er einen Apfel schält, wobei sich die Schale in einer langen gleichmäßigen Schlange aufs Zeitungspapier ringelt und er dann die Kerne aus dem Gekröse pult, um sie zu sammeln und im Winter als Vogelfutter zu verwenden. Er lässt mich unter seinem eckigen Esstisch, der mit sechs ledergepolsterten Stühlen und einer wuchtigen Kredenz einen Gutteil des Wohnzimmers füllt, zwischen den Beinen mit den überkreuz stehenden Streben spielen und die hölzerne Ritterburg und ledernen Indianertipis aufbauen, sogar während seines Mittagsschlafs im Sessel, wenn es still zu sein hat im Haus. Er fährt mit mir in seinem Wagen in die Stadt, nachdem er ihn umständlich rückwärts aus der Garage gelenkt hat. Er nimmt mich bei der Hand, wenn wir durch den Garten gehen oder entlang der Felder spazieren, die unser Haus umgeben. Dann hat er seine Baskenmütze aufgesetzt; die flauschige Hausjacke ersetzt ein durchgeknöpfter altmodischer Gehrock. Manchmal, wenn wir uns auf den Weg machen, blicke ich hoch und sehe meinen zweieinhalb Jahre älteren Cousin, den einzigen Sohn von Tante Margret, am Fenster stehen und zu uns herunterschauen. Ich begreife nicht, weshalb er in seinem Verhalten mir gegenüber feindselig, schroff und ruppig ist. Die Mahlzeiten nimmt Großvater nicht mit meinen Eltern und mir gemeinsam in der Küche ein. Meine Mutter serviert sie ihm, pünktlich nach der Uhr, in seinem Wohnzimmer. Oft verlasse ich den Tisch nach der Hauptspeise und esse bei ihm das Dessert, Quark oder Pudding mit Kompott, während im Radio ein Mittagskonzert spielt. Allein sitzt er bei sich und horcht auf die Geräusche, die seiner Hausordnung zuwiderlaufen könnten. Sogar zum sonntäglichen Gottesdienst fährt er unabhängig von uns mit dem Auto.
DIE ZWEITE HAUT
Mein Vater holt mich vor der Zeit aus dem Landschulheim ab, in dem meine Klasse während des ersten Schuljahrs am Gymnasium für eine Woche einquartiert ist. Ich bin froh, fortzudürfen. Das Wetter ist schlecht, das auf Plastikgeschirr verabreichte Essen miserabel – morgens dünner Kakao aus Blechkannen, an deren Tüllen faltige Milchhäutchen kleben, Graubrot, übersüße Erdbeermarmelade, Aufschnitt, mittags Eintopf oder Stampfkartoffeln mit Bratensoße und »Leipziger Allerlei« (Erbsen und Möhren aus der Dose), abends kalte Grießschnitten, teigig dicke Pfannkuchen oder Butterbrot. Die Räume sind mäßig geheizt, Handtücher und Bettzeug klamm, die Nächte in doppelstöckigen Betten im Viererzimmer und das Gemeinschaftsbad vor den langen trogartigen Waschrinnen mit hoch darüber angebrachten Kränen, die ihr Wasser pladdernd ins Becken spritzen, für mich ungewohnt. Tagsüber trotten wir mürrisch von unserer auf einer Anhöhe gelegenen Burg hinunter ins Dorf Nütterden und weiter in das niederrheinische Feuchtgebiet mit seinem störrischen Reichswald. Unser Latein- und Klassenlehrer Schulze-Schwering lässt uns singen »Als die Römer frech geworden, simserim simsim simsim«, ohne dass wir Sextaner für das einstige Kampf- und Marschlied des aufkeimenden deutschen Nationalbewusstseins Sinn und Verstand gehabt hätten. Für Caesars De bello Gallico sind wir noch zu jung. Kleines Latinum. Der Lateinunterricht begleitet uns während der neun Jahre von Sexta bis Oberprima auf dem humanistischen Gymnasium, dessen Direktor Heinrich Weber, selbst Altphilologe, sich von unserer Klasse in der Obertertia erstmals abringen lässt, wählen zu dürfen zwischen Griechisch und Französisch. Ich gehöre zu den Franzosen, als der Präzedenzfall beschlossen ist – den Französischunterricht erteilt Weber selbst.
Großvater, der schon bettlägerig gewesen ist, bevor ich abgereist bin, geht es zunehmend schlecht, er möchte mich in seiner Nähe haben. Als er mich sieht, sagt er nur: »Der Peiatz.« Das am Brusteinsatz gefältelte weiße Nachthemd hat einen winzigen roten Fleck. Auf dem Fußboden neben dem großen Doppelbett steht eine flache weiße Emailschüssel, deren Inhalt am Bodengrund ich lieber nicht genau ansehe.
Seine zwei nicht im Elternhaus gebliebenen, ins Rheinland und in den Oberharz gezogenen, dort kinderlos verheirateten Töchter sind seit mehreren Wochen bei uns. Sie, Emma und Berta, sowie meine Mutter und die vierte Schwester Margret wechseln sich in der Pflege und in den Nachtdiensten für Großvater ab und organisieren gemeinsam, nicht frei von Rivalität, den Haushalt. Vorausplanend haben sie schwarze Kostüme gekauft oder die vorhandenen umarbeiten lassen von der Schneiderin meiner Mutter, die Frau Sauerbrei heißt, was mich derart erheitert, dass ich es darauf anlege, häufig die Sprache auf sie zu bringen: Wollte Frau Sauerbrei nicht schon längst die fertigen Kostüme vorbeigebracht haben? Die Schwestern kaufen sich meistens ähnliche Kleidungsstücke – Sommerkleid, Übergangsmantel, Rock und Bluse oder eine Krokohandtasche, die sich nur in Farbe, Schnitt oder weiteren kleineren Details unterscheiden. Während das schwarze Kostüm meiner Mutter mit einem Ozelotkragen abschließt, zeigt das von Tante Margret Silberfuchs am Revers sowie als Stulpen am Ärmel, die anderen haben schwarzen Persianer- und braunen Nerzbesatz.
Auch die Pelzmäntel gleichen einander. Sie dienen nicht nur gegen Winterkälte, sondern stellen gediegen gutbürgerliche Verhältnisse aus. Josef Telake, Kürschner, Geschäftsmann und Stammtischbruder eines meiner Onkel, hat die kurze, flinke Gestalt und die verkniffen schlaue, taxierende Miene, gesteigert durch den nervösen Tic, das linke Auge fest zuzukneifen, des Laurel-and-Hardy-Widersachers James Finlayson. Im schummrigen Halbdunkel seines Ateliers, aus dessen rückwärtig gelegener Werkstatt der Geruch gegerbten Leders, das stumpf gewordene, strenge Tieraroma der Felle, der Stechreiz chemischer Lösungsmittel und der stoffliche Duft von Futterseide, Loden und Wolle austreten, trägt »Jupp« immer einen weißen Kittel wie ein westfälischer Hubert de Givenchy. Im Frühjahr nimmt er die Pelze der Damen an sich und hängt sie bis zum Herbst in Jutesäcken in eine klimatisierte Kammer. Alle paar Jahre wird das gute Stück auseinandergenommen und, gemäß modischer Direktiven, geändert, verlängert oder gekürzt, glockig geweitet, gerade oder eng auf Taille geschnitten, werden talergroße Knöpfe doppelreihig angenäht oder wird eine verdeckte Knopfleiste angebracht, hinter der sich Metallzähnchen ineinander verbeißen. Ich liebe es, am Mantel meiner Mutter diese Häkchen zu schließen und dabei das lockige Vlies an den Fingern zu spüren. Seit ich Gustav Schwabs Sagen des klassischen Altertums lese, weiß ich, dass ein Vlies das abgezogene Fell eines Widder- oder Stiergottes ist. In späteren Jahren denke ich darüber nach, dass und weshalb in den Büchern Mose des Alten Testaments das strotzend virile, mächtig drohende Tieridol zum Goldenen Kalb verkleinert wurde. Die christliche Lehre hat das Triebgeschehen des johlend geilen Volkes am Berg Sinai infantilisiert und enterotisiert.
Eines Nachts, die Nacht, in der Großvater stirbt, höre ich die Unruhe im Haus – Stimmen, Bewegung, Schritte auf der Treppe, Türen, die zufallen, das Motorgeräusch eines abfahrenden Wagens und die Ankunft mehrerer Autos. Das Licht zieht einen geraden Strich unter der Türritze. Niemand kommt. Ich werde nicht geholt. Bleibe allein. Schlaflos. Lauschend. Können die Erwachsenen geglaubt haben, das Kind würde von all dem nichts bemerken?
Die Eltern beziehen Großvaters Schlafzimmer mit ihrem Mobiliar aus rötlich-gelbem Kirschholz. Großvaters schwarzes Ebenholzkreuz über dem Ehebett bleibt hängen. Ihr oben gelegenes Zimmer wird mit meinem zu einem einzigen größeren verbunden. In manchen Nächten nehme ich nun den umgekehrten Weg, von oben nach unten.
DER TÄNZER
Am Abend meines Geburtstags schenkt mir Anders eine Fotografie von sich. Sie zeigt ihn in der Maske der griechischen Göttin Hekate. Ihr mythischer Steckbrief weist ihr Zuständigkeit für die Unterwelt, für Schwellenübergänge, Wandel und Wechsel zu. Das Bild zu betrachten, ist für mich wie eine Meditationsübung: Anders' Blick aus den Augenwinkeln; der Fleck auf der Wange, gekerbt wie in porösen Stein; die scharf hervorspringende, halb verschattete Nase, die ein dunkles Dreieck bildet; gepresste Lippen; das Kinn, das sich in eine Schattenlinie verlängert, als säße dort ein Hebelmechanismus, der das Sprechwerkzeug blockiert, manipuliert und bewegt; die Krallenhand, aus der hervor sich eine Schlange ringelt; schließlich das Kleid, gepanzert zur Rüstung, und die sich aufbauende Körperdiagonale, die als Trennlinie das Bildrechteck durchschneidet. All das signalisiert: Gefahr durch den Gefährdeten, Drohung und Bitte, Skepsis und Abschätzen, ein »Komm mir nicht zu nahe« und »Du ahnst nicht, worauf du dich einlässt«, Lockung und I lock my door upon myself, Versprechen und Verbot, das versagte Glück und die Gnade des Vorenthaltens. Das Wagnis, sich auf einen Menschen einzulassen.
Wenn Anders tanzt, beinahe auf dem Fleck, sind die Füße leicht nach außen gedreht und verschleifen am Boden. Wenn er beschleunigt, kommen die Schultern ins Spiel. Sie beginnen zu rotieren und steigern ihr Kreisen, als wären es Treibstangen einer Lok, bis der Kopf im Takt nickt und der ganze Mensch, beharrlich konzentriert, wippt und pulsiert. Trotzdem scheint in ihm der Leichtsinn aufgehoben. Die beseelte Maschine, geborgen in sich, glücklich allein aus sich und mit sich.
Einmal noch dies können. Oder vielmehr: es sein. Wie ist es gewesen? Heißt es nicht, Schmerzen legen ihre Lernspur? Verbindet sich nicht noch nach Jahrzehnten ein Aroma mit einer bestimmten Erinnerung? Als ich vor einiger Zeit die Cafeteria in Buchenwald betrat, war im selben Moment der Geruch von Landschulheim da, unerklärlich, aus welchen Molekülen zusammengesetzt und wo abgespeichert in mir. Anders meint, das Reinigungsmittel könnte es gewesen sein. Ich glaube das nicht.
Einmal noch mit der Hand ins eigene Haar greifen, es in seiner Fülle kaum zu fassen kriegen und es dann Luftstrom und Wind überlassen, bis es zurückfällt in einen Wirbel. Vorbei. Die Geste hat sich selbst vergessen. Ich greife, aber unwillkürlich verändert die Hand ihre Form, spreizt nicht die Finger, die die Strähnen bauschen und lockern würden, sondern wird zur Fläche, duckt sich wie der Rücken eines erschrockenen Tiers auf dem Feld, wölbt sich zum Schutz und fasst die Stirn, als würde sie Stütze und Halt brauchen vom Ermüden durch Gedanken. Bewegung und Gegenbewegung.
Auf meinen Schreibtisch stelle ich die Fotografie eines Kindes. Ein Porträt. Der Junge von etwa fünf Jahren trägt einen eckig ausgeschnittenen schwarzen Strickpullover über den sich, mit einem geschlossenen Knopf, der Kragen des weißen Hemdes legt wie eine Callablüte. Nur das linke Ohr ist sichtbar, das Haar nahezu gerade geschnitten, es lässt einen Teil der Stirn frei. Die großen Augen unter den fein gezeichneten hellen Brauen blicken nicht in die Kamera, sie fixieren nichts, sondern richten sich nach innen. Die Wangen sind noch rund und weich, der Mund mit den geschlossenen Lippen ist im Verhältnis zum Übrigen des Gesichts eher klein und wie von vorausschauender Traurigkeit zusammengezogen. Das Kind war ich. Bin ich es noch? Auge in Auge mit ihm – mit mir – suche ich in der Miene etwas vom Fühlen und Ahnen zu gewärtigen, das das Damals ans Heute bindet, das Heute aus dem Damals erklärt.
DER ERSTE SCHRITT
Liegt in der Haltung der langsam sich nähernden Person nicht etwas Verstörendes für den, der diese Ruhe und Gelassenheit in sich nicht findet? Mir versetzt sie einen Stich. Ich fühle mich ausgeschlossen von dem sich darbietenden intimen Zwiegespräch mit sich selbst. Ja, es hat für mich etwas von einer Darbietung, auch wenn die Behauptung zu stark wäre, Absicht zu unterstellen und bewusst herbeigeführte Wirkung. Das würde nämlich den Eindruck unbedingt schmälern und beschädigen. Der Vorgang ist komplizierter und besteht in einer subtileren Korrespondenz und Komplizenschaft zwischen Wille und unwillkürlichem Verhalten.
Dass er erwartet wird, spürt Anders vielleicht an dem Blick auf sich, wie der sein Bild scannt und das Porträt der eigenen Galerie hinzufügt, nur weiß Anders natürlich nicht, kann nicht einschätzen, wie sein Abbild dort betrachtet wird oder mit wem es sich Wertschätzung zu teilen hat. Er geht nicht langsam, nicht schnell, flaniert oder schlendert nicht, er geht als jemand, der vollauf mit sich beschäftigt und von sich ausgefüllt ist und seine Schritte der Bewegung, die in ihm selbst das Maß vorgibt, anpasst.
Für mich ist es schwer auszuhalten, und ich frage mich, wie jemand beschaffen sein muss, um der Unabhängigkeit, die ich geradezu körperlich wahrnehme, zu begegnen und ihr standzuhalten.
Wenn ich zurückschaue, scheint es ebenso befremdlich und unheimlich wie doch auch anders nicht vorstellbar, mein Leben mit mir allein verbracht zu haben. Was hat dazu geführt, was davon ist angelegt und vorgebildet und an welcher Stelle der Biografie ist die Hemmnis, Abkehr oder Verweigerung von mir selbst verursacht worden? Die Wahrheit ist, dass niemand um meine Hand angehalten hat, ich denke es tatsächlich mit dieser Formel. Nüchtern betrachtet: dass niemand liebend sein Leben mit mir verbringen wollte. Ist das die Wahrheit oder ist es meine Wahrheit, die vor einer objektiven Instanz nicht Bestand haben würde?
Ich kann die Anteile von Neid, Eifersucht und Bewunderung nicht voneinander lösen, die in mir wirken. Spüre auch, dass ich kaum unterscheide zwischen Anders, der diese Anmutung für mich besitzt, und möglichen mir unbekannten Dritten und Vierten, die in meiner Vorstellung selbstbewusst und souverän genug sind, keinen Mangel bei sich selbst zu empfinden, sich nicht in Vergleich zu ihm zu setzen.
Allein, stelle ich mir vor, wie sie das Wort »vögeln« benutzen – »Lass uns vögeln« oder so ähnlich. Habe ich nie getan, es nie über die Lippen gebracht. Ich würde mich vor mir selbst schämen, mich erwischt und überführt fühlen, als hätte ich mir etwas herausgenommen, das mir nicht zusteht. Das passt sich nicht, heißt es im Jiddischen.
Gibt es das überhaupt oder begegnen sich nicht günstigenfalls zwei Mängelwesen, deren jeweils Fehlendes im Gegenüber auf entsprechende Fülle trifft? So wie ein Stift in eine Vertiefung, ein Schlüssel in ein Schlüsselloch passt und die Öffnung ermöglicht. Das alles, dieses Gedankengebäude mit seinen Winkeln, Dunkelkammern und Lichtinseln, errichtet sich in Sekundenschnelle – in dem Augenblick seiner allmählichen Annäherung.
Wir sind verabredet, »auf einen Kaffee«, das heißt, auf ein limitiertes Treffen. Aber das stimmt nicht ganz. Denn es könnte passieren, dass sich das Miteinander ausdehnt. Es ist nicht vorherzusehen, nicht planbar.
DIE AUFLEHNUNG
Dass ich komfortabel lebe, ist auch dem Patenonkel Kasimir bzw. Kazimierz (die Familie mütterlicherseits besaß polnische Wurzeln) zu danken. Geboren und aufgewachsen im westpreußischen Marienwerder an der Weichsel mit seiner Ordensburg und dem St.-Johannes-Dom, das nach dem Zweiten Weltkrieg an Polen fiel oder zurückfiel, hatte ihn mein Vater, der im etwa 200 Kilometer entfernten pommerschen Stolp groß geworden ist, bei Besuchen des Großelternhauses als Kind oft gesehen. Ihn, den jüngsten Bruder seiner Mutter, also meiner Großmutter – ein Nachkömmling. Nach einigen Stationen in der Nachkriegszeit ist er in Aschaffenburg am Main sesshaft geworden und hat in der Nähe des Pompejanums, des Nachbaus einer antiken römischen Villa oberhalb des angrenzenden städtischen Weinbergs, einen Spirituosengroßhandel eröffnet.
Er kleidet sich mit altmodisch dezenter Eleganz, sobald er seinen grauen Kittel, in dem er zu Hause und bei der Arbeit herumläuft, ablegt, um sich etwa zu seinem täglichen Spaziergang im Park aufzumachen und im Anschluss im Café, das er auch beliefert und in dem er als Stammgast seinen reservierten Tisch hat, ein Kännchen Kaffee und ein Stück Butterkuchen zu sich zu nehmen. Meine Eltern und ich begleiten ihn, wenn wir während der Sommermonate bei ihm zu Besuch sind. In den entweder grau gemusterten oder blau gestreiften Jacketts seiner sorgfältig gepflegten Anzüge rückt er ständig die Schultern zurecht, fingert wiederholt am Krawattenknoten oder fühlt mit der rechten Hand am kleinen Finger der linken nach seinem Ring, um dessen Herkunft und Wert er ein Geheimnis macht. Es ist ein schwerer und breiter goldener Reif mit einem einkarätigen Diamanten zwischen zwei oval geschliffenen Saphiren. Alleinstehende Damen, die an benachbarten Tischen sitzen oder Platz nehmen, begrüßt er, indem er sich leicht von seinem Sitz erhebt und steif verbeugt, beide Hände auf die gedeckte Tischplatte gestützt, wobei er darauf achtgibt, dass der Ring gut sichtbar ist. Er berichtet gern, diese und jene Dame habe ihm schöne Augen gemacht und verfüge über nicht geringe Besitztümer. Es wird nie etwas daraus.
In diesen Wochen unternimmt er mit uns sogenannte Spritztouren zu Weinkellereien und Winzergasthöfen mit Übernachtung. Nach Alzenau und in den Spessart, nach Ingelheim oder nach Iphofen und bis Würzburg. Er hält uns dann die Autotüren auf und spielt mit wie eingefrorener Miene den Domestiken: »Johann steht zu Diensten.« Dafür erwartet er, von meinem Vater zum Essen eingeladen und überhaupt unterwegs ausgehalten zu werden, da er ja schon seinen Teil beigetragen hat.
Misstrauisch gegenüber der Beständigkeit eines jeden Staatswesens, gegen Behörden und Mitmenschen, belässt er es beim Einmannbetrieb. Er ist Einkäufer und Verkoster, Lagerist, Auslieferer, Vertreter und Kundenbetreuer, Buchhalter und einmal im Jahr Armesünder, wenn er dem Finanzamt seine mageren Einkünfte gegen die hohen Kosten vorrechnet, glaubhaft insofern, als er in einem behelfsmäßig bescheidenen Gebäude wohnt mit vorgelagertem Hof, von dem, verborgen durch Gesträuch, eine Art Bunker in einen Lagerraum für Leergut, Fässer und sperriges Gut führt. Das schmale, weiß getünchte Haus verfügt im Erdgeschoss nur über zwei kleine, vollgestellte Büros und eine nach Benzin und Öl riechende Garage für den flaschengrünen Ford Taunus samt Anhänger. Von ihr aus gelangt man in einen allerdings gewaltigen, modrige Kälte ausdünstenden Keller, in dem die Mosel-Saar-Ruwer-, Franken- und Rheinweine und Spirituosen lagern. In der ersten Etage unter dem Flachdach befinden sich ein rosa gefliestes Bad, das entlang der Vorderfront sich hinziehende Wohnzimmer mit Durchgang zu einer winzigen Küche und ein rückwärtig gelegenes Schlafzimmer, in dem über der üppig breiten, diwanartigen Lagerstatt ein von ihm auf einer Nachlassversteigerung erworbenes enormes Ölgemälde hängt, das den Raum schrumpfen lässt: Der Reigen seliger Geister nach Glucks Orfeo ed Euridice aus dem späten 19. Jahrhundert. Dies ist die ganze Herrlichkeit.
Lange Zeit vor seinem Tod, der ihn 1981 mit 72 Jahren nach einem Schlaganfall in seinem Kontor trifft, wo der Postbote den leblosen Körper findet, hat Onkel Kasimir seinem Neffen und Großneffen, also meinem Vater und mir, mündlich – nur ja nichts Schriftliches! – eingebläut und uns danach bei jeder sich bietenden Gelegenheit abgefragt, wo von ihm welches Bargeld in mehreren Währungen (kanadische Dollar erscheinen ihm am sichersten, Uncle Sam traut er nicht) und das Gold in verschiedenen Grammgewichten verteilt und untergebracht worden sei.
Auf einer dieser halb Geschäftsreisen, halb Vergnügungsfahrten hat er meine frisch vermählte Mutter fotografiert.
Sie ist etwa 30 Jahre alt. Kasimir hat meine beiden damals verliebten Eltern aufgenommen, aber jeden für sich. Seltsamerweise ist in dem Album kein Paarbild zu finden. Meine Mutter, das dunkle Haar kraus, das Lächeln strahlend, die Haltung gelöst, sitzt auf einem Baumstumpf auf einer Weide inmitten einer Schafherde. Sie hat ihren weiten Rock ausgebreitet, eines der Tiere den Kopf in ihren Schoß gebettet. Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld. Auf zwei weiteren Fotos steht mein Vater gegen denselben Baumstumpf gelehnt. Er schaut, als würde er der Kamera nicht trauen und deren durchdringendes Auge fürchten. Die bukolische Szene und die Glückseligkeit auf dem Gesicht meiner Mutter zeigen etwas, das zu meiner Erfahrung mit den Eltern nicht gehört. Das Unbehagen und der Argwohn im Gesicht meines Vaters schon. Die Zukunft, die Zuversicht, aller Treu und Glaube, so pervertiert sie auch gewesen sind, selbst das Recht auf Irrtum – alles verwirkt angesichts der Größe des Grauens, deren mitausführender Teil er als Luftwaffenoffizier und Kampfpilot gewesen war; seine Uniform bewahrt er in einem Schrank auf dem Dachboden auf. Und kein Fundament da, das hätte standhalten können, sei es das bürgerlich konservative, das christliche oder das schlicht bäuerliche der Vorfahren. Ihm war der Grund verlorengegangen.
Nachdem er in die Familie meiner Mutter, wie man sagt, »hineingeheiratet« hat, fängt er in der Zentrale eines großen Unternehmens für Getriebe als technischer Angestellter an und arbeitet sich zum Abteilungsleiter hoch. Außerdem engagiert er sich ehrenamtlich in der Evangelischen Kirche. Er wird zum Presbyter und Kirchmeister gewählt, als der er noch eine besondere Funktion im Presbyterium der Gemeinde ausübt, und zum Beisitzer in der Kommission für Wehrdienstverweigerer berufen. Lobend bescheinigt er gern jemandem, »schneidig« zu sein. Er hätte sich gewünscht, dass der einzige Sohn ebenfalls Offizier geworden wäre – oder Theologe.
Niemand in der Familie, der sich in seiner Haut wohlgefühlt hätte. Alle in den falschen Rollen, Kleidern, Häusern, Ehen, Verhältnissen, Beziehungen zueinander. Drei der Geschwister mütterlicherseits haben Ehepartner, die nach dem Krieg aus West- und Ostpreußen und Pommern geflüchtet sind und die es in die Westzonen verschlagen hat, darunter mein Vater, der außer in wenigen verklärenden Kindheitserinnerungen nie auf die einstige Heimat Bezug nimmt, als wäre dieses Kapitel spurlos ausradiert.
Man lässt es »die Priechlinge« – der von der Familie meiner Mutter geprägte Spottname bezieht sich auf ihre etwas andere Betonung und Aussprache – spüren, nicht dazuzugehören. Gemeinsam ist ihnen die Hemmung im Umgang mit den Alteingesessenen, die sich in nervöser Anspannung, als verkrampftes Eifern und beflissenes Sich-Entschuldigen ausdrückt und sich hinter übersteigerten Gebärden und untertänigen Floskeln duckt.
»Sie haben aber einen netten Mann, so aufmerksam und hilfsbereit.« Auf die freundliche Ansprache antwortet meine Mutter bündig: »Das sagen Fremde immer.«
Sie ist Kind ihres Vaters geblieben und jüngste Schwester ihrer Geschwister, ist nicht die Frau ihres Mannes geworden. Wurde Mutter, aber blieb Tochter. Als ihr Sohn spüre ich den Kampfplatz Familie undeutlich, die in seinen Gewohnheiten befestigte Überlegenheit des Großvaters, der den Schwiegersohn missachtet, wenn nicht verachtet, der die Tochter beherrscht und den Enkel vergöttert.
Sie erfüllte sich einen späten Jungmädchentraum, als sie meinen Vater während eines Besuchs bei ihrer ältesten Schwester Emma in Wiesbaden kennengelernt hatte. Briefe hielten den Kontakt – bis zum heutigen Tag werde ich das verwahrte Bündel nicht geöffnet und nicht gelesen haben. Heimliche Treffen folgten bei Gustav, dem älteren der beiden Brüder meiner Mutter, der eingeweiht wurde. Es ist eine Auflehnung. Das einzige Mal in ihrem Leben behauptete sie sich gegen den Willen des Vaters, handelte gegen den Rat der Schwestern, kehrte sich gegen die Konvention und protestantische Regel – mein Vater war Katholik und konvertierte mit der Hochzeit.
Ich habe nie verstanden, woher sie die Kraft und den Willen nahm. Vielleicht deshalb nicht, weil diese Kraft niemals mehr zu spüren gewesen ist, nachdem sie erkannt hatte, die falsche Wahl getroffen zu haben. Sie war verbraucht worden für diesen einen Kampf. Denkt sie, vom eigenen Empfinden getrogen worden zu sein? Das Unglück lässt sich nur leben, indem beide sich gegenseitig verantwortlich machen – weil es zu schmerzlich wäre, es sich selbst zuzuschreiben und das komplizierte Muster der Anziehung, Erwartung, Enttäuschung, Ablehnung, auch der körperlichen, aufzulösen. Sie schweigen nebeneinanderher, durchbrochen von Streitigkeiten, die das Wesen des Konflikts meiden und sich konzentrieren auf Dritte, auf Belangloses und Kleinliches.
Der gestaute Zorn über die Verweigerung, sich einander die eigene Geschichte abzufordern und sie voreinander preiszugeben, steht in den Räumen. Ich höre Hohn in den Vorwürfen, sehe Verletzung in den Gesichtern. Und schweige selbst. Bloß fort von hier – aber weshalb dann immer wieder zurück? Statt zu versuchen, ihnen aufzusperren, sperre ich mich selbst mit ein – separiert im Einzelzimmer.
Mein Vater flüchtet in einen zwanghaften Sauberkeits- und Ordnungswahn, der sich auf widersinnige Weise mit Verwahrlosung mischt, bis er in den letzten Jahren die Grenze zum Psychotischen überschreitet. Meine Mutter weicht aus in Krankheit, Resignation und die sie entlastende Unterordnung gegenüber ihren Schwestern. Manchmal legt sie sich im von den Jalousien abgedunkelten Zimmer ins Bett. Sie habe ihren »Moralischen«. Schwermut und Depression sind keine Begriffe für sie, um ihren Zustand zu beschreiben. Ich sitze auf der Bettkante. Ihr gut zuzureden hilft nicht. Könnte ich handeln? Sie in den Arm zu nehmen, steht nicht in den Statuten der Familientradition.
Das Zerstörungswerk Leben verrichtet seine Arbeit.
DAZWISCHEN
Als ich vier oder fünf bin, bringen meine Eltern mich, wie vorher schon oft, zum jüngeren Bruder meiner Mutter, der mit Ehefrau Clarissa und Schwägerin Christa sowie dem Schwiegervater auf geräumigen drei Etagen in einer Neubausiedlung bei Ratingen wohnt. Ich bin gerne bei ihnen, weil ich in dem kinderlosen Haushalt noch mehr verwöhnt werde als zu Hause und es dort, verglichen mit uns, pompös zugeht. Der Esstisch ist festlich in weißem Damast mit Silber, Kerzen und Blumen gedeckt; die Gerichte werden in Deckelschüsseln und auf garnierten Platten aufgetragen. Die puppenhaft grazilen, kettenrauchenden, sommers wie winters fröstelnden Frauen, beide berufstätig – Prokuristin die eine, Department Head bei British Airways die andere – umsorgen »ihren Mann« wie Bedienstete eines Fünf-Sterne-Hotels und huschen die vielen Treppen auf und ab mit nach Lavendel duftender gestärkter Wäsche, Putzutensilien, Tabletts mit Gebäck oder Gläsern, Whiskey und Eiskübel. Mein Onkel Robert, der nach dem Notabitur als Freiwilliger während der letzten Kriegsmonate durch einen Granatsplitter am Bein schwer verletzt worden war, so dass es ihm im Lazarett bis zum Oberschenkel amputiert werden musste, arbeitet als leitender Angestellter in der Deutschlandzentrale des US-amerikanischen DuPont-Konzerns. Um den Verlust seiner Unversehrtheit »für Führer, Volk und Vaterland« nicht als sinnlos und fehlgeleitet erkennen und akzeptieren zu müssen, beruft er sich in der historischen Beurteilung der Nazidiktatur auf die Stimmen, die zumindest die Kriegsschuldfrage nicht eindeutig zulasten des Dritten Reichs zu beantworten willens sind. Gut aussehend mit markanten Zügen wie Curd Jürgens als des Teufels General, ist er der verhätschelte Bruder seiner vier älteren Schwestern, die ihn im Vergleich mit den eigenen Ehemännern als die bessere Partie ansehen, und Chef der von ihren Schwägerinnen kritisch beargwöhnten, zudem noch katholischen Ehefrau Clarissa und ihrer Schwester Christa, die Robert mit wenigen scharfen Worten in flatternde Nervosität bringt: zwei aufgescheucht hüpfende Zeisige in der Voliere.
Der Vater dieser Schwestern, Dr. August Klocke, ehemaliger Betriebsdirektor im Eichsfeld, sitzt in seinem Herrenzimmer, so oft jemand bei ihm anklopft, gebeugt über Papieren am Schreibtisch, springt aus dem ledergepolsterten Bürostuhl, komplimentiert mit umständlichen Redewendungen den Besucher zu sich herein, blättert ihm die aus dem Osten herübergeretteten Fotoalben der Familie auf und verirrt sich bis zum Unverständlichen in seinen filigran gebauten labyrinthischen Satzperioden.
Mit mir, dem Neffen, verfahren die Tanten Clarissa und Christa nicht anders als gewissenhaft ergeben, bereiten heiße Bäder, seifen ein und rubbeln ab, cremen mit wohlriechenden Essenzen und hüllen in ein vorgewärmtes Frotteebadetuch. Ich ahne, dass ich dieses Mal länger bleiben soll, als ich es mir vorgestellt habe. Über Nacht. Ich weigere mich, so werden die Tanten noch Jahrzehnte später erzählen, ins Bett zu gehen und stehe völlig übermüdet am Fenster, durch das ich auf die Straße sehen kann, um jede etwaige Ankunft nur nicht zu versäumen und dabei litaneiartig wie in Trance zu wiederholen: »Mama kommt gleich.«
Einige Jahre später. Das Kind will etwas aus der Speisekammer holen, die von der schwarz-weiß gefliesten Küche abzweigt als Abschluss eines wandeinnehmenden Einbauschranks und, verborgen hinter einer schmalen Schnapptür, sich ausweitet zu einem L-förmigen, kühlen, wohlduftenden Gelass mit runder Fensterluke. Mein Vater kommt mir hinterher, schluchzend in Tränen, und fordert mich auf, ich möge mich zu ihm bekennen und zu ihm stehen gegen die Familie meiner Mutter. Ich weiß nicht, was vorgefallen ist, bin schreckensstarr. Das ist nicht der Vater, von dem ich mir Gute-Nacht-Geschichten erbettle aus der Zeit, »wo du klein warst«, der mir in monatelanger abendlicher Arbeit die Ritterburg mit Graben und Zugbrücke und eine Weihnachtskrippe mit Ziehbrunnen und einem aus klebrig-glänzendem Kunststoff gegossenen Bächlein, das durch ein Unterholz fließt, gebastelt hat und mir jeden Wunsch erfüllt. Das ist jemand, den ich nicht kenne, der mir Angst macht, weil er Angst hat. Das Kind ist zerrissen zwischen Loyalitäten. Ihm fehlt es an nichts, außer an emotionaler Eindeutigkeit und der Erfahrung elterlicher Harmonie. Dem Ultimatum der Schwäche, sich für oder wider zu entscheiden, kann es sich unmöglich beugen. Das Kind enthält sich. Was hätte es antworten sollen?
Ich will hier bei dir stehen, verachte mich doch nicht.
Meine Mutter verbringt ihre Abende oben bei ihrer Schwester und ihrem Schwager, während mein Vater im Keller in einer komplett eingerichteten Werkstatt Spielzeug für mich bastelt. Ihre Ehe ist eine Verlegenheit. Beiden gelingt es nicht, wie Mann und Frau miteinander zu leben, sich ihre Gefühle mitzuteilen und sie miteinander zu teilen: die guten, die bösen und die gemischten. Was vertrauen sie wohl in den sonntäglichen Gottesdiensten ihren Gebeten an?
Großvaters Testament setzt mich zum Erben ein, nicht seine vier Töchter und zwei Söhne, nicht die acht Enkelkinder insgesamt. Er tut dies nicht gefühlsbetont, weil ich der Liebling bin, sondern überlegt und besonnen. Ich bin das einzige Kind seiner jüngsten Tochter, die er in ihrer unseligen Ehe sieht, von der er nicht weiß, ob sie halten wird. Sie will er absichern, aber verhindern, dass der Schwiegersohn über meine Mutter Einfluss auf das Erbe, vor allem das Haus, bekommt. Deshalb bestimmt er seinen jüngeren Sohn, meinen Onkel, zum Vormund, der, bis ich volljährig werde, etwaige Entscheidungen zu treffen hat. Mein Vater erlebt die Bestimmung als demütigend. Dass die sechs Geschwister – sie waren vorab darüber unterrichtet – den Letzten Willen akzeptieren und er ihr inniges Verhältnis untereinander nicht beeinflusst und sie es als Zurückgesetzte mich, den Bevorzugten, nicht spüren ließen, ist in Familien mit ihren Zerrüttungskräften ganz sicher die Ausnahme. Meine Eltern und meine Tante Margret mit ihrer Familie wohnen bei mir formal zur Miete. Praktisch bezahlt mein Vater für alles, was ansteht: Umbau, Modernisierung, fällige Reparaturen. Er sieht sich als ausgebootet: Pflichten, keine Rechte. Hausmeister seines Sohnes.
FEUER UND FLAMME
Wir sind zu siebt an meinem achten Geburtstag.
Georg und Werner von schräg gegenüber, die am liebsten Erdlöcher auf dem hauseigenen Sandspielplatz buddeln, sich in die Höhlungen hineingraben und sie wieder zuschütten, was ihre Mutter veranlasst, ernsthaft in ihnen künftige Bauingenieure oder Architekten erkennen zu wollen. Breit der eine, schmal der andere Bruder, soll sich ihnen eine trivialere berufliche Zukunft eröffnen – Maurer und Klempner.
Das Gesicht von Martin, der während zwei, drei Jahren in der Volksschule, wie das damals heißt, mein bester Freund ist, sehe ich nur noch undeutlich vor mir, es hat milchweiße Haut, so zart, dass das blaue Geäder darunter hindurchscheint, was mir vorkommt wie etwas, das dem Blick nicht offenliegen dürfte.
Burkhard, der etwas älter ist als wir Übrigen, ein bisschen polternd, eckig wie ein Roboter in seinen Bewegungen und schwerfällig, nicht anders als seine herzensguten, aber grobschlächtigen und lauten Eltern, deren Gemüsegarten an unseren Vorgarten grenzt, und der mehr dem Gebot der Nachbarschaft wegen und weniger aus Überzeugung eingeladen wird, er wird früh sterben durch einen Motorradunfall.
Der schon hoch aufgeschossene, seine Sätze undeutlich vermurmelnde, vielleicht deshalb gehemmte Raimund, der der Einzige sein wird, der mit mir ans städtische humanistische Gymnasium wechselt und über Jahre hin den Schulweg gemeinsam mit mir nimmt.
Als Mädchen zwischen uns sechs schließlich die Jungen gegenüber nicht verlegene Gundi, die mit ihrem blonden Fransenpony der Schauspielerin Karin Baal ähnelt, die in Die Halbstarken Horst Buchholz zur Gewalt aufstachelt. Sie ist mit ihren Eltern erst vor Kurzem hergezogen, in ein kastenförmiges Herrenhaus etwas außerhalb knapp vor der holländischen Grenze gelegen. Lange hatte es leer gestanden, was mir bekannt war, weil ich während meiner Radtouren in der ländlichen Umgebung häufig an dem Grundstück vorbeigekommen war.
Gundi liegt einmal mit uns auf einem abgemähten Stoppelfeld in der Sommersonne und findet nichts dabei, dem phlegmatischen Burkhard einen grünlich schleimigen Popel aus der Nase zu puhlen und ihn sich ausgiebig zu beschauen, bevor sie ihn nachlässig wegschnippt. Dass sie sich nicht geekelt und er sich nicht geniert hat, beschäftigt mich lange und grundiert meine Vorstellung davon, was Mädchen und Jungen wechselseitig anzieht. Ich schäme mich, ohne genau zu unterscheiden, ob für sie oder für ihn, dem diese mir unerklärliche Zuwendung widerfährt.
Fünf Jahrzehnte danach treffe ich Gundi auf der Party einer Kollegin und Theaterkritikerin in Berlin, die sie mir als Frau des deutschen Botschafters in einem lateinamerikanischen Land vorstellen will. Wir erkennen uns sofort wieder und winken das Zeremoniell ab. Beide können wir gleich den Kurzfilm unserer Erinnerungen einlegen und abspulen und finden nichts dabei. Dass ihr – aschige Strähnen im schulterlang glatten, hellen Haar, weit geschnittener, die Figur seidenweich umhüllender Hosenanzug, am linken Handgelenk ein breiter Goldreif mit ovalem Türkis, an der anderen Hand ihren Gatten, der, wie sie selbst, zur Entourage von Truman Capotes Holly Golightly gehören könnte – nichts peinlich ist, daran hat sich im Lauf der Zeit nichts geändert. Überraschend für mich ist vielmehr, dass ich ohne eine mich heiß überlaufende Erinnerung an das sommerliche Feldlager hinter unserem Grundstück denken und darüber sprechen kann. Gundi erinnert sich auch an den Vorfall an meinem achten Geburtstag, indem sie mich, mokant lächelnd, »gebranntes Kind« nennt:
Am Geburtstagsnachmittag sitzen wir in unserem Wintergarten um den festlich gedeckten Couchtisch mit blümchenbestickter weißer Halbleinendecke, dem »guten« Porzellan mit Goldrand und einem Kranz getrockneter gelber Mimosen mit acht Kerzen, essen selbst gebackenen Marmor- und gedeckten Apfelkuchen und trinken Kakao mit Schlagsahne. Die hauchdünnen Papierservietten haben ein chinesisches Muster in Rosa und Fliederfarbe und als Umrandung eine wie gefiederte Bordüre, die sich im Gleichklang mit den auf ihren Dochten unruhig flackernden Flämmchen im ansonsten nicht wahrnehmbaren Luftzug sacht bewegt.
Messer, Gabel, Schere, Licht, dürfen kleine Kinder nicht





























