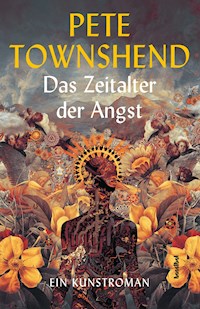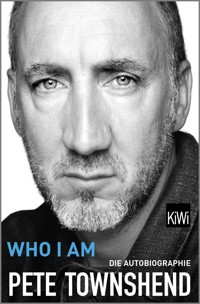
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Der legendäre Gitarrist und Songwriter von The Who erzählt Songwriter, Komponist, Gitarrist und kreativer Kopf hinter der legendären Band »The Who« – zu ihren Hoch-Zeiten die aufregendste Rockband der Welt - : Pete Townshend ist eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der Rockgeschichte. In den Sechzigerjahren war er die Speerspitze des Rock, zerschlug in selbstzerstörerischen Auftritten seine Gitarren und schrieb Songs, die die Popmusik radikal veränderten. Pete Townshend erfand den Powerchord, durchbrach in Tommy, Quadrophenia und späteren Werken das Drei-Minuten-Schema des Popsongs und arbeitete so an einer strukturellen Weiterentwicklung des Rock als Kunstform. Townshend jedoch hat sich mit dem Etikett des Gitarrenhelden, dem die rasende Menge 1969 in Woodstock zu Füßen lag, nie so recht wohl gefühlt.Seine Intelligenz, seine Phantasie und sein wacher Geist führten ihn in bislang von Rockstars unerforschte Gefilde – als Schriftsteller, Dichter, Bühnenautor und Verleger.Und noch immer erkundet er als Solist oder mit The Who die utopischen Möglichkeiten der Musik und ist so nach wie vor Inspiration für zahllose junge Musiker. Nun erzählt Townshend zum ersten Mal seine eigene Geschichte, berichtet auf extrem berührende Weise von seiner schwierigen Kindheit, deren Nachhall bis heute anhält, und von seinem Bemühen, die eigene Vergangenheit zu verstehen und dabei seinem Publikum treu zu bleiben.Als eine Geschichte über Ehrgeiz & gnadenlosen Perfektionismus, Krawalle & Rock'n' Roll-Exzesse, über emotionale und spirituelle Unruhe und der Suche nach Erlösung ist dieses Buch nicht nur ein echter Rock-Klassiker, sondern ein bewegendes Dokument eines wahren Künstlers unserer Zeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 839
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Inhalt
CoverTitelERSTER AKT KRIEGSMUSIK1 ICH WAR DABEI2 IT’S A BOY!3 YOU DIDN’T SEE IT4 RACHE AUF TEENAGER-ART5 THE DETOURS6 THE WHO7 I CAN’T EXPLAIN8 SUBSTITUTE9 ACID LIEGT IN DER LUFT10 GOTT CHECKT IM HOLIDAY INN EIN11 AMAZING JOURNEY12 TOMMY: DER MYTHOS UND DIE MUSIKZWEITER AKT EIN ZUTIEFST VERZWEIFELTER MENSCH13 LIFEHOUSE UND EINSAMKEIT14 DAS LAND DAZWISCHEN15 CARRIERS – BOTEN DES ROCK16 EIN BETTLER, EIN HEUCHLER17 PASS AUF, UM WAS DU BITTEST18 DER LEICHENBESTATTER19 EIN ECHTER ROCKER20 DER ROCKSTAR VERKACKTDRITTER AKT SPIELT FÜR DIE LETZTEN REIHEN21 DAS LETZTE GLAS22 IMMER NOCH BEKLOPPT23 IRON MAN24 PSYCHODERELICT25 RÜCKFALL26 NOODLING27 EIN NEUES ZUHAUSE28 BRIEF AN MEIN ACHTJÄHRIGES ICH29 SCHWARZE TAGE, WEISSE RITTER30 TRILBYS KLAVIER31 INTERMEZZO32 WHO I AMANHANG: EINE FANPOST AUS DEM JAHR 1967CODADANKSAGUNGBILDTEILBILDNACHWEISREGISTERBuchAutorÜbersetzerImpressumERSTER AKTKRIEGSMUSIK
You didn’t hear it.
You didn’t see it.
You won’t say nothing to no one.
Never tell a soul
What you know is the truth
»1921« (1969)
Don’t cry
Don’t raise your eye
It’s only teenage wasteland
»Baba O’Riley« (1971)
And I’m sure – I’ll never know war
»I’ve Known No War« (1983)
1 ICH WAR DABEI
Es ist fantastisch, magisch, surreal, sie alle zu meinen Feedback-Gitarrensoli tanzen zu sehen. Im Publikum stehen meine Freunde von der Kunsthochschule kerzengerade zwischen den Mods aus West und North London mit ihren hängenden Schultern, dieser Armee von Teenagern, die auf ihren sagenhaften Rollern gekommen ist, mit kurzen Haaren und teuren Schuhen, randvoll mit Pillen. Ich kann nicht sagen, was in den Köpfen meiner Bandkollegen Roger Daltrey, Keith Moon oder John Entwistle vorgeht. Normalerweise würde ich mich wie ein Einzelgänger fühlen, selbst inmitten der Band, aber heute Abend, im Juni 1964, beim ersten Konzert von The Who im Railway Hotel in Harrow, West London, bin ich unbesiegbar.
Wir spielen R&B: »Smokestack Lighting«, »I’m a Man«, »Road Runner« und andere coole Klassiker. Ich schleife die jaulende Rickenbacker-Gitarre am Mikrofonständer auf und ab, dann lege ich den Spezial-Schalter um, den ich vor Kurzem montiert habe, und ein stotternder, spritzender Soundkugelhagel ergießt sich über die erste Reihe. Brutal reiße ich die Gitarre in die Luft – und mir läuft ein eisiger Schauer über den Rücken, als der Klang sich von einem Dröhnen in ein klapperndes Brummen verwandelt. Ich sehe nach oben und ziehe den abgebrochenen Kopf meines Instruments aus dem Loch, das ich in die abgehängte Decke gebohrt habe.
In diesem Moment treffe ich eine blitzschnelle Entscheidung – und ramme die kaputte Gitarre wie ein Wahnsinniger immer wieder in die Decke. Was ein sauberer Bruch war, wird zu wüstem Gesplitter. Triumphierend recke ich die Gitarre vor dem Publikum in die Luft. Ich habe sie nicht zertrümmert: Ich habe eine Skulptur für sie daraus gemacht. Dann werfe ich das zerbrochene Instrument gleichgültig auf den Boden, hole mir eine nagelneue zwölfsaitige Rickenbacker und spiele weiter.
An jenem Dienstagabend stolperte ich zufällig über etwas, das mächtiger war als Worte und weit emotionaler als meine Versuche, als Weißer den Blues zu spielen. Und als Reaktion erhielt ich die lautstarke Anerkennung der Menge. Ungefähr eine Woche später, auf der gleichen Bühne, gingen mir die Gitarren aus, und ich kippte den Turm Marshall-Verstärker um. Unser Drummer Keith Moon – niemand, der sich die Schau stehlen ließ – machte mit und trat sein Schlagzeug zusammen. Roger schleifte sein Mikro über das kaputte Becken. Manche Leute betrachteten die Zerstörungsaktion als Masche, aber ich wusste, dass die Welt sich gerade veränderte und eine Botschaft übermittelt wurde. Die alte, konventionelle Art, Musik zu machen, hatte ihren Zenit überschritten.
Ich hatte keine Ahnung, wohin die erste Zertrümmerung meiner Gitarre führen würde, aber mir war ziemlich klar, woher das alles kam. Als Sohn eines Klarinettisten und Saxofonisten bei den Squadronaires, der prototypischen englischen Big Band, war ich mit der Liebe zu dieser Musik aufgewachsen, einer Liebe, die ich nun einer neuen Leidenschaft wegen verraten würde: dem Rock’n’Roll, der Musik, die angetreten war, um sie zu zerstören.
Ich bin Brite. Ich bin Londoner. Ich kam in West London zur Welt, als der verheerende Zweite Weltkrieg gerade dem Ende zuging. Als Künstler haben mich diese drei Umstände maßgeblich geprägt, genau wie das Leben meiner Großeltern und Eltern von den Düsternissen des Krieges geprägt wurde. Ich wuchs in einer Zeit auf, als der Krieg noch immer seine Schatten warf, obwohl das Klima sich im Laufe meines Lebens so schnell veränderte, dass man nicht einmal ahnen konnte, was kommen würde. Krieg war für drei Generationen meiner Familie eine reale Bedrohung gewesen oder doch zumindest etwas, womit man lebte.
Im Jahr 1945 hatte Unterhaltungsmusik einen ernsten Zweck: der Nachkriegsdepression zu trotzen und die Sehnsüchte und Hoffnungen eines erschöpften Volkes wiederzubeleben. Meine Kindheit war durchdrungen vom Bewusstsein um die Geheimnisse und Romantik der Musik meines Vaters, die so wichtig für ihn und Mum war, dass sie der Mittelpunkt des Universums zu sein schien. Es gab Lachen und Optimismus; der Krieg war vorbei. Die Musik, die Dad spielte, hieß Swing. Das wollten die Leute hören. Und ich war dabei.
2 IT’S A BOY!
Ich bin gerade auf die Welt gekommen, der Krieg ist vorbei, aber noch nicht ganz.
»Es ist ein Junge!«, ruft jemand aus dem Rampenlicht auf die Bühne. Aber mein Vater spielt weiter.
Ich bin ein Kriegskind, auch wenn ich Krieg nie erlebt habe, geboren in eine Musikerfamilie am 19. Mai 1945, keine zwei Wochen nach der Kapitulation Deutschlands und drei Monate vor der Kapitulation Japans. Doch der Krieg und seine synkopischen Echos – die Sirenen und Saxofone, die Big Bands und Bunker, V2s und Violinen, Klarinetten und Kampfflugzeuge, Indigo-Mood-Wiegenlieder und Satin-Doll-Serenaden, die Bombardements, die Explosionen, das Heulen und Dröhnen – schaukeln, erschüttern und verunsichern mich noch im Mutterleib.
Zwei Momente werden mir für immer im Gedächtnis bleiben, wie Träume, die man nie wieder vergisst, nachdem man sich einmal an sie erinnert hat.
Ich bin zwei Jahre alt und sitze im Oberdeck einer alten Tram, die Mum und ich oben am Acton Hill in West London bestiegen haben. Die Straßenbahn zuckelt an meiner Zukunft vorbei: dem Elektrogeschäft, in dem Dads erste Platte 1955 in den Verkauf kommen wird; der Polizeiwache, wo ich mein gestohlenes Fahrrad abholen werde; der Eisenwarenhandlung, die mich mit ihren Tausenden von säuberlich beschrifteten Schubladen fasziniert; dem Odeon, wo ich mit meinen Freunden samstagnachmittags urkomische Filmvorführungen besuchen werde; der St. Mary’s Church, wo ich Jahre später mit dem Chor anglikanische Hymnen singen und dabei zusehen werde, wie Hunderte von Menschen die Kommunion empfangen, ohne es jemals selbst zu tun; dem White Hart Pub, wo ich mich 1962 zum ersten Mal richtig betrinken werde, nach einem wöchentlichen Gig mit einer Schulband namens The Detours, aus der sich eines Tages The Who entwickeln werden.
Dann bin ich schon etwas älter, mein zweiter Geburtstag liegt drei Monate zurück. Es ist der Sommer 1947, und ich befinde mich an einem Strand in hellem Sonnenschein. Zum Herumlaufen bin ich noch zu klein, aber ich sitze auf der Decke und genieße die Gerüche und Geräusche: Seeluft, Sand, ein leichter Wind, Wellen, die an die Küste plätschern. Meine Eltern kommen wie Araber auf Pferderücken angeritten, spritzen Sand in alle Richtungen, winken fröhlich und reiten wieder davon. Sie sind jung, glamourös, schön, und ihr Verschwinden ist wie die Herausforderung eines schwer zu erreichenden Grals.
Dads Vater Horace Townshend (genannt Horry) war mit dreißig schon kahl, mit seiner Adlernase und der dicken Hornbrille aber trotzdem noch attraktiv. Horry, ein halbprofessioneller Musiker/Komponist, schrieb Lieder und trat in den 1920ern während der Sommermonate in Küstenstädtchen, Parks und Varietés auf. Als gelernter Flötist konnte er Noten lesen, aber ihm gefiel das leichte Leben, und er verdiente nie viel Geld.
Horry lernte meine Großmutter Dorothy im Jahre 1908 kennen. Sie arbeiteten zusammen als Entertainer und heirateten zwei Jahre später, als Dot mit ihrem ersten Kind Jack im achten Monat schwanger war. Onkel Jack erinnerte sich daran, als Kleinkind seine Eltern beobachtet zu haben, wie sie auf dem Brighton Pier Straßenmusik machten. Eine vornehme Dame kam näher, bewunderte ihr Spiel und warf einen Shilling in ihren Hut. »Für welchen guten Zweck sammeln Sie?«, fragte sie.
»Für uns selbst«, erwiderte Dot.
Dot war eine auffallende und elegante Erscheinung. Auch sie konnte Noten lesen, trat als Sängerin und Tänzerin bei Varietévorführungen auf, manchmal an der Seite ihres Mannes, und wirkte später an Horrys Liedkompositionen mit. Sie war fröhlich und optimistisch, wenn auch ziemlich eitel und etwas überheblich. Zwischen ihren Vorstellungen zeugten Horry und Dot meinen Vater, Clifford Blandford Townshend, der 1917 geboren wurde, ein Gefährte für seinen älteren Bruder Jack.
Mums Eltern Denny und Maurice wohnten anfangs mit ihr in Paddington. Denny hatte zwar einen Sauberkeitsfimmel, passte aber nicht sonderlich gut auf ihre Kinder auf. Mum kann sich daran erinnern, wie sie sich mit ihrem Bruder Maurice Jr. auf dem Arm weit aus dem Fenster im ersten Stock beugte, um ihrem Vater zu winken, wenn er mit seinem Milchwagen vorbeifuhr. Der Kleine wäre beinahe heruntergestürzt.
Opa Maurice war ein liebenswürdiger Kerl, den Denny – nach elf Jahren Ehe – eiskalt sitzen ließ. Sie brannte ohne Vorwarnung mit einem wohlhabenden Mann durch, der sie sich künftig als Geliebte hielt. Als Mum an jenem Tag von der Schule kam, war das Haus leer. Denny hatte sämtliche Möbel außer einem Bett mitgenommen und nur einen Abschiedsbrief ohne Adresse hinterlassen. Maurice brauchte mehrere Jahre, um die eigensinnige Frau aufzuspüren, aber sie versöhnten sich nie.
Maurice zog mit den beiden Kindern zu seiner Mutter Ellen. Mum beteiligte sich mit ihren zehn Jahren schon am Haushalt und geriet unter den Einfluss ihrer irischen Großmutter. Sie schämte sich für die Mutter, die sie im Stich gelassen hatte, war aber stolz auf ihre Großmutter Ellen, die ihr beibrachte, wie sie ihre Sprechstimme zu modulieren hatte, um das Irische darin zu vervollkommnen. Mum war geschickt im Nachahmen unterschiedlicher Akzente und zeigte eine frühe Begabung für Musik.
Als Teenager zog sie dann zu ihrer Tante mütterlicherseits nach London. Ich habe Rose als außergewöhnliche Frau in Erinnerung, selbstsicher, intelligent, belesen; sie war lesbisch und lebte still, aber durchaus offen mit ihrer Partnerin zusammen.
Wie ich war Dad ein rebellischer Teenager. Vor dem Krieg gehörten er und sein bester Freund zu Oswald Mosleys faschistischen Schwarzhemden. Später schämte er sich natürlich dafür. Aber er verzieh sich – schließlich waren sie jung und die Uniformen ziemlich schick. Anstatt bei Prokofjews Klarinettenstudien zu bleiben, die er jeden Vormittag zwei Stunden brillant durchstürmt hatte, beschloss Dad mit sechzehn, lieber bei Bottle-Partys zu spielen, einer englischen Variante der amerikanischen Flüsterkneipen. Musikalisch verlangten ihm diese Auftritte wenig ab. Sein gesamtes Leben lang war er technisch überqualifiziert für die Musik, die er machte.
Binnen weniger Jahre trat Dad mit Billy Wiltshire und seiner Picadilly Band in ganz London auf und spielte Lounge- und Tanzmusik in Bars – Bar Stooling nannte man das. Zwischen den beiden Weltkriegen wurde die ständige, unterschwellige Angst vor Auslöschung durch Kultiviertheit, Glamour und Unbeschwertheit überdeckt. Die großen Themen waren verborgen in Wolken von Zigarettenrauch und innovativer Unterhaltungsmusik. Sex war, wie eh und je, das Mittel der Wahl, um das ängstliche Herz zu besänftigen. Doch in der Zeit meines Vaters wurde sexuelle Energie in der Musik eher angedeutet als explizit dargestellt, wurde versteckt hinter der gepflegten Eleganz von Männern und Frauen in Abendgarderobe.
Der Krieg und die Musik brachten meine Eltern zusammen. 1940 meldete Dad sich zur Royal Air Force und spielte Saxofon und Klarinette in kleinen Bands, um als Teil seiner Pflichten seine Kameraden zu unterhalten. 1945 gehörte er bereits zum RAF Dance Orchestra, einem der größten der gesamten Armee. Es setzte sich aus Armeeangehörigen zusammen, die Mitglieder bekannter Gruppen gewesen waren, wurde von Sergeant Leslie Douglas dirigiert und gilt heute als eines der besten Tanzorchester, die Großbritannien je hervorgebracht hat. Auf seine Weise war es revolutionär. Seine Geheimwaffe war der Swing, der damals gesamtgesellschaftlich immer noch nicht als salonfähig empfunden, aber von den einfachen Leuten geliebt wurde. Dad hatte den Posten bekommen, weil Vera Lynns Mann, der Saxofonist Harry Lewis, trotz seiner Zugehörigkeit zur RAF Flugangst hatte und nicht nach Deutschland fliegen wollte. Und tatsächlich war Dad, als ihm der Motorradkurier die Nachricht von meiner Geburt auf die Bühne zurief, gerade in Deutschland und spielte für die Truppe Saxofon.
Mum gab ein falsches Alter an, um sich 1941 zur Armee melden zu können. Sie war eine talentierte Sängerin und wurde Vokalistin in Dads Band. Ein Konzertprogramm für den 18. Juni 1944 in der Colston Hall in Bristol führt sie als Interpretin von »Star Eyes«, »All My Life« (ein Duett mit dem gut aussehenden Sergeant Douglas) und »Do I Worry« auf. Dad wird dort als Solist bei »Clarinet Rhapsody« und »Hot and Anxious« erwähnt. Wie es im Begleitheft einer Platte heißt, richtete sich das RAF Dance Orchestra direkt ans Ohr der Öffentlichkeit. Der Sound wird als fließend und frei beschrieben, im nächsten Moment wieder akzentuiert, der Rhythmus als flexibel, was dem Solisten mehr Raum für Ausdruck gibt.
Nach dem Krieg entschied sich das Orchester, seinen bisherigen Spitznamen anzunehmen: die Squadronaires.
Mum hat die Anfangsjahre ihrer Ehe als einsam beschrieben: »Ich habe Dad kaum zu Gesicht bekommen. Er war nie da. Und wenn er mal da war, dann saß er gegenüber im White Lion oder oben im Granville.« Dad war fröhlich, gut aussehend, immer für eine Lokalrunde gut und deshalb in den Kneipen unserer Gegend beliebt, wo sein musikalischer Erfolg ihn zu einer kleinen Berühmtheit machte.
Mums Einsamkeit erklärt vielleicht zum Teil, warum es sie so wütend machte, dass mein Vater bei meiner Geburt nicht anwesend war. Da sie damals bei Dads Eltern wohnte, zeigte sie ihren Ärger, indem sie auszog. Sie kannte ein jüdisches Paar, Sammy und Leah Sharp, Musiker aus Australien, die mit ihrem Sohn in einem einzigen großen Zimmer lebten, und dort schlüpften Mum und ich ebenfalls unter. Leah übernahm mich. Ich erinnere mich nicht an sie, aber Mum beschrieb sie als »einen dieser Menschen, die für ihr Leben gern das Baden und Kinderwagenschieben und den ganzen Krempel übernehmen«. Mum, die sich weniger für »den ganzen Krempel« interessierte und nach wie vor als Sängerin auftrat, nahm ihre Hilfe gerne in Anspruch.
1946 versöhnten sich meine Eltern, und wir drei zogen in ein Haus in Whitehall Gardens in Acton. Zu unseren unmittelbaren Nachbarn gehörten der großartige blinde Jazzpianist George Shearing und der Comiczeichner Alex Graham, dessen Atelier mit dem verstellbaren Zeichenbrett, den riesigen Papierbögen, Tintenfässchen und seltsamen Stiften mich faszinierte – wohl eines der Initialerlebnisse, die mich später zum Besuch der Kunsthochschule anregten.
Wir teilten uns das Haus mit der Familie Cass, die das obere Stockwerk bewohnte und, wie viele der engsten Freunde meiner Eltern, Juden waren. Ich erinnere mich an lärmende, ausgelassene Pessachfeste mit viel Gefilte Fisch, gehackter Leber und dem Duft langsam schmorender Rinderbrust. Jede Familie hatte drei Zimmer, eine Küche und ein Bad, aber keine Innentoilette. Unsere befand sich im Garten, und als Toilettenpapier hing Zeitungspapier an einem Nagel. Wegen der Kälte und der Spinnen dauerten meine Ausflüge dorthin nie besonders lange.
Ich schlief im Esszimmer. Meine Eltern schienen nur wenig Sinn für mein Bedürfnis nach einem eigenen Platz zu haben, wo ich mein Spielzeug oder meine Zeichnungen einfach herumliegen lassen konnte, ohne das Gefühl zu haben, in Erwachsenenterritorium vorzudringen. Ich besaß kein Bewusstsein für Privatsphäre oder auch nur dafür, ein Recht darauf zu haben.
Mum gab das Singen auf und bereute es später, aber sie hat immer gearbeitet. Sie half bei der Leitung der Squadronaires aus, deren Büro am Picadilly Circus lag, und nahm mich oft mit in den Tourbus. Ich genoss die lässige Art der Bandmitglieder und sammelte die leeren Bierflaschen ein. Unsere Fahrten endeten immer in einem kleinen Hotel an der Küste, einem Feriendorf oder einem verschnörkelten Theater voller Geheimtreppen und unterirdischer Korridore.
Charlie, der für die Roadies zuständig war, musste sich viele blöde Scherze gefallen lassen, aber die Squadronaires liebten ihn, das merkte man. Mums und Dads alltäglicher Einfluss auf mich nahm etwas ab, wenn ich mit dem Orchester zusammen war, das mir wie ein großer Männerverein auf Reisen vorkam. Mum war das singende Maskottchen, und Dads musikalisches Können verlieh ihm einen besonderen Status unter seinen Kollegen. Jeden Tag übte er mindestens eine Stunde lang Tonleitern und Arpeggien, und sein morgendliches Proben kam mir in seiner Komplexität magisch vor. Im Rock verwenden wir heutzutage eine schlichtere Sprache: Er war schnell.
Das Feriendorf war damals eine typisch englische Institution – ein Urlaubsziel für Arbeiter, die dort im Sommer eine Woche hemmungslos feiern konnten, und oft war Unterhaltung in Form eines Orchesters wie der Squadronaires dabei inklusive. Die übliche Anordnung von einer Familie pro Häuschen schien nicht gerade optimal für heimliche Liebschaften zu sein. Wenn man sich allerdings statt einer Familie in einer dieser Unterkünfte eine Gruppe junger Männer vorstellt und in einer anderen ein paar junge Frauen, dann kann man erahnen, was für Möglichkeiten das eröffnete.
Feriendörfer strahlten etwas Egalitäres aus, aber ich fühlte mich dem gewöhnlichen Volk gegenüber, das hier durchrotierte, immer etwas überlegen. Schließlich gehörte ich zum Orchester, und ich verbrachte den ganzen Sommer dort, bis zu sechzehn Wochen. Von meinem Platz hinter dem Bühnenvorhang lernte ich die Kunst kennen, das Publikum zu fesseln. Ich wuchs mit einem Gefühl dafür auf, was Menschen unterhält, und sah auch den Preis, den das manchmal forderte. Als Gag zur Belustigung der Feriengäste wurde Dad jeden Nachmittag um zwei Uhr vom höchsten Brett in den Swimmingpool geschubst, in voller Orchesteruniform. Wenn er wieder auftauchte, immer noch auf seiner alten Klarinette spielend, tat er, als wäre er traurig, niedergeschlagen. Als Kind ging mir das sehr nah. Mein strahlender Vater wird gedemütigt, dachte ich immer, nur damit ihr Proleten was zu lachen habt.
Ich lernte, mich von diesen gewöhnlichen Leuten abzugrenzen, den Kunden, die indirekt unseren Unterhalt bezahlten. Bis heute fühle ich mich, wenn ich auf ein Konzert gehe, bei dem ich nicht selbst auftrete, ein bisschen verloren. Und ich denke immer an meinen Dad.
Im September 1949, mit vier Jahren, kam ich in den Silverdale-Kindergarten in Birch Grove, Acton, der meine Mum wahrscheinlich ansprach, weil sie mich in der Uniform niedlich fand, einem roten Blazer mit passender Kappe. Mum war von Natur aus glamourös, und als die Kleiderrationierung nach dem Krieg aufhörte, stattete sie sich aus wie ein Hollywoodstar. Ihre Schwiegereltern missbilligten das. Warum gab sie Dads schwer verdientes Geld für Kleider und einen Privatkindergarten aus, wo sie doch eigentlich einen Kinderwagen schieben sollte?
Ich allerdings war glücklich. Whitehall Gardens bestand aus einer Reihe von Straßen, auf denen es vor Jungs in meinem Alter nur so wimmelte. Unsere Gang wurde von meinem besten Freund angeführt, den wir alle Jimpy nannten, nach einer Figur mit ähnlicher Haartolle in einem beliebten Comic aus dem Daily Mirror. Wie alle Kinder spielten wir Fußball, Cricket, Verstecken und Cowboy und Indianer – unser Lieblingsspiel. Krieg spielten wir bloß mit Zinnsoldaten oder Modellautos: der echte war noch zu frisch im Gedächtnis.
Unsere Fantasie wurde angeregt von Filmen, die wir samstagnachmittags sahen: Roy Rogers, Hopalong Cassidy, Flash Gordon, Die drei Stooges, Charlie Chaplin, Laurel und Hardy, Looney Tunes, Disney-Zeichentrickfilme und so weiter. Laurel und Hardy waren die lustigsten Menschen auf der Welt. Chaplin kam mir altmodisch vor, aber genau genommen waren praktisch alle Filme, die wir zu sehen bekamen, vor dem Krieg gedreht.
Sobald wir aus dem Haus waren, konnten wir mehr oder weniger tun, was wir wollten. Wir krochen unter Zäunen durch, auf Rangiergleise, wir klauten in fremden Gärten Äpfel vom Baum, warfen mit Steinen nach Enten, öffneten jedes unverschlossene Garagentor (Autos waren hochinteressant) und folgten dem Milchmann und seinem Pferdewagen bis zum Gunnersbury Park, ein Weg von hin und zurück gut fünfzehn Kilometern.
Jimpy und ich hatten beide Dreiräder, und eines Tages, mit immer noch erst vier Jahren, fuhren wir zusammen auf meinem in den Park, um einen neuen Abfahrts-Zweier-Geschwindigkeitsrekord auf dem steilen Weg vor dem Herrenhaus aufzustellen. Ich stand auf der Hinterachse, und Jimpy lenkte. Das Dreirad wurde bei hohem Tempo unkontrollierbar, also konnten wir nur geradeaus fahren – und krachten genau in eine halbhohe gemauerte Beeteinfassung am Fuße des Hügels. Wir landeten beide mit dem Gesicht auf der Erde, erschrocken und blutend. Das Dreirad war so schlimm verbogen, dass wir damit nicht nach Hause fahren konnten. Mein Nasenbluten dauerte zwei Tage.
1950, als ich fünf wurde, kam ich nicht mit meinen Freunden zusammen auf unsere kostenlose öffentliche Grundschule. Mum fand mich immer noch niedlich in Uniform, daher meldete sie mich auf der privaten Beacon House School an, einen Kilometer von unserem Haus entfernt. Ich kannte keines der Kinder dort, kann mich an niemanden von dort erinnern und hasste praktisch jede Minute.
Die Schule war in einem Einfamilienhaus untergebracht, und als Aula diente ein kleines Hinterzimmer, in das wir jeden Morgen »Onward Christian Soldier« singend einmarschieren mussten wie ein Trupp gehirngewaschener chinesischer Kommunisten. Nach einem ungenießbaren Mittagessen erwartete man von uns, eine Viertelstunde an unseren Schreibtischen zu schlafen. Wenn wir auch nur zuckten, wurden wir ausgeschimpft; weiteres Gezappel konnte zu einem Klaps mit dem Lineal oder Schlimmerem führen. Ich wurde mehrmals mit dem Rohrstock geschlagen und einmal vom Lehrer mit der Gummisohle seines Pantoffels verdroschen.
Einmal war ich so gedemütigt und verletzt, dass ich mich bei meinen Eltern beklagte. Sie sprachen mit der Schulleiterin, deren Reaktion darin bestand, mich ab da besonders grausam zu behandeln. Nun durfte ich tagsüber nicht mal mehr auf die Toilette, und manchmal machte ich mir auf dem langen Heimweg in die Hose, weil ich mir nicht mehr zu helfen wusste. Da ich Angst vor noch härteren Strafen hatte, erzählte ich meinen Eltern zu Hause kein Wort mehr davon. Ich ging zu Jimpy und erhielt dort das Mitgefühl – und die frischen Unterhosen –, die ich zu Hause nicht bekam.
Ungefähr um diese Zeit fing Mum an, mich zum Ballettunterricht zu schicken. Ich betrat einen Raum und sah zwanzig leichtfüßige Mädchen in Tutus, die mich ankicherten. Es gab nur wenige Jungen in der Gruppe. Einmal, als ich mich schlecht benommen hatte, zog der Lehrer mir die Strumpfhose herunter, beugte mich über eine Badewanne und verprügelte mich, während die Mädchen sich aufgeregt in der Badezimmertür drängten.
Es ist vielleicht absurd, aber ich mochte den Ballettunterricht. Seinetwegen bin ich heute fast ein Tänzer. Ich neige zwar selbst heute mit über sechzig noch dazu, die Schultern hängen zu lassen wie ein Halbwüchsiger – in einem Buch über die Alexander-Technik wird tatsächlich ein Foto von mir in jungen Jahren als Beispiel für die »post-adoleszente Fehlhaltung« verwendet –, aber ich bin immer noch ziemlich beweglich, und viel von meiner Bühnenshow basiert auf dem, was ich damals in meinen ersten Ballettstunden gelernt habe. Dad machte allerdings bald klar, dass ihm die Sache mit dem Unterricht nicht behagte, also ging Mum nicht mehr mit mir hin.
Gegen Ende der Sommertour der Squadronaires, der arbeitsreichsten Phase für das Orchester, erhielt Mum einen Anruf von Rosie Bradley, einer guten Freundin des Bruders meiner Großmutter Denny, meines Großonkels Tom. Rosie wohnte in Birchington, genau gegenüber von Dennys Bungalow, und erzählte meiner Mutter schon seit einer Weile zunehmend beunruhigende Geschichten über Denny.
Im Sommer 1951 begann Denny sich absonderlich zu verhalten, und Rosie konnte nicht einschätzen, wie viel davon den Wechseljahren geschuldet war. Mr Buss, Dennys reicher Liebhaber, hatte darauf reagiert, indem er Geld schickte. Rosie fand, Mum sollte hinfahren und sich um sie kümmern. Sie erzählte beispielsweise von mehreren Paketen, die Denny kürzlich geliefert bekommen habe, woraufhin sie quer über die Straße rief: »Rosie, Rosie! Komm und sieh dir das an!« In den Paketen waren vier Abendkleider und zwei Pelzmäntel, trotzdem lief Denny mitten in der Nacht im Morgenmantel auf der Straße herum. Rosie beschrieb das Verhalten von Mums Mutter als »ziemlich plemplem«.
Nachdem sie meine Eltern benachrichtigt hatte, überredete Rosie Mr Buss, eine Zweizimmerwohnung über einer Schreibwarenhandlung in der Station Road in Westgate für Denny zu mieten. Dennoch machte Mum sich weiter Sorgen. »Cliff«, sagte sie zu Dad, »ich glaube, sie schnappt langsam über. Aber vielleicht könnte Pete ja zu ihr ziehen? Es gibt da diese kleine Schule in der Nähe, St. Saviours. Womöglich würde das alles wieder einrenken.« Und darum, so merkwürdig das klingen mag, wurde ich zu meiner Großmutter nach Westgate geschickt und versank in das dunkelste Kapitel meines Lebens.
Dennys häusliche Vorstellungen waren regelrecht viktorianisch. Sie organisierte ihren Tag – und meinen – mit militärischer Präzision. Noch vor sechs Uhr standen wir auf und frühstückten, Toast für sie und Cornflakes und Tee für mich – außer, ich hatte etwas falsch gemacht: Ihre Lieblingsstrafe bestand darin, mir Nahrung vorzuenthalten. Zuneigung bekam ich nur, wenn ich still, vollkommen brav, absolut fügsam und frisch gewaschen war – sprich: nie. Sie war eine böse Hexe und drohte mir gelegentlich sogar mit Zigeunerflüchen. Was hatten sich meine Eltern nur dabei gedacht, mich zu ihr zu schicken?
Als ich mit sechs Jahren nach St. Saviours kam, war ich in Lesen und Schreiben der Schlechteste der ganzen Klasse. Am Ende war ich einer der Besten. Das zumindest war wohl das Gute daran, zu Denny zu ziehen. Ich schrieb einen Brief an Tante Rose, Dennys ältere Schwester, die ihn mir übersät von roten Rechtschreib- und Grammatikkorrekturen zurückschickte. Das verletzte mich, aber Tante Rose sagte Denny auch, dass ich zu alt sei, um nicht anständig lesen und schreiben zu können, und schlug ihr vor, mir ein spannendes Buch bis zur Hälfte vorzulesen, dann aufzuhören und es mich selbst beenden zu lassen. Also las Denny mir Black Beauty von Anna Sewell vor, und der Trick funktionierte. Gefesselt nicht nur von der Geschichte, sondern auch von dem ungewohnten Vergnügen, vorgelesen zu bekommen, schnappte ich mir das Buch im Anschluss sofort und las es fertig.
Ich erinnere mich an kein anderes Buch aus meiner Zeit bei Denny. Einer meiner wenigen Zeitvertreibe bestand darin, mit den Knöpfen einer Kommode zu spielen und zu tun, als wären es die Schalter eines U-Boots. Außerdem hörte ich die Kinderstunde im Radio; die Toytown-Abenteuer mit Larry the Lamb und Dennis the Dachshund waren ziemlich gut.
Der Wohnung gegenüber befand sich eine Bushaltestelle. Manchmal rief Denny aus dem Fenster und lud die Fahrer auf eine Tasse Tee ein. Oder sie brachte ihnen den Tee oder schickte mich. Denny fand nichts Ungewöhnliches daran, in Nachthemd und Morgenmantel auf die Straße zu gehen, und auch mir machte es nichts aus, im Schlafanzug zur Haltestelle zu laufen, um einem Busfahrer einen Tee zu bringen. Aber weitere Strecken fand ich schlimm, zum Zeitungshändler oder Lebensmittelladen, wo ich Erwachsenen auf dem Weg zur Arbeit begegnen würde, die mich komisch ansahen.
Oft weckte Denny mich um fünf Uhr morgens und packte diverse Lebensmittel ein, unter anderem Biskuitkuchen in Backformen. Dann marschierten wir zu mehreren vorher vereinbarten Verabredungen, normalerweise mit Offizieren der American Air Force. Es gab kurze Gespräche, und Denny übergab ein Sandwich oder eine Backform, aber was sie als Gegenleistung erhielt, weiß ich nicht. Ich erinnere mich an große, protzige Autos mit halb offenen Fenstern. Vage erinnere ich mich auch an einen Mann, den ich »Onkel« zu nennen hatte. Er war auf einem Ohr taub und blieb ein paarmal über Nacht. Er hatte ein Hitlerbärtchen.
Die ganze Angelegenheit löste Wut und Verbitterung in mir aus. Jahrelang habe ich im Rahmen einer Psychotherapie versucht, es zu verstehen. 1982 drängte mich meine Therapeutin zu versuchen, auf eine deutlichere Erinnerungsebene vorzustoßen, indem ich diese frühmorgendlichen Begegnungen aufschrieb. Ich fing an, und mitten in der Schilderung eines Treffens – der Air-Force-Offizier kurbelte das Fenster herunter, Denny beugte sich in den Wagen – fiel mir plötzlich zum ersten Mal wieder ein, dass sich die Tür zum Rücksitz öffnete. Ich brach in ein unkontrollierbares Zittern aus und konnte schlagartig nichts mehr schreiben oder mich an irgendetwas erinnern. Mein Gedächtnis schaltete sich einfach ab.
Unsere Wohnung war zum Hausflur im ersten Stock offen und mein Zimmer nie abgeschlossen; der Schlüssel steckte außen. Bekam ich nachts Angst, rannte ich zu Dennys Zimmer. Wenn ihre Tür offen war, scheuchte sie mich weg; wenn sie abgesperrt war, stellte sie sich schlafend und reagierte nicht. Bis zum heutigen Tag schrecke ich in Angstschweiß gebadet und zitternd vor Wut aus dem Schlaf, weil meine Tür zum Treppenhaus nachts nie verschlossen wurde. Ich war ein kleines Kind, erst sechs Jahre alt, und jeden Abend schlief ich mit dem Gefühl ein, unfassbar ausgeliefert, allein und schutzlos zu sein.
Zusätzlich zu den Bussen hatten wir auch Sicht auf den Bahnhof. Ich liebte es, die herrlichen Dampfloks zu betrachten, und träumte davon, solche Momente gemeinsam mit einem Freund, Bruder, Schwester – irgendjemandem zu erleben. Meine letzten Gedanken vor dem Einschlafen kreisten häufig um meine Sehnsucht nach körperlicher Zuneigung. Denny fasste mich nicht an, außer um mir eine Ohrfeige zu geben, mich in der Wanne brutal abzuschrubben oder meinen Kopf unter Wasser zu tauchen, um die Seife abzuwaschen. Eines Abends, als sie die Beherrschung verlor, drückte sie meinen Kopf sehr lange unter.
In St. Saviours gab es mehrere Kinder vom nahe gelegenen amerikanischen Luftwaffenstützpunkt. Ein großer, schlaksiger Junge kam in einem kecken Seersucker-Blazer zur Schule, wie er immer noch in gewissen Teilen der USA gerne getragen wird. Seinen Eltern war überhaupt nicht bewusst, welchen Spott das provozieren konnte. Oder doch zumindest, bis Rosie Bradleys Sohn Robert und ich ihn so schlimm hänselten, dass er in Tränen ausbrach, während seine unglückselige Mutter ihn nach Hause begleitete. Dafür schäme ich mich noch heute.
Der dicke, glatzköpfige, falsch-fröhliche Schulleiter hieß Mr Matthews. Das Fenster in Mr Matthews Büro ging zum Spielplatz, und sein Lieblingsritual bestand darin, Kinder auf seinem Schreibtisch mit dem Rohrstock zu verhauen, während draußen ein Publikum johlender Kinder versammelt war. Einmal landete auch ich vor dem Schreibtisch, warum, weiß ich nicht mehr. Ich beugte mich über die Platte, mit dem Blick zum Fenster, an das sich schaulustige Gesichter drückten, um sich genussvoll an meinem Schmerz zu laben, aber zu ihrer großen Enttäuschung ließ Mr Matthews mich gehen.
Wenn Mum hin und wieder Denny und mich in Westgate besuchte, verströmte sie eine Aura von Londoner Glamour und von Eile, aber auch von Unzuverlässigkeit. Denny stellte weiterhin irgendwelchen Busfahrern und Fliegern nach, und ich war einfach nur unglücklich. Ich hatte meine wunderschönen jungen Eltern gegen ein Leben in spartanischer Disziplin bei einer bemitleidenswerten Frau eingetauscht, die verzweifelt ihre Jugend schwinden sah. Dennys Emotionen mir gegenüber kamen mir rachsüchtig vor, genau wie Mums Vernachlässigung. Und auch der Tod beziehungsweise das Verschwinden der geliebten Männer aus meinem Leben – meines abwesenden Vaters und des kürzlich verschiedenen Königs George VI. – fühlten sich so an, als seien sie zu meiner Bestrafung gedacht. Im Alter von sieben Jahren war ich erfüllt von einem Gefühl, dass sowohl Liebe als auch Regentschaft am Ende seien.
In dieser Zeit ging Mum eine Beziehung mit einem anderen Mann ein. Ich erinnere mich, auf dem Rücksitz eines VW-Käfers zu sitzen und an einer Kreuzung auf der Gunnersbury Avenue zu warten. Mum stellt mir den Fahrer vor, Dennis Bowman; sie sagt, er bedeute ihr sehr viel – und er werde mein neuer Vater sein.
»Ich mag dich lieber als meinen anderen Dad«, sage ich zu Mr Bowman. »Du hast ein Auto.«
Der Wagen ist hellgrün; die Ampel wechselt zu grün, und ich gebe Mr Bowman grünes Licht.
3 YOU DIDN’T SEE IT
Meine Erinnerung an Mr Bowman kehrte erst zurück, als Mum mir Jahre später von ihm erzählte. Rosie Bradley hatte sie über Dennys sich verschlechternden Geisteszustand auf dem Laufenden gehalten, und am Ende bat Mum Dad, sie zu ihrer Mutter zu begleiten. Geschockt von Dennys unberechenbarem Verhalten erklärte er: »Das ist Irrsinn, er kann unmöglich bei ihr bleiben, die ist ja völlig verrückt.« Sie beschlossen, dass Denny bei uns unterkommen sollte, bis es ihr besser ginge. Manchmal glaube ich, ohne Dennys offensichtlichen Wahnsinn hätte ich nie zurück nach Hause gedurft.
Im Juli 1952 holte Mum mich mit dem Zug in Westgate ab – allerdings nicht zusammen mit Dad, sondern mit Dennis Bowman und Jimpy, den zu sehen ich mich sehr freute. Auf dem Rückweg im Zug allerdings wurde deutlich, dass Mum sich nicht darauf vorbereitet hatte, mich wieder bei sich zu haben. Mein Rumgezappel nervte sie, genau wie meine laufende Nase. Ich konnte nichts richtig machen. Dennis Bowman sagte leise zu ihr: »Das ist ein richtig lieber kleiner Junge, den du da hast. Warum lässt du ihn nicht in Ruhe?«
Während meiner Abwesenheit hatten sich die Kinder meines Alters in Acton in zwei Gangs aufgeteilt. Jimpy war der Anführer der größeren Gruppe, und seine Autorität erneuerte er jede Woche durch ein Wettrennen, das er immer gewann. Am Tag meiner Rückkehr schlug ich ihn wie durch ein Wunder beinahe und wurde auf der Stelle zu seinem Vize befördert. Nach dem Rennen ging ich zum Klettergerüst auf dem Spielplatz, das von einem bedrohlich aussehenden Jungen besetzt war, der mich höhnisch angrinste. »Du kommst hier nicht drauf, Kleiner.«
Normalerweise hätte ich Leine gezogen, aber mein neu gewonnenes Selbstbewusstsein trieb mich dazu, ihn herauszufordern. Ich kletterte auf das Gerüst, und als der Junge mich schubste, schubste ich so fest zurück, dass er hinunterfiel. Er klopfte sich die Hose ab, und ich sah ihm an, dass er mit dem Gedanken spielte, mir einen Denkzettel zu verpassen, aber jemand flüsterte ihm etwas ins Ohr. Daraufhin schlich er davon, weil man ihm mit Sicherheit mitgeteilt hatte, dass ich ein Freund von Jimpy war. Schon damals fühlte ich mich glücklich und sicher in einer Jungs-Gang, beschützt von einem männlichen Leittier.
Gerade als meine Kindheit sich zum Besseren wendete, begann der Boden unter meinen Füßen erneut zu schwanken. Es sah aus, als würde ich einen geliebten Elternteil verlieren. Die Einzelheiten erfuhr ich erst Jahre später.
»Dad hatte eingewilligt, dass ich gehe und dich mitnehme«, erklärte Mum. »Und kurz darauf hat Dennis eine neue Stelle im Mittleren Osten bekommen. Er war ein ehemaliger Royal-Air-Force-Offizier mit Auslandsqualifikationen, sehr präsentabel, und wegen des Schlamassels, in den er mich hier gebracht hatte, hat er sich ins Ausland beworben. Schließlich hat er eine Stelle in Aden gekriegt. Sehr gut bezahlt.«
Aber dann hatte Dad es sich anders überlegt.
»Sobald Cliff erfuhr, dass wir nach Aden ziehen, kam er an und meinte: ›Setz dich hin, ich will dir was sagen.‹ Ich hatte schon unsere Fahrkarten, deine und meine. Cliff hat gesagt: ›Ich hab es mir anders überlegt, du nimmst Peter nicht mit. Das ist zu weit weg. Denk noch mal drüber nach, willst du wirklich gehen?‹ Also hab ich drüber nachgedacht und am Ende beschlossen, es noch mal mit deinem Vater zu probieren.«
Ich fragte mich, was Mum mit dem »Schlamassel« meinte, in den Dennis Bowman sie gebracht hatte. War sie schwanger geworden? »Ja. In der Hinsicht war ich in sehr schlechter Verfassung.« Sie zögerte. »Ich hatte ein paar Fehlgeburten.« Sie machte eine lange Pause. »Selbstverschuldete Fehlgeburten.« Nach einer illegalen Abtreibung hatte Mum entschieden, dass sie von da an ihre Schwangerschaften selbst abbrechen würde. »Fünf Mal hab ich das gemacht.«
Ich war sieben und glücklich, wieder zu Hause zu sein, zurück in der lärmenden Wohnung mit Klo im Garten und dem köstlichen Duft jüdischen Essens von oben. Es war alles sehr beruhigend. Jerry Cass hörte immer noch jeden Morgen beim Rasieren eine Viertelstunde lang unfassbar laut Radio, das Dritte Programm der BBC, Klassik, meistens Orchestermusik. (Ich höre immer noch gern zum Aufwachen Radio 3, wie es heute heißt.)
Ich gewöhnte mich wieder in meinen früheren Alltag ein, und das Leben schien verheißungsvoll. Dad war immer noch oft auf Tour oder unterwegs zu Abendauftritten, aber Mum war immer in der Nähe. Manchmal war sie geistesabwesend, spielte aber nicht mehr mit dem Gedanken, Denny auf mich aufpassen zu lassen.
1952 bekamen die Squadronaires ein Sommer-Engagement im Palace Ballroom in Douglas auf der Isle of Man, das über ganze zehn Jahre laufen sollte. In jenem ersten Jahr nahmen wir uns für die gesamten Ferien eine Wohnung, und Mum, die ihre Liebesaffäre noch nicht ganz abgeschlossen hatte, mietete heimlich ein Postfach, wo sie sich Dennis Bowmans täglichen Brief abholte.
Die kleine Ferienwohnung lag im Souterrain eines großen Häuserblocks. Mein Bett stand im Wohnzimmer, eine Verbesserung nach dem Esszimmer. Manchmal wachte ich davon auf, dass Dad barfuß herumschlich, wenn er spät aus der Kneipe kam oder versuchte, sich wegzustehlen.
Ich liebte Jimpy wie einen Bruder. Wir spielten fantasievolle und ausgeklügelte Spiele, und wir waren große Entdecker. In Douglas, der Hauptstadt der Isle of Man, wohin Jimpy uns begleitet hatte, fanden wir ein halb verfallenes altes Herrenhaus, über dessen hohe Mauern wir kletterten, um Äpfel zu stehlen. Das Haus wirkte verlassen. Wir schafften es irgendwie, in einen Anbau reinzukommen, und entdeckten durch ein Schlüsselloch einen Oldtimer. Durch ein anderes Schlüsselloch konnten wir einen Tisch sehen, auf dem anscheinend ein Schatz ausgebreitet lag – alte Uhren, Werkzeug, Ketten. Wir versuchten, die Türen aufzubrechen, aber sie waren gut verschlossen.
Entdecker zu sein, machte Spaß, aber das Tollste überhaupt war, zu den Auftritten der Squadronaires zu gehen. Das hieß, sich schick anzuziehen und von Mum ein paar Shilling für Chips und Milchshakes zu bekommen. Vor Beginn der Tanzveranstaltungen stellten wir uns mitten in den leeren Raum und wippten auf und ab – der gesamte Boden war gefedert. Danach durften wir herumlaufen, der Musik zuhören und die hüpfenden Rocksäume der tanzenden jungen Mädchen beobachten. Manchmal übten wir am Rande der Tanzfläche aus Eichenbohlen unsere eigenen Tanzschritte.
An Sonntagen fanden im Palace Theatre neben dem Ballsaal Konzerte statt, bei denen die Squadronaires Gastkünstler begleiteten, manche davon etwas ganz Besonderes: Shirley Bassey, Lita Roza, Eartha Kitt, Frankie Vaughan, The Morton Fraser Harmonica Gang und eine Reihe von Komikern – ich glaube sogar George Formby war darunter mit seinem albernen kleinen Banjo. Ich erinnere mich an einen Gitarristen, der auf einer E-Gitarre und gleichzeitig auf einer winzigen Mundharmonika spielte. Er sah ziemlich lächerlich aus, und die Mundharmonika piepste so hoch, dass sie wie das Quietschen einer zwischen seinen Zähnen klemmenden Maus klang. Aber er trat regelmäßig bei diesen Konzerten auf, also kam er offenbar beim Publikum gut an.
Als ich das sah, wollte ich unbedingt auch Mundharmonika lernen, und begann ziemlich ernsthaft, auf der von Dad zu üben.
Es war eine wundervolle Zeit auf der Isle of Man in jenem Jahr. Ich verliebte mich in das jüngere blonde Mädchen von nebenan. Eines Tages, als wir »Mutter, Vater, Kind« spielten, hielt ich sie in einem Spielzelt in den Armen und fühlte mich einen Moment lang wie ein richtiger Erwachsener. Ich weiß noch, dass ihre Mutter mir später erzählte, das kleine Mädchen würde mal eine »Herzensbrecherin«, wenn sie groß wäre. Ich hatte keine Ahnung, was sie damit meinte, trotz meines eigenen heftig pochenden Herzens.
Gegen Ende dieses ersten Urlaubs auf der Isle of Man holte Mum Denny zu uns und ließ mich in ihrer Obhut, während sie selbst nach London zurückkehrte, um ein für allemal ihre Affäre mit Dennis Bowman zu beenden. In jenem Herbst begannen Mum und Dad, ihr Liebesleben wieder aufzubauen. Sie versuchten, ein zweites Kind zu bekommen, um die Familie zu stabilisieren und mir ein Geschwisterchen zu schenken. Ich weiß heute, dass der Grund, warum es so lange dauerte – mein Bruder Paul kam erst fünf Jahre später auf die Welt –, Mums ramponierter Reproduktionsapparat war. Vielleicht hätte sie ihrem Körper nicht so viel zugemutet, wenn sie früher gewusst hätte, für welchen Mann sie sich entscheiden würde.
Es muss schwer für meinen stolzen Vater gewesen sein, Mum nach der Sache mit Dennis Bowman zurückzunehmen. Ich glaube nicht, dass er von ihren Abtreibungen wusste, aber falls doch, würde das vielleicht sein Trinken und seine häufigen Abwesenheiten erklären. Es könnte außerdem erklären, warum er sich nach der Versöhnung anscheinend mit seiner Frau und Familie am wohlsten fühlte, wenn er angeheitert war; nur dann konnte er seiner Liebe in Worten Ausdruck verleihen.
Im September 1952 kam ich auf die Berrymede Junior School. Ich erinnere mich daran, dass Denny, wenn ich nach Hause kam, meist mit dem Gesicht an die Balkontür gepresst dastand wie ein seltsames, eingesperrtes Tier. Mum und Dad hatten Denny ihr Schlafzimmer überlassen, das sie mit der traurigen Beute aus ihren Jahren als Mr Buss’ Geliebte angefüllt hatte – Haarbürsten aus echtem Silber, Nageletuis und Ronson-Tischfeuerzeugen. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass sie mir leidtat, aber ich glaube, das stimmt nicht.
Ungefähr um diese Zeit fing ich an zu zündeln. Ich ging von Tür zu Tür und borgte Streichhölzer von den Nachbarn, mit der Ausrede, Mums Ofen sei ausgegangen. Ich habe nie Häuser angezündet, nur Schutthaufen in zerbombten Häusern oder alte Autos. Eines Tages verkalkulierte ich mich: Ich hatte eine Stadt aus Bauklötzen unter einem Kühltransporter gebaut, den ich für herrenlos hielt, dann stopfte ich Papier in die Stadt und steckte sie in Brand. Der Insasse des Lieferwagens sprang heraus und schrie: »Benzin! Benzin! Du bringst uns alle um!«
An einem anderen Tag, als wir auf dem Zerstörungstrip waren, zogen Jimpy und ich ein riesiges Eisenstück quer über die Bahngleise unter der Brücke und legten uns in einiger Entfernung auf die Lauer. Als der Zug kam, rannten wir weg und warteten darauf, einen schrecklichen Unfall zu hören. Das hätte nicht nur viele Menschen verletzen oder sogar töten, sondern uns auch in ein völlig anderes Leben verfrachten können – nämlich in den Jugendknast. Gott sei Dank ist der Zug nicht entgleist.
Zu Hause war unser Hauptzeitvertreib das Radio. Natürlich gab es 1952 auch schon Fernseher, aber wie Millionen andere Briten wartete auch unsere Familie bis zur Krönung der Queen 1953, bevor wir uns einen Apparat anschafften. Ich las auch viele Comics und mochte sehr gern die Noddy-Bücher von Enid Blyton, die erstmals 1949 erschienen, also damals noch ziemlich neu waren. Dad baute ein Modellsegelboot, das wir manchmal sonntags auf dem Round Pond im Hyde Park schwimmen ließen. Er nahm mich auch mit zu Windhundrennen, was ich total faszinierend fand, besonders im White City Stadium. Und er gab mir immer viel zu viel Taschengeld.
Berrymede lag in einem armen Teil des südlichen Acton, und eines Tages in meinem ersten Schulhalbjahr erzählte ich einem Jungen auf dem Spielplatz, dass Dad 30 Pfund pro Woche verdiene. Er nannte mich einen Lügner – der Durchschnittslohn betrug damals weniger als ein Drittel davon –, aber ich blieb hartnäckig, weil ich wusste, dass es stimmte. Wir hätten uns beinahe deshalb geprügelt, doch dann schritt ein Lehrer ein und meinte, ich solle keine Märchen erzählen: »Niemand verdient so viel Geld. Sei nicht so dumm!«
Dad mochte ja gut bezahlt gewesen sein, aber unserem Lebensstil merkte man davon wenig an – abgesehen von Mums Garderobe. Ich trug schmuddelige kurze graue Hosen und einen bunt gemusterten Strickpulli, dazu lange graue Wollstrümpfe, die mir auf die Knöchel rutschten, verdreckte Schuhe und ein weißes Hemd, das natürlich nie ganz weiß war. Wir hatten kein eigenes Auto, wohnten in einer Mietwohnung und fuhren nur selten in den Urlaub. Ein Grammofon hatten wir zwar, hörten aber meine gesamte Kindheit lang dieselben zwanzig Platten, bis ich anfing, selbst neue zu kaufen.
Eine der wenigen verfügbaren Kinderplatten war The Teddy Bear’s Picnic, die Aufnahme von Henry Hall mit dem BBC Dance Orchestra mit »Hush, Hush, Hush! Here Comes the Bogeyman« als B-Seite. Ich hörte sie sehr oft, aber selbst damals bevorzugte ich schon den Sound der modernen Big Bands, einschließlich der Orchester von Ted Heath, Joe Loss und Sidney Torch, bei dem Mum vor ihrer Ehe eine Zeit lang Gastsängerin gewesen war. Seit meiner Zeit bei Denny in Westgate hatte ich eine Abneigung gegen Broadway Musicals: Jeden Tag hatten die unheimlichen Klänge von »Bali Hai« aus South Pacific aus Dennys großer Musiktruhe geknistert, einem Geschenk von Mr Buss. Es gab nur ein Lied in South Pacific, das mir damals gefiel: »I’m Gonna Wash That Man Right Out of My Hair« – diesen Mann werd ich mir aus den Haaren waschen. Aber dank Dennys Badezimmerbrutalität hatte selbst das einen schaurigen Beiklang.
1953 entwickelte sich zu einem der glücklichsten Jahre meines Lebens – doch dann zog Jimpy weg. Bis dahin war er, auch wenn wir nicht mehr auf die gleiche Schule gingen, immer noch der Mittelpunkt meines Daseins gewesen. Jetzt war er plötzlich fort. Meine Eltern beschlossen, ihn durch einen Springer-Spaniel-Welpen zu ersetzen. Ich weiß noch, wie ich an meinem Geburtstag verschlafen aufwachte und mit diesem bezaubernden Hündchen bekannt gemacht wurde, das zusammengerollt in einem Sessel döste. Wir nannten es Bruce.
Bruce wurde mein ganzes Glück, obwohl er schamlos untreu war. Wenn irgendeiner von meinen Freunden oder ein Nachbar aus unserer Straße seinen Namen rief, rannte das verräterische Geschöpf sofort zu ihm; und was ich auch tat, es weigerte sich, zu mir zurückzukommen. Niemand aus meiner Familie kam je auf die Idee, den Hund zu erziehen, mit dem Ergebnis, dass Bruce ziemlich viel durch die Gegend streunte und bellte.
An einem Sommertag knipste ein örtlicher Fotograf ein Bild von meinem Jimpy-Ersatz und mir, das später in der Acton Gazette abgedruckt wurde. Ich sitze neben meinem Hund in der Nachmittagssonne, schläfrig an eine Mauer gelehnt. Für uns war der Bürgersteig damals eine einzige lange Sitzbank. Da hockten wir und kontrollierten wie Nachwuchspenner jeden, der vorbeiging.
Als Gang wurden wir abenteuerlustiger, und als wir etwas älter waren, saßen wir gern unter der West Acton Bridge an der Hauptstrecke der Great Western Railway Richtung Westen. Das Tor an der Twyford Avenue stand immer offen, und unter der Brücke konnten wir vor dem Regen geschützt auf den West Country Express und den Welsh Express von Paddington warten, die dann mit vollem Tempo vorbeidonnerten. Einmal warf ich geistesabwesend ein Stöckchen auf die Gleise, als der Zug sich näherte. Bruce – ganz der geborene Apportierhund – sprang hinterher, die dröhnende Lokomotive fuhr über ihn drüber, und ich war mir sicher, dass er tot war. Plötzlich tauchte er mit dem Stock im Maul zwischen den großen Triebrädern auf, sein Kopf hüpfte mit den Antriebswellen auf und ab. Irgendwie schaffte es das verrückte Vieh, durchzuspringen, ohne sich zu verletzen, und legte den Stock vor den Füßen von Peter S. ab, einem seiner Lieblingsnachbarn. Ich staunte sowohl über seine Unbezwingbarkeit als auch über seine Treulosigkeit.
Eines Tages kam ich nach Hause, und Bruce war weg. Er war zu seinem Züchter zurückgebracht worden – zumindest erzählte Mum das. Ich wusste tief im Inneren, dass er eingeschläfert worden war, aber ich schluckte die Geschichte, damit Mum sich nicht aufregte, weil ich mich aufregte. Ich versuchte mich damit zu trösten, dass er, wenn Mum ihn nicht hätte einschläfern lassen, wahrscheinlich sowieso gestorben wäre.
Bruce war mehr als nur ein Gefährte gewesen. Ohne ihn war ich todunglücklich – nicht nur wegen des Hundes, sondern wegen dem, was er ersetzen sollte. Als Jimpy noch da gewesen war, hatte ich uns als richtige Familie empfunden.
Im Juni 1953 sahen wir uns die Krönungsfeier in Westminster Abbey live auf unserem nagelneuen 23-cm-Fernseher an, auf dem man so gut wie nichts erkennen konnte, wenn nicht alle Lampen aus und die Vorhänge zugezogen waren. Bis dahin hatten meine Eltern mich mitnehmen müssen, wenn sie in den Pub wollten, oder einen Babysitter besorgen. Jetzt, mit dem Fernseher zu meiner Unterhaltung, konnten sie mich zu Hause lassen.
Ganz allein und zu Tode verängstigt sah ich mir die gruselige Science-Fiction-Serie The Quatermass Experiment an. Nach seiner Rückkehr zur Erde verwandelt sich der einzige Überlebende einer Weltraummission, der von Aliens »infiziert« wurde, langsam in ein abstoßendes Wesen. Die Spezialeffekte waren vermutlich ziemlich primitiv, aber der psychologische Effekt war verheerend. Ich bekam furchtbare Albträume. Wenn ich allein war, machte ich mir öfter am Heizstrahler zu schaffen – vielleicht in dem unbewussten Versuch, meine Eltern nach Hause zu zwingen –, faltete Zeitungsstreifen zusammen und zündete sie an den glühenden Drähten an. Zum Glück steckte ich das Haus nie in Brand.
Meine Eltern waren immer noch dabei, ihre Ehe zu kitten, und die Kneipe und ihr Freundeskreis dort spielten bei diesem Prozess eine wichtige Rolle. Damals war es normal, Kinder allein zu lassen, aber ich will nicht so tun, als hätte ich es gemocht oder als normal empfunden. In Wahrheit war die Erfahrung, mich allein, anders, fremd zu fühlen, jedoch viel »normaler«, als mir bewusst war.
Ich war schon immer ein Träumer. Meine neue Lehrerin Miss Caitling bemerkte das und half mir. Sie erwischte mich ein- oder zweimal beim Lügen und gab mir zu verstehen, dass sie Bescheid wusste, machte aber nie eine große Sache daraus. Damit machte diese kluge Frau es mir unmöglich, eine Autoritätsperson für mein Schamgefühl wegen des Schwindelns verantwortlich zu machen. Mir blieb nichts anderes übrig, als einzusehen, dass ich selbst schuld war.
Miss Caitling war nicht im gängigen Sinne hübsch. Sie war untersetzt, hatte dunkle, kurze Haare, wirkte etwas burschikos und trug praktisches Schuhwerk. Aber ihre dunklen Augen waren voller Wärme und Verständnis. Sie setzte sich für die Underdogs ein und war somit die perfekte Lehrerin für das heruntergekommene Viertel, zu dem South Acton mittlerweile geworden war. Sie war weder ein unzuverlässiger Vamp (wie Mum) noch eine böse Hexe (wie Denny); sie war ein völlig neuer Frauentyp für mich.
Was Mädchen meines eigenen Alters anging, war ich voll und ganz auf die Expertise meiner Altersgenossen angewiesen – aber die wussten noch weniger als ich. Und Dad war mir auch keine große Hilfe. Eines Abends, als er betrunken war, klärte er mich auf. »Der Mann pinkelt sozusagen in die Frau«, sagte er. Die restlichen Details waren unzweideutig, deshalb weiß ich nicht, warum er beim entscheidenden Teil schummelte. Ich erinnere mich, diese Informationen, so wie ich sie verstand, an einen Freund von mir weitergegeben zu haben – und auch an seine Verwunderung darüber, dass wir alle aus Urin entstanden sein sollten.
Am 8. Mai 1955 stand Dad gerade im Green’s Playhouse in Glasgow auf der Bühne, als er ein Telegramm von Norrie Paramor von Parlophone Records, das zu EMI gehört, bekam, in dem er ihm einen Solovertrag anbot. Dads Platte »Unchained Melody« wurde am 31. Juli 1956 veröffentlicht. Sein attraktives Gesicht hing in allen Plattenläden der Gegend. Auch wenn der Song »Unchained Melody« nie ein Hit wurde, so ist er doch von mindestens fünf anderen Künstlern gecovert worden, von denen drei gleichzeitig in den Charts waren. Mein Vater, der Popstar! Ich wollte wie er werden.
In diesem Sommer fuhren wir alle wie üblich auf die Isle of Man. Einmal, als die Band im Palace Ballroom spielte, saßen zwei Mädchen rechts und links von mir und zogen mich auf. Sie trugen die Tellerröcke und Petticoats der damaligen Zeit, mit hübschen Schuhen und tief ausgeschnittenen Oberteilen. Ich kam mir sehr klein vor, mein Blick schnellte zwischen ihren wogenden Dekolletés hin und her, während sie erörterten, welches Mitglied der Squadronaires ihnen am besten gefiel. Eines der Mädchen entschied sich sofort für den Schlagzeuger. Das andere nahm sich Zeit und wählte schließlich den Saxofonisten.
»Das ist mein Dad!«, rief ich. Ihre Enttäuschung verwirrte mich.
Der Vorfall bewirkte zwei Dinge: Er weckte in mir den Wunsch, Musiker zu werden, und er nahm mich unwiderruflich gegen Schlagzeuger mit ihrem schnell trommelnden Sexappeal ein.
1956 bedeutete Unterhaltungsmusik noch nicht Rock’n’Roll. Aber in der Goon Show mit Peter Sellers, Spike Milligan und Harry Secombe, die Dad und ich uns im Radio anhörten, liefen einige frühe BBC-Aufnahmen von Rockauftritten. Einer der Stammmusiker der Sendung war Ray Ellington, ein junger englischer Schlagzeuger, Sänger und Kabarettist. Mit seinem Quartett spielte er Songs wie »Rockin’ and Rollin’ Man«, die er extra – und wohl eher hastig – für die Sendung komponierte. Für mich hörte sich das an wie eine Art Hybridjazz: Swingmusik mit dummen Texten. Aber ich fand es jugendlich und rebellisch, wie die Goon Show insgesamt.
Meine Eltern waren der Ansicht, dass ich nur wenig musikalisches Talent besaß, abgesehen von einer dünnen, nasalen Sopranstimme. Dads Klarinetten oder Saxofone durfte ich nicht anfassen, nur meine Mundharmonika.
Nach einem Fiasko mit einer riesigen Forelle bei meinem ersten Angelausflug auf der Isle of Man tröstete ich mich damit, dass ich im Regen Mundharmonika spielte. Ich verlor mich im Klang des Instruments und hatte ein ganz außergewöhnliches, lebensveränderndes Erlebnis: Plötzlich hörte ich Musik in der Musik – satte, komplexe harmonische Schönheit, die in den von mir erzeugten Tönen eingesperrt gewesen war. Am nächsten Tag ging ich Fliegenfischen, und dieses Mal erschien mir das Murmeln des Flusses als eine so gewaltige Quelle von Musik, dass ich immer wieder in Trance fiel. Es war der Beginn meiner lebenslangen Verbindung zu Flüssen und Meer – und zu dem, was man als die Musik der Sphären bezeichnen könnte.
Ich habe mich schon immer zum Wasser hingezogen gefühlt. Ein Schulfreund war bei den Seepfadfindern, und mit meinen elf Jahren beeindruckten mich die Abzeichen und die schneidige Uniform. Er nahm mich mit zu seinem Stammesleiter, und ich wurde sofort für ein »Herbergswochenende« eingetragen, um mich mit der Gruppe vertraut zu machen. Dad befragte einen der Assistenten des Leiters und war sehr misstrauisch. Er erzählte mir, der Bursche wisse nicht mal, wie herum man die englische Flagge aufhänge, und bezweifelte, dass er bei der Navy gewesen sein konnte. Als ich nachhakte, meinte Dad, er glaube, der Mann sei »vom anderen Ufer«, ein Ausdruck, den ich nicht verstand.
Letzten Endes gab Dad doch sein O.K. Das Hauptquartier des Stammes befand sich an der Themse. Es gab einen geräumigen umgebauten Schuppen, in dem man übernachten konnte, und ein großes Ruderboot – das Rettungsboot eines alten Schiffs, mit dem die Pfadfinder Ausflüge machten. Wir kamen am Samstag an und verbrachten den Nachmittag damit, Seemannsknoten von einem Schaubild nachzuknüpfen, was die beiden anwesenden Erwachsenen nicht schafften. Nach einem üppigen Mittagessen begann es schon bald zu dämmern, und wir wurden eilig für eine kurze Fahrt auf dem Fluss ins Boot gescheucht.
Es war Flut und deshalb zu gefährlich zu rudern, also befestigten die Männer einen uralten Außenbordmotor am Heck und warfen ihn an. Als wir am Old Boathouse in Isleworth vorbeiglitten, hörte ich erneut eine ganz eigenartige Musik, ausgelöst vom Heulen des Außenborders und dem Plätschern des Wassers am Rumpf. Ich hörte Geigen, Celli, Hörner, Harfen und Gesang, der immer weiter anwuchs, bis ich unzählige Stimmen eines Engelschors vernahm; es war eine wunderschöne Erfahrung. Solche Musik habe ich seitdem nie wieder gehört, und es war immer mein persönlicher musikalischer Ehrgeiz, diesen Klang wiederzuentdecken und seine Wirkung auf mich noch einmal zu erleben.
Genau auf dem Höhepunkt meines euphorischen Trancezustands lief das Boot auf dem schlammigen Ufer vor dem Schuppen auf. Als es stillstand, hörte auch die Musik auf. Ich fing leise zu weinen an. Einer der Männer legte mir seine Jacke um die Schultern und führte mich zum Lager hinauf, wo ich vor den Ofen gesetzt wurde, um mich aufzuwärmen. Immer wieder fragte ich die anderen Jungen, ob sie die Engel singen gehört hatten, aber keiner von ihnen gab mir auch nur eine Antwort.
Ein paar Augenblicke später stand ich nackt unter einer kalten Dusche beim Schuppen. Es war fast dunkel; eine grelle Glühbirne brannte hinter den beiden Männern, die mich beobachteten, während ich unter dem eisigen Wasserstrahl zitterte. »Jetzt bist du ein echter Seepfadfinder«, sagten sie. »Das ist unser Initiationsritus.« Das einzige Rituelle daran war das Gewichse, das diese beiden Kerle durch ihre Hosentaschen veranstalteten. Es war eiskalt, aber ich durfte die Dusche nicht verlassen, bis jeder von ihnen seinen verstohlenen Höhepunkt erreicht hatte. Ich war angewidert, aber auch verärgert, weil ich wusste, dass ich nicht zurückkommen konnte: Ich würde nie meinen Matrosenanzug bekommen.
Ich erinnere mich nur an einen wirklich schrecklichen Streit zwischen meinen Eltern. Ich saß verängstigt im Esszimmer, während in der Küche Tassen flogen; ich glaube, Mum fuchtelte mit einem Messer herum. Als ich dazwischenging – schluchzend wie ein Kinderdarsteller –, wurde ich von Dad auch noch ausgeschimpft, weil ich mich damit an diesem verabscheuungswürdigen Melodrama beteiligte. Es gab auch Partys, und Dad lud manchmal Musiker ein. Ihr Spielen hielt mich wach, und ich nervte und blamierte Dad, indem ich weinend ins Zimmer platzte und ihn vor seinen Freunden wegen der Ruhestörung zurechtwies. Aber eigentlich war es irrsinnig aufregend. Der Geruch von Zigaretten, Bier und Scotch wehte durch den Flur.
Vielleicht als Entschädigung dafür, dass ich wegen der wilden Partys nachts nicht schlafen konnte, bekam ich ein kleines schwarzes Fahrrad, das ich jeden Tag an meinen Freund David vermietete, der damit seine Zeitungen austrug. Er zahlte mir einen Sixpence die Woche, aber eines Tages erwischte ich ihn dabei, wie er heftig mit dem Fahrrad gegen den Bordstein knallte, und beendete das Arrangement.
Mit meinem neuen Fahrrad lebte ich meine Reiselust voll aus; es gab kaum eine Straße oder Gasse im Umkreis von sechs oder sieben Kilometern, die ich nicht erforschte. Allerdings besaßen in meiner Gang nur wenige ein Fahrrad, und meine Soloausflüge vertieften mein Einsamkeitsgefühl noch. Oft verfiel ich beim Fahren in einen tranceähnlichen Zustand, und einmal wurde ich beinahe von einem Müllwagen überfahren, als ich ihm vor die Motorhaube kurvte, den Kopf voller Engelsstimmen.
Mühsam brachte ich mir die knifflige Mundharmonika-Titelmelodie der Fernsehserie Dixon of Dock Green – gespielt von Tommy Reilly – auf meinem ersten chromatischen Instrument bei. Niemand war auch nur im Geringsten beeindruckt von meiner Leistung, und ich begriff, dass ich das falsche Instrument spielte, wenn ich ein Superstar werden wollte.
Wie viele meiner Altersgenossen verbrachte ich lange, öde Stunden vor diversen Kneipen, ein Päckchen Chips und eine Limo in der Hand, und fragte mich, warum mir solcher Luxus nur gestattet war, wenn meine Eltern sich betranken. Einmal wurde ich beim Klauen erwischt. Ich war in einen Buchladen gegangen, um mir ein paar Bände aus der Observer’s-Reihe zu kaufen, die ich damals sammelte. Ich bezahlte zwei und versuchte, mit sechs zu gehen. Seltsam ist, dass ich vorher wusste, ich würde erwischt. Die Polizei wurde gerufen, und ich wurde vernommen, ehe man mich gehen ließ.
Dad verlor kein Wort über den Vorfall. Es war die nicht unfreundliche Warnung des Polizisten, die mir im Gedächtnis blieb: »Das ist dein erstes Mal, mein Sohn. Mach das letzte draus – das ist ein furchtbarer Weg, den du da eingeschlagen hast.« Ein furchtbarer Weg? Er war ein guter Polizist, aber ich dachte, es wäre offensichtlich, dass ich mich nur langweilte und mir irgendwie die Zeit vertreiben wollte. Um solider zu werden, fing ich an zu sammeln: Modelleisenbahnen, Modellautos, Comics, Briefmarken.
Ich war entschieden unintellektuell, obwohl ich ständig Geschichten schrieb und Hunderte von Bildern malte, hauptsächlich von Schlachten. Eine Zeit lang zeichnete ich wie besessen Konstruktionspläne für eine Fantasieflotte von riesigen, doppelstöckigen Reisebussen. Meine Busse enthielten Klassenräume, Spielzimmer mit elektrischen Eisenbahnen, Schwimmbecken, Kinos, Musiksäle, und als ich auf die Pubertät zuging fügte ich noch ein großes Fahrzeug hinzu, das eine Nudistenkolonie mit Kuschelzimmer beherbergte.
Ein paar Jahre besuchte ich die Sonntagsschule und sang im Kirchenchor. Abends vor dem Einschlafen trällerte ich meine Gebete in den Verschluss meiner Wärmflasche, die ich wie ein Mikrofon hielt. Meine Eltern sträubten sich weiterhin gegen die Vorstellung, dass ich irgendein musikalisches Talent besaß. Egal, ich war bereits ein Visionär. Eine mobile Nudistenkolonie mit Kuschelzimmer? Ich möchte wetten, nicht mal Arthur C. Clarke hat sich so was in dem Alter ausgedacht!
Immer wenn wir Horry und Dot besuchen fuhren, sah ich nicht nur meine geliebten Großeltern, sondern auch Tante Trilby, Dots Schwester. Trilby war ledig, als ich sie kennenlernte, und hatte ein Klavier in ihrer Wohnung. Das war für mich die einzige Möglichkeit, auf einem zu spielen. Tril konnte Noten lesen und spielte leichte Klassik und Schlager, aber sie versuchte nicht, mir viel beizubringen. Stattdessen unterhielt sie mich damit, mir aus der Hand zu lesen und die Tarotkarten zu legen, wobei alles darauf hindeutete, dass ich in jeder Hinsicht sehr erfolgreich werden – oder zumindest ein »großes« Leben haben würde.
Tante Trilby gab mir Zeichenpapier und lobte meine schnellen Skizzen. Nach einer Weile bewegte ich mich dann Richtung Klavier, und nachdem ich mich vergewissert hatte, dass sie in ihr Strickzeug oder ein Buch vertieft war, begann ich zu spielen. Das Instrument war nie ganz richtig gestimmt, aber ich erforschte die Tastatur, bis ich die jeweilige Kombination fand, nach der ich suchte.