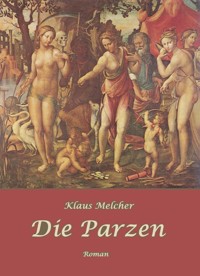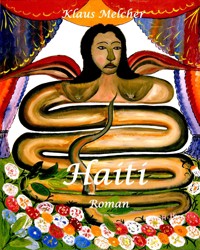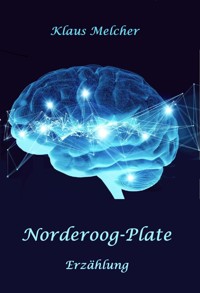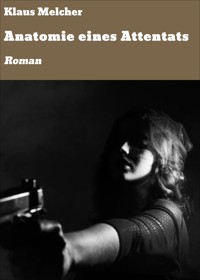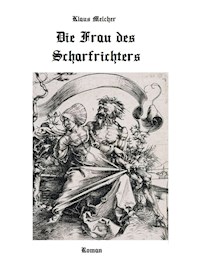Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Alexander Fromm wacht im Krankenhaus auf und erfährt von seinem Sohn, dass er seine Wohnung aufgelöst und seinen Vater in die 'Weserresidenz' eingekauft hat. Nur sehr widerwillig findet sich Fromm mit seinem Schicksal ab und das nur, weil eine der Schwestern ihn an ein amouröses Erlebnis in seiner Jugend erinnert. Im Speisesaal lernt er seinen Tischnachbarn Gustav Preuss kennen, der ebenfalls gegen seinen Willen in die Weserresidenz "gesteckt" worden ist. Um fit im Kopf zu bleiben, hat er eine besondere Strategie entwickelt. Beide beobachten aus einer gewissen Distanz ihre Mitbewohner. Angelika Hapcke, die Leiterin der 'Weserresidenz', von Preuss und Fromm wegen ihrer immer gleichen Kleidung nur das 'Kostüm' genannt, ist um das Wohl der ihr Anvertrauten ehrlich bemüht und nimmt ihre Probleme ernst. So organisiert sie z. B. eine Fahrt nach Hammeln in ein großes Möbelhaus, kleine Feiern im Heim, das Engagement eines Chores zu Weihnachten. Die Freundinnen Anneliese Hohenstedt und Emma Evers haben schon in Berlin mit ihren Ehemännern in einer großen Wohnung gemeinsam gewohnt und sind an die Weser gezogen, nachdem ihre Ehemänner sie miteinander betrogen haben und Frau Evers an Alzheimer erkrankt ist. Die Krankheit macht rasche Fortschritte, und schließlich verlangt Frau Evers das Einhalten eines alten Versprechens. Friedrich Helms wird wegen seiner Unsauberkeit und Schlampigkeit allgemein abgelehnt, wird aber wegen seiner Erzählungen über seine vielen Reisen als Unterhalter von den meisten Bewohnern geschätzt. Besonderes Interesse findet sein Bericht über seinen Aufenthalt in Persien und seine Flucht, den er genüsslich ausschmückt. Besonders elitär gibt sich Elisabeth Kahle. Ihr Vater war Obersturmführer im Konzentrationslager Sachsenhausen. Als Kind hat Elisabeth ihren Vater wegen seiner Uniform und seiner Macht vergöttert. Daran hat sich auch inzwischen nichts geändert. In der 'Weserresidenz' hat sie ein zweites Zimmer gekauft, das sie als Traditionszimmer eingerichtet hat. Der 'Oberst' ist ein pensionierter Bundeswehroffizier, etwas hölzern, aber korrekt. Als Sohn eines der Hitler-Attentäters wurde er nach dem missglückten Attentat '44 in das Kinderheim 'Borntal' bei Bad Sachsa verbracht und lebte nach Kriegsende bei entfernten Verwandten. Ausgerechnet ihm zeigt Elisabeth Kahle stolz ihr Traditionszimmer. Besonderes Interesse bei den Damen erregt der geheimnisvolle Alois Lachleitner, der das letzte freie Appartement bezieht. Er verfügt über glänzende Umgangsformen und kleidet sich stets elegant. Heiratsschwindler im Ruhestand, hat er sich in die Einsamkeit dieser Residenz geflüchtet, um nach Verbüßung einer Gefängnisstrafe nicht wieder rückfällig zu werden. Trotzdem genießt er seine Wirkung auf die Weiblichkeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 378
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Klaus Melcher
Wie im Paradies
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
1. Gefangen
2. Willkommen im Paradies
3. Der Sinn des Lebens
4. Das Chamäleon
5. Wie eine Fliege unter einem Glas
6. Alles ist weg
7. Gott bewahre, dass wir jemals so werden
8. Hennings Geschichten
9. Wundervoll glattes, festes Fleisch
10. Alexanders Traum
11. Pharisäer ham wir nich, nur Kaffe
12. Auf dem Sterbefell
13. Zurück im Leben
14. Manchmal konnte Preuss unglaublich albern sein
15. Willkommen im Möbelparadies
16. Wasch dir das Gesicht, und dann geh!
17. Es war doch alles noch da, in seinem Kopf
18. Je taime
19. Alles neu
20. Das Versprechen
21. Zweifel
22. Das letzte Geleit
23. Fromms Sommernachtstraum
24. Die neue Mitte
5. Die Enso-Lampe
26. Sommertag mit Anneliese
27. Der Verdacht
28. Neugier
29. Geschichte aus 1001 Nacht
30. Soleikha
31. Das Geschenk
32. Adventsgebäck
33. Schuld
34. Er hätte besser aufpassen sollen
35. Das Gerücht
36. Eitel war er eigentlich nicht
37. Julklap
38. Die Abrechnung
39. Fingerübungen
40. Lebkuchen und andere Köstlichkeiten
41. Endlich Bescherung
42. Abgesang
Impressum neobooks
1. Gefangen
Die erste Nacht in diesem Gefängnis!
Als er über den nachtdunklen Flur schlurfte, der nur von einem grässlichen grünlichen fluoreszierenden Licht erleuchtet wurde, befiel ihn wieder die Beklemmung, die er schon einmal verspürt hatte, vor ein paar Tagen oder Wochen, so genau wusste er es nicht mehr, als er in einem ihm unbekannten Zimmer aufwachte. In den Betten neben seinem lagen fremde Menschen, ordentlich aneinander gereiht.
Nachdem er sich so weit zurechtgefunden hatte, dass er vermuten konnte, er befände sich wohl in einem Krankenhaus oder wenigstens einer Krankenstation, zermarterte er sich sein Hirn darüber, wie er wohl hierher gekommen war, was der Grund seines Aufenthaltes war und – nicht weniger wichtig – in welchem Krankenhaus er sich überhaupt befand.
Er fischte nach der Klingel, die, wie er sehr wohl wusste, an jedem Krankenbett entweder von dem Galgen über dem Bett herunter baumelt oder an dem eisernen Nachtisch befestigt ist. Und während er mit seinem Arm vergeblich herumruderte, den ganzen Luftraum über und neben seinem Bett erkundete, ohne eine Klingel zu entdecken, befiel ihn eine ihm bisher unbekannte Beklemmung.
Er wollte aufstehen, fliehen aus diesem Käfig mit schnarchenden, röchelnden, rülpsenden und stinkenden Leibern, die aufgedunsen unter ihren Decken lagen oder zusammengekrümmt vor sich hin wimmerten.
Er wollte - wen auch immer - fragen, wie man dazu käme, diese Menschen, die sich nicht kannten, wie Vieh zusammenzupferchen, aber er hatte nicht die Kraft und wusste nicht, an wen er sich wenden konnte.
Er ließ noch einmal seinen Blick über seine Nachbarn gleiten, und ihm dämmerte,
man hatte ganz sicher gedacht, für die kurze Zeit des ihnen noch verbleibenden Lebens lohnte sich nicht ein besseres Zimmer. Vielleicht hätten sie auch nichts Besseres verdient oder bekämen nicht mit, was um sie herum geschah.
Vielleicht brauchte man auch die anderen Zimmer für Patienten, die den Luxus eines Zweibettzimmers noch zu schätzen wussten. Schließlich muss ein Krankenhaus auch scharf kalkulieren.
Und bei ihnen wurde eben scharf kalkuliert.
Noch bevor sich das Fenster in ein schwarzes Loch verwandelte, kam eine Schwester, warf einen sehr genauen Blick auf einen der Patienten, fühlte seinen Puls, checkte die Monitore, an die er angeschlossen war, schien noch nicht ganz zu glauben, dass die weiße Kurve auf dem grünen Hintergrund zu einer durchgezogenen Linie geschrumpft war, betätigte irgendeinen Schalter und kapitulierte.
Die gerade Linie hatte alle ihre Bemühungen überstanden, sie wieder in eine ausgefranste Kurve zu verwandeln.
Wohl auf ein geheimes Zeichen betraten zwei Ärzte das Krankenzimmer, fühlten ebenfalls den Puls, als hätten sie die Hoffnung, ein zweites Mal würde zu einem anderen Ergebnis führen.
Ein dezentes Nicken. Die Schwester wusste, was sie tun hatte, sie befreite den Patienten von den Apparaten und zog ihm das Laken über den Kopf.
Zwei kräftige Krankenpfleger schoben den Patienten auf den Flur, und während er irgendwo im Keller des Krankenhauses verschwand, wurde sein Bettstellplatz bereits wieder belegt.
Es sprach wenig dafür, dass er lange bleiben würde.
Nun war er weiß Gott niemand, auf dessen medizinische Kenntnisse man etwas geben konnte, aber jeder hier im Zimmer spürten diesen eigenartigen Geruch, den Todgeweihte ausströmen.
Die beiden Ärzte, die eben den Abtransport ihres Zimmergenossen veranlasst hatten, kehrten nach angemessener Zeit in das Zimmer zurück, traten an die Betten, sorgenvoll blickend, aber doch vorsichtig optimistisch: „Das wird schon wieder!“
Was er hatte, und warum er hier lag, wusste er immer noch nicht. Als er den Oberarzt, er vermutete, das war der bedeutender Aussehende von den beiden, fragen wollte, hatte der sich schon zur Tür gewandt und verließ das Zimmer mit wehendem Arztkittel, seinen Kollegen, die Schwester und eine Schwesternschülerin im Schlepp.
Es war schon merkwürdig.
Da liegt man in einem Zimmer zusammen mit jemandem, der gerade stirbt oder gestorben ist. Man bekommt es gar nicht mit, bemerkt nicht einmal, dass er vielleicht schon länger nicht stört, dass er nicht die gewohnten Geräusche von sich gibt, dass er anders riecht.
Und plötzlich erfährt man, er ist gerade gestorben.
Und da fällt es einem auf. Irgendetwas ist anders geworden. Man weiß nur nicht, was.
Und noch etwas wird einem plötzlich bewusst: Vielleicht ist man der Nächste.
Gerade in diesem Moment, in dem sich Alexander Fromm in seine Decke rollen wollte, alles um sich herum vergessen wollte, klopfte es, und sein Sohn trat ein. Müde sah er aus, müde, weil er sich Tag und Nacht Sorgen um ihn gemacht hätte, wie er fast vorwurfsvoll verkündete.
Was er inzwischen alles unternommen hätte, um seinem Vater das Leben zu erleichtern, von Pontius zu Pilatus wäre er gelaufen, hätte all seine Beziehungen spielen lassen, denn so könnte es mit ihm nicht weitergehen, das müsste er doch einsehen.
Alexander Fromm konnte sich nicht daran erinnern, seinen Sohn darum gebeten zu haben. Er hatte sich nie sonderlich um ihn gekümmert, allenfalls mal ein Anruf zu Weihnachten und zu Ostern. Seinen Geburtstag schien er ganz vergessen zu haben, jedenfalls hatte er von diesem Ereignis seit mehr als zwanzig Jahren keine Notiz genommen.
Jetzt also stand er da. Die Hände in den Manteltaschen, den Kragen hochgeschlagen, den Schal lässig um den Hals geschlungen, wie das im Augenblick Mode zu sein schien. Die Augenbrauen zusammengezogen, seine Lieblingszornesfalte auf der Stirn.
Der ganze Mann war ein einziger Vorwurf!
Alexander Fromm wollte seinen Sohn ignorieren. Es gab keinen Grund für seinen Besuch. Bisher war er ohne ihn ausgekommen. Eigentlich kannte er ihn überhaupt nicht.
Als seine Frau weggelaufen war, Monate vor seiner Geburt, und er irgendwann durch das Amtsgericht von seiner Existenz erfuhr, da hätte er ihn gerne als seinen Sohn begrüßt, obgleich er sich seiner Vaterschaft durchaus nicht sicher war. Trotz aller Zweifel hatte er nicht auf einem Vaterschaftstest bestanden, sondern hatte alle Verpflichtungen übernommen.
Dass er mit seinem Sohn nie richtig warm geworden war, lag ganz sicher nicht an ihm. Seine Ex hatte erfolgreich alles daran gesetzt, dass ihm das Sorgerecht entzogen wurde. Zweimal im Jahr durfte er Kontakt zu seinem Sohn aufnehmen, mehr nicht. Und entsprechend steif verliefen die Treffen, bis sie schließlich ganz unterblieben.
Später, als er nicht mehr unter der Fuchtel seiner Mutter stand, spätestens da hätte er sich ab und zu um seinen Vater kümmern können, es gab schließlich viel nachzuholen. Wenigstens mal eine Karte, einen Urlaubsgruß, ein Telefonat.
Aber nein!
Nicht einmal zu dessen Hochzeit war er geladen.
Trotzdem hatte er in dem besten Antiquitätengeschäft der Stadt ein Paar wunderschöne Girandolen erstanden, sie eigenhändig sorgfältig eingepackt und mit den besten Wünschen dem jungen Paar zugeschickt.
Nach ungefähr einem Monat erhielt er die Danksagung: eine unpersönliche gedruckte Karte, die auch als Dank für einen Kochtopf passend gewesen wäre.
All die folgenden Jahre hatte Fromm kaum etwas von seinem Sohn gehört.
Er war mit sich selbst beschäftigt. Seine verkorkste Ehe, die Scheidung, die berufliche und gesellschaftliche Karriere, schließlich der Umzug nach Berlin, das war alles viel wichtiger als sein Vater.
Fromm hatte sich damit arrangiert.
Was wollte er jetzt hier?
Was hatte Fromm getan, dass er ihn jetzt belästigte?
Er schloss die Augen.
„Du kannst hier nicht bleiben!“
Die Stimme seines Sohnes klang rau und kalt.
Unwillkürlich musste Fromm schmunzeln über so viel Dummheit.
Wer sagte ihm, dass er hier bleiben wollte?
Er hatte eine schöne Wohnung, alle Geschäfte, Ärzte und was man in seinem Alter sonst noch so braucht, in unmittelbarer Nähe.
Warum sollte er wohl hier bleiben wollen?
„Hör zu, ich habe mit Dr. Freise gesprochen. Am Samstag kannst du wahrscheinlich das Krankenhaus verlassen.“
Er war also im Krankenhaus! Hatte er sich irgendwie schon gedacht.
Gerade wollte er fragen, in welchem Krankenhaus er war und warum, da unterbrach sein Sohn seine Gedanken.
„Aber in deine Wohnung kannst du natürlich nicht wieder zurück!“
Da war er wieder, so ein Tiefschlag, wie er ihn von seinem Sohn eigentlich hätte erwarten müssen.
Er wollte lautstark protestieren, schließlich bestimmte er immer noch selbst, wo er wohnte, da unterbrach ihn sein Sohn und hörte nicht auf zu reden, bevor er ihm in seiner unbestechlichen Logik auseinandergesetzt hatte, dass er unmöglich in seine alte Wohnung zurückkehren könnte. Er könnte die Verantwortung nicht übernehmen.
Als ob er das je getan hätte und er ihn darum gebeten hätte!
So ein Schlaganfall könnte jederzeit wieder kommen, und dann läge er unter Umständen tagelang alleine in der Wohnung, bis …
Fromm hatte also einen Schlaganfall erlitten!
„Hörst du mir überhaupt zu?“
Sein Sohn schien ärgerlicher geworden zu sein.
Er stand von dem Bettrand auf, auf den er sich gesetzt hatte, da kein Stuhl frei war, wandte sich zum Fenster und sah einen Augenblick in die Dunkelheit, gerade kurz genug, um seinen Vater nicht wieder zu Worte kommen zu lassen.
„Ich habe dir ein Appartement in der“, er zog einen Zettel aus der Tasche, entfaltete ihn und warf einen Blick darauf, „in der ‚Weserresidenz’ besorgt. Du wirst von hier direkt dorthin entlassen.“
Fromm wollte etwas sagen, wollte protestieren, ihn fragen, wie er dazu käme, über seinen Kopf hinweg zu entscheiden, wollte ihm Unfreundlichkeiten an den Kopf werfen, ihn beschimpfen, doch er kam nicht dazu.
„Das ist alles besprochen“, fuhr er fort. „Einige Möbel, der Lehnstuhl, die Barockkommode und der kleine Sekretär, deine Wäsche, soweit sie noch anständig ist, und einige Erinnerungsstücke sind schon drüben. Bett und Schrank stellt das Haus. Die Bilder habe ich in einen großen Karton gepackt, sie stehen im Lager. Der Hausmeister wird dir beim Aufhängen helfen.“
Er holte Luft, und Fromm nutzte die unerwartete Pause.
„Ich denke nicht daran, in dieses … - wie heißt es noch mal? – ist ja auch egal, in dieses Altersheim zu ziehen!“
Endlich hatte er es geschafft, hatte ihm seinen Willen unmissverständlich mitgeteilt.
Ein für allemal, er bestimmte selbst über sein Leben! Und wenn er in der Wohnung verrottete, war das allein seine Angelegenheit!
Ein süffisantes Lächeln umspielte die Lippen seines Sohnes.
Er gab sich noch nicht geschlagen. Er hatte noch einen Trumpf.
„Willst du auf der Straße sitzen?“, fragte er, und nach einer Weile, während derer er seinen Vater von der Seite beobachtete, setzte er fort: „Deine Wohnung ist nämlich gekündigt und ausgeräumt.“
Alexander Fromm hatte schon von ähnlichen Fällen gehört, hatte sie aber nicht ganz ernst genommen, denn das konnte ja nicht passieren, und wenn doch, dann musste schon Gravierendes vorgefallen sein. Er jedenfalls – da war er sich sicher – würde sich mit Händen und Füßen dagegen wehren. Man würde gar nicht erst wagen, ihn zu bevormunden.
Und nun offenbarte sein Sohn ihm so ganz nebenbei, was er für ihn geplant hatte.
Alexander Fromm hatte das Gefühl, in einem Aufzug zu sitzen, der in rasender Geschwindigkeit abwärts fuhr. Seine Beine wurden ihm fortgezogen, im Kopf rauschte es, und obgleich er nichts gegessen hatte, meinte er sich übergeben zu müssen.
Er musste wohl recht entgeistert ausgesehen haben, denn sein Sohn lachte.
„Siehst du, du hast gar keine andere Wahl. Ich wusste, was das Beste für dich ist, und habe es getan.
Also, du ziehst von hier direkt in die Residenz.“
Er zog einen bunten Prospekt hervor und legte ihn achtlos auf die Bettdecke.
„Du kannst dich ja schon mal vertraut machen. Du wirst sehen, es ist wie im Paradies.“
Er knöpfte seinen Mantel zu, nickte seinem Vater knapp zu und ging zur Tür, ohne ein weiteres Wort zu sagen. Es gab für ihn keinen Grund, Liebe oder auch nur Verbundenheit zu heucheln.
Dass er trotzdem dieses sündhaft teure Heim gewählt hatte, war nur seiner eigenen gesellschaftlichen Stellung geschuldet.
Was hätten seine Bekannten und Kollegen von ihm gedacht, hätte er seinen Vater in irgendeinem Heim untergebracht!
Nein, es musste schon ein besonderes sein!
2. Willkommen im Paradies
Der Umzug in sein neues Zuhause gestaltete sich erstaunlich undramatisch.
Obgleich er absolut nicht einverstanden war mit dem, was sein Sohn über ihn verfügt hatte, leistete er keinen Widerstand, sondern ließ alles über sich ergehen.
Anfangs hatte er sich aufbäumen wollen, vermutlich ein letztes Mal in seinem Leben, hatte er etwas pathetisch gedacht, hätte vielleicht einen Tobsuchtsanfall simulieren können, aber dann wären die Männer mit den weißen Jacken gekommen und hätten ihn dorthin gebracht, wo er noch viel weniger gerne sein würde.
Auch Tabletten, in wenigen Tagen gesammelt und von anderen Patienten zusammengebettelt, würden ihm zu einem theatralischen Abgang verhelfen und vielleicht seinen Sohn in Schwierigkeiten bringen, doch das würde nur seine Freiheit ganz erheblich einschränken.
Das Altersheim – seien wir ehrlich und nennen das Kind beim Namen – würde ihm nicht erspart bleiben, auch wenn er sich noch so dagegen sträubte. Andere hatten für ihn die Entscheidung getroffen, und er würde unter ständiger Beobachtung stehen, wenn er Schwierigkeiten machte. Und er könnte es dem Personal nicht einmal verdenken.
Er könnte Essen und Trinken verweigern. Das würde ihm im Augenblick nicht einmal schwer fallen. Aber man würde ihn künstlich ernähren, und das war ihm noch mehr zuwider.
Und so saß er nun, nicht glücklich, aber doch gefasst auf dem Rücksitz eines Krankenfahrzeugs für Sitzendtransporte, wie es im Amtsdeutsch so schön heißt.
Die Innenstadt von Hannover hatten sie hinter sich gelassen, Linden erkannte er von früher, den Ricklinger Kreisel.
Dann musste er wohl eingenickt sein.
Als er aufwachte, passierten sie gerade die letzten Häuser Hamelns.
Also hierher hatte es ihn verschlagen?
Eigentlich hätte er jetzt aufmerksam sein sollen, doch die Aufregungen gestern und heute Morgen waren wohl zu viel. Er nickte wieder ein und wachte erst auf, als der Wagen anhielt, die Straße kreuzte und in eine breite, von hohen Platanen gesäumte Auffahrt bog.
In sanften Bögen schlängelte sich die Straße den Berg hinan und endete auf einem weitläufigen Platz vor einem dreiflügligen schlossartigen Gebäude.
Der breite Mittelflügel wurde beherrscht von einem Säulenportal, zu dem eine weit ausladende Sandsteintreppe empor führte. Rechts und links der zweiflügligen Tür gestatteten hohe Fenster den Blick in eine weitläufige Halle, von der sich wohl der Zugang zu den Seitenflügeln öffnete.
In ihnen schienen mehrere Räume untergebracht zu sein, deren Funktion von außen nicht erkennbar war.
Die beiden Obergeschosse waren ähnlich aufgebaut, ihren Mittelpunkt bildete wie auch im Erdgeschoss eine Halle.
Donnerwetter, entfuhr es Alexander Fromm. Mit einem derartigen Luxus hatte er nicht gerechnet. Hatte sein Sohn sich also nicht lumpen lassen.
Zwei freundliche Frauen, die ältere in einem schlichten grauen Kostüm, die andere, jüngere, in einem weißen Kittel mit trotz der Kälte kurzen Ärmeln, und ein Mann, wohl der Hausmeister oder Hausdiener, standen zum Empfang bereit. Lächelnd, voller unaufdringlicher Freude, wie es schien, über den Besuch.
Die Schwester oder Pflegerin, jedenfalls die in dem weißen Kittel, hakte Fromm unter. Leicht wie eine Feder hing sie an seinem Arm, und führte ihn die wenigen Schritte zur Treppe und dann die Stufen empor. Er hätte sie auch ungestützt gehen können, hätte keine Hilfe gebraucht, aber dann spürte er die leichte Erregung in seinem alten Körper, und er wies die Begleitung nicht fort.
Vorweg war schon das graue Kostüm gegangen, hatte die prunkvolle Eingangstür weit geöffnet und ließ Fromm mit seiner Begleitung eintreten. Ihnen folgte der Hausmeister mit zwei Koffern, wohl seinen. Den einen kannte er, in ihm lagen seine Kleidung und persönlichen Artikel, die er im Krankenhaus hatte. Irgendwer hatte ihn ihm gebracht, vielleicht sein Sohn. Der andere war ihm gänzlich unbekannt. Was er beinhaltete, wusste ich nicht, auch nicht, wie er in den Krankentransportwagen hineingeraten war.
Während er sich noch den Kopf über sein Gepäck zerbrach, obgleich es ihn eigentlich gar nicht interessierte, querten sie die Eingangshalle, einen wenig anheimelnden Raum mit dem angestaubten Charme des ausgehenden neunzehnten Jahrhunderts, dem man durch zwei kleine Sitzgruppen etwas Gemütlichkeit zu verleihen versucht hatte.
Sie gingen daran vorbei und steuerten direkt auf die breite Tür eines Aufzuges zu, der sie in den zweiten Stock brachte.
„Hier haben Sie Ihr Appartement“, sagte ‚das Kostüm’ und tackerte den langen Flur entlang.
An einer der vielen Türen blieb sie stehen und schloss auf.
„Bitte!“
Sie ließ Fromm eintreten.
„Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Wir haben schon Ihre persönlichen Dinge eingeräumt.“
Sie ließ ihren Blick durch das Zimmer schweifen, als wollte sie sich davon überzeugen, dass auch alles da wäre.
Sie schien zufrieden.
Ein kurzes Nicken in Richtung ihres neuen Gastes, und sie ging.
„Soll ich Ihnen beim Auspacken Ihrer Koffer helfen, oder möchten Sie erst noch ein wenig ausruhen, bevor es das Mittagessen gibt? Ich würde dann am Nachmittag kommen, wenn Sie es wünschen.“
Fromm war einverstanden.
Obgleich er auf dem Weg geschlafen hatte, hatte ihn die Fahrt doch angestrengt.
Ein wenig Ruhe würde ihm gut tun.
Das Zimmer, Appartement war wirklich stark übertrieben, war alles in allem vielleicht dreißig Quadratmeter groß, gemessen an seiner Altbauwohnung in der List zwergenhaft.
Man betrat es durch einen Flur mit einer Art Teeküche. Ein Zweiplattenherd mit untergebautem Kühlschrank, eine Spüle, ein Hängeschrank von gleicher Breite und ein schmaler Hochschrank, das war es, aber immerhin, es war wenigstens etwas.
Der Hängeschrank enthielt, soweit er so schnell sehen konnte, zwei Gedecke, einige Gläser und eine Kasserolle.
Der Kühlschrank war vergleichsweise üppig bestückt: je zwei Fläschchen Piccolo und Bier, einige Flaschen Saft und Mineralwasser, ein Becher Joghurt.
Auf der anderen Seite des Ganges befand sich das recht geräumige Duschbad, natürlich behindertengerecht ausgestattet, mit einer schönen großen Dusche mit Glastrennwand, Toilette mit Aufsatz und Waschbecken. Den Aufsatz würde er ablehnen. Schließlich konnte er sich noch ohne große Schwierigkeit setzen.
Gerne hätte er die verschiedenen Strippen abschneiden lassen, die überall an den Wänden herunterhingen, doch die sollten wohl der Sicherheit dienen und würden bleiben müssen.
Der Wohnraum war etwas gewöhnungsbedürftig.
Eine Wand nahmen das Bett, seine Kommode und ein Kleiderschrank aus dem Bestand des Hauses ein. Vor dem großen Fenster gruppierten sich sein geliebter Ohrensessel und zwei kleinere wohl auch hauseigene Sessel um einen kleinen runden Couchtisch.
Recht unmotiviert wirkte der quadratische Tisch an der dritten Wand nahe dem Fenster. Viel machen konnte man an ihm nicht, vielleicht einmal eine Kleinigkeit essen, die man sich in der Teeküche aufgewärmt hatte, oder eine Tasse Kaffee trinken. Mehr ganz sicher nicht.
In der Mitte der dritten Wand, der Kommode gegenüber, stand sein Lieblingsstück, sein Sekretär.
Wenigstens den hatte man ihm gelassen! Und ihn anständig gestellt.
Seine Bilder hatte man noch nicht aufgehängt. Sie standen aufrecht gestapelt in einem Bananenkarton. Man wollte ihm wohl die Freiheit gewähren, sie nach seinem Geschmack zu platzieren. Hammer, Zange und eine Handvoll Nägel lagen auf dem Tisch.
Es klopfte.
„Herein!“
Die nette Schwester, die ihn empfangen hatte, öffnete vorsichtig die Tür und schob ihren Kopf herein.
„Haben Sie alles gefunden?“
Was er gefunden haben sollte, wollte er fragen, doch er ließ es. Sie hatte keine derartige Unhöflichkeit verdient. Und mit dem Personal sollte man sich besser gut stellen.
Ob sie ihn in den Speisesaal führen dürfte, fragte sie, nachdem er ihre erste Frage einfach überhört hatte, und zauberte ein hinreißendes Lächeln auf ihr Gesicht.
Alexander Fromm war knurrig und schlecht gelaunt. Er hasste dieses Haus, das er nicht kannte, er hasste es, wie ein Tattergreis behandelt zu werden, er hasste es, von seinem eigenen Sohn abgeschoben worden zu sein, auch wenn das Haus sicher nicht das schlechteste war.
Er hasste einfach alles!
Aber da war auch diese nette Schwester, die ihn schon beim Empfang an die Hand genommen hatte, ihn wie selbstverständlich in sein Zimmer geführt hatte, die ihm nicht mit irgendwelchem dummen Geplapper auf die Nerven gefallen war, die sich diskret zurückgezogen hatte, um ihm Zeit für sich zu geben, und jetzt wieder da war und ihm anbot, ihn in den Speisesaal zu führen.
Trotzdem, er wollte nicht, war bockig. Und doch ließ er es zu, dass sie seinen Arm fasste und ihn ungeheuer sanft den Flur entlang führte. Ihr Druck war kaum zu spüren, fast nur eine leichte Berührung, von der er sich jeden Augenblick befreien könnte, wenn er es nur wollte.
Doch er wollte es nicht.
Im Gegenteil, er genoss es, an ihrer Seite zu gehen.
„Möchten Sie lieber den Aufzug oder die Treppe nehmen?“, fragte sie und ließ ihm Zeit zum Überlegen. Sie schien unendlich viel Zeit zu haben.
„Kommen Sie, den Blick von hier oben in die Halle sollten Sie sich gönnen“, sagte sie, als er noch unentschlossen war, und führte ihn an ihrer leichten Hand zu der breiten Treppe, die in die Eingangshalle führte.
Es war eigenartig, aber von hier oben wirkte die Halle viel größer, viel edler als von unten, als er sie das erste Mal betreten hatte.
„So, da wären wir“, flüsterte sie und öffnete die Glastür zum Speisesaal.
Der Speisesaal vermittelte noch ganz den Glanz der vergangenen Jahrhunderte.
Üppige Lüster hingen von der hohen Decken und ließen den Saal in sanftem Licht erstrahlen. Überall an den Wänden, die von alten Tapeten mit Jagdmotiven oder galanten Szenen geziert wurden, brach sich das Licht der vielen Kristalle.
Auf dem edlen Parkett waren Tische und Stühle, Fromm vermutete Chippendale, zu Gruppen zusammen gestellt, alle weiß eingedeckt.
Vor den Fenstern, die fast bis an den Boden reichten, hingen luftige, fast transparente Vorhänge und bewegten sich leicht, wenn jemand an ihnen vorbei ging.
An einer Längsseite hatte man Nischen aus Blumenkübeln und niedrigen Bücherregalen gebildet, in denen Vierertische mit leichten Sesseln aufgestellt waren, eigentlich eine Platzverschwendung, die man aber jederzeit korrigieren konnte.
Hierher konnte man sich nach der Mahlzeit für eine Tasse Kaffee zurückziehen.
Die Schwester führte Fromm, immer noch sanft seinen Arm haltend, quer durch den Raum und hielt erst am linken oberen Rand des zweiten Achtertisches an.
„Das wäre Ihr Platz“, lächelte sie.
Er war froh, dass ihn niemand besonders beachtete.
Er fühlte sich fremd, irgendwie sinnlos in diesem Raum, auch wenn er sich Mühe gab, einladend zu wirken.
Er hatte keinen Hunger.
Das letzte Essen lag ihm immer noch wie ein Stein im Magen, und er konnte sich nicht vorstellen, jemals wieder Hunger zu haben.
Jedenfalls nicht hier!
Er hatte etwas ganz Anderes erwartet. Einen Speisesaal mit dem Jugendherbergscharme der Neunziger, mit resopalbedeckten Tischen, damit man die Saucenflecken leichter beseitigen und das Gemüse ohne Schwierigkeit in die Schüssel zurückfüllen konnte.
Und mit Stühlen, nicht gerade einem Ausbund an Komfort. Helle Kiefernholzbeine wurden zusammengehalten durch rote Plastiksitze und Rückenlehnen, alle abwaschbar und stapelbar. Er hatte solche Stühle mal in dem Katalog eines großen Möbelhauses gesehen, und die hatte er hier erwartet.
Diese Einrichtung passte nicht zu seiner Erwartung, und im Augenblick machte selbst das ihn nicht glücklich.
Die ersten Mitbewohner betraten durch die breite Schiebetür an der Stirnseite den Saal, einzeln die meisten, überflogen mit einem leeren Blick den ihnen bekannten Raum, entdeckten den Fremden, der ihnen schon beim Frühstück angekündigt worden war, nahmen aber keinerlei Notiz von ihm, als gäbe es ihn gar nicht.
Langsam strebten sie zu ihrem Platz.
Das alles lief gespenstisch leise ab, wie nach einem festen Plan, fast wie ein Uhrwerk.
Wen würde es an seinen Tisch, an seine Seite verschlagen? Die Alte mit dem langen Putenhals, an dem eine einreihige Perlenkette baumelte, oder der Dicke oder vielleicht der knorrige Lange. Der wäre ihm der Liebste, wenn er wählen dürfte!
Er durfte nicht wählen!
Eine Allerweltsperson steuerte auf den Stuhl neben seinem zu, zog ihn mit einem Ruck zurück, sagte kurz, fast militärisch knapp: „Guten Tag!“, stellte sich in den schmalen Zwischenraum zwischen Stuhl und Tisch, ging etwas in die Knie und zog den Stuhl exakt bis in seine Kniekehlen vor, so dass sein Gesäß mitten auf das Sitzkissen platziert wurde. Das geschah mit einer derartigen Akkuratesse, wie Fromm sie noch nie gesehen hatte.
Der Mann beugte sich ein wenig nach links vor, als wollte er seinen Nachbarn in ein vertrauliches Gespräch ziehen, warf aber nur einen Blick auf seine Serviettentasche und nahm sie auf, als er sich davon überzeugt zu haben schien, dass es seine war.
„Man muss immer aufpassen. Die sind manchmal sehr nachlässig und verwechseln die Servietten.“
Fromm nickte.
Ja, das könnte er sich ohne weiteres vorstellen, bei so vielen Leuten, sagte er, obgleich er nicht wusste, ob sein Nachbar ihn wirklich angesprochen hatte.
Nichts wäre ihm unangenehmer gewesen, als ein Gespräch zu beginnen, das nicht gewünscht war.
Und seinem Nachbarn schien in der Tat nichts daran zu liegen, sich mit Fromm zu unterhalten.
Schweigend entfaltete er seine Serviette, legte sie sorgfältig auf den Schoß, wartete schweigend und kerzengerade auf seinem Stuhl sitzend, dass ihm der Teller mit einer wässrig aussehenden – und ebenso schmeckenden – Suppe gefüllt wurde.
Vorsichtig tauchte er den Löffel ein, vermied sorgfältig, dass die kleinen Sternchennudeln über den Rand schwappten, füllte ihn bis zur Hälfte und führte ihn zum Munde. Nachdem er die Brühe kurz angepustet hatte, um sie abzukühlen, probierte er sie und versenkte den Löffel gleich wieder auf dem Tellerboden.
„Wer soll das essen?“, schimpfte er und schob seinen Teller von sich.
Der Mann, verdammt noch mal, imponierte Fromm!
Schade nur, dass er während des ganzen Essens keinen weiteren Laut mehr von sich gab.
Wie übrigens all die anderen auch, die im Laufe der nächsten Minuten ihren Platz eingenommen hatten und geduldig auf das Essen warteten.
Wer Fromm ebenfalls imponierte, eher den Atem raubte, waren die Serviererinnen.
In keinem Hotel, das er in seinem langen Leben bereist hatte, und er kannte viele und nicht gerade die schlechtesten, hatte er eine derartige Häufung von jungen hübschen Frauen gesehen, alle ausgestattet mit den edelsten Proportionen, endlos langen Beinen und schlankem knackigem Po, mit Brüsten, die jeden Mann noch im Schlaf verfolgen, mit einem Gesicht so voller Liebreiz, dass man das Essen vergaß.
Wie eine Prozession traten sie aus einer Nebentür, aus der das Klappern von Tellern und Töpfen drang, stöckelten, Servierwagen vor sich herschiebend auf die Tische zu, hielten in der Mitte inne, beugten sich, verheißungsvoll lächelnd, leicht vor und gewährten jedem, der es wünschte, einen atemberaubenden Einblick in die Tiefe ihres weißen Kittels, während sie die Teller abräumten.
Gerade wollte Fromm den warmen Duft, der ihrem Dekolletee entströmte, wie ein Ertrinkender in sich aufsaugen, da servierten sie das Hauptgericht, zwei Scheiben Rinderbraten in dicker brauner Sauce, ein Klacks Rotkohl, drei Kartoffeln.
„So ist das immer“, sagte der Nachbar und stocherte auf seinem Teller herum, schob das Fleisch von der einen Seite zur anderen, dass es von allen Seiten in der Sauce gebadet wurde.
„Erst machen sie einem den Mund wässrig, lassen einen in ihrem Duft baden, und dann das! Servieren nur Sauce.“
Er machte eine Pause, aus der die tiefste Enttäuschung sprach, derer ein Mensch fähig war.
„Können sie nicht endlich mal das Versprechen einlösen?“
Sein Nachbar nickte mit dem Kopf in die Richtung, in der sich die letzte Serviererin entfernte.
Auch sie ging kerzengerade, kaum merklich schwangen ihre Hüften, und dann wurde sie von der Küchentür verschlungen.
„Dafür nehme ich selbst das Essen in Kauf“, sagte er, und nach einer Weile fuhr er fort: „Und auch all das andere hier.“
Während Fromm noch überlegte, was sein Nachbar wohl gemeint hatte, sagte er: „Ich heiße übrigens Gustav Preuss.“
Während das Geschirr klappernd wieder abgeräumt wurde und in der Küche verschwand und man auf den Nachtisch wartete, den Höhepunkt fast jeden Mittagessens, begannen die ersten leisen Gespräche. Jetzt hatte man Zeit, verpasste nichts, auch nicht den Nachschlag, der gerne gewährt wurde.
Man wartete geduldig und voller Erwartung.
Augenblicklich verstummte das Raunen im Speisesaal, als die Wagen, voll beladen mit den Dessertschälchen, herein geschoben wurden.
„Bestimmt wieder Vanillepudding mit Schokoladensauce“, mutmaßte Gustav Preuss, „vielleicht auch mit Obst aus der Dose. - Ganz besonders lecker sind die tiefgefrorenen Himbeeren. Aber die gibt es nur an besonderen Feiertagen.“
Sehnsüchtig sah er ihrer zuständigen Serviererin entgegen, und der Grund war jetzt sicher Vanillepudding und nicht die überhaus süße kleine Person, die ihn servierte.
Als Fromm sah, wie verzückt sein Nachbar diese alberne Nachspeise genoss, schob er ihm sein Schälchen zu.
„Ich bin Alexander“, sagte er wie zur Entschuldigung oder Begründung.
„Gustav“, stellte Preuss sich noch einmal vor und zog den Teller zu sich heran.
Nachdem er auch seinen zweiten Pudding verschlugen hatte, legte er seinen Teelöffel in das leere Schälchen, wischte sich den Mund und verstaute die sorgfältig zusammengefaltete Serviette in der Serviettentasche.
Mit einer weit ausholenden Geste, die den ganzen Speisesaal umfasste, wandte er sich wieder Fromm zu.
„Sehen Sie sich in diesem Raum mal um. Was sehen Sie hier?“
Als Fromm nicht gleich antwortete, fuhr er fort: „Lauter alte Leute, alle fast scheintot. Und warum sind hier lauter Gruftis? Weil wir nicht mehr in der Gesellschaft der Jungen gelitten sind. Früher, ja, da waren wir willkommen, als sie uns brauchten. Aber jetzt machen wir nur Umstände, und sie haben für uns einen Platz gesucht weit ab vom Schuss.“
Er lachte bitter.
„Wir sollen einen schönen Lebensabend haben, sagen sie, und das hier wäre wie ein Paradies, gerade richtig für uns, wir hätten uns das schließlich verdient. Aber ganz ehrlich, in Wirklichkeit geht es denen nur darum, dass wir auch beim Sterben keine Umstände machen.“
Ob Alexander Fromm hier bleiben würde, würde sich noch zeigen.
Noch jedenfalls war er nicht davon überzeugt.
Und nur die hübschen Serviererinnen anzustarren, war zwar reizend, aber ob das auf die Dauer ausreichen würde?
3. Der Sinn des Lebens
Als Fromm in sein Zimmer zurückkehrte, erwartete ihn eine Überraschung. Auf dem Tisch standen eine Schale mit etwas Obst, eine Flasche Wasser und vor allem eine reich bebilderte Broschüre mit dem Titel ‚Weserresidenz – Das Paradies im Weserbogen’.
Er setzte sich in seinen Lehnstuhl und schlug das Heft auf. Hübsche farbige Bilder vom Haus, einem ehemaligen Schloss, mit einigen ansehnlichen Nebengebäuden, die wie um einen kleinen Dorfplatz gruppiert waren, und dem Schlosspark sollten Lust auf Entdeckungen wecken.
Gerade hatte er das Heft zur Seite gelegt und wollte ein wenig die Augen schließen, da klopfte es, und die nette Pflegerin betrat das Zimmer.
„Darf ich Ihnen beim Aufhängen der Bilder helfen?“
Sie bemerkte, dass sie offensichtlich störte, hielt sich erschrocken die Hand vor den Mund, stammelte eine Entschuldigung und wollte schon wieder gehen, als Fromm sie – gerade noch rechtzeitig – bat, doch zu bleiben.
Natürlich wäre er ihr dankbar, wenn sie ihm helfen würde, versicherte er ihr. Er hätte zwei linke Hände, hätte noch nie einen Nagel gerade in die Wand bekommen, ohne dass die halbe Wand anschließend gespachtelt und übergestrichen werden musste, und was man dergleichen für Albernheiten sagt, maßlose Übertreibungen, die niemand ernst nimmt und die deshalb vom eigenen Unvermögen ablenken sollen.
Sie machte ihre Arbeit gut, viel besser als er es geschafft hätte.
Hatte sie einmal einen Nagel angesetzt, fixierte sie ihn mit einem doppelten vorsichtigen Pinkern und trieb ihn anschließend mit drei weiteren Schlägen tiefer in die Wand, ohne dass ein Krater rund um ihn heraus brach.
Es war eine Freude, ihr zuzusehen.
„Sie sollten mal das Haus erkunden“, schlug sie vor, als sie auch noch die Bilder aufgehängt hatte, „wenn Sie sich wieder stark genug fühlen.“
Stark genug! Als ob er etwa erschöpft wäre! Sah sie nicht, dass er topfit war?
„Lohnt es denn?“, fragte er und versuchte sich seine leichte Verärgerung nicht anmerken zu lassen.
Sie sah ihn von der Seite an, etwas spitzbübisch, wie ihm schien, aber das konnte er sich auch einbilden. So eine Tochter oder Enkeltochter hätte er sich gewünscht.
Praktisch, zupackend und doch sehr, sehr weiblich.
Und was hatte er?
Einen kaltherzigen Stiesel von Sohn, für den nichts zählte als der berufliche Erfolg, der auf der ständigen Jagd nach Erfolg alles Menschliche verloren hatte, wenn er es überhaupt jemals besessen hatte.
„Na, wie wär’s?“, unterbrach sie Fromms Gedanken.
Schlafen konnte er auch nachher. Die Chance, in netter Begleitung das Haus zu erkunden, kam vielleicht nie wieder.
Das Haus war weitläufiger als er vermutet hatte.
Der Seitenflügel, in dem sich auch sein Zimmer befand, erstreckte sich noch ein ganzes Stück weiter und ging am Ende im rechten Winkel in einen weiteren Flügel über, in dem sich andere Gästezimmer befanden.
Sie gingen nur bis zur Ecke und kehrten zurück in den Hauptflügel, den Fromm schon kannte.
„Treppe oder doch lieber Aufzug?“, fragte die Schwester.
Da er die Treppe kannte, wählte er jetzt den Aufzug, der ungeheuer sanft nach unten glitt.
„Der ist erst drei Jahre alt“, erläuterte die Schwester, als sie Fromms Erstaunen bemerkte.
Sie durchschritten die Halle, gingen vorbei an der Tür zum Speisesaal und betraten die Bibliothek. Hier fühlte sich Alexander Fromm schon beim Betreten wohl.
Schwere dunkelbraune Ledersessel, wie sie früher in jedem gutbürgerlichen Herrenzimmer standen, gruppierten sich – meistens zu viert – um runde Rauchtische, auf denen allerdings die Aschenbecher fehlten.
An den Wänden klebten halbhohe Bücherregale, einige Tageszeitungen hingen an einem Garderobenständer.
Es war erstaunlich, mit wie wenigen Mitteln man eine anheimelnde Atmosphäre, das Gefühl von Vertrautheit herstellen konnte.
Vielleicht würde er sich hier doch irgendwann eingewöhnen.
Gedankenverloren fuhr er mit der Hand über eine Sessellehne, spürte das alte, etwas vernarbte, leicht brüchige Leder, roch es, drückte mit Zeige- und Ringfinger eine Delle in das Polster, spürte den bockigen Widerstand.
Ja, so mussten Ledersessel sein!
Fromm betrachtete die Bücher, die wohl noch aus dem Bestand des Schlosses stammten. Lessing, Goethe und Schiller in Prachtausgaben hinter Glas und die deutschen Romantiker füllten den ersten Schrank, direkt neben der Eingangstür.
Daran schloss sich ein unverglastes Regal an mit Literatur der Jahrhundertwende und der Zeit zwischen den Kriegen. Einige Autoren waren Fromm bekannt, er hatte sie selbst besessen, von anderen hatte er nur gehört, sie aber nie gelesen, wieder andere kannte er nicht einmal dem Namen nach.
Und dann kamen die Regale mit der Nachkriegs- und zeitgenössischen Literatur.
Waren die Bücher anfangs noch nach einem bestimmten System geordnet, so machte man sich jetzt offensichtlich nicht mehr die Mühe. Sie wurden nur noch aneinander gereiht.
Gemein war allen Regalen, dass die Bücher nur so hoch gestapelt waren, dass man sie erreichen konnte, ohne eine Leiter benutzen oder auf einen Stuhl steigen zu müssen.
Und erst da fiel Fromm auf, dass es keinen einzigen Stuhl in diesem Raum gab.
Sicher keine schlechte Entscheidung! Niemand würde versucht sein, auf einen wackligen Stuhl zu klettern, um ein unerreichbares Buch aus dem Regal zu ziehen. Überhaupt, irgendwie begann sein neues Zuhause im zu gefallen.
Anne, so las er erst jetzt auf einem kleinen Schildchen an dem Kittel der netten Schwester, hatte unendlich viel Geduld, beobachtete, wie er diesen Raum ganz in sich aufsog, wie er die Titel der Bücher verschlang.
Nachdem er die Zeitungen flüchtig durchgeblättert und wieder aufgehängt hatte, räusperte sie sich, und sie traten durch die breite Glastür in den herbstlichen Garten.
„Im Sommer kann man hier wunderbar sitzen“, erläuterte sie, „und herrliche Spaziergänge durch den alten Park machen. Früher war er zwar größer, ein Teil ist verpachtet und wird von Bauern der Umgebung bewirtschaftet, aber ich finde, er reicht immer noch.“
„Und die Häuser dort drüben? Sind das die Bauern?“
Anne lachte.
Nein, diese Häuser gehörten zum Schloss. Das wären Wirtschaftsgebäude und vor allem wohnte dort das Personal. In der Scheune dort rechts würde gerade ein Schwimmbad gebaut. Im Sommer sollte es fertig werden. Das würde sicher den Bewohnern sehr gefallen. Dann könnte ihnen auch Wassergymnastik angeboten werden.
Plötzlich fröstelte es Fromm.
Die Sonne hatte sich hinter diffusen Wolken verborgen, und erst jetzt bemerkte er die feuchte Kühle aus dem Park aufsteigen.
Mit beiden Händen umfasste er seine Oberarme, um sie zu wärmen, und die beiden wandten sich eilig dem Haus zu, nahmen gleich den Haupteingang, der sie in die Halle führte.
„Das muss ich Ihnen noch zeigen. Haben Sie noch einen Augenblick Zeit?“
Als er nickte, führte Anne ihn den Gang entlang am Lesezimmer vorbei. An der dritten Tür stoppte sie, zauberte einen Schlüssel aus ihrem Kittel hervor und schloss auf.
„Unser Kiosk“, sagte sie und breitete ihre Arme aus, als wollte sie den ganzen Raum umfassen.
„Viel hat er nicht zu bieten, aber mehr bekommen Sie auch unten im Ort nicht.
Wenn Sie etwas Spezielles haben möchten, müssen Sie es nur sagen, Janoš, unser Hausmeister, versucht es zu besorgen.“
Das Angebot war wirklich überschaubar, doch man gab sich nicht die verzweifelte Mühe, altersgerechte Diät oder Abstinenz durchzusetzen: Kartoffelchips und süßes Gebäck, zwei Sorten Schokolade, preiswerte Pralinen, saure Gurken, Wasser, Bier und Wein, rot und weiß, süß und trocken.
Es waren keine Spitzenweine, aber immerhin trinkbare.
„Die bekommen Sie auch im Speisesaal, aber die werden extra abgerechnet. Und wenn Sie nicht eine ganze Flasche trinken möchten, wird der Rest für Sie aufbewahrt und am nächsten Tag serviert. Sie können ihn aber auch mit auf ihr Zimmer nehmen oder im Lesezimmer trinken.“
Der Speisesaal füllte sich gerade, als sie an der Tür vorbeikamen.
Was suchten all die Alten hier? Sie hatten doch erst vor zwei Stunden ihr Mittagessen zu sich genommen.
Die ersten Kaffeekannen wurden aus der Küche getragen und auf den Tischen verteilt, gefolgt von Kuchenplatten.
Fromm wollte nicht, jetzt war er wirklich müde und wollte ein kleines Nickerchen halten, doch Schwester Anne munterte ihn auf: „Gehen Sie doch! Eine Tasse Kaffee und ein Stückchen Kuchen werden Ihnen gut tun, glauben Sie mir.“
Der Speisesaal war wirklich schon gut besucht, mehr als Fromm von außen gesehen hatte.
Es gab etwas umsonst, und das musste man mitnehmen!
Gustav Preuss saß schon auf seinem Platz, dick, behäbig, zufrieden. Seine Tasse war bereits gefüllt, nur sein Teller war noch leer. Gerade starrte er auf die Kuchenplatte, suchte im Geiste das größte Stück, verglich das eben ins Auge gefasste mit den anderen, konnte sich nicht entscheiden, bis sein Gegenüber ihm die Platte streitig machte.
Preuss hielt sie fest, zog energisch an ihr und griff ein anderes Stück.
Triumphierend sah er Fromm an. Er hatte einen Sieg errungen, und den kostete er jetzt aus.
Fromm setzte sich auf seinen Platz neben ihm. Der Kuchen reizte ihn nicht.
Preuss warf einen sehnsüchtigen Blick darauf, und als Fromm nickte, griff er blitzschnell zu.
Fromm hatte einen Fresser zum Nachbarn!
Schon am Abend, als sie noch im Lesezimmer beisammen saßen, vertraute Preuss ihm an, das machte er immer so, das wäre so eine Art tägliches Training, bei dem er seine Reaktionsgeschwindigkeit übte. Es wäre äußerst wichtig für ihn, um im Kopf fit zu bleiben. Seine größte Sorge wäre, irgendwann abzustumpfen und nur vor sich hin zu dämmern, eine leblose Puppe.
Nur beim Nachmittagskaffee hätte er die Möglichkeit zum Training.
Beim Frühstück und Abendessen bediente man sich am Buffet und mittags würde ein Tellergericht serviert. Hier wäre jede Konkurrenz ausgeschaltet. Wenn man mehr haben wollte, bediente man sich selbst oder bäte um einen Nachschlag.
Nur beim Kuchen gäbe es einen Wettkampf.
Die Kuchenstücke unterschieden sich nur geringfügig voneinander, wären mal so, mal so geschnitten, und deshalb gehörte sehr genaue Beobachtungsgabe dazu, das größte Stück unter den nahezu gleichen herauszufinden. Auch müsste man blitzschnell überschlagen können, ob das etwas dickere, aber schmalere Stück wirklich mehr wäre als das großflächige dünne.
Fromm muss wohl recht abwesend ausgesehen haben, denn plötzlich fragte Preuss: „Interessiert Sie überhaupt, was ich Ihnen erzähle?“
Mit einem Ruck fuhr er zusammen, so als würde er aus einem Sekundenschlaf geweckt.
„Doch, doch!“, beeilte er sich zu versichern.
Er ahnte ja nicht, wie sehr Fromm ihn beneidete. Er hatte einen Sinn in seinem Leben gefunden.
4. Das Chamäleon
Er wusste, es würde wiederkommen, dieses Gefühl des Abgeschobenseins, des Überflüssigen, des Wertlosen. Fast wie Müll kam er sich auf einmal vor, als er in seinem Zimmer war und sich bettfertig machte.
Zwar schaffte er das alles allein, brauchte keine Hilfe, weder beim Ausziehen noch bei den anderen Verrichtungen, aber plötzlich stand das alles wie ein Berg vor ihm.
Hier brauchte er sich keine Sorgen zu machen, ein kurzes Ziehen an einer der vielen Strippen reichte, und eine Schwester oder ein Pfleger würde sofort kommen und ihm helfen. Aber er wollte keine Hilfe!
Sein Sohn hätte darauf sehr großen Wert gelegt, antwortete das graue Kostüm, als Fromm nachfragte, warum sein Sohn dieses Haus gewählt hätte.
„Hat er es Ihnen nicht gesagt?“, fragte sie erstaunt, „fast alle Angehörigen wählen unser Haus wegen der vorbildlichen Betreuung. Wir sind mehrfach zertifiziert.“
Ob er – etwa – etwas auszusetzen hätte, fügte sie hinzu, und ihre Stimme klang leicht feindselig.
Wenn Fromm ehrlich war, er hätte in seiner Wohnung nicht mehr bleiben können. Zwar hätte er sich das Leben erleichtern können, hätte eine Schwester von einem sozialen Dienst kommen lassen können, die nach ihm sah, ihn mit dem Nötigsten versorgte, könnte sich das Essen kommen lassen, könnte einen Schüler damit beauftragen, für ihn einzukaufen, wenn er die wenigen Schritte nicht mehr selbst laufen konnte. Er könnte sich auch einen Pieper um den Hals hängen, mit dem er jederzeit den Notdienst erreichen würde.
Aber war er damit nicht noch abhängiger?
Er lag auf dem Bett, halb ausgezogen, zu mehr hatte die Kraft plötzlich nicht gereicht. Er hätte die Strippe ausprobieren können, die auch an der Wand seines Bettes herunterhing, doch er tat es nicht.
Warum sollte er läuten?
Um sich und dem Personal zu zeigen: Da ist wieder ein Gebrechlicher, der Hilfe braucht?
Das wenigstens wollte er sich noch möglichst lange bewahren, das Gefühl, sich noch selbst steuern zu können.
Zwar konnte er sich nicht an seinen Aufenthalt im Krankenhaus erinnern, doch dass er total auf fremde Hilfe angewiesen war, das war ihm schon klar. Und dieses Bewusstsein war fürchterlich.
Gustav Preuss hatte es geschafft.
Zwar konnte auch er nicht mehr alles leisten, was er wollte, war auch er auf Hilfe angewiesen, vielleicht nicht so sehr wie Fromm oder andere es waren, aber er hatte eine Möglichkeit gefunden, sich über die anderen zu erheben, ihnen zu zeigen, ich bin nicht auf euch angewiesen, ich packe euch!
Dieser simple Kuchentrick, an jedem Nachmittag exakt um 15.33 Uhr vorgeführt, hatte ihn aus seiner Abhängigkeit befreit. Nicht nur, dass er das größte Kuchenstück ergatterte!
Das war nicht der Hauptgrund, auch dass er sein Reaktionsvermögen schulte, sicher nicht, selbst wenn er es behauptete.
Nein, er triumphierte über all die anderen, wenn seine Hand vorschoss und ein bestimmtes Stück Kuchen griff und auf seinen Teller legte.
Dann wusste jeder: Ihm war keiner gewachsen.
Später gewann Fromm allerdings den Eindruck, die Küche gab auf ihren Teller immer ein etwas größeres Kuchenstück, nur um seine Reaktion zu testen oder zu schulen.
Aber das konnte natürlich Einbildung sein, vielleicht auch ein wenig Neid, weil Preuss bevorzugt wurde.
Einmal nur hatte er sich verschätzt und ein falsches Stück gegriffen.
Seine Hand schnellte nicht langsamer vor als gewöhnlich, griff zielsicher wie immer das angepeilte Kuchenstück, ähnlich einem Chamäleon, das mit seiner klebrigen Zunge seine Beute fängt, aber es war ein dünneres Stück als all die anderen. Irgendjemand hatte es manipuliert, und dafür kam eigentlich nur jemand in der Küche in Frage.
Unter dem Kuchen lag, exakt in seiner Größe, ein Stück Karton, vielleicht nur fünf Millimeter stark. Aber das reichte.
Preuss brauchte Wochen, um die Schmach zu verwinden, erst nur die Ungewissheit, wer ihm diesen teuflischen Streich gespielt hatte, dann die vor Schadenfreude blitzenden Augen vieler seiner Mitbewohner, das leise Getuschel, wenn er die Platte fixierte, und schließlich der Applaus, der in der ersten Zeit losbrandete, wenn er seinen Kuchen gegriffen hatte.
Inzwischen haben sich alle beruhigt.
Darauf, den Betrüger zu ermitteln, verzichtete man. Es war niemand ernsthaft geschädigt, und selbst Preuss bestand nach längerem Überlegen nicht darauf, auch nicht darauf, dass sich der Schuldige bei ihm entschuldigte.
Trotzdem blieb ein leichter Schatten zurück.
Zwar spielte Preuss sein Spiel nach wie vor, doch mit weniger Freude. Es fehlte das Blitzen in seinen Augen, und manchem schien sogar, dass er seine Hand nur mit einiger Verzögerung vorschnellen ließ, als misstraute er seinem ersten Eindruck.
Es gab Tage, an denen ließ er sich zur Kaffeezeit gar nicht im Speisesaal blicken.
Als der Platz neben seinem das erste Mal nicht besetzt war, dachte Fromm sich nichts dabei. Warum sollte Preuss nicht auch mal fehlen? Vielleicht war er vom Mittagessen noch zu satt, obgleich er heute nicht besonders viel gegessen hatte. Oder er hatte einfach verschlafen.
Fromm wusste ja nicht, dass er in den annähernd drei Jahren, die Preuss schon hier war, noch nicht einmal die Kaffeetafel versäumt hatte.
Als er ein paar Tage später wieder nicht zum Kaffeetrinken erschien, wunderte sich, Fromm, unternahm aber nichts. Zum Abendessen war Preuss ja wieder da.
Am dritten Tag machte Fromm sich ernsthafte Sorgen. Was lässt jemanden mit einem Brauch brechen, der wichtiger Bestandteil seines Lebens ist?
Er suchte ihn in seinem Appartement auf.
Als er auf sein Klopfen nur ein leises Gemurmel hörte, interpretierte er es als „Herein!“ und öffnete die Tür.
Preuss saß in einer Art Liegesessel, der vor seinem laufenden Fernsehapparat stand, und schlief. Den Ton hatte er abgeschaltet, sein Kopf war etwas vornüber geneigt, der Mund war albern geöffnet, und ihm entströmten regelmäßige, tiefe Schnarchtöne.
Obgleich Fromm es kaum für möglich hielt, musste er ihn geweckt haben, denn Preuss schreckte hoch, riss die Augen auf, und sein Schnarchen brach augenblicklich ab.
„Entschuldigung“, stotterte Fromm, „ich hatte angeklopft und hatte gemeint, Sie hätten ‚Herein!’ gerufen.“