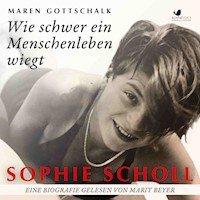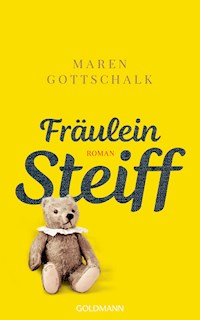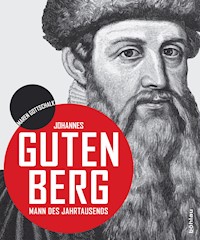17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
VON UNBESTECHLICHER MENSCHLICHKEIT: DAS LEBEN DER SOPHIE SCHOLL
"Wir schweigen nicht, wir sind Euer böses Gewissen, die Weiße Rose lässt Euch keine Ruhe!", hieß es auf einem Flugblatt der kleinen studentischen Widerstandsgruppe in München, zu dessen innerem Kreis neben Alexander Schmorell und Hans Scholl dessen jüngere Schwester Sophie, Christoph Probst, Willi Graf sowie der Universitätsprofessor Kurt Huber gehörten. Selbst vor Roland Freisler sprach die 21-Jährige im Gerichtssaal unbeirrt aus, was sie dachte: "Was wir schrieben und sagten, das denken Sie alle ja auch, nur haben Sie nicht den Mut, es auszusprechen." Postum ist die Studentin, die mit ihren Freunden furchtlos die Stimme erhob gegen das NS-Unrechtsregime und den Vernichtungskrieg, tatsächlich zu einem Gewissen der Deutschen geworden. Heute ist sie weltweit eine der bekanntesten Persönlichkeiten der deutschen Geschichte.
Wenige Tage nach Kriegsbeginn schrieb Sophie Scholl an ihren Freund: "Ich kann es nicht begreifen, daß nun dauernd Menschen in Lebensgefahr gebracht werden von anderen Menschen. Ich kann es nie begreifen und ich finde es entsetzlich. Sag nicht, es ist für’s Vaterland." Gestützt auf teils noch unveröffentlichte Selbstzeugnisse schildert Maren Gottschalk das so verheißungsvolle Leben Sophie Scholls, die sich nach anfänglicher Faszination für die Hitlerjugend immer entschiedener gegen den Nationalsozialismus stellt. 1942 geht sie in den aktiven Widerstand. Am 18. Februar 1943 wird sie mit nur 21 Jahren verhaftet, vier Tage später mit dem Fallbeil hingerichtet.
- Nicht nur die zur Ikone gewordene Widerstandskämpferin in Schwarzweiß, sondern Sophie Scholl in Farbe: lachend, lebensfroh, naturhungrig
- Enthält viele bisher unbekannte Passagen aus ihren Tagebüchern
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
MAREN GOTTSCHALK
Wie schwer ein Menschenleben wiegt
SOPHIE SCHOLL
EINE BIOGRAFIE
C.H.Beck
Zum Buch
Wenige Tage nach Kriegsbeginn schrieb Sophie Scholl an ihren Freund: «Ich kann es nicht begreifen, daß nun dauernd Menschen in Lebensgefahr gebracht werden von anderen Menschen. Ich kann es nie begreifen und ich finde es entsetzlich. Sag nicht, es ist für’s Vaterland.» Gestützt auf teils noch unveröffentlichte Selbstzeugnisse schildert Maren Gottschalk das so verheißungsvolle Leben Sophie Scholls, die sich nach anfänglicher Faszination für die Hitlerjugend immer entschiedener gegen den Nationalsozialismus stellt. 1942 geht sie in den aktiven Widerstand. Am 18. Februar 1943 wird sie mit nur 21 Jahren verhaftet, vier Tage später mit dem Fallbeil hingerichtet.
«Wir schweigen nicht, wir sind Euer böses Gewissen, die Weiße Rose lässt Euch keine Ruhe!», hieß es auf einem Flugblatt der kleinen studentischen Widerstandsgruppe in München, zu dessen innerem Kreis neben Alexander Schmorell und Hans Scholl dessen jüngere Schwester Sophie, Christoph Probst, Willi Graf sowie der Universitätsprofessor Kurt Huber gehörten.
Selbst vor Roland Freisler sprach die 21-Jährige im Gerichtssaal unbeirrt aus, was sie dachte: «Was wir schrieben und sagten, das denken Sie alle ja auch, nur haben Sie nicht den Mut, es auszusprechen.» Postum ist die Studentin, die mit ihren Freunden furchtlos die Stimme erhob gegen das NS-Unrechtsregime und den Vernichtungskrieg, tatsächlich zu einem Gewissen der Deutschen geworden. Heute ist sie weltweit eine der bekanntesten Persönlichkeiten der deutschen Geschichte.
Über die Autorin
Maren Gottschalk studierte Geschichte und Politik in München. Sie arbeitet als Journalistin für den Westdeutschen Rundfunk und hat zahlreiche, von der Kritik sehr gelobte Biografien vor allem für ein jüngeres Publikum verfasst, u.a. zu Nelson Mandela, Andy Warhol und Astrid Lindgren. Zehn Jahre nach ihrer viel gerühmten Lebensgeschichte der Sophie Scholl beschäftigt sie sich auf der Basis von bisher unveröffentlichten Quellen und Gesprächen mit Zeitzeugen noch einmal mit Sophie Scholl.
Inhalt
Sophies Lachen
1.: Stille Rebellion: Im Reichsarbeitsdienst
2.: Wurzeln: Pazifismus und Glaube
3.: Ein Paradies: Die Kindheit in Forchtenberg
4.: Härteres Pflaster: Zwischenstation Ludwigsburg
5.: Es wurde unentwegt marschiert: Ulm 1932/33
6.: Wie ein feuriger wilder Junge: Faszination Hitlerjugend
7.: Romantisch, idealistisch, fanatisch: Jungmädelschaftführerin
8.: Jeden Augenblick leben: Die Suche nach sich selbst
9.: Liebe? Alles sentimentaler Quatsch!
10.: Die Sache mit Fritz: Fragiles Gleichgewicht
11.: Sag nicht, es ist für’s Vaterland: Kriegsgegnerin von Anfang an
12.: Dazu bin ich zu egoistisch: Im Fröbelseminar
13.: Gebt mir Zeit, mich zu bewähren: Ein Krisenjahr
14.: Studium Nebensache: Mit Hans in München
15.: Die Stärkeren im Geiste: Die Weiße Rose
16.: Meinen freien Willen fühle ich: Aktiver Widerstand
17.: Ich bereue meine Handlungsweise nicht: Unbeugsam bis zuletzt
18.: Das Erbe der Weißen Rose
Dank
Anhang
Anmerkungen
Sophies Lachen
1. Stille Rebellion: Im Reichsarbeitsdienst
2. Wurzeln: Pazifismus und Glaube
3. Ein Paradies: Die Kindheit in Forchtenberg
4. Härteres Pflaster: Zwischenstation Ludwigsburg
5. Es wurde unentwegt marschiert: Ulm 1932/33
6. Wie ein feuriger wilder Junge: Faszination Hitlerjugend
7. Romantisch, idealistisch, fanatisch: Jungmädelschaftführerin
8. Jeden Augenblick leben: Die Suche nach sich selbst
9. Liebe? Alles sentimentaler Quatsch!
10. Die Sache mit Fritz: Fragiles Gleichgewicht
11. Sag nicht, es ist für’s Vaterland: Kriegsgegnerin von Anfang an
12. Dazu bin ich zu egoistisch: Im Fröbelseminar
13. Gebt mir Zeit, mich zu bewähren: Ein Krisenjahr
14. Studium Nebensache: Mit Hans in München
15. Die Stärkeren im Geiste: Die Weiße Rose
16. Meinen freien Willen fühle ich: Aktiver Widerstand
17. Ich bereue meine Handlungsweise nicht: Unbeugsam bis zuletzt
18. Das Erbe der Weißen Rose
Literatur
Ungedruckte Quellen
Gedruckte Quellen
Erinnerungen von Zeitzeugen
Literatur
Bildnachweis
Personenregister
Für Ulrike Staudinger
Wir haben alle unsre Maßstäbe in uns selbst, nur werden sie zu wenig gesucht. Vielleicht auch, weil es die härtesten Maßstäbe sind.
Sophie Scholl an Fritz Hartnagel am 16. Mai 1940
Sophies Lachen
An einem sonnigen Wintermorgen im Januar 1943 schlendern die beiden Studentinnen Sophie Scholl und Traute Lafrenz über die Münchner Ludwigstraße. Es ist ungewöhnlich warm, fast fühlt es sich an, als würde der Frühling bevorstehen. Die beiden jungen Frauen haben sich an der Uni getroffen und gehen in Richtung Innenstadt. Sie verstehen sich gut, aber sie sind keine engen Freundinnen und vertrauen sich auch keine persönlichen Geheimnisse an. Traute, eine auffallend schöne, selbstbewusste junge Frau, ist die Exfreundin von Sophies Bruder Hans. Neben ihr wirkt die zwei Jahre Jüngere mädchenhaft. Als schweigsam und in sich gekehrt wird Traute Sophie später beschreiben, aber nicht als schüchtern. Beide Frauen gehören zu dem Freundeskreis, den wir heute Weiße Rose nennen. Sie sind an diesem Morgen unterwegs, um Papier und Umschläge für die nächste Flugblattaktion der Weißen Rose zu kaufen. «An der Straße stand ein Pferd und Wagen, das Pferd schnob laut in die sonnige Luft hinein», erinnert sich Traute. «‹Ha, Kerrle›, sagte Sophie und klopfte ihm lachend den Hals – dann stand sie mit der gleichen Einfachheit, dem gleichen frohen Gesicht im nächsten Schreibwarenhandel und verlangte Briefumschläge.»[1]
Diese lachende Sophie Scholl, die sich auch in Zeiten großer Gefahr und zunehmender Erschöpfung über die Sonnenstrahlen auf ihrem Gesicht freut und im Schnauben des Kutschpferds die gleiche Lebenslust erkennt, die sie selbst spürt, steht immer im Schatten der ernsten Widerstandskämpferin. Zwar gibt es Fotos, die eine lächelnde Sophie zeigen, aber das sind nicht die Bilder, die zuerst in unseren Köpfen auftauchen, wenn wir ihren Namen lesen. Meistens sehen wir sie mit nachdenklichem oder traurigem Ausdruck. Dabei hatte sie noch 1940 ihrem Freund Fritz Hartnagel an die Front geschrieben:
Ich bedaure die Leute, die nicht über jede Kleinigkeit lachen können, d.h. nicht an jedem Ding etwas zum Lachen entdecken können, Salz u. Pfeffer des täglichen Lebens. Das muß mit Oberflächlichkeit nichts zu tun haben. Ja ich glaube, in der traurigsten Minute könnte ich noch etwas Lächerliches finden, wenn nötig.[2]
Sophie Scholl ist eine Heldin der deutschen Geschichte, heute ist sie fast schon ein Mythos: eine junge, zarte Frau, die sich dem NS-Regime mutig entgegenstellte und aus diesem Grund auf brutale Weise ermordet wurde. Es war nicht zuletzt ihre Freude am Leben, die ihr die Kraft dazu gab, gegen die Nazis aufzustehen. Damit ist sie zu einer Ikone des deutschen Widerstands geworden. Ob in Filmen, Büchern oder Theaterstücken – ihr Leben und ihr tragisches Ende werden besonders häufig erzählt. «Bei der Weißen Rose sind wir uns noch alle einig», sagt der Historiker und Pädagoge Umberto Lodovici, der schon Hunderte von Schülerinnen und Schülern durch die Münchner DenkStätte Weiße Rose geführt hat. Während die Motive anderer Widerstandsgruppen, etwa des militärischen Widerstands vom 20. Juli 1944 oder der Roten Kapelle, immer wieder auch skeptisch betrachtet werden, scheinen die Mitglieder der Weißen Rose von einer Aura der Unschuld umgeben, die sie gegen jede Kritik abschirmt. Das verleiht ihnen auf der ganzen Welt eine besondere Anziehungskraft und lässt sie in Deutschland zu beliebten Namenspaten für Schulen werden.
Aber diese Schulen werden nicht nach der Weißen Rose benannt, sondern nach ihren Mitgliedern. Dahinter verbirgt sich der Wunsch, dass Schülerinnen und Schüler sich mit ihnen identifizieren. Den knapp 200 Geschwister-Scholl-Schulen stehen jedoch nur wenige Schulen gegenüber, die nach den anderen Mitstreitern Alexander Schmorell, Christoph Probst, Willi Graf oder Kurt Huber benannt sind.
Dass die Geschwister Scholl in der deutschen Erinnerungskultur einen so prominenten Platz einnehmen, hat nicht zuletzt mit ihrer ältesten Schwester zu tun: Als Inge Scholl 1952 ihr Buch Die Weiße Rose veröffentlichte und darin zuerst den Deutschen und bald darauf den Menschen auf der ganzen Welt ihre Version der Geschichte der Widerstandsgruppe erzählte, stellte sie ihre Geschwister Hans und Sophie ins Zentrum der Ereignisse. Mit ihrem Buch entstand ein Narrativ, das die bis heute sichtbaren Spurrillen gegraben hat. Keine spätere Ergänzung und keine Korrektur des Berichts von Inge Scholl hat es vermocht, den Vorsprung der Bekanntheit zu verkürzen, den die Geschwister vor ihren Mitstreitern genießen. Doch obwohl Inge Scholl ihrem Bruder Hans eine größere Rolle zugestand als ihrer Schwester Sophie, hat diese auch ihn, was die Bekanntheit betrifft, hinter sich gelassen. Im Jahr 2000 wählten Leserinnen der Brigitte sie zur Frau des Jahrhunderts. Es ist Sophie Scholls Büste, die in der Ruhmeshalle von Walhalla steht, ihre Wachsfigur wird im Berliner Kabinett von Madame Tussauds präsentiert, und nach ihr haben sich inzwischen zwei evangelische Gemeinden in Deutschland benannt. Ihr großer Mut und ihr unbedingter Wille, das Richtige zu tun, nehmen uns für sie ein. Aber können wir hundert Jahre nach ihrer Geburt hinter dem bewunderten Heldinnenbild überhaupt noch den Menschen Sophie Scholl erkennen? Nur wenn wir verstehen, wie Sophie Scholl dachte, wie modern und frei sie war, aber auch wie kompliziert und selbstquälerisch, wie wütend und entschlossen, können wir ihre Leistung für den deutschen Widerstand in vollem Umfang würdigen. Dazu gehört auch das Lachen der Sophie Scholl, ihre unbändige Lebenslust, ihre Freude an der Natur, an Musik und Literatur. In Sophie Scholls Leben gab es viel Farbe, die wir heute rasch ausblenden, weil wir die NS-Zeit fast nur aus Schwarz-Weiß-Aufnahmen kennen.
1.
Stille Rebellion: Im Reichsarbeitsdienst
Krauchenwies, 27. April 1941. «Heute ist der dritte Sonntag, den ich hier bin. Da ist mir’s so richtig trübselig zumute. Selbst wenn ich es ganz und gar objektiv ansehe, muss ich sagen: hier ist es nicht schön.»[1] Unglücklich schreibt die 19-jährige Sophie Scholl ihrer Freundin Lisa Remppis. Sie ärgert sich, dass ihr Plan, dem sechsmonatigen Reichsarbeitsdienst (RAD) zu entgehen, nicht aufgegangen ist. Aus diesem Grund hatte Sophie nach dem Abitur eine Erzieherinnenausbildung absolviert, denn es hieß, wer einen sozialen Beruf erlerne, würde vom RAD befreit. Aber am Ende ist sie doch gemustert worden, und seit dem 6. April lebt sie im Lager Krauchenwies bei Sigmaringen.
Zum ersten Mal in ihrem Leben ist Sophie Scholl für mehr als ein paar Wochen aus dem vertrauten Zuhause in Ulm, aus dem Kreis von Familie und Freunden herausgerissen. Genau das ist der Plan der Nazis. Sie rekrutieren mit Hilfe des RAD nicht nur billige Arbeitskräfte, sondern sie richten auch ihre Propagandamaschine auf junge Erwachsene, die aus der Hitlerjugend herausgewachsen sind. «Dann kommen sie in den Arbeitsdienst und werden dort wieder sechs oder sieben Monate geschliffen», hatte Adolf Hitler angekündigt.[2]
Sophie Scholl ist 1941 längst eine Gegnerin des NS-Systems. Sie hasst das geistlose Getöse der Politiker ebenso wie die ständige Bevormundung, und sie verabscheut den Krieg, der jetzt schon fast zwei Jahre währt und aus ihrer Sicht nur sinnlose Opfer fordert. In der geschützten Ulmer Nische konnte Sophie den Krieg zwar nicht aus ihren Gedanken ausblenden, zumal ihr Freund Fritz Hartnagel Soldat ist und auch ihr Bruder Hans und eine Reihe von Freunden immer wieder für Monate Kriegsdienst leisten müssen, aber immerhin lebte sie in Ulm unter gleichgesinnten Menschen, die sich für Musik und Literatur interessieren und mit denen sie sich über religiöse und philosophische Fragen austauschen konnte. Beim RAD hingegen herrscht das geistlose Klima der NS-Zwangsgemeinschaft.
Das «Zivilarbeitslager 501 Krauchenwies» befand sich im Nebengebäude eines heruntergekommenen Schlosses, des ehemaligen Sommersitzes der Fürsten von Hohenzollern-Sigmaringen. 1941 war von der früheren Pracht nur noch die idyllische Lage inmitten eines Parks mit alten Bäumen und einem See geblieben. Die Einrichtung des Lagers war spartanisch. Acht bis zehn «Arbeitsmaiden» teilten sich einen Schlafsaal mit einfachen Stockbetten, unter denen in der Nacht die Mäuse hin und her flitzten. Sophie war froh, ein oberes Bett erwischt zu haben, trotzdem konnte sie in den ersten Nächten wegen der Kälte fast nicht schlafen, denn bis auf das Büro der Lagerleitung waren alle Räume nicht beheizbar. Hungrig war sie auch, denn das Essen – hauptsächlich Pellkartoffeln – war nicht sehr reichlich. Auf dem Gang vor den Schlafräumen standen Spinde, in denen die achtzig jungen Frauen ihre persönliche Habe verstauen konnten.
In den ersten Wochen durften sie das Lager nicht verlassen, sondern wurden für ihren Einsatz im Außendienst gedrillt. Dazu trugen sie RAD-Uniform, blaue Kittelkleider mit weißen Schürzen. Außerhalb des Lagers waren erdbraune Kostüme vorgeschrieben, am Revers steckte eine Brosche mit der Inschrift: «Deutscher Frauenarbeitsdienst – Arbeit für Dein Volk adelt Dich selbst.» Auf das Wecken um 6 Uhr folgten Frühsport, Fahnenappell mit Hitlergruß und gemeinsames Singen. Danach wurden die einen zum Putzen, Waschen oder Bügeln geschickt, andere eilten in die Küche oder den Garten. Am Abend mussten alle zum Unterricht in Erster Hilfe, Hauswirtschaft und nationalsozialistischer Weltanschauung antreten, oder es standen Basteln und Singen auf dem Programm.
«Wir leben sozusagen wie Gefangene, da nicht nur die Arbeit, sondern auch Freizeit zu Dienst wird», schreibt Sophie ihrer Schwester Inge.[3] Erst nachdem die Fahne abends im Beisein der ganzen Gruppe feierlich wieder eingeholt worden ist, dürfen die jungen Frauen bis zum Schlafen ein bisschen private Zeit genießen, Briefe schreiben oder lesen. Für Sophie ist der RAD eine Geduldsprobe, sie ist genervt von der nutzlosen Geschäftigkeit im Lager, wo nichts geschieht außer «Strumpfappell, Zahnglas-Hemden-Handtuchappell» und den eigenen Dreck «zusammenkehren und wieder zerstreuen u. somit nur noch Zeit totschlagen».[4]
Ihr Urteil über die Kameradinnen fällt hart aus: «Ich bin beinahe entsetzt, unter annähernd 80 Menschen nicht einen zu finden, der etwas Kultur hätte», schreibt sie an Lisa:
Es sind wohl Abiturientinnen drunter, die den Faust aus Pietät dabeihaben, sich auch sonst recht kultiviert gebärden, aber alles ist so sehr durchsichtig, so etwas wie ihre Frisur, ihrer eigenen Person zum Schmuck. Der einzige, allerbeliebteste und häufigste Gesprächsstoff sind die Männer. Manchmal kotzt mich alles an. Jetzt zum Beispiel. Deshalb sei so gut und heb diesen Brief nicht länger als einen Tag auf, nicht wahr? Ich verlass mich darauf.[5]
Lisa Remppis hat sich der Aufforderung Sophies nicht gefügt, zum Glück. Denn in den Briefen aus Krauchenwies zeigte die junge Frau eine Seite von sich, die sie sonst lieber verbarg. «Da Du mich nach meiner Belegschaft fragst: […] Kein besonders guter Durchschnitt. Man muss sich in Acht nehmen vor dieser großen Masse. Sie hat in manchen Dingen unheimlich Anziehungskraft. Andererseits ist es oft schwer, nicht ungerecht zu sein.»[6] Sophie wollte sich abseits halten und nicht in diese Gemeinschaft hineinwachsen. «Ich kenne Gott sei Dank niemanden u. hab bis jetzt noch ziemlich meine Ruhe», schrieb sie ihrem jüngeren Bruder Werner, der ebenfalls gerade mit dem RAD begonnen hatte. Die selbstgewählte Isolation gründete nicht nur auf der Ablehnung nationalsozialistischer Werte und der Missbilligung des Jubels über militärische Siege, die abends im Radio verkündet wurden. Sophie konnte sich denken, dass nicht alle Mädchen in Krauchenwies überzeugte Nazis waren, aber sie wollte auch bei ihren harmlosen Aktivitäten nicht mitmachen.
Manche der Frauen, die mit Sophie in Krauchenwies waren, haben vor allem gute Erinnerungen an den Reichsarbeitsdienst, einige bezeichnen diese Zeit sogar als die «unbeschwerteste»[7] ihres Lebens, vor allem diejenigen, die zuvor oder danach in Arbeitsverhältnissen oder familiären Zwängen steckten, die sie mehr einengten als das Lager. Der RAD bot ihnen eine unkomplizierte Gemeinschaft gleichaltriger Frauen, mit denen sie auch über private Probleme sprechen konnten. Deshalb wunderten sich einige über das zarte Mädchen Sophie Scholl, das so ernst und abweisend wirkte. «Ich sah sie selten lachen», erinnert sich Ruth Steinbuch, die zur selben Zeit in Krauchenwies ihren RAD ableistete.[8] Irmgard Hallmann, eine Schülerin aus Ulm betont: «Wir haben auch Spaß dabei gehabt, also wirklich!»[9]
Sophie Scholl (2. v. li.) im Reichsarbeitsdienst, Krauchenwies, Frühjahr 1941
Selbst Sophie gelang es nicht, sich auf Dauer abzuschotten. Nach ein paar Wochen schrieb sie nach Hause, sie habe sich von dem nettesten Mädchen aus ihrem Schlafsaal eine Taschenlampe geliehen, um unter der Bettdecke länger lesen zu können. Auch in der Küche fand sie bald Verbündete, «die mir ab u. zu etwas zukommen lassen».[10] In den Briefen an die Eltern stellte sie die Zeit in Krauchenwies als Herausforderung dar, die sie zu meistern hatte: «Trotz dieser negativen Seiten, die ich da aufgezählt habe, fühle ich mich ganz wohl hier. Und dies dank meinem Wurstigkeitsgefühl, das ich hier noch immer pflege.»[11] Die Taktik, Dinge ungerührt an sich abprallen zu lassen, beherrschte Sophie gut. Sie mochte daher auch nicht die «Modesache» mitmachen und über die Lagerleiterin Fräulein Recknagel meckern, wie es alle andern taten: «Mir tut sie in ihrer Verschrobenheit oft leid. Ich glaube, sie hätte es viel leichter, wenn sie weniger bissig wäre.»[12]
Trotz der munteren Worte: Eltern und Geschwister sorgten sich um Sophie. Inge spürte schon Wochen vor Beginn des RAD, dass die Schwester sich einen Panzer zugelegt hatte: «Es ist oft schwer, gut zu ihr zu sein, weil sie in den letzten Tagen so gleichgültig ist. Aber ich weiß ja, diese Gleichgültigkeit ist nichts andres als Abgeschafftsein.»[13]
Von ihrem älteren Bruder Hans, der in München Medizin studierte und sowohl RAD als auch Wehrdienst hinter sich hatte, bekam Sophie einen Rat: «In drei langen Jahren habe ich gelernt, Wesentliches vom Unwesentlichen zu unterscheiden […] So wird sich immer ein Türlein finden, durch das man hinauswitschen kann, für Minuten frische freie Luft atmen kann, auch bei Dir im Arbeitsdienst.»[14] Die jüngere Schwester enttäuschte den Bruder nicht und schrieb ihm, sie finde «das besagte Türlein immer wieder, und außerdem habe ich ein dickes Fell, an dem alles abläuft, was ablaufen soll. Wenn ihr mir Bücher schickt, dafür bin ich auch immer dankbar. Wenn einem der Betrieb bekannt ist, versteht man es, hier und da etwas Privates einzuschieben.»[15] Ein paar Minuten im Park, eine halbe Seite lesen in der Pause, ein Briefchen zwischendurch in Eile verfasst – das waren die kleinen Freiheiten, die Sophie sich herausnehmen konnte.
Bücher und Briefe waren Sophies rettende Inseln im Meer fremdbestimmter, geistloser Tätigkeit, vor allem in den ersten Wochen des Arbeitsdiensts. «Ich rechne meine Zeit immer von Postausgabe zu Postausgabe», schreibt sie den Eltern.[16] Denn die «Wurstigkeit» nach außen war nur ein Teil ihrer Taktik, um die Zeit zu überstehen. Daneben galt es, sich den inneren Kern zu bewahren, die Freude an intellektuellem Austausch wachzuhalten und die eigenen Ansprüche nicht aus den Augen zu verlieren. Sophie Scholl wollte sich weiterentwickeln, indem sie gerade unter diesen schwierigen Umständen nicht nachließ, ihren Geist zu trainieren. Dafür las sie «mit eiserner Konsequenz» jeden Abend eine Passage in einem ihrer Bücher.[17] Thomas Manns Zauberberg hatte sie bald durch, im Spind lag noch ein Band mit Rilke-Gedichten, aber ihre wichtigste Lektüre waren nun die Bekenntnisse des Kirchenvaters Augustinus, das erste große Selbsterforschungsbuch unseres Kulturkreises, und Die Gestalt als Gefüge, eine Kompilation von Augustinus-Texten, zusammengestellt und kommentiert von dem Theologen Erich Przywara. Sophie erwähnte den Band mehrfach. Inge hatte ihn ihr vor der Abreise in den Koffer gepackt und wies die jüngere Schwester immer wieder auf bestimmte Stellen hin. Sophie musste gestehen, sie sei noch nicht sehr weit gekommen und habe auch Hemmungen, das Buch tagsüber vor den Augen der anderen Mädchen zu lesen. Lieber würde sie es abends im Bett studieren.
Es war nicht nur theologische Belehrung, die sie beim Kirchenvater suchte: «Habe ich Dir schon geschrieben, dass ich allabendlich Augustinus lese? Da steht geschrieben: Du hast uns geschaffen hin zu Dir, und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in Dir.»[18] Nur Lisa erfuhr, dass Sophie diese Lektüre manchmal überforderte. «Im Denken, glaube ich, bin ich etwas schwerfälliger geworden. Ich muss oft laut vor mich hinlesen, um den Sinn der Worte zu erfassen. […] Ich glaube, wenn ich wieder mit jemand Vernünftigem werde sprechen können, dass ich wieder etwas auftaue.»[19] Mit der Lektüre wolle sie sich auch von den Gesprächen der Zimmergenossinnen abschirmen, erklärte Sophie dem Bruder: «Abends im Bett lese ich noch ein bißchen, solange die andern Zoten machen. Daß das abends ekelhaft sein kann, das Geschwätz von soviel anderen (meistens ordinär), wirst Du wohl schon selbst gemerkt haben.»[20] Der gewünschte Effekt trat ein, Sophie blieb für sich, wurde deshalb aber von einigen für hochmütig gehalten.[21]
Ihre Sonderrolle in Krauchenwies zeigte sich auch in der Bevorzugung durch die Lagerleitung. «Unbegreiflicherweise u. ohne mein Zutun ist meine Lagerführerin sehr nett zu mir, ich darf aufs Büro (wo es warm ist) u. schreiben u. zeichnen.»[22] Fräulein Recknagel, die wie Sophie aus Ulm stammte, wusste von ihrem zeichnerischen Talent und forderte von ihr eine große Karte von Griechenland. Seit Beginn des Balkanfeldzugs im Frühjahr 1941 war die Topographie des Landes von Interesse für die RAD-Leitung. Am Abend, wenn die Truppenbewegungen im Radio gemeldet wurden, wollte sie den jungen Frauen zeigen, wo die Deutschen gerade gesiegt hatten. Da Sophie den Nachrichten nicht traute, schrieb sie ihrem Vater, sie wüsste gerne «wie hoch man das Stimmungsbarometer wegen der Kapitulation Griechenlands stellen darf. Hier ist’s enorm hoch.»[23] Kaum verschlüsselt antwortete Robert Scholl: «Das Barometer ist vorübergehend für die Oberflächlichen etwas gestiegen und es kann in nächster Zeit vielleicht noch etwas steigen. Aber der Umschwung kommt mit unausbleiblicher Konsequenz.»[24] Er verhehlte der Tochter also nicht seine Überzeugung, dass die Nazis den Krieg verlieren würden.
Um das Material für die Griechenlandkarte zu besorgen, durfte Sophie allein mit dem Fahrrad nach Sigmaringen fahren, was normalerweise nicht erlaubt war: «Und da war ich von 8–12h wieder einmal frei. Ich bekam ein Vesper mit Wurst und Butter des Stabs dick belegt u. setzte mich irgendwo im Wald hin u. vesperte u. ließ mir’s wohl sein. Das war mein schönster Tag bisher.»[25]
Im Mai durfte Sophie endlich für drei Tage nach Hause fahren, dort beobachtete die Familie sie genau. «Sie ist so munter, so guter Dinge, dabei so klar und frisch in ihren Gedanken und Gesprächen und keine Sprosse ist ihr zu hoch», notierte Inge in ihr Tagebuch, «Ich habe das sichere Gefühl … dass sie das rechte Verhältnis zum Arbeitsdienst hat und dass sie so am sichersten durchkommen und sich ganz und gar bewahren wird.»[26]
Sophie schien ihren Frieden mit dem RAD gemacht zu haben, und die Frage einer Freundin «Warst Du noch nicht rebellisch in Deinem Verein?»[27] hätte sie mit Nein beantworten müssen. Doch es hätte wenig gebracht, der Lagerleiterin offen mit Renitenz zu begegnen, weil das lediglich Strafen und noch mehr Einschränkungen nach sich gezogen hätte. Sophies Aufmüpfigkeit hielt sich also in Grenzen, wie sie zugab: «Als sichtbares (nicht allzu sichtbares) Zeichen meiner dauernden Opposition werde ich noch heute abend eine von Annelieses guten Zigaretten rauchen (ich erhielt gestern ein Päckchen von ihr, das ist doch nett, gell?), denn auch das ist verboten», schrieb sie an Hans.[28] Auch in einem Brief an Inge klingt die Freude über solche kleinen Vergehen durch:
Gestern abend saßen Gisela, Trude und ich noch rauchenderweise hinter einem Heuhaufen, aus kindischem Oppositionsgefühl und diese Tat gibt einem doch, so lächerlich sie auch ist (aber eine Tat ist es) ein Gefühl des Götz von Berlichingen. Wenn nicht vorne, dann eben hintenherum.[29]
Äußerlich hatte Sophie sich mit der Situation arrangiert, aber in ihrem Innern sah es anders aus. Dem Tagebuch vertraute sie Nöte an, die sie mit niemandem teilte. Sie reflektierte ihr Verhalten und ging dabei hart mit sich ins Gericht: «[…] ich erwische mich immer wieder bei kleinen Prahlereien. Es ist ekelhaft, diesen Geltungstrieb zu haben. Schon jetzt, wenn ich schreibe, ist nebenher der Gedanke, wie sich das Geschriebene ausnimmt. Es zerstört jede Harmonie.»[30] Beschämt registrierte sie einen Anflug von Stolz, als sie über die Bevorzugung der Lagerleiterin nachdachte: «Sie verfährt sehr vorsichtig mit mir, daß ich mich manchmal wundere. (Schon wieder muss ich mich dabei gegen ein kleines Triumphgefühl wehren).»[31]
Sophie vergleicht sich mit ihrer Schwester Inge, von der sie etwas herablassend sagt, sie sei viel zu schwärmerisch und reagiere oft mit einem zu hohen Gefühlsaufwand. Dafür aber laufe Inge nicht Gefahr, sich so gespalten zu fühlen, wie Sophie sich gerade erlebe:
Ich glaube, es wäre ihr nicht möglich, neben Gefühlen, oder Gedanken, die einen ganz in Anspruch nehmen sollten, noch nebenher ein so ekelhaftes Teufelchen zu haben, das dich selbst beobachtet u. deine eventuelle Wirkung auf die andern. Ich werde mir das schwer abgewöhnen. Ob es mir gelingt? Dieser Zwiespalt […] verdirbt mir viel u. macht mich schlecht, gemein.[32]
Als Sophie im August 1941 erfährt, dass sie nach dem Ende des RAD im Oktober noch immer nicht studieren darf, sondern noch ein weiteres halbes Jahr Kriegshilfsdienst ableisten muss, ist sie aufgebracht. «Ich werde ein altes Weib bis ich zu studieren anfangen kann. – Aber so schnell gebe ich den Kampf nicht auf. Lieber esse ich Gift.»[33] Was immer sie vom Dienst befreien könnte, würde sie versuchen, schreibt sie an Hans, aber letztlich schlagen alle Versuche fehl.
Der erneute Aufschub wird zu einer besonderen Bewährungsprobe: «Aber seltsam, jetzt erst spüre ich so recht, daß mich nichts zwingen wird, ein herrliches Stärkegefühl habe ich manchmal.»[34] Dass sie ihre Zukunftspläne dem NS-System immer wieder unterordnen muss, geht ihr gehörig gegen den Strich. Doch sie ist sich dessen bewusst, dass nicht nur ihr eigenes Lebensglück vom Krieg betroffen ist. Und ihr wird auch klar, dass es auf Dauer nicht darum gehen kann, sich nach innen zu kehren und alles an sich abprallen zu lassen. Sie will sich dem Leben und seinen Aufgaben stellen.
Manchmal schon, besonders in letzter Zeit, empfand ich es als bittere Ungerechtigkeit, in einer solchen von Weltgeschehen ganz ausgefüllten Zeit leben zu müssen. Aber das ist natürlich Unsinn, und vielleicht sind uns wirklich heute Aufgaben, nach außen und mit der Tat zu wirken gestellt. Obwohl es scheint, als bestünde unsere ganze Aufgabe darin, zu warten. Das ist schwierig, und oft möchte einem die Geduld vergehen, und man möchte sich ein anderes leichter erreichbares und erfolgreicheres Ziel stecken.[35]
2.
Wurzeln: Pazifismus und Glaube
Sophies Mutter Lina Scholl wird oft als fleißige Hausfrau beschrieben, die sechs Kinder zur Welt gebracht und sie von früh bis spät mit Wärme und Gottvertrauen versorgt hat. Aber das ist nur ein Teil der Wahrheit. Denn Lina hatte zunächst ganz andere Lebenspläne. Diese über den Haufen zu werfen erforderte Mut und Entschlossenheit.
Geboren wurde Lina Scholl am 5. Mai 1881 als Magdalena Müller in der Kreisstadt Künzelsau im Hohenloher Land.[1] Ihr Vater, der Schuhmacher Friedrich Müller, arbeitete als Schichtmeister in einer Fabrik. Er war Freimaurer und ein stiller Zeitgenosse. Ganz anders seine groß gewachsene Frau Sofie, fröhlich und kontaktfreudig. Sie stammte aus dem Nachbarort Niedernhall und war eine glühende Protestantin. Solange sie Gottes Geboten folge, könne ihr nichts passieren, glaubte sie, und mehr verlangte sie vom Leben nicht. Ihre Tochter Magdalena, schon als Kind von allen Lina genannt, ging in ihrer religiösen Hingabe noch einen Schritt weiter und entschied sich, Diakonisse zu werden. Mit 23 Jahren begann sie eine fünfjährige Ausbildung im Diakoniewerk Schwäbisch Hall. Neben dem Unterricht in Krankenpflege hatte sie Bibel- und Diakonielehre. 1909 wurde Lina Müller eingesegnet und trug zu diesem Anlass zum ersten Mal die schwarze Schwesterntracht mit weißem Kragen und weißer Haube. Mit 28 Jahren war sie eine junge Frau, die im Umgang mit hilfsbedürftigen Menschen Selbstbewusstsein zeigte und den Gemeindedienst mit großem Eifer erfüllte.
Nach dem Beginn des Ersten Weltkriegs pflegte sie seit September 1914 Verwundete im Lazarett von Schloss Hochdorf bei Ludwigsburg. Freiherr von Tessin schrieb voller Anerkennung an den Leiter der Diakonissenanstalt, Pfarrer Gottlob Weißer: «Es wird Sie gewiss freuen zu hören, dass die Schwester Lina sehr gut eingeschlagen ist. Da ich schon 11 Mann habe, gibt es sehr viel Arbeit, aber mit Fleiß und Geschick wird sie mit allem fertig. Namentlich ist sie bescheiden und versteht es auch mit den Leuten sehr gut.»[2] Drei Monate später, am 12. Januar 1915, wurde Lina Müller an einen neuen Einsatzort versetzt, das Reservelazarett II in Ludwigsburg. Hier kamen neben der Krankenpflege vor allem hauswirtschaftliche Aufgaben auf sie zu: Wäsche waschen, kochen, backen, Kleidung ausbessern.
Die Leitung der Diakonissenanstalt achtete darauf, nur durchsetzungsstarke Schwestern in die Lazarette zu schicken, die innerlich gefestigt waren. Frauen, von denen man annahm, sie seien zu alt, um sich auf eine Liebesbeziehung einzulassen. Doch als Lina Müller den Sanitäter Robert Scholl kennenlernte, stellte sie bald ihren bisherigen Lebensplan in Frage. Alles, was sie sich versagt hatte, Mann, Kinder und Familienleben, schien ihr auf einmal doch erstrebenswert zu sein.
Vielleicht fiel ihr an dem jungen Mann mit den strengen Zügen als Erstes auf, dass er seine Meinung schlecht für sich behalten konnte. Er war auch empfindlich für Kränkungen, aber vermutlich gelang es ihr mit Geduld und Freundlichkeit, ihm seine Geschichte zu entlocken.
Robert Scholl, geboren 1891, wuchs keine Autostunde von Lina Müllers Heimatstadt entfernt auf, in Steinbrück bei Geißelhardt. Seine Eltern waren Kleinbauern, die hart schufteten, um elf Kinder durchzubringen. Höhere Schulbildung war für keines von ihnen vorgesehen, doch Robert Scholl legte 1909 die Prüfung zur Mittleren Reife an einem Stuttgarter Gymnasium ab. Er entschied sich für eine Ausbildung zum Verwaltungsbeamten im Mittleren Dienst und bestand 1913 die Verwaltungsdienstprüfung. Nach einer ersten Anstellung in der Stuttgarter Polizeibehörde wechselte er ins Steueramt. Doch bevor der 23-Jährige sich neue Ziele setzen konnte, unterbrach der Krieg seine verheißungsvolle Laufbahn.
Der Beginn des Ersten Weltkriegs, der «Urkatastrophe» Europas im 20. Jahrhundert, hat die Mehrheit der Deutschen keineswegs so einhellig in einen kollektiven Rausch versetzt, wie lange behauptet wurde.[3] Die berühmten Filmaufnahmen und Fotografien von jubelnden Menschen auf den Straßen zeigen nur einen Teil der Wahrheit, manche der Aufnahmen wurden gezielt herbeigeführt. Von denjenigen, die in düsterer Vorahnung zuhause saßen, gibt es keine Fotos.
Lina Müller und Robert Scholl gehörten zu den Menschen, die den Krieg kategorisch ablehnten. Robert musste zwar eine Ausbildung zum Infanterie-Soldaten absolvieren, wurde dann aber als nur «garnisonsverwendungsfähig» eingestuft. Nach einer Schulung zum Sanitäter arbeitete er im Ludwigsburger Reservelazarett II in der Verwaltung. Vielleicht war es bei einer Tasse Kaffee im Pausenzimmer, dass die beiden feststellten, wie sehr sich ihre Gedanken über den Krieg ähnelten. Zwei Jahre später fragte Robert Scholl Lina in einem Brief: «Was hat denn der Christengott, das Christentum, mit dem deutschen Sieg zu tun? Sind nicht in allen Ländern wahre Christen?»[4] Der das schrieb, stand, anders als die Adressatin, der Kirche kritisch gegenüber.
Vorsichtig warb der junge Sanitäter um die zehn Jahre ältere Diakonisse, die sich zur Ehelosigkeit verpflichtet hatte. Neben dem Altersunterschied, dem Dissens in Bezug auf Religion im Allgemeinen und das Christentum im Besonderen und Linas Gelübde gab es noch ein weiteres Ehehindernis: Robert Scholl hatte einen unehelichen Sohn. Ernst Gruele, geboren am 5. April 1914, war das Kind aus seiner Beziehung mit einer verheirateten Frau.
Willensstark und selbstbewusst entschied sich Lina für den jüngeren Mann und gegen das Leben als Diakonisse. Einer ihrer Leitsätze lautete: «Es geht, wie Gott will.» Anfang 1916 versprachen die beiden sich einander, doch erst im Herbst weihten sie ihre Familien in das Geheimnis ein. Am 20. Oktober 1916, Lina hatte Urlaub genommen und war in ihr Elternhaus nach Künzelsau zurückgekehrt, legte sie das schwarze Kleid ab und trat aus dem Diakonissenverband aus. Am selben Tag verlobte sie sich mit Robert. Leicht war ihr die Entscheidung nicht gefallen, sie habe viel denken und grübeln müssen, schrieb sie dem Verlobten ein paar Tage später, aber jetzt komme sie «mit Gottes Hilfe wieder ins Helle».[5]
Linas Eltern hießen den jungen Mann wohlwollend in ihrer Familie willkommen, aber die Verbindung stieß auch auf Ablehnung: Robert hatte seinen Vorgesetzten wohlweislich schriftlich in Kenntnis gesetzt. Als dieser die Neuigkeit im Pausenraum des Ludwigsburger Reservelazaretts verkündete, sei es gewesen, «wie wenn eine Bombe eingeschlagen hätte so sprangen alle von ihren Stühlen auf, da gab es lange und erstaunte Gesichter», berichtete ihm ein Freund. Eine Mitschwester von Lina habe den ganzen Tag geweint, denn «sie kannte sich nimmer vor Wut und Ärger».[6] Robert Scholl war also vorbereitet, als ihm nach seiner Rückkehr zum Dienst die Diakonissen die kalte Schulter zeigten. Immerhin wünschten ihm seine Kameraden Glück und schenkten ihm einen Blumenstrauß.
Über die Frage ihrer jüngeren Schwester Elisabeth, ob sie sich überhaupt zutraue, einen Familienhaushalt zu führen, konnte die ehemalige Diakonisse nur lachen. Die 35-Jährige hatte vor der Arbeit im Lazarett als Gemeindeschwester verschiedene Haushalte führen müssen, darunter einige, die sich in chaotischem Zustand befanden. Zuversichtlich schrieb sie ihrem Verlobten, sie fühle sich dieser Aufgabe durchaus gewachsen, und stellte auch gleich klar, wie sie sich das gemeinsame Leben vorstellte: Gesellschaften würden sie ja wohl nicht geben, und falls es später doch dazu käme, «so wüsste ich schon durchzukommen».[7] Es müsse doch machbar sein, nur für sie beide und das gemeinsame Glück zu leben. Halb entschuldigend klang ihre Beteuerung «Sparen kann ich, vielleicht Dir nur zu arg». Robert solle ihr bloß keine Geschenke kaufen, denn mehr als einen Schrank, einen Küchentisch und Stühle bräuchten sie für den Anfang nicht.
Doch die Einrichtung eines gemeinsamen Hausstands musste warten. Lina wurde im Haus ihrer zukünftigen Schwiegereltern in Geißelhardt gebraucht, um Roberts erkrankte Mutter zu pflegen. Christiane Scholl starb schon ein paar Wochen später, mit nur 56 Jahren, am 21. November 1916. Alle hatten gehofft, sie würde den Tag der Hochzeit, der auf den 23. November festgelegt worden war, noch erleben. Aber nun musste sich die Familie vor der Trauung zunächst auf dem Friedhof versammeln.
Des Krieges wegen war zunächst nicht an eine eigene Wohnung und ein Leben zu zweit zu denken. «Wollte Gott, daß bald Friede werde u. wir dieser schönen Zeit näher rücken. Inzwischen wollen wir aber auch jedes an seinem Ort seine Pflicht tun», schrieb Lina ihrem Mann.[8] Sie blieb beim Schwiegervater, kümmerte sich um dessen Haushalt und half bei der Versorgung von Armen und Kranken in der Gemeinde. Ihre Aufgabe in Ludwigsburg vermisste sie trotzdem, auch wenn diese Zeit «nicht ganz ohne Schatten» gewesen sei.[9] Aus ihren Briefen an Robert spricht große Nähe und tiefes Vertrauen. Beide waren bestrebt, den anderen an seinem Alltag und seinen Gedanken teilhaben zu lassen. Nicht nur die Hoffnung auf das Familienglück, auch die Politik war dabei Thema. Lina las begierig die Zeitungen, die Robert bei seinen Besuchen mitbrachte. Gespannt verfolgten sie etwa die Diskussion um die berühmte «Frieden-ohne-Sieg-Rede» des amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson im Januar 1917: «Hast Du die Rede Wilsons gelesen?», schrieb Robert an seine Frau, «Das ist mir politisches Evangelium … Ich bekenne mich zu seiner Anschauung Punkt für Punkt, denn mit meiner Gesinnung ist man im Krieg doch ziemlich einsam, immer wieder muss man sich prüfen, ob man denn nicht einem dummen, unmöglichen Ideal anhängt.»[10]
Am Sonntagvormittag besuchte Lina den Gottesdienst. Dass ihr Mann sich von der Kirche weitgehend gelöst hatte, störte sie nicht. Sie wollte ihn nicht bekehren, ließ den Kirchgang sogar ab und zu ausfallen, wenn er zu Besuch war. Lina war nicht prüde: «Ich durfte ja bei Dir meiner Liebe Ausdruck geben in so mancher Weise und wir durften uns ungestört genießen.»[11] Als sie schwanger wurde, zog sie wieder zu ihren Eltern nach Künzelsau, wo ihre Mutter sie liebevoll versorgte und es ausreichend zu essen gab.
Zwischen 1914 und 1918 starben fast 800.000 Deutsche an Hunger und Unterernährung, überwiegend traf es die Stadtbevölkerung. Lina und Robert Scholl wurden vom Hunger verschont, doch sorgenfrei war das Leben des jungen Paares nicht. Der Krieg überschattete alles, und die dauernde Entfernung voneinander machte beiden zu schaffen.
Doch dann waren es die Kriegsumstände, die Robert Scholl im Frühling 1917 überraschend eine ganz neue berufliche Perspektive eröffneten. Am 2. Juni 1917 trat er das Amt des stellvertretenden Schultheißen in der Doppelgemeinde Ingersheim/Altenmünster an der Jagst an, heute gehören beide Dörfer zu Crailsheim. Solange der Krieg währte, musste Scholl sich vor allem um die tägliche Versorgung der Menschen kümmern: Es fehlte an Lebensmitteln, ständig fiel der Strom aus, und vieles musste instand gesetzt werden. Doch ihm blieb wenig Gestaltungsspielraum: «Es hagelte nur so von Verordnungen und Verfügungen, die die Ortsvorsteher übernehmen mussten.»[12] Der 26-Jährige machte seine Sache offensichtlich gut, denn er wurde im September 1917 fast einstimmig zum neuen Bürgermeister gewählt.
Lina und Robert Scholl, 1932
Im Rückblick zählten die Jahre in Ingersheim für Lina und Robert Scholl zu den schönsten ihres Lebens. Ihre Wohnung über dem Laden des Gemischtwarenhändlers hatte die passende Adresse Am Schollberg 6. Dort kam am 11. August 1917 ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt, Ingeborg, genannt Inge. Nur etwas mehr als ein Jahr später, am 22. September 1918, wurde Johannes Fritz Scholl geboren, von allen Hans gerufen. Die Ingersheimer begrüßten den Sohn ihres Schultheißen mit Böllerschüssen.
Zwei Monate später, an dem Tag, als Hans getauft wurde, endete der Erste Weltkrieg. Zu diesem Zeitpunkt war das Deutsche Reich bereits keine Monarchie mehr. Die Novemberrevolution hatte Kaiser, Könige, Großherzöge und Fürsten von ihren Thronen gestoßen. Der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann rief am 9. November 1918 vom Balkon des Berliner Reichstags der versammelten Menschenmenge zu: «Das deutsche Volk hat auf der ganzen Linie gesiegt. Das alte Morsche ist zusammengebrochen; der Militarismus ist erledigt! Die Hohenzollern haben abgedankt! Es lebe die deutsche Republik!»
Während die deutschen Soldaten von Frankreich und Belgien aus nach Hause marschierten, bereitete der Rat der Volksbeauftragten in Berlin die Einführung des Frauenwahlrechts, des Acht-Stunden-Tages sowie des Rechts auf Tarifverträge und Arbeitnehmervertretungen in mittleren und großen Betrieben vor. Am 6. Februar 1919 trat die neugewählte Nationalversammlung im Hoftheater von Weimar zusammen, bis Mai 1919 wurde in Versailles der Friedensvertrag ausgehandelt. Darin heißt es, die alleinige Kriegsschuld liege beim Deutschen Reich, das zu Zwangsabgaben von Waffen und Kriegsschiffen und zu hohen Reparationszahlungen verpflichtet wurde. Außerdem verloren die Deutschen neben den Kolonien etwa 13 Prozent ihrer Gebiete und mussten sich Souveränitätsbeschränkungen gefallen lassen, etwa die Begrenzung des Heeres auf 100.000 Mann, das Verbot der Wehrpflicht und die Kontrolle durch eine Kommission der Alliierten.
Nicht nur die meisten Deutschen, auch einige der alliierten Unterhändler hatten den Eindruck, man bestrafe die Deutschen zu hart. Das hatte zur Folge, dass das Bedürfnis nach Abschaffung des «Versailler Diktats» jedes Interesse an der Analyse eigener Fehler verdrängte. Stattdessen lancierte die Oberste Heeresleitung unter Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg die sogenannte Dolchstoßlegende, mit der sie die Verantwortung für die militärische Niederlage auf die Zivilisten abwälzte. Die deutsche Armee sei «im Felde unbesiegt» geblieben und von demokratisch gesinnten Politikern, den «Novemberverbrechern», durch den Waffenstillstand «von hinten ermordet» worden. In Wirklichkeit war es genau umgekehrt: Die verblendeten Befehlshaber, die ihr eigenes Scheitern und die tatsächliche Lage nicht hatten wahrhaben wollen, hatten jede Möglichkeit eines Verständigungsfriedens ausgeschlagen und für die vollständige militärische Niederlage gesorgt. Diejenigen, die das hatten verhindern wollen, rangen jetzt verzweifelt um eine neue Ordnung in Deutschland.
Robert und Lina Scholl erhofften sich viel von der neuen Republik. Sie erlebten das Ende des Krieges weit entfernt von Berlin und Weimar, doch in den Jahren 1918/19 war man überall im Deutschen Reich nah dran an den Schauplätzen der Geschichte. Denn auch das Königreich Württemberg verschwand am 9. November 1918 durch eine unblutige Revolution von der Landkarte.
Als Bürgermeister hatte Robert Scholl in Ingersheim/Altenmünster den Übergang von der Kriegs- in die Friedenswirtschaft zu organisieren und die heimkehrenden Soldaten in Arbeit zu bringen. Dabei lernte er Eugen Grimminger vom Oberamt Crailsheim kennen, der als Freiwilliger in den Ersten Weltkrieg gezogen und als Pazifist zurückgekehrt war. Die beiden Männer wurden später Freunde.
Scholl brachte mit Engagement und Hartnäckigkeit vieles auf den Weg. Weil er sich selbst mit 300 Reichsmark an den Kosten einer neuen Brücke über die Jagst beteiligte, immerhin einem Fünftel der Gesamtsumme, tauften die Ingersheimer die Brücke Schulzensteg oder Robertssteg. Immer wieder kam es jedoch zu Querelen und Kompetenzgerangel zwischen den beiden Gemeindeteilen und dem Oberamt Crailsheim. Deshalb sah der ehrgeizige Bürgermeister sich bald nach einer neuen Aufgabe um.
3.
Ein Paradies: Die Kindheit in Forchtenberg
Im November 1919 trat Robert Scholl nach einem knappen Wahlsieg über drei Mitbewerber sein neues Amt als Bürgermeister von Forchtenberg an, einem Städtchen mit 1300 Einwohnern. Als er mit der hochschwangeren Lina und den beiden kleinen Kindern von Ingersheim fortzog, mussten sie in eine gelbe Postkutsche steigen, denn das 60 Kilometer entfernte Forchtenberg war weder mit der Eisenbahn zu erreichen, noch gab es eine Straße, auf der das Postauto hätte verkehren können. Im zuständigen Oberamt Öhringen hatte man dem Städtchen daher den Spitznamen «Balkan» verpasst. Forchtenberg war malerisch, aber an vielen Hauswänden bröckelte der Putz, es gab keine Kanalisation, bei starkem Regen schoss das Wasser durch die Gassen und drang in die Keller ein. Robert Scholl nahm sich vor, die Stadt zu modernisieren.
Die Bürgermeisterwohnung lag im ersten Stock des Rathauses, eines stattlichen Gebäudes aus dem 18. Jahrhundert mit undichten Fenstern und ohne ein richtiges Bad. Entschädigt wurde man durch den schönen Blick auf die Weinberge, wo die Trauben für den «Forchtenberger Kocherberg» wachsen. Kurz nach dem Umzug, im Februar 1920, kam das dritte Kind der Familie Scholl zu Welt, Elisabeth, auch Liesl genannt. Etwas mehr als ein Jahr später, am 9. Mai 1921, wurde auch Sophie Scholl im ersten Stock des Rathauses geboren. Getauft wurde sie auf den Namen Sofie Lina. Sie selbst schrieb ihren Namen als Kind und Jugendliche mit f, außer wenn sie sich in den Poesiealben ihrer Freundinnen verewigte. Erst im Sommer 1941 entschied sie sich dauerhaft für das ph.
Anderthalb Jahre nach Sophie, am 13. November 1922, wurde der zweite Sohn von Lina und Robert geboren, Werner Scholl, zweieinhalb Jahre später, am 22. März 1925, die vierte Tochter Tilde. In der Familie lebte jetzt auch Ernst Gruele, der uneheliche Sohn von Robert. Die Familie Scholl hat sich viele Jahre über ihn ausgeschwiegen. Es ist Manuel Aicher, Inge Scholls Sohn, und dem Historiker Jakob Knab zu verdanken, dass die schemenhafte Gestalt, die nur auf einem öffentlich bekannten Familienfoto zu sehen ist, wenigstens ein paar Konturen bekommen hat. Ernst war beim Einzug in Forchtenberg fünf Jahre alt. Unklar ist bis heute, wo der Junge nach dem frühen Tod seiner Mutter gelebt hat. Nicht nur die Nachbarn hielten ihn für einen Pflegesohn, auch seine Halbgeschwister wussten offenbar nicht, dass sie mit ihm verwandt waren. Sie erfuhren es erst viele Jahre später, und dass sie den Halbbruder in ihren Kindheitserinnerungen überhaupt nicht erwähnen, beweist die mächtige Wirkung eines solchen Familiengeheimnisses.
Jeden Morgen ging Robert Scholl aus der Wohnung über den kurzen Flur in seine Amtsräume. Seine Frau wirtschaftete derweil in der dunklen Küche. Dort stand ein großer, altmodischer Herd, der mühsam mit Holz angefeuert werden musste, worüber sie sich manches Mal beschwerte. Lina Scholl konnte nun unter Beweis stellen, wie sparsam sie zu wirtschaften vermochte. Wie einige ihrer Nachbarn hatten die Scholls einen Garten hinter der Stadtmauer gepachtet, um dort Blumen und Gemüse zu ziehen. Ein kleiner Weinberg und eine Wiese mit Obstbäumen gehörten auch dazu. Die reichliche Ausbeute an Kirschen, Zwetschgen und verschiedenen Apfelsorten war hoch willkommen, und alles, was die große Familie nicht gleich verbrauchte, wurde eingekocht oder gedörrt. Einen Luxus leistete sich Lina aber doch: Sie buk regelmäßig einen köstlichen Hefezopf, zu dem sie Butter und Kompott auf den Tisch stellte.
Ohne Haustöchter wäre die Arbeit kaum zu schaffen gewesen. Bei Scholls wohnten fast immer zwei junge Bauernmädchen, deren Eltern froh waren, wenn ihre Töchter gegen Kost und Logis eine ordentliche Haushaltsführung lernten. Das Familienleben fand größtenteils in der Diele statt, dort spielten die kleinen Kinder, während die größeren über ihren Hausaufgaben brüteten. In der Diele hing auch eine Schaukel; es war gemütlich und warm dort, während die ungeheizte gute Stube nur zum Klavierüben benutzte wurde und natürlich, wenn Besuch kam, was selten geschah. Ein eigenes Schlafzimmer hatte keines der Kinder.
Während Inge und Hans die evangelische Volksschule in Forchtenberg besuchten, verbrachten die Kleinen, darunter auch Sophie, den Vormittag in der Kleinkinderschule, einer sogenannten Bewahrungs- und Beschäftigungsanstalt für siebzig Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren. Obwohl die Einrichtung in erster Linie zur «Erleichterung für Eltern mit Berufsgeschäften» gedacht war, fühlte sich Lina Scholl genügend beansprucht, um die Verantwortung für die Jüngsten ein paar Stunden pro Tag abzugeben. Die Forchtenberger Kleinkinderschule war 1832 als erste in der Region und zweite überhaupt in Württemberg gegründet worden. Morgens spielte Kinderschwester Rosa, eine schwäbische Diakonisse, auf dem Tischharmonium und brachte den Kindern Lieder bei. Erzählte sie biblische Geschichten, mussten die Kinder still und brav auf der Bank sitzen. Gespielt wurde aber auch. Beliebt waren ein Tretroller, Radelrutsch genannt, die Sandkiste und ein Brunnen mit Wasser im «Höfle».
Für die Kinder war Forchtenberg ein Paradies: Sie spielten in den Gärten der Freunde oder liefen hinauf zur Burg. Die Ruine war in Privatbesitz, was die Kinder nicht davon abhielt, dort herumzustromern. Doch wegen Unfallgefahr musste Robert Scholl in seiner Funktion als Bürgermeister das Gelände absperren lassen und den Kindern das Spielen dort verbieten.
Aber im nahen Wald durften sie stundenlang toben, Beeren und Pilze sammeln, sich mit Hagebutten bewerfen oder Schnitzeljagden veranstalten. Mit großem Eifer schleppten sie Steine von den Trockenmauern der Weinberge in den Wald: «Wir benutzten die Steinplatten, um uns ganze Wohnungen einzurichten. Je nach Form und Größe benutzten wir die Brocken als Tisch, Stühle und sogar als Klavier.»[1] Kinder spielen das nach, was sie kennen, deshalb gehörte ein Klavier ins Haus, auch wenn es nur eine Hütte mit Blätterdach war.
Im Sommer war das Stauwehr am Kocher einer der Lieblingsplätze. Man konnte dort faul in der Sonne liegen und dem plätschernden Wasser nachschauen. Nachdem Inge ihr das Schwimmen beigebracht hatte, durchquerte Sophie mit knapp sechs Jahren den klaren, kalten Fluss zum ersten Mal. Sie sollte immer eine Vorliebe für das Wasser hegen, an keinem Bach könne sie vorbeigehen, ohne wenigstens kurz mit nackten Füßen hineinzuwaten, schrieb sie später.[2]
Im Winter tummelte sich die Jugend von Forchtenberg an der Kirchenstiege. Wer sich traute, konnte mit dem Schlitten in halsbrecherischem Tempo von der Dorfmitte nach unten rasen, am Rathaus vorbei «bis zum Milchhäusle am Kocher».[3] Dank der Recherchen der Künstlerin Renate Deck kann man heute auf dem Sophie-und-Hans-Scholl-Pfad in Forchtenberg die wichtigsten Orte der Kindheit von Sophie Scholl und ihren Geschwistern entdecken.
Weil die Scholls mit der Pfarrersfamilie Krauß befreundet waren, durfte Lina ihre Wäsche in deren großem Garten zum Trocknen aufhängen und an Ostern dort die bunten Eier für ihre Kinder verstecken. Sie fühlten sich im verwilderten Pfarrgarten bald ganz zuhause. Zwischen den hohen Bäumen führten sie selbst ausgedachte Theaterstücke und Märchen auf und verkleideten sich dafür mit abgelegten Anziehsachen der Erwachsenen. Meistens war die sehr musikalische Inge die Anführerin, die große Freude am Inszenieren hatte. Einmal schrieb sie sogar eine Kinderoper. Bis das Zeichentalent von Sophie auffiel, galt Inge als die künstlerisch Begabte in der Familie.
Ein beliebtes Spiel im Pfarrgarten war «Hochzeit halten». Pfarrerssohn Arnold, der sich damit am besten auskannte, übernahm die Rolle des Bräutigams und wählte sich gerne Sophie zur Braut. Die Geschwister und Freunde spielten die Brautjungfern und Hochzeitsgäste. «Wir schmückten uns aufs herrlichste», schrieb Sophie später in einem Schulaufsatz, «ich war in meinem Leben nimmer schöner gewesen, als damals im Brautschleier und Kranz aus Maßliebchen.»[4] Die feingemachte Hochzeitsgesellschaft zog lärmend durch die Gassen, manchmal spielte eines der Kinder dazu Trompete. Arnolds Mutter tischte das «Hochzeitsmahl» auf, Schokoladenpudding, Himbeersaft und Kekse. Zum Schluss tobten die Kinder durch den Garten und manchmal verlor der Bräutigam dabei den falschen Bart, der eigentlich zum Nikolauskostüm gehörte.
Die Scholl-Kinder denken sich die meisten ihrer Spiele aus und basteln sich alles Nötige dafür selbst.[5] Gekaufte Spielsachen gibt es kaum, sie haben trotzdem alles, was sie brauchen: geheime Plätze, Spaß und Aufregung. Sophie Scholls Liebe zur Natur entsteht in diesen Jahren. Was sie als Kind im Hohenloher Land sieht, fühlt und riecht, bleibt für immer in ihrem Gedächtnis. Wenn sie später ihrer Lebensfreude Ausdruck geben will, liefert ihr die Natur dazu die Bilder. Aber sie sucht die Natur nicht nur als Ort des Glücks und der Inspiration, sondern auch als Herausforderung und um sich selbst zu spüren, beim Schwimmen, Wandern oder Skifahren.
Das Paradies von Forchtenberg lebte in den Erinnerungen weiter. Der Vater kam darin wenig vor, die Mutter hingegen schon. Unter der Überschrift «Kleine und große Feste im Jahreslauf» erzählte Sophie in einem Aufsatz vom Badetag, einem der schönsten Rituale der Woche. Weil die Scholls wie die meisten Forchtenberger kein Badezimmer hatten, mietete Lina die Badestube des Bäckers für den Samstagnachmittag. Inge durfte als Älteste alleine baden, aber:
Wir vier Kleinen wurden dann, zwei und zwei, in die Badewanne gesteckt und unserem Schicksal überlassen. Denn unsre Mutter hatte uns die überaus wichtige Aufgabe gestellt, uns selbst zu waschen. Dies erfüllte uns mit ernstem Eifer […] Die Rücken bearbeiteten wir uns gegenseitig mit Seife und Bürste so heftig, bis sie krebsrot waren und die Betroffene in Wehgeschrei ausbrach.[6]
Wenn es zu wild wurde und die Kinder sich schreiend um Badeenten, Papierschiffchen oder den Schwamm stritten, beendete die Mutter das Vergnügen, duschte und trocknete alle ab. Die wenigen Meter nach Hause waren schnell geschafft, und am Ende des Tages saßen alle auf ihren Betten, eingehüllt in warme Decken: «Den herrlichen Abschluss dieses Abends bildete eine heiße Zuckermilch und ein Honigbrot. Während wir es langsam und voll Genuß verzehrten, erzählte uns Mutter ein Märchen.»[7]
Sophie (re.) mit Freundin, Ende der 20er Jahre
Sophie liebte ihre Puppen und konnte sich stundenlang in das Spiel mit ihnen vertiefen. Die Mutter förderte diese Beschäftigung, weil die Mädchen sich damit auf ihre spätere Rolle als Hausfrau und Mutter vorbereiten sollten. Zu Weihnachten nähte Lina hübsche Kleider und bastelte immer etwas Neues für die Puppenstube. Sophie wünschte sich einmal ein großes Puppenbett mit Rädern, das sie auch bekam. Liebevoll versorgte sie ihre Puppenkinder, zog sie am Abend aus und legte sie schlafen, ganz so, wie die Mutter es mit der kleinen Tilde machte.
Abends betete Lina Scholl mit den Kindern und sonntags führte sie die kleine Schar in die evangelische Michaelskirche. Das «Kinderkirchle», wie der Kindergottesdienst genannt wurde, leitete sie manchmal selbst. Was Lina Scholl vermittelte, war ein Kinderglauben im besten Sinn: «Sie lehrte uns beten und ließ uns von Anbeginn mit dem Dasein eines Unsichtbaren […] vertraut werden: es war der liebe Heiland [,] der einmal gewesen war, der alles wusste und konnte und der nun für immer für uns da war und uns liebte, obwohl wir ihn nicht sahen.»[8] Als junge Erwachsene werden die Geschwister mit diesem Kinderglauben im Gepäck das Christentum neu für sich entdecken.
Zu Beginn des Jahres 1926 fiel ein dunkler Schatten auf die heile Welt der Familie: Tilde starb, noch kein Jahr alt. Sie hatte gerade begonnen zu laufen und war der verhätschelte Liebling der Familie, als sie zuerst Masern und dann eine Lungenentzündung bekam. Am Morgen des 5. Januar stellte der Kirchendiener in seiner Funktion als Leichenbeschauer offiziell den Tod des Kindes fest. Tilde blieb zwei Tage lang im Hausflur aufgebahrt, wie es der regionale Brauch war. Erst nach einer zweiten Leichenschau durfte die Beerdigung stattfinden. Die Familie folgte dem Sarg vom Rathaus zu Fuß über die Kocherbrücke zum Friedhof. Dort steht die zweite Michaelskirche von Forchtenberg, ein romanischer Bau, der über 1000 Jahre alt ist. Tildes Grabspruch aus dem Buch des Propheten Jeremia lautet: «Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte.» Der Tod eines Kindes, eine der schmerzlichsten Erfahrungen für Eltern, war für Lina Scholl kein Grund, an der Liebe Gottes zu zweifeln.
Am 1. Mai 1928, kurz vor ihrem siebten Geburtstag, wurde Sophie Scholl eingeschult. Da in der evangelischen Volksschule von Forchtenberg immer zwei Jahrgänge zusammen unterrichtet wurden, saßen Sophie und Elisabeth in derselben Klasse. Aus dieser Zeit stammt folgende Familienanekdote: Die Kinder werden streng nach ihren Leistungen und Noten platziert, die Besten sitzen ganz vorne. Meistens sind es Elisabeth und ihre Freundin Lore, die um den ersten Platz in der Klasse wetteifern. Als Elisabeth eines Tages einen Tintenfleck in ihr Heft kleckst, schickt der Lehrer sie auf den zweiten Platz. Da hält es Sophie nicht mehr auf der Bank. Sie geht nach vorn zum Lehrerpult und erklärt selbstbewusst, ihre Schwester habe heute Geburtstag, deshalb setze sie Elisabeth jetzt wieder «hinauf».[9] Ist diese Geschichte wahr oder erfunden? Das lässt sich bei solchen Berichten, die zum festen Erinnerungsschatz einer Familie gehören, im Nachhinein nicht mehr sagen. Barbara Leisner berichtet, der Lehrer habe sich über Sophies Einmischung amüsiert, seine Entscheidung aber nicht geändert. Hermann Vinke hingegen schreibt, der Lehrer habe es geschehen lassen. Die Biographin hat mit Elisabeth gesprochen, der Biograph mit Inge Scholl. Aber selbst wenn sich die Sache nicht so zugetragen haben sollte, erzählt die Geschichte etwas darüber, wie Sophie von ihrer Familie gesehen wurde: Als mitfühlendes Kind, das sich traut, einer höheren Autorität die Stirn zu bieten. Vielleicht zeigte sich schon jetzt etwas von dem, was Sophie Scholl später von sich forderte: ein weiches Herz und ein harter Geist.
Sophies Eintreten für die Schwester in der Schule wäre in jedem Fall mutig gewesen, denn in Forchtenberg durften die Lehrer noch «Tatzen» verteilen und mit dem Rohrstock auf die flache Hand der Kinder schlagen, was nicht nur weh tut, sondern auch die Hand anschwellen lässt. Sophie habe nur einmal «Tatzen» bekommen, erinnert sich Inge, denn sie sei eine gute und brave Schülerin gewesen. Sie war auch ehrgeizig und wollte unbedingt auf die Mädchenoberrealschule in Künzelsau gehen, genau wie ihre großen Schwestern.