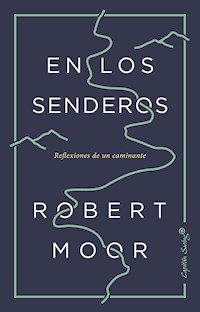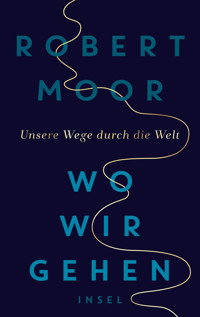
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Warum wählen wir im Zweifel lieber befestigte Wege statt Trampelpfade? Warum finden Ameisen scheinbar mühelos ihren Weg durch unbekanntes Terrain? Und warum haben Lebewesen überhaupt begonnen, sich von einem Ort fortzubewegen?
Als Robert Moor den Appalachian Trail entlangwanderte und endlose Kilometer auf den Weg vor seinen Füßen starrte, trieb ihn mehr und mehr die Frage um, warum es überhaupt so etwas wie Wege gibt und wie sie entstehen. Er reiste sieben Jahre lang rund um den Globus, beschritt große Routen ebenso wie schmale Cherokee-Pfade – und setzte sich der Wildnis aus. Seine eigenen Erlebnisse verbindet er aufschlussreich mit Erkenntnissen aus Wissenschaft, Geschichte und Philosophie.
Ein inspirierendes erzählendes Sachbuch, ein wunderbares Stück Nature Writing, eine Entdeckung! – Aus diesem Buch »geht« man anders heraus, als man eingetreten ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 552
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Robert Moor
Wo wir gehen
Unsere Wege durch die Welt
Aus dem amerikanischen Englisch von Frank Sievers
Insel Verlag
Ein Pfad entsteht, indem man ihn geht.– Zhuangzi
Übersicht
Cover
Titel
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Inhalt
Cover
Titel
Widmung
Inhalt
Prolog
Erstes Kapitel Fossilienspuren. Der Welt einen Sinn geben
Zweites Kapitel Insektenpfade. Die Entstehung der Schwarmintelligenz
Drittes Kapitel Wildwechsel. Was in anderen Tieren vorgehen mag
Viertes Kapitel Vormoderne Pfade. Die Weisheit der Ureinwohner und die verlorenen Wege
Fünftes Kapitel Moderne Wege. Die Zerstörung der Wildnis und die Geburt des Wanderns
Sechstes Kapitel Postmoderne Wege. Wegbereiter der Zukunft
Epilog
Anmerkung des Autors
Danksagung
Verwendete Literatur
Fußnoten
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Prolog
Einmal, vor vielen Jahren, machte ich mich auf, um ein großes Abenteuer zu erleben, und starrte stattdessen fünf Monate lang auf Schlamm. Im Frühling 2009 begann ich meine Wanderung über den Appalachian Trail, den ich in seiner vollen Länge von Georgia nach Maine laufen wollte. Den Zeitpunkt hatte ich mir genau überlegt, um nahtlos vom milden Frühling des Südens in den lauen Sommer des Nordens überzugehen, doch aus irgendeinem Grund wurde es während meiner Reise nicht warm. Es war ein kühles Jahr mit viel Regen. Die Zeitungen verglichen es mit dem Ausnahmesommer 1816, als der Mais bis zu den Wurzeln gefror, Italien von rosa Schnee bedeckt war und die junge Mary Shelley, in der Schweiz in einer dunklen Villa eingesperrt, von Monstern zu träumen begann. In meiner Erinnerung sah ich auf dieser Wanderung vor allem nasse Steine und schwarze Erde. Auf nicht wenigen Berggipfeln entbehrte ich jeden Ausblicks. Von Nebel umhüllt, die Regenhaube auf dem Kopf, den Blick gesenkt, blieb mir kaum mehr, als mit talmudischer Intensität Kilometer um Kilometer, Monat um Monat den Pfad vor meiner Nase zu studieren.
In seinem Roman Gammler, Zen und hohe Berge nennt Jack Kerouac diese Art des Wanderns »über den Pfad meditieren«. Die Figur Japhy Ryder, die dem Zen-Poeten Gary Snyder nachempfunden ist, sagt zu ihrem Freund: »Du musst einfach laufen und auf den Pfad zu deinen Füßen sehen und nicht in die Gegend gucken und einfach in Trance verfallen, während der Boden vorbeisaust.« Mit so großer Aufmerksamkeit werden Pfade selten bedacht. Ärgern wir Wanderer uns über einen besonders strapaziösen Weg, dann beschweren wir uns, wir hätten den ganzen Tag nur auf unsere Füße geschaut. Lieber sehen wir nach oben, hinaus, in die Ferne.
Idealerweise fungiert ein Pfad als dezenter Helfer, der uns elegant durch die Welt geleitet und uns zugleich das Gefühl gibt, frei und selbstbestimmt zu handeln. Vielleicht ist das der Grund, weshalb Pfade in der Literaturgeschichte stets am Rande des Blickfelds geblieben sind, an der Unterkante des Bildes: als gehörten sie schon nicht mehr zum Bild und stünden buchstäblich kurz davor, aus dem Rahmen zu fallen, als gingen sie uns nichts an.
Während Hunderte und Tausende Kilometer des Pfades unter meinen Augen davonzogen, kam in mir irgendwann die Frage auf, was dieses endlose Geschmiere bedeuten sollte. Wer steckte dahinter? Woher kam es? Und warum gab es eigentlich Pfade?
Noch lange nachdem ich das Ende des Appalachian Trail erreichte, verfolgten mich diese Fragen. Von ihnen angestachelt, im vagen Gefühl, sie könnten mich in neue gedankliche Gefilde befördern, verwandte ich Jahre darauf, sie zu beantworten, was mich wiederum zu noch größeren Fragen führte: Warum haben Tiere überhaupt begonnen, sich fortzubewegen? Wie erschließen sich Lebewesen die Welt? Warum sind manche Individuen Anführer und die anderen folgen? Wie haben wir Menschen es angestellt, unserem Planeten seine jetzige Form zu geben? Stück für Stück setzte ich ein Panoramabild zusammen, in dem Pfaden eine wichtige lenkende Kraft auf diesem Planeten innewohnt: Auf jeder Stufe der Skala des Lebens, vom mikroskopisch kleinen Einzeller bis hin zur Elefantenherde, nutzen Lebewesen Pfade, um eine überwältigende Auswahl an Möglichkeiten auf eine einzelne, schnell ans Ziel führende Route zu reduzieren. Ohne Wege wären wir verloren.
Aber meine Suche nach dem Ursprung der Wege war schwieriger als gedacht. Heutzutage künden Wanderwege mit grell bemalten Schildern und Wegzeichen lauthals von ihrer Existenz; ältere Pfade sind dagegen sehr viel unauffälliger. Manche Fußpfade alter indigener Kulturen wie der Cherokee waren nur wenige Zentimeter breit. Als die Europäer in Nordamerika einfielen, verbreiterten sie nach und nach die Wege der Ureinwohner, für ihre Pferde, ihre Wagen und dann für ihre Automobile. Heute liegt das Urwegenetz größtenteils unter Straßen begraben, auch wenn man immer noch Reste des alten Pfadsystems finden kann, sofern man weiß, wo – und wie – man suchen muss.
Andere Pfade sind sogar noch obskurer. Die Spuren mancher Waldsäugetiere ziehen sich so fein durchs Unterholz, dass nur erfahrene Fährtenleser sie erkennen. Ameisen schnüffeln sich über unsichtbare chemische Pfade – will man sie sehen, muss man ihre Umgebung mit Lykopodium bestreuen, jenem Pulver, das auch die Polizei benutzt, um Fingerabdrücke aufzuspüren. Manche Pfade verlaufen unterirdisch: Termiten und Nacktmulle graben Tunnel und markieren sie mit Pheromonspuren, um auf Kurs zu bleiben. Noch feiner sind die verzweigten Nervenbahnen im menschlichen Gehirn, deren Netzwerk so unüberschaubar ist, dass selbst die fortschrittlichsten Computer der Welt sie noch nicht vollständig kartieren können. Derweil strickt die Technologie tief unter der Erde und hoch oben im Äther ein kompliziertes Wegenetz, damit Informationen rasend schnell zwischen den Kontinenten hin und her reisen können.
Ich lernte, dass die Seele eines Pfades – seine Pfadhaftigkeit – nicht in Erde und Fels geschrieben ist; sie ist immateriell, flüchtig, wie Luft. Entscheidend ist seine Funktion: wie sich der Pfad beständig verändert, um den Zwecken seiner Nutzer zu dienen. Ruhm und Ehre gebührt den Wegbereitern, jenen hartgesottenen Seelen, die physisch wie metaphorisch auf unbekanntes Terrain vordringen – aber den Nachfolgern kommt beim Entstehen eines Pfades eine ebenso wichtige Rolle zu. Sie kürzen unnötige Kurven ab und bügeln Hindernisse nieder, sodass sich der Pfad mit jedem Mal leichter gehen lässt. Erst dank all der Menschen, die ihn benutzen, stellt er irgendwann »durch Erfahrung und Vertrautheit die ideale Anpassung der Bewegung an den Raum« dar, wie Wendell Berry es formuliert. In verwirrenden Zeiten – wenn alle alten Wege im Morast zu versinken scheinen – ist es sinndienlich, den Blick erdwärts zu richten und die oft übersehenen Lebensweisheiten unter unseren Füßen zu betrachten.
*
Als ich zehn Jahre alt war, kam mir zum ersten Mal der Gedanke, ein Pfad könnte mehr sein als ein Streifen blanker Erde. In jenem Sommer schickten mich meine Eltern in ein altmodisches kleines Ferienlager in Maine, das Pine Island Camp, wo es keinen Strom und kein fließendes Wasser gab, nur Petroleumlampen und einen kalten See. In der zweiten von insgesamt sechs Wochen, die ich dort verbringen sollte, wurden ein paar von uns Jungs in einen Transporter gesteckt und auf einer stundenlangen Fahrt zum Fuß des Mount Washington gekarrt, wo ich die erste Rucksacktour meines Lebens unternahm. Als Kind der betonierten Vorstadtprärie von Illinois war ich erst einmal skeptisch. Mit schwerem Gepäck durch die Berge zu wandern sah mir verdächtig nach einem Bußritual aus, zu dem sich Erwachsene zuweilen nötigten – wie der Besuch bei fernen Verwandten oder das Aufessen trockener Brotrinde.
Aber ich hatte unrecht; es war noch schlimmer. Unsere Begleiter hatten uns drei Tage zubemessen, um die dreizehn Kilometer bis zum Gipfel des Mount Washington und wieder zurück zu wandern, im Grunde also reichlich viel Zeit. Aber der Weg war steil und ich ein dürrer Junge. Mein Rucksack – ein schweres, schlecht sitzendes Ungetüm mit Aluminiumgestell von Kelty – sah aus wie eine Ganzkörperzahnspange.
Als wir gerade einmal eine Stunde auf dem steinigen Weg durch die Tuckerman Ravine unterwegs waren, bekam ich in meinen steifen neuen Lederstiefeln schon die ersten Blasen und die Haut an meinen Fersen schürfte ab. Heiß rann mir der Schmerz durch die Rückenmuskeln. Wenn unsere Begleiter gerade nicht hinsahen, zog ich den entgegenkommenden Wanderern schmerzerfüllte, flehentliche Grimassen, als wäre ich Opfer einer besonders raffinierten Entführung. Als ich am Abend im Unterstand in meinem Schlafsack lag, überlegte ich, wie ich meine Flucht bewerkstelligen könnte.
Am zweiten Morgen wehte grauer Regen heran. Anstatt auf den Gipfel zu steigen, was unseren Begleitern zu unsicher erschien, nahmen wir einen weiten Umweg um die Südflanke des Berges. Die Rucksäcke ließen wir im Unterstand zurück, sodass jeder nur eine Flasche Wasser und Snacks dabeihatte. Vom elenden Gewicht befreit, vom Regenponcho angenehm warm gehalten, konnte ich das Wandern endlich genießen. Ich atmete die tannensüße Luft ein und Nebelatem aus. Chlorophyllen schimmerte der Wald.
Wir gingen in einer Reihe und schwebten wie kleine Geister zwischen den Bäumen hindurch. Nach ein oder zwei Stunden gelangten wir an die Baumgrenze und betraten ein Reich aus flechtenverharschtem Fels und weißem Dunst. Rund um den Berg verästelten sich immer feiner die Pfade. Als der Weg den Crawford Path kreuzte, verkündete einer unserer Begleiter, dass wir jetzt auf einen Abschnitt des Appalachian Trail abbiegen würden. Seinem Ton nach zu urteilen, sollten wir wohl beeindruckt sein. Ich hatte den Namen zwar schon gehört, verband aber nicht viel damit. Der Pfad unter unseren Füßen, erklärte der Begleiter, führe über den Grat der Appalachen, in nördlicher Richtung nach Maine, in südlicher Richtung bis hinab nach Georgia, das über dreitausend Kilometer entfernt lag.
Ich erinnere mich noch an das Prickeln der Verwunderung, als ich diese Worte hörte. Plötzlich schwoll der schlichte Pfad unter meinen Füßen auf ein überbordendes Maß an. Ich fühlte mich, als würde ich in unserem Zeltlager auf den Grund des Sees tauchen und dort einen unermesslich riesigen Blauwal entdecken. So klein, wie ich mir damals vorkam, fand ich es ungeheuer erregend, etwas so Großes zu erleben, und sei es, dass ich nur einen kleinen Zipfel davon erhaschte.
*
Ich wanderte weiter. Es wurde leichter – oder besser gesagt, ich härtete ab. Mein Rucksack und meine Wanderschuhe wurden weicher und schmiegten sich bald wie ein alter Baseballhandschuh an meinen Körper. Ich lernte, wie ich mich trotz schweren Gepäcks behände bewegen konnte, und wanderte schließlich mehrere Stunden ohne Pause. Auch die Genugtuung, am Ende eines langen Tages den Rucksack abzulegen, genoss ich nun: Das warme Tier fiel kühl von mir ab und ich fühlte mich, als wäre ich mit Helium gefüllt, sodass meine Sohlen den Erdboden nur noch streiften.
Das Wandern erwies sich als ideale Freizeitbeschäftigung für ein ankerloses Kind wie mich. Meine Mutter hatte mir einmal ein in Leder gebundenes Tagebuch geschenkt, auf dessen Rücken sie in Gold meinen Namen einprägen ließ, nur dass der Buchdrucker ihn missverstand und ROBERT MOON draufschrieb. Ein seltsam passender Name. Als Kind fühlte ich mich oft wie ein Außerirdischer. Ich war nicht einsam oder gar ausgegrenzt; ich fühlte mich nur einfach nie richtig heimisch. Bevor ich aufs College ging, wusste niemand, dass ich schwul war, und ich kannte auch keine anderen Schwulen. Ich bemühte mich, nicht aufzufallen. Jahr für Jahr zog ich zu jedem Frühlings- und zu jedem Abschlussball Anzug und Krawatte an. Ich kleidete mich in athletische Einheitskluft, Mädchen-kennenlernen-Kluft, Geklaute-Bierdosen-im-Partykeller-trinken-Kluft. Dabei fragte ich mich insgeheim, was dieses kostümierte Theater sollte, das wir da unablässig aufführten.
In meiner Familie war ich mit einem Abstand von fast zehn Jahren das jüngste Kind. Als ich geboren wurde, waren meine Eltern schon über vierzig und sie gewährten mir ungewöhnlich viele Freiheiten. Ich hätte ein Wildfang werden können. Doch stattdessen verbrachte ich die meiste Zeit lesend in meinem Zimmer, was ungefähr auf das Gleiche hinauslief, als wäre ich von zu Hause weggerannt, nur ohne das Risiko und die elterlichen Magenschmerzen. Und so brannte ich von der dritten Klasse an mit meinen Büchern durch, die ich verschlang wie ein Kettenraucher die Zigaretten; kaum war das letzte aufgeraucht, hatte ich schon das nächste in der Hand.
Das Buch, das aus meiner Freizeitbeschäftigung eine Leidenschaft werden ließ, war eine Taschenbuchausgabe von Laura im großen Wald auf dünnem Papier. Ich erfuhr, dass unser Haus im Norden von Illinois nur ein paar hundert Kilometer südöstlich des Ortes lag, in dem die Autorin Laura Ingalls Wilder 1867 geboren worden war. Aber ihre Beschreibungen der großen Wälder von Wisconsin waren mir vollkommen fremd. »Wenn man einen ganzen Tag, eine ganze Woche, ja, einen ganzen Monat nach Norden ging, so war man immer noch im Wald«, heißt es da. »Es gab keine Häuser. Es gab keine Straßen. Es gab keine Menschen. Es gab nur Bäume und wilde Tiere.« Ich war wie berauscht von dem Gefühl der Abgeschiedenheit und Autarkie, das Ingalls evozierte.
Ich weiß nicht mehr, wie viele Bände der Reihe Unsere kleine Farm ich nacheinander las, genug jedenfalls, dass mein Lehrer mich irgendwann sanft darauf hinwies, dass ich auch einmal wieder etwas anderes lesen könne. In den nächsten Jahren steigerte ich mich von Unsere kleine Farm über Allein in der Wildnis und Walden bis zu Am Anfang war die Erde und Pilger am Tinker Creek. Es gefiel mir, in allen Einzelheiten in das Leben im Freien einzutauchen. In meinem ersten Sommer im Pine Island Camp entdeckte ich ein weiteres Genre, in dem es um Abenteuer in der Wildnis ging: die jungenhaften Geschichten von Mark Twain und Jack London, dann die alpinen Träumereien von John Muir und schließlich die antarktischen Qualen von Ernest Shackleton und existenziellen Odysseen von Robyn Davidson und Bruce Chatwin.
Zwischen diesen beiden Klassen von Autoren verlief eine grobe Trennlinie: Die einen waren in einem Gebiet tief verwurzelt, die anderen stolz auf ihre Ungebundenheit. Ich hielt es mit den Herumtreibern. Mir fehlte die tiefe Verbundenheit mit meinem Land, meinen Vorfahren, meiner Kultur, meiner Gemeinde, meinem Geschlecht oder meiner Rasse. Ich war ohne Religion und ohne Hass auf andere Religionen aufgewachsen. Meine Familie hatte sich weit verstreut: Als ich in die erste Klasse kam, waren meine Eltern, zwei Texaner im frostigen Norden, schon geschieden; kurz darauf verließen meine beiden älteren Schwestern das Haus, um aufs College zu gehen und nicht mehr zurückzukehren. Eine unbestimmte Rastlosigkeit schien durch unsere Adern zu fließen.
Neun Monate im Jahr trieb ich durch die Hallen der akademischen Einrichtungen, wechselte die Kostüme, lernte neue Dialekte, gab mich weltläufig. Nur im Sommer, bei meinen immer länger werdenden Ausflügen in die Wildnis, schien mein natürliches Wesen hervorzutreten. Ich arbeitete mich von den Appalachen hinauf zu den gewaltigen Rocky Mountains, dann zu den Beartooth Mountains, der Wind River Range, den schneebedeckten Kolossen der Alaskakette und schließlich zu den hohen Gipfeln von Mexiko bis Argentinien. Dort oben konnte ich fern aller Benimmregeln und Rituale ungemustert und unbehelligt wandern.
Während des College nahm ich zweimal im Sommer einen Job im Pine Island Camp an und führte die Kinder auf kurzen Ausflügen durch die Appalachen. Auf dem Appalachian Trail traf ich dabei gelegentlich auf Wanderer, die sich aufgemacht hatten, um den Pfad in einer monatelangen Mammuttour in seiner vollen Länge zu gehen. Diese Fernwanderer waren leicht zu erkennen: Sie stellten sich mit seltsamen »Trailnamen« vor, aßen heißhungrig und hatten einen leichten, wolfsähnlichen Gang. Sie schüchterten mich ein und machten mich zugleich neidisch. Und sie glichen Rockstars aus einer idealisierten Vergangenheit – die langen Haare, die wilden Bärte, das verkommene Äußere, der esoterische Slang, der rastlose Lebensstil, das matte Gefühl von der Vergeblichkeit des Daseins, das sozusagen Heldenhafte.
Manchmal unterhielt ich mich mit ihnen und bearbeitete sie mit Käsestücken oder händeweise Süßigkeiten. Ich erinnere mich an einen alten Mann, der den gesamten Trail in einem schottischen Kilt und Sandalen gegangen war, und an einen jungen Mann, der ohne Zelt unterwegs war, aber mit einem prallgefüllten Federkissen. Einige Wanderer missionierten mit Eifer für die eine oder andere Kirche, andere sagten, wir müssten uns auf die bevorstehende ökologische Apokalypse vorbereiten. Viele, mit denen ich sprach, wechselten gerade den Job, die Ausbildung oder den Ehepartner. Ich begegnete Kriegsheimkehrern und Menschen, die einen Tod in ihrer Familie verarbeiten mussten. Manche Sätze hörte ich immer wieder. »Ich musste einen klaren Kopf bekommen«, hieß es, oder: »Ich wusste, das ist vermutlich meine letzte Chance.« Einmal erzählte ich einem jungen Wanderer, dass ich hoffte, die Wanderung irgendwann einmal selbst zu unternehmen. »Steig aus«, sagte er bestimmt. »Mach es jetzt.«
*
Ich stieg nicht aus. Dafür war ich ein zu vorsichtiger Mensch. 2008 zog ich nach New York, wo ich eine Reihe schlecht bezahlter Jobs annahm. In meiner Freizeit plante ich meine Wanderung. Ich las Reiseführer und Onlineforen, entwarf versuchsweise Routen. Kein Jahr später war ich bereit, mich auf den Weg zu machen.
Im Gegensatz zu vielen anderen Menschen hatte ich keinen besonderen Anlass für diese Wanderung, keinen initialen Moment. Ich betrauerte keinen Tod und musste mich nicht von meiner Drogensucht erholen. Es gab auch nichts, wovor ich floh. Ich war nie im Krieg gewesen. Ich war nicht deprimiert. Ich war allerhöchstens ein bisschen verrückt. Meine Wanderung stellte nicht den Versuch dar, zu mir selbst, inneren Frieden oder Gott zu finden.
Vielleicht musste ich, wie man so schön sagt, einfach einen klaren Kopf bekommen; vielleicht wusste ich, dass es vermutlich meine letzte Chance war. Wie die meisten Klischees stimmte beides mehr oder weniger. Aber ich wollte auch herausfinden, wie es ist, monatelang in vollkommener Freiheit in der Wildnis zu verbringen. Vor allem wollte ich wohl eine Herausforderung meistern, die mir seit meiner Kindheit durch den Kopf geisterte. Als ich noch ein zarter Junge war, erschien es mir wie eine Herkulesaufgabe, den Appalachian Trail in seiner vollen Länge zu gehen. Später dann, als Erwachsener, lag gerade in der Unmöglichkeit der Reiz.
*
Ich hatte von den Fernwanderern im Laufe der Jahre einige nützliche Tipps bekommen. Vor allem wusste ich, dass das größte Hindernis zu schweres Gepäck war, weshalb ich meinen treuen alten Rucksack in den Ruhestand schickte und in einen neuen, ultraleichten investierte. Dann tauschte ich mein wuchtiges Zelt in eine Hängematte um, kaufte einen leichten Schlafsack mit Gänsedaunen und verbannte meine Lederstiefel zugunsten neuer Geländelaufschuhe. Meine Reiseapotheke beschränkte ich auf ein paar Pillen gegen Durchfall, Jodtupfer, eine daumendicke Rolle Klebeband und eine Sicherheitsnadel. Den Gaskocher tauschte ich gegen ein fast gewichtsloses Utensil, das aus zwei Aluminiumdosen bestand. Als ich meine Ausrüstung in den neuen Rucksack gestopft hatte und ihn zum ersten Mal hochhob, war ich ebenso verblüfft wie erschrocken. Zu dürftig schien mir mein Pack, um einen Menschen fünf Monate lang zu kleiden, zu nähren und zu beherbergen.
Um mich nicht von einer blutleeren Diät aus Instantramen und gefriergetrocknetem Kartoffelbrei ernähren zu müssen, kochte ich Unmengen nahrhafter wasserreicher Speisen (Bohnen mit Naturreis, Quinoa, Couscous, Vollkornnudeln mit Tomatensauce), denen ich anschließend das Wasser entzog. Ich goss winzige Mengen Olivenöl und scharfe Sauce in kleine Plastikflaschen. Befüllte Plastikbeutel mit Backpulver, Körperpuder, Vitaminen und Schmerzmitteln. Dann teilte ich meine Vorräte in Fünf-Tage-Portionen und packte sie in insgesamt vierzehn Kartons. Dazu ein Gedichtbändchen oder einen dickeren Taschenbuchroman, den ich mit Rasiermesser und Paketband in dünne Hefte zerlegt hatte.
Die Kartons adressierte ich an Postfilialen auf dem Weg – in Orten wie Erwin, Hiawassee, Damascus, Caratunk oder Bland (mein Lieblingsname: ein Ort, der sich selbst öde nennt) –, worauf ich meinen Mitbewohner bat, sie jeweils zu einem bestimmten Datum abzuschicken. Ich kündigte meinen Job. Vermietete meine Wohnung unter. Verkaufte oder verschenkte alles, was ich entbehren konnte. Dann, an einem kalten Märztag, flog ich schließlich nach Georgia.
*
Auf dem Gipfel des Springer Mountain, des südlichen Endes des Appalachian Trail, begrüßte mich ein alter Mann, der sich Many Sleeps nannte. Den Spitznamen hatte er sich angeblich erworben, weil er eine der langsamsten vollständigen Wanderungen über den Trail gemacht hatte, die je registriert worden waren. Mit seinen herabhängenden Lidern und dem langen weißen Bart sah er aus wie Rip Van Winkle in Nylon.
In der Hand hielt Many Sleeps ein Klemmbrett. Seine Aufgabe bestand darin, von allen Wanderern, die den Trail in voller Länge gehen wollten, Informationen zu sammeln. Dieses Jahr sei sehr viel los: Allein an diesem Tag hätten sich schon zwölf Fernwanderer bei ihm angemeldet, am Vortag siebenunddreißig. Insgesamt hatten sich in diesem Frühling fast tausendfünfhundert Menschen auf den Weg gemacht, um vom Springer Mountain bis hinauf nach Maine zu laufen, wenngleich kaum ein Viertel von ihnen am Ziel ankommen sollte.
Ehe ich meine langersehnte Wanderung begann, hielt ich noch einmal inne, um vom Berggipfel das unter mir liegende Land zu bewundern: Wogen frostverbrannter Erde, die zum Horizont von Braun in Grau und Blau verblassten. Die Berge sanken und stiegen, liefen aufeinander zu, bis sie kollidierten. Weit und breit kein Ort, keine Straße. Da begriff ich, dass ich ohne den Appalachian Trail niemals nach Maine finden würde. In dieser mir fremden, unübersichtlichen Gegend hätte ich sogar Schwierigkeiten, auf den nächstgelegenen Grat zu gelangen. Von nun an würde der Trail fünf Monate lang meine Lebensader sein.
*
Auf einem Pfad zu gehen heißt, ihm zu folgen. Wie ein Kniefall oder eine Lehre erfordert und erwirkt das Wandern ein gewisses Maß an Demut. Um möglichst leicht zu wandern, hatte ich keine Landkarten und kein GPS-Gerät dabei, nur einen dünnen Reiseführer und einen billigen Kompass für Notfälle. Der Pfad war mein einziger echter Orientierungspunkt. Und so klammerte ich mich an ihn wie Theseus sich an seinen Ariadnefaden.
Einmal schrieb ich abends in mein Tagebuch: »Es gibt Momente, in denen man das Gefühl hat, das eigene Leben werde von irgendeinem nicht hundertprozentig gütigen Gott gelenkt. Man steigt einen Berggrat hinab, nur um ihn sogleich wieder hinaufzuklettern; man kraxelt auf einen steilen Gipfel, obwohl es offenkundig einen Weg gibt, der um ihn herumführt; man überquert ohne ersichtlichen Grund dreimal in einer Stunde denselben Fluss und macht sich dabei gründlich die Schuhe nass. Und alles, weil irgendwer einmal beschlossen hat, dass der Pfad genau hier entlangführen muss.«
Es war ein gruseliges Gefühl, meine Entscheidungen nicht selbstständig zu treffen. In den ersten Wochen dachte ich oft an eine Anekdote, die ich über den berühmten Insektenforscher E. O. Wilson gehört hatte. Ende der 1950er-Jahre schrieb Wilson, wenn er seine Besucher amüsieren wollte, mit einer speziellen chemischen Flüssigkeit seinen Namen auf ein Stück Papier. Sogleich kam ein Schwarm Feuerameisen aus dem Nest gekrochen, um sich pflichtbewusst in Reih und Glied aufzustellen und wie eine Marching Band die einzelnen Buchstaben des Namens abzulaufen.
Man muss dazusagen, dass Wilsons Partytrick aus einer wichtigen neuen Erkenntnis der Wissenschaft entstanden war. Wissenschaftler hatten zwar schon seit Jahrhunderten vermutet, dass Ameisen für ihre Gefährten unsichtbare Spuren als Wegweiser hinterlassen, aber Wilson war der erste, der ihre Quelle ausfindig machte: ein winziges fingerförmiges Organ, die sogenannte Dufoursche Drüse. Als er einer Feuerameise die Drüse aus ihrem Abdomen entnahm und sie über eine Glasplatte zog, schwärmte sogleich eine Schar Feuerameisen herbei. »Sie stürzten förmlich übereinander, so eilig hatten sie es, dem Pfad zu folgen, den ich für sie gelegt hatte«, erinnerte sich Wilson. Später synthetisierte er das Spurpheromon, von dem er schätzte, dass sich mit nur fünf Litern eine Billion Feuerameisen anziehen ließen.
1968 verfeinerte eine Forschergruppe in Gulfport im US-Bundesstaat Mississippi Wilsons Trick: Sie entdeckte, dass eine bestimmte Termitenart einer von einem normalen Kugelschreiber gezogenen Linie folgt, sofern dessen Mine Glykolverbindungen enthält, da die Termiten diese mit Spurpheromonen verwechseln – wobei ihnen aus irgendeinem Grund blaue Farbe lieber ist als schwarze. Seit dieser Entdeckung kritzeln Dozenten zum Vergnügen ihrer Studierenden blaue Spiralen auf Papier, auf dass Termitenschwaden verwirrte Kreise ins Nirgendwo ziehen.
Wenn der Pfad auf meiner Wanderung zu stark nach Osten oder Westen abdriftete, fragte ich mich manchmal, ob nicht vielleicht auch ich hinterhältigerweise im Kreis geführt wurde. Aus einem bestimmten Blickwinkel betrachtet stellen Pfade eine besonders unerbittliche Form der Fremdbestimmung dar. »Der Mensch mag sich wenden wohin er will, er mag unternehmen was es auch sei«, heißt es bei Goethe, »stets wird er auf jenen Weg wieder zurückkehren, den ihm die Natur einmal vorgezeichnet hat.« Auf dem Appalachian Trail war das ganz sicher der Fall. Auch wenn ich die umliegenden Wälder erkundete und in die Orte trampte, kehrte ich am Ende immer zum Trail zurück. Wenn Abenteuer vor allem Ungewissheit bedeutet, was für ein Abenteuer erlebte ich dann eigentlich gerade?
*
Durch den grauen Südstaatenfrühling wanderte ich nach Norden. Die Bäume schwarze Gerippe, der Boden in Laub gehüllt. Einmal, in Tennessee, waren meine Wanderschuhe am Morgen eisüberzogen. In North Carolina wanderte ich erst durch knietiefen Schnee, dann durch knöcheltiefen Schneematsch. Das Gehen war hart, aber immerhin erlebte ich alle paar Tage – unabhängig von der Gegend oder dem Wetter – das Vergnügen, einem dunklen Wald zu entschlüpfen und in Luft und Licht aufzusteigen.
In meiner zweiten Woche auf dem Trail traf ich auf eine nette kleine Gruppe Gleichgesinnter. Einige Wochen wanderten wir frohgemut zusammen. Doch als wir Virginia erreichten, beschleunigte ich meinen Schritt und ließ die Gruppe hinter mir. Wochen oder gar Monate später sollte ich ihr wiederbegegnen, wenn ich langsamer oder sie schneller wurde, als handelte es sich um einen wundersamen Zufall. Das Wunder war natürlich der Trail selbst, der uns zusammenhielt wie Perlen auf einer Kette.
Jeder Fernwanderer hatte seinen eigenen Wandernamen. Meist bekam man ihn, wenn man etwas Bestimmtes gesagt oder getan hatte; meine Freundin Snuggles zum Beispiel kuschelte sich nachts in den Unterständen immer an andere Wanderer, um sich warm zu halten. Manche suchten sich einen Namen aus, um eine neue, würdevollere Identität anzunehmen. Eine nervöse Frau mit silbernen Haaren nannte sich Serenity, während sich ein schüchterner junger Mann als Joe Kickass vorstellte; natürlich wurde sie mit der Zeit immer ruhiger und er immer kühner.
Eine Gruppe vergnügter älterer Damen taufte mich wegen des weltraumhaften Erscheinungsbilds meiner glänzenden Ausrüstung Spaceman. Der Name blieb hängen. Ich begann, Bildergeschichten in die Pfadregister zu zeichnen – das sind Notizbücher, die in regelmäßigen Abständen auf dem Trail ausliegen, damit sich die Wanderer eintragen und ihre Gedanken austauschen können. Der Protagonist meiner Comics war ein Allbewohner, der auf die Erde gekommen war und jetzt die seltsamen Bräuche und durchgeknallten Figuren auf dem ach so wilden Appalachian Trail bestaunte.
Etwa einmal die Woche trampte eine Wandergruppe in den nächsten Ort, um in einem billigen Motel – manchmal zu sechst oder zu acht in einem Einzelzimmer – zu duschen, die dreckigen Klamotten zu waschen, Bier zu trinken, unwahrscheinliche Mengen fettigen Essens zu verzehren und schlechte Fernsehsendungen zu schauen. Unsere Art, uns wie Barbaren den trügerischen Vergnügungen der Zivilisation hinzugeben. Am nächsten Morgen gierten wir danach, auf den Trail zurückzukehren, um den Dreck auszuschwitzen und die frische Luft zu genießen.
Ich hatte erwartet, dass der Trail ein Refugium für Einzelgänger wie mich sein würde; der Gemeinschaftssinn, der zwischen uns verstreuten Wanderern herrschte, überraschte mich, bis er schließlich zum Nektar meiner Reise wurde. Uns verband die gemeinsame Erfahrung. Jeder von uns wusste, wie es war, wochenlang durch Hagel, Schnee und Regen zu wandern. Wir hungerten; wir fraßen. Wir tranken von Wasserfällen. In den Grayson Highlands leckten uns wilde Ponys den Schweiß von den Beinen. In den Great Smoky Mountains störten Schwarzbären unseren Schlaf. Wir hatten alle dem Zerberus der Einsamkeit, der Langeweile und der Selbstzweifel ins Gesicht geblickt und festgestellt, dass wir ihn nur loswerden konnten, indem wir ihm davonwanderten.
*
Als ich meine Wandergefährten besser kennenlernte – ein bunter Haufen von Freiheitssuchern, Naturanbetern und Mondsüchtigen –, kam es mir plötzlich merkwürdig vor, dass wir uns alle aus freien Stücken demselben Wanderweg anvertraut hatten. Die meisten sahen in dieser Wanderung ein Intermezzo ungezügelter Freiheit, ehe sie wieder in das Korsett des Erwachsenenlebens zurückkehrten, das sie immer enger einschnürte. Aber wie sich herausstellte, findet man die Freiheit nicht auf einem Pfad. Eher ist das Gegenteil der Fall – ein Pfad ist eine diskrete Minimierung von Möglichkeiten. Die Freiheit des Pfades ist flussartig, nicht ozeanisch.
Um es einmal ganz schlicht zu sagen: Ein Pfad ist ein Weg, um sich die Welt zu erschließen. Man kann eine Landschaft auf die unterschiedlichsten Arten durchqueren; die Möglichkeiten sind überwältigend, der Stolperfallen viele. Die Funktion eines Pfades besteht darin, dieses ausufernde Chaos auf eine einzige lesbare Linie zu reduzieren. Die alten Weisen und Propheten – die zumeist zu einer Zeit lebten, da Fußpfade die Hauptverkehrswege darstellten – waren sich dessen zutiefst bewusst. Deshalb beschwören auch die Gründungstexte fast aller großen Religionen die Metapher des Weges. Zarathustra sprach von den »Pfaden« der Ermöglichung, der Erhöhung und der Erleuchtung. Die alten Hindus schrieben drei margas vor, drei Pfade, auf denen die Befreiung der Seele zu erreichen sei. Siddhārtha Gautama predigte den āryāṣṭāṅgamārga, den Edlen Achtfachen Pfad. Tao bedeutet wörtlich »Pfad«. Das hebräische Wort für das jüdische Gesetz, Halacha, heißt »Gehen«; das arabische Wort für das islamische Recht, Scharia, bedeutet wörtlich »der Pfad zur Wasserstelle«. Auch die Bibel ist voller Pfade: »Fragt nach den Wegen der Vorzeit, welches der gute Weg sei, und wandelt darin, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele!«, befahl der Herr den Götzendienern. (Worauf sie antworteten: »Wir wollen's nicht tun!«)
Viele Wege, sagen die überkonfessionellen Propheten, führen den Berg hinauf. Solange ein Pfad mir hilft, mich in der Welt zurechtzufinden und das Gute zu suchen, ist er per Definition von Wert. Nur selten trifft man auf einen geistlichen Führer, der predigt, es gebe keine Wege zur Erleuchtung. Manche Zen-Meister kamen dem zwar nahe, aber selbst der große Dōgen erklärte, Meditation sei »der direkte Pfad des Buddha-Wegs«. Die einzige Ausnahme ist der indische Philosoph Jiddu Krishnamurti. »Die Wahrheit ist ein pfadloses Land«, heißt es bei ihm. »Autoritäten gleich welcher Art sind, gerade auf dem Feld des Denkens und Verstehens, das Übelste und Schädlichste, was es gibt.« Kaum überraschend zog sein Weg der Weglosigkeit weniger Anhänger an als die beruhigend ausführlichen Anweisungen eines Mohammed oder Konfuzius. Die meisten Menschen, die sich im Jammertal des Lebens verloren fühlen, ziehen die einengende Beschränktheit eines einzelnen Weges der verwirrenden Freiheit ungekennzeichneter Wildnis vor.
*
Mein spiritueller Weg – so ich denn einen ging – war der Trail selbst. Für mich war das Fernwandern eine geerdete, aufs Wesentliche reduzierte Gehmeditation amerikanischer Prägung. Der mich einschränkende Weg machte meinen Geist frei für kontemplative Tätigkeiten. Meine aus dem Stegreif entworfene Wegreligion verfolgte das Ziel, dass ich mich ungehindert bewegen, einfach leben, von der Wildnis lernen und in Ruhe den beständigen Fluss der Erscheinungen betrachten konnte. Unnötig zu erwähnen, dass ich in fast jeder Hinsicht scheiterte. Als ich kürzlich noch einmal in meinem Tagebuch blätterte, stellte ich fest, dass ich die meiste Zeit auf Nörgeln, Tagträumen, logistische Sorgen und An-Essen-Denken verwandt hatte, anstatt meine Tage in einem Zustand gelassener Beobachtung zu verbringen. Erleuchtet wurde ich nicht. Aber alles in allem war ich doch glücklicher und gesünder als je zuvor in meinem Leben.
In den ersten Monaten steigerte ich mein Tempo allmählich von fünfzehn auf zwanzig, dann fünfundzwanzig und schließlich dreißig Kilometer am Tag. Als ich über die relativ niedrigen Berggrate von Maryland, Pennsylvania, New Jersey, New York, Connecticut und Massachusetts wanderte, wurde ich sogar noch schneller. In Vermont schaffte ich an die fünfzig Kilometer am Tag. Im Gehen wurde mein Körper für die Aufgabe des Gehens gerüstet. Meine Schritte wurden länger. Aus Blasen wurden Schwielen. Jedes überflüssige Fett und einiges an Muskeln in Brennstoff umgewandelt. Dabei gab es in der Maschine immer ein, zwei Bauteile, die nach Wartung schrien – ein entzündeter Knöchel, eine wundgeriebene Hüfte. Doch an den seltenen Tagen, an denen alles lief wie geschmiert, kam mir das Gehen auf dem Trail vor, als schösse ich im Sportwagen über eine leere Fernstraße: das perfekte Zusammenspiel von Herausforderung und Instrument.
Auch geistig veränderte ich mich, fast unmerklich. Nimblewill Nomad, ein legendärer alter Wanderer, erzählte mir, achtzig Prozent der Wanderer, die den Appalachian Trail in voller Länge hatten gehen wollen und aufgaben, täten es nicht aus körperlichen, sondern aus mentalen Gründen. »Sie kommen einfach nicht mit der Stille klar, über Tage, Wochen und Monate. Das ist eine echte Herausforderung«, sagte er.
Widerwillig lernte ich, die mönchische Stille der östlichen Wälder anzunehmen. An manchen Tagen glitt ich nach vielen gelaufenen Kilometern in einen Zustand fast vollkommener geistiger Klarheit – gleichmütig, kristallen, gedankenlos. Es war, wie die Zen-Weisen sagen, das reine Gehen.
*
Der Trail hinterlässt beim Wanderer Spuren: Meine Beine wurden zu einer Landkarte aus schwarzen Schürfwunden und bluteglig rosa Narben. Kraterähnliche Löcher klafften in meinen Wanderschuhen, Socken und Füßen. Durch die monatelange Reibung und den zersetzenden Schweiß löste sich mein T-Shirt auf. Wenn ich mir an den Rücken fasste, spürte ich, dass meine Schulterblätter wie aufgehende Flügel durch den abgewetzten Stoff stießen.
Gleichzeitig fiel mir auf, dass auch wir Wanderer den Trail veränderten. Zum ersten Mal bemerkte ich es, als ich an den Berghängen die steilen Serpentinen hinaufstieg. Ist ein Weg zu kurvenreich, nehmen Wanderer beim Abstieg gern Abkürzungen. Auch fiel mir auf, dass sich Wanderer in sumpfigen Gegenden immer möglichst trockenen Untergrund suchen, weshalb sich der Weg in mehrere Stränge teilte. Offenbar gab es einen grundlegenden Unterschied zwischen den Vorstellungen derer, die den Trail entworfen hatten, und derer, die ihn wanderten. Als ich später einmal ehrenamtlich beim Wegebau aushalf, erfuhr ich auch den Grund dafür: Wanderer suchen für gewöhnlich den Weg des geringsten Widerstands; Wegebauer dagegen versuchen, Wege so anzulegen, dass sie nicht erodieren, empfindliche Pflanzen schonen und nicht über Privatgelände führen. Nachdem in den USA den Wanderern zwanzig Jahre lang das Prinzip »keine Spuren hinterlassen« eingetrichtert worden ist, haben sich die beiden widerstrebenden Auffassungen zumindest wieder angenähert. Doch selbst wer gewissenhaft im Wegebett bliebe, würde den Pfad trotzdem verändern, weil jeder Schritt eines Wanderers zum Fortbestand des Pfades beiträgt. Würde alle Welt plötzlich beschließen, nicht mehr über den Appalachian Trail zu gehen, würde er überwuchert und irgendwann verschwinden.
An dieser Stelle gerät die Vorstellung vom spirituellen Pfad, wie er in unzähligen heiligen Büchern dargestellt wird, ins Wanken: In den Schriften wird er gern als ein unveränderlicher Weg zur Weisheit dargestellt, der uns von oben herabgesandt wurde. Aber Pfade sind wie Religionen selten starr. Sie unterliegen ständiger Wandlung – werden breiter oder enger, teilen oder verbinden sich –, abhängig davon, ob und wie Wanderer sie benutzen. Religiöse Wege und Wanderwege entstehen, wie die Taoisten sagen, indem man sie geht.
Pfade bilden sich durch Benutzung aus. Dauerhafte Pfade müssen demnach von Nutzen sein. Sie bleiben bestehen, weil sie einen begehrenswerten Ort mit einem anderen verbinden: einen Unterstand mit einer Süßwasserquelle, ein Haus mit einem Brunnen, ein Dorf mit einem Hain. Da sie ein gemeinschaftliches Verlangen ausdrücken und erfüllen, existieren sie, solange dieses Verlangen besteht; wenn es vergeht, vergeht auch der Weg.
In den 1980er-Jahren untersuchte Klaus Humpert, der als Professor für Stadtplanung an der Universität Stuttgart lehrte, einige Trampelpfade, die auf den Grünflächen des Campus als Abkürzung zwischen den gepflasterten Wegen entstanden waren. Er führte ein Experiment durch und tilgte die informellen Fußpfade des Campus, indem er auf ihnen neuen Rasen pflanzte. Wie erwartet, tauchten an exakt denselben Stellen sehr bald neue Pfade auf.
Diese spontan entstehenden Wege, die es überraschend oft gibt, heißen »Wunschlinien«. Man findet sie in den Parks aller größeren Städte der Welt, wo sie die beklagenswert ineffizienten rechten Winkel abkürzen. Auf Satellitenbildern habe ich selbst in den Hauptstädten der repressivsten Länder Wunschlinien gesehen – in Pjöngjang, in Naypyidaw, in Aşgabat. Verständlicherweise werden sie von diktatorischen Architekten genauso gehasst wie von den Diktatoren. Eine Abkürzung ist gleichsam ein geografisches Graffito, das auf das Versagen des autoritären Regimes hinweist, unsere Bedürfnisse vorauszusagen und unsere Wünsche zu kontrollieren. Stadtplaner versuchen manchmal, Wunschlinien mit Gewalt zu verhindern. Aber diese Taktik ist zum Scheitern verurteilt – Hecken werden niedergetrampelt, Schilder ausgerissen, Zäune umgelegt. Ein kluger Gestalter geht nicht gegen, sondern mit den Bedürfnissen.
Wenn ich früher im Wald oder im Stadtpark einen ungekennzeichneten Pfad sah, fragte ich mich, wer wohl der Urheber war. Mit der Zeit lernte ich, dass es sich für gewöhnlich nicht um eine einzelne Person handelte. Ein Weg bildet sich heraus. Jemand sieht eine Schwierigkeit, nimmt einen ersten Anlauf, dann kommt ein anderer, dann noch ein anderer, und schrittweise verbessert sich der Weg.
Wege sind in dieser Hinsicht nichts Besonderes – ein ähnlicher evolutionärer Prozess findet auch bei anderen gemeinschaftlich entstehenden Dingen statt, bei Märchen, Arbeitsliedern, Witzen oder Memes. Jedes Mal, wenn ich einen bestimmten alten Witz hörte, fragte ich mich, welcher geniale namenlose Komiker ihn wohl geschrieben hatte. Eine sinnlose Überlegung, da die meisten alten Witze nicht fertig auf die Welt gekommen sind, sondern sich über Jahrzehnte entwickelt haben. Richard Raskin, der zu jüdischem Humor forscht, hat Hunderte von Anthologien mit jüdischen Witzen durchgesehen, in den verschiedensten Sprachen und vom Anfang des 19. Jahrhunderts bis heute. Er stellte fest, dass sich die traditionellen jüdischen Witze häufig auf bestimmten »Wegen« entwickeln – mit Umdeutungen, logischerem Plot, neuen Figuren oder Situationen und überraschenderen Pointen –, wobei es immer darum geht, »das komische Potenzial der Geschichte auszureizen«. Ein guter Witz ist genau wie ein guter Weg das Ergebnis der Zusammenarbeit unzähliger Autoren und Autorinnen, Lektorinnen und Lektoren. Raskin gibt ein Beispiel aus dem Jahr 1928. Ein Ehepaar läuft über einen unbefestigten Weg, als plötzlich heftiger Regen einsetzt:
»Sarah, du musst deinen Rock anheben. Er saugt ja förmlich den Dreck auf!«, ruft der Mann.
»Das geht nicht. Meine Strumpfhose hat eine Laufmasche!«, erwidert die Frau.
»Warum hast du denn keine neue angezogen?«, fragt der Mann.
»Woher hätte ich denn wissen sollen, dass es regnen wird?«
Raskin hält diesen Witz für misslungen; ihm fehle der logische Widerspruch, der im Absurden liege. Aber die Version war ein Anfang. Zwanzig Jahre später hatte sich der Witz auf verschiedene Arten und Weisen weiterentwickelt: Die Szene begab sich nun nicht mehr an irgendeinem namenlosen Ort, sondern in der mythischen Stadt Chelm, in der es bekanntermaßen vor Dummköpfen wimmelt, die Sätze waren zugespitzt und aus der Strumpfhose ein Regenschirm geworden, wodurch das logische Paradox der Pointe besser funktionierte. Nachdem der Witz durch unzählige Münder gegangen war, avancierte der Kalauer zum Klassiker:
Zwei Weise aus Chelm gehen spazieren. Der eine hat einen Regenschirm dabei, der andere nicht. Plötzlich beginnt es zu regnen.
»Schnell, spann deinen Schirm auf!«, sagt der Weise ohne Schirm.
»Das ist sinnlos«, antwortet der andere.
»Wieso ist das sinnlos? Der Schirm hält doch den Regen ab.«
»Nein, leider nicht. Der Schirm ist löchrig wie ein Sieb.«
»Aber warum hast du ihn dann überhaupt mitgenommen?«
»Weil ich dachte, es würde heute nicht regnen!«
*
Einmal, an einem Nachmittag mit sintflutartigen Regenfällen, sah ich am Ufer des Nuclear Lake in New York hinter einer Biegung einen Schwarzbären über den Appalachian Trail tapsen. Offenbar konnte er mich wegen des Regens weder hören noch riechen. Er schnüffelte in aller Gemütsruhe in der Luft herum, bis ich meine Wanderstöcke aneinanderschlug, worauf er sich umdrehte, mich erblickte und erschrocken in den Wald abtrottete. Ich blieb stehen, um im Schlamm die Abdrücke der dicken Tatzen mit den scharfen Krallen zu inspizieren. Im Laufe der nächsten Wochen erkannte ich auf dem feuchten Untergrund noch verschiedene andere Abdrücke – meist von Hirschen, Eichhörnchen, Waschbären und, weiter im Norden, auch von Elchen. Wann immer ich den Trail verließ, um die umliegenden Wälder zu erkunden, erhaschte ich überrascht ein Schattenreich an Pfaden, die unbekannte Orte verbanden.
Der Mensch ist weder der erste noch der wichtigste Wegbereiter der Welt. Im Vergleich zu unseren plumpen Fußpfaden wirken die Pfade der Ameisen wie Wunderwerke. Auch sind viele Säugetierarten bemerkenswert geschickte Wegebauer. Selbst die dümmsten Tiere finden traumwandlerisch den effizientesten Weg durch ihre Umgebung. Unsere Sprache spiegelt diese Tatsache: In Japan wird die Wunschlinie kemonomichi genannt, Weg der Bestie, in Frankreich chemin de l'âne, Eselspfad, in Holland Olifantenpad, Elefantenpfad. In Amerika und England sagt man auch cow path, Kuhweg.
»Es heißt, Boston wurde von Kühen angelegt«, schrieb Ralph Waldo Emerson, womit er sich auf den – vermutlich apokryphen – Glauben bezog, das schiefe Raster der Stadt sei entstanden, indem man die alten Kuhwege gepflastert habe. »Es gibt jedenfalls schlechtere Landvermesser. Wer über unsere Wiesen und Weiden wandert, kann sich bei den Kühen bedanken, die uns den besten Weg durchs Dickicht und über die Hügel ebnen. Auch wissen alle Reisenden und Ureinwohner um den Wert eines Büffelpfads, der ihnen mit Sicherheit den leichtesten Weg über den Berggrat weist.« Über hundert Jahre später bestätigte eine Studie der University of Oregon Emersons Behauptung: Vierzig Kühe wurden gegen ein ausgeklügeltes Computerprogramm angesetzt, um den schnellsten Weg über ein Feld ausfindig zu machen. Die Kühe waren dem Computer deutlich überlegen und über zehn Prozent effizienter.
Vor der Kolonisierung Nordamerikas folgten viele Stämme den Pfaden der Hirsche und Bisons, die die niedrigsten Pässe über die Bergketten und die flachsten Flussübergänge gefunden hatten. In Indien und Afrika sollen Elefanten die zielführendsten Wege durch viele Gegenden geebnet haben. Nichtmenschlichen Tieren gelingt ein solch effizienter Wegebau nicht dank übermenschlicher Intelligenz, sondern durch schiere Beharrlichkeit. Sie suchen permanent nach einer besseren Route, und sobald sie eine gefunden haben, verwenden sie nur noch diese. So entstehen auf einfache, organische Weise durch Iteration Wegenetze von schier unglaublicher Effizienz, ohne dass eine vorherige Planung notwendig wäre.
Ein geduldiger Beobachter kann in Echtzeit zusehen, wie ein Pfad schnittiger wird. So erlebte der Physiker Richard Feynman dieses Phänomen, als er sich mit den Ameisen beschäftigte, die sein Haus in Pasadena befallen hatten. Eines Nachmittags sah er, wie eine Reihe von Ameisen den Rand seiner Badewanne entlangwanderte. Obwohl sein Fachgebiet nichts mit Ameisenkunde zu tun hatte, wollte er herausfinden, weshalb Ameisenpfade immer »so schön geradlinig« verlaufen. Er streute ein Häufchen Zucker ans Ende der Badewanne und wartete ein paar Stunden, bis eine Ameise es aufspürte. Als sie ein Bröckchen davonkarrte, um es zu ihrem Nest zu bringen, zeichnete Feynman ihren Weg über die Badewanne mit einem farbigen Stift nach. Es war »eine ziemliche Schlangenlinie« mit vielen Abwegen.
Sodann tauchte eine zweite Ameise auf, die der Spur folgte und den Zucker fand. Als auch sie zum Nest zurücktrottete, markierte Feynman ihre Spur mit einem andersfarbigen Stift. Die Ameise, die es offenbar eilig hatte, mit ihrer Beute heimzukehren, kam mehrmals vom Weg ab und verkürzte dabei viele unnötige Kurven, sodass die zweite Linie schon deutlich gerader verlief als die erste. Die dritte Linie, stellte Feynman fest, war noch gerader. Nachdem er die Wege von insgesamt zehn Ameisen nachgezeichnet hatte, bildeten die letzten Pfade wie erwartet eine schnurgerade Linie über den Badewannenrand. »Das Ganze ähnelt einer Skizze«, erklärte er. »Man fängt mit einer ziemlich schiefen Linie an, dann geht man einige Male darüber, bis man schließlich eine schöne gerade Linie hat.«
Wie ich später erfuhr, gibt es einen solchen Optimierungsprozess nicht nur bei Ameisen beziehungsweise bei Tieren allgemein. »In gewissem Maße versucht in der Natur alles, sich zu optimieren«, erzählte mir der Entomologe James Danoff-Burg.
Das fand ich faszinierend. Ich fragte ihn, ob er mir ein gutes Buch darüber empfehlen könne.
»Klar«, sagte er. »Der Ursprung der Arten von Charles Darwin.«
Die Evolution sei eine Art langfristiger genetischer Optimierung, die ebenfalls über das Prinzip von Versuch und Irrtum funktioniere. Und wie Darwin zeigte, sind im großen universellen Optimierungsprozess auch Fehler unentbehrlich. Wären nicht einige Ameisen fehleranfällig, würde der Ameisenpfad niemals gerade werden. Die Kundschafter sind vielleicht die genialen Architekten und Wegbereiter, aber jeder abtrünnige Arbeiter kann zufällig eine Abkürzung finden. Wir alle sind Optimierer, ob wir vorausgehen oder folgen, Regeln aufstellen oder brechen, erfolgreich sind oder versagen.
*
Nach dreieinhalb Monaten erreichte ich den Fuß des Mount Washington in New Hampshire. Ich unternahm den Aufstieg über den Crawford Path, den ich auch schon mit zehn Jahren gegangen war. In schneller Folge klapperte ich ein halbes Dutzend Gipfel ab, die ich in den letzten zehn Jahren schon einmal bestiegen hatte: die Presidential Range, Old Speck, Sugarloaf, Baldpate, die Bigelow Range. Manchmal überraschte mich die Reihenfolge; es war, als hätte jemand das Fotoalbum meiner Kindheit aufgeschlagen und meine Erinnerungen neu sortiert. Auch kamen mir die Berge jetzt kleiner vor. Aufstiege, für die ich als Kind Tage gebraucht hatte, dauerten nur noch ein paar Stunden. Es war unheimlich, gargantuesk – ein Gefühl, als würde man seinen alten Kindergarten besuchen.
Der Stolz auf mein Können war dabei immer von Demut durchsetzt. Ich war dreitausend Kilometer gewandert, hätte die Strecke aber niemals ohne fremde Hilfe schaffen können. Meine Route verdankte ich unzähligen freiwilligen Wegebauern und dem permanenten Strom früherer Wanderer.
Dieses Gefühl hatte ich auf dem Trail oft: Ich konnte gleichzeitig einen Gedanken und sein komplettes Gegenteil denken. Pfade befördern dieses Denken allein durch ihre Struktur. Sie verwischen die strikte Trennung von Wildnis und Zivilisation, Führern und Nachfolgern, ich und dem anderen, alt und neu, natürlich und künstlich. Passenderweise ist im Mahayana-Buddhismus das Bild des Mittleren Weges das Symbol für die Auflösung aller Dualität und nicht irgendeine andere Metapher. Die einzige Zweiheit, die für einen Pfad letztlich eine Rolle spielt, ist die zwischen Nutzung und Nichtnutzung – der kontinuierliche gemeinschaftliche Prozess der Herstellung von Sinn und der langsame entropische Prozess, bei dem dieser Sinn wieder aufgelöst wird.
*
Am 15. August, fast fünf Monate nachdem ich mich am Springer Mountain auf den Weg gemacht hatte, erreichte ich den Gipfel des Mount Katahdin in Maine. Unten in der Tiefe erstreckten sich, wohin ich blickte, grüne Wälder und blaue Seen und Inseln grüner Wälder in blauen Seen. Nach gefühltem monatelangem Dauerregen war der Himmel endlich aufgeklart. Ich konnte förmlich spüren, wie die Feuchtigkeit aus meinen Knochen wich. Endlich hatte ich das Ende des Trails erreicht.
In der Mitte des Gipfels verkündete ein ikonisches Holzschild das nördliche Ende des Appalachian Trail. Es hatte die Aura eines Schreins. Tageswanderer standen in respektvollem Abstand im Halbkreis um das Schild herum, während sich ihm eine Handvoll Fernwanderer – einer nach dem anderen – mit einem Ausdruck von Ehrfurcht und unterdrückter Erwartung näherte. Jeder durfte einen Augenblick allein bei dem Schild stehen und für ein Gedenkfoto posieren – manche überschwänglich, manche betrübt –, um sich schließlich wieder zu entfernen, damit sich der nächste Wanderer zu dem Schild stellen konnte.
Als ich an der Reihe war, legte ich die Hände auf das windgepeitschte Schild und küsste es. Der Moment hatte etwas Surreales; tausend Mal hatte ich ihn mir vorgestellt. Meine Freunde und ich holten eine Flasche billigen Champagner heraus, schüttelten sie und ließen den Inhalt in weit ausfächernden Bögen in die Luft schießen. Als wir einen Schluck nahmen, war der Champagner schon schal und warm. Ungefähr so fühlte es sich an, das Ende des Trails zu erreichen: prickelnd, aber auch irgendwie dumpf. Nach fünf Monaten war plötzlich alles vorbei.
Oder auch nicht. Als ich wieder zurück in New York war, stellte ich fest, dass ich die Welt immer noch mit den Augen eines Fernwanderers wahrnahm. Nach fast einem halben Jahr in gebirgiger Wildnis erschien mir die Stadt abwechselnd wie ein Wunder und wie ein Ungeheuer. Kaum ein Ort ist wohl stärker von menschlicher Hand geformt. Doch was mich am meisten verblüffte, war die Starrheit der Stadt: die geraden Linien, die rechten Winkel, Straßen aus Asphalt, Mauern aus Beton, Träger aus Stahl, strikte und mit Gewalt durchgesetzte Regeln. Es grassierte der Müll; alles war im Verfall begriffen. Der Trail hatte mich gelehrt, dass gute Gestaltung – wie bei jahrhundertealtem Werkzeug oder klassischen Märchen – etwas Pfadhaftes hat: Ein gemeinsames Bedürfnis wird durch ein ausgewogenes Gleichgewicht aus Effizienz, Flexibilität und Dauerhaftigkeit erfüllt. Pfade optimieren sich. Festigen sich. Lassen sich biegen, aber nicht brechen. Dagegen erschien mir unsere gebaute Umwelt auf fürchterliche oder gar gefährliche Weise unelegant.
Doch jetzt sah ich, wohin ich auch blickte, Pfade: eine Wunschlinie, die sich durch einen winzigen Park am East River wand, eine Reihe von Ameisen, die über meine Fensterbank krochen. Mir fiel auf, dass die Schuhe der Pendler in der U-Bahn schmierige Linien auf dem Beton hinterließen, dass die Eingänge der Nachtclubs von schwarz gewordenem Kaugummi und platt getretenen Zigarettenkippen markiert waren. Bei meiner gefräßigen Lektüre entdeckte ich, dass sich breite Pfade durch die Werke der Literatur, Geschichte, Ökologie, Biologie, Psychologie und Philosophie zogen. Als ich die Bücher niederlegte und wieder auf Wanderschaft ging, suchte ich nach Gefährten – Wanderern und Wegebauern, Jägern und Hirten, Entomologen und Ichnologen, Geologen und Geografen, Historikern und Systemtheoretikern –, um möglicherweise aus diesen vielen unterschiedlichen Fachgebieten einige allgemeingültige Wahrheiten herauszufiltern.
Irgendwann auf dem Weg wurde mir klar, dass meinem Denken eine einfache Idee zugrunde lag: Pfade geschmeiden sich zu ihrem Zweck und Ende. Ein Entdecker findet ein lohnendes Ziel, und jeder Wanderer, der seiner Spur folgt, macht den Weg ein wenig besser. Ameisenpfade, Wildwechsel, uralte Trampelpfade, moderne Wanderwege – sie alle passen sich kontinuierlich den Zielen derer an, die sie gehen. Wanderer, die es eilig haben, laufen geradere Wege, gemächliche Wanderer kurvenreichere, so wie manche Gesellschaften versuchen, ihren Profit zu maximieren, während andere möglichst große Gleichheit oder militärische Macht oder maximales Bruttonationalglück erreichen wollen.
Die Wege von Läufern und Wanderern sind oft unterschiedlich, weil diese, selbst wenn sie dasselbe Ziel haben, verschiedene Prioritäten setzen. William Herbert Guthrie-Smith, ein neuseeländischer Schafzüchter, hat einmal beobachtet, dass Reitwege auf offenem Gelände immer gerader werden, aber nur dort, wo die Pferde traben, kantern oder galoppieren durften. Beim langsamen Schritt folgten die Pferde bereitwillig jeder Biege des gewundenen Pfads, was für sie am unanstrengendsten war, da sie sich einfach den Konturen der Landschaft anpassen konnten. Wurden sie schneller, schnitten sie die Kurven, sodass diese sich verkürzten. Ließe man die Pferde »mit Renngeschwindigkeit laufen«, glaubte Guthrie-Smith, würden sie »aus den Pfaden mit der Zeit fast vollständig gerade Linien machen«.
Wir lernen daraus nicht nur, dass rennende Pferde ihre Wege optimieren, sondern auch, dass schnelle wie langsame Pferde immer den Weg des geringsten Widerstands suchen. Bei unterschiedlichen Zielen sind auch die Wege unterschiedlich. Diese Pfade, die sich überschneiden und kreuzen, erschaffen von unzähligen Lebewesen, die jeweils ihren eigenen Zweck verfolgen, sind der Erde Kette und Schuss.
*
Dieses Buch ist das Ergebnis jahrelanger Forschung und weiter Wanderungen. Auf dem Weg durfte ich mich von zahlreichen Fachleuten leiten lassen, die verschiedene Schlüsselelemente in der langen Geschichte der Pfade vom Präkambrium bis zur Postmoderne erhellten. Im ersten Kapitel nehmen wir die ältesten Fossilien der Welt unter die Lupe und gehen der Frage nach, warum Tiere sich überhaupt zu bewegen begannen. Das zweite Kapitel befasst sich damit, wie Insektenkolonien Wegenetze erstellen, indem sie ihre Schwarmintelligenz möglichst optimal nutzen. Im dritten Kapitel folgen wir den Spuren vierbeiniger Säugetiere – Elefanten, Schafe, Hirsche und Gazellen –, um herauszufinden, wie sie sich in ihren immensen Revieren zurechtfinden und inwiefern unsere Spezies durch das Jagen, Hüten und Studieren dieser Tiere geprägt wurde. Das vierte Kapitel legt dar, wie die ältesten menschlichen Gesellschaften ihre Umgebung mit Fußpfaden durchsetzten, die sich sodann eng mit den zentralen Fäden unserer Kultur verwoben – Sprache, Überlieferung und Gedächtnis. Im fünften Kapitel gehen wir dem verschlungenen Ursprung des Appalachian Trail und anderer moderner Wanderwege auf den Grund, Wege, die allesamt Jahrhunderte vor der Kolonisierung Amerikas durch die Europäer entstanden sind. Im sechsten und letzten Kapitel folgen wir dem längsten Wanderweg der Welt von Maine bis nach Marokko und überlegen, inwiefern uns Wege und Technologien – deren Kombination wir unser modernes Transportsystem und unser Kommunikationsnetzwerk verdanken – in zuvor unvorstellbarer Weise verbinden.
Als Autor und Wanderer bin ich auf meine eigene Erfahrung, meinen Hintergrund und meine Verortung in der Geschichte beschränkt. Sollten manche Leser der Ansicht sein, dieses Buch sei zu amerikazentrisch oder zu anthropozentrisch, so möchte ich sie um Verzeihung bitten; ich bin eben nur ein Mensch, der aus Amerika kommt und versucht hat, sich mit einem sehr komplexen Thema auseinanderzusetzen. Außerdem möchte ich darauf hinweisen, dass dieses Buch zwar eine räumliche und zeitliche Bewegung macht – von den kleinen und ältesten Dingen hin zu den großen futuristischen –, aber keine Teleologie im philosophischen Sinne darstellt, also keine Sprossen auf einer Leiter aufsteigt, die zu einem bestimmten Ziel führt. Ich bin nicht so naiv zu glauben, dass sich Pfade über Jahrmillionen immerfort weiterentwickelt hätten, um im Wanderweg des 21. Jahrhunderts ihren Kulminationspunkt zu erreichen. Insofern möchte ich meine Leserinnen und Leser bitten, dieses Buch nicht als eine aufwärts führende Leiter anzusehen, sondern als einen Pfad, der vom dunklen Horizont der Vergangenheit zum breiten Vordergrund der Jetztzeit mäandert. Wir hätten in unserer Geschichte viele Wege einschlagen können, haben aber eben nur einen tatsächlich genommen.
Pfade finden sich in nahezu jedem Teil unserer weiten, merkwürdigen, launenhaften, teils gezähmten, aber immer noch furchtbar wilden Welt. Seitdem es Leben auf der Erde gibt, haben wir Pfade erschaffen, um darauf zu reisen, Nachrichten zu überbringen, Vielfalt zu fördern und Weisheit zu bewahren. Zugleich haben Pfade unseren Körperbau und unsere Landschaften mitgeprägt und unsere Kultur verändert. Im Irrgarten der modernen Welt brauchen wir die Weisheit der Pfade wie eh und je, und in den immer labyrinthischer werdenden technologischen Netzwerken bald mehr denn je. Um uns in dieser Welt gewandt bewegen zu können, müssen wir verstehen, wie wir Pfade und wie Pfade uns formen.
Erstes Kapitel
Fossilienspuren
Der Welt einen Sinn geben
Um die Bedeutung von Wegen zu begreifen, muss man sich wohl zumindest einmal im Leben durch weglose Wildnis geschlagen haben. Dass dem europäischen Geist über tausend Jahre lang – vom Fall Roms bis zum Aufstieg der Romantik – wenige Dinge so sehr widerstrebten wie die »unwegsame«, »verworrene« Wildnis, hatte einen ganz praktischen Grund. In einer berühmten Passage spricht Dante von dem Gefühl, in einem »wilden Wald« zu stehen, in dem es keine Pfade gibt, »so rauh und dicht verwachsen, daß herber kaum der Tod mir schiene«.
Fünfhundert Jahre später konnte ein Romantiker wie Lord Byron verkünden: »Ha, welche Lust im unwegsamen Walde«, aber erst, nachdem die Wildnis in Westeuropa gezähmt und umzäunt worden war. Da glaubte man schon, die wahre »unwegsame Wildnis« existiere nur auf anderen Kontinenten wie etwa Nordamerika, wo die Wendung bis weit ins 19. Jahrhundert geläufig war.[1] So wurde die amerikanische Wildnis zum Symbol einer unwirtlichen, abgeschiedenen Gegend, die kalt, grausam und unzivilisiert ist. Auf der Boston Railroad Jubilee von 1851 beschrieb der Politiker Edward Everett das Land zwischen Boston und Kanada als »fürchterliche Wildnis, Flüsse und Seen ohne die Rahmung menschlicher Kunst, unwegsame Sümpfe, düstere Wälder, bei deren Betreten man sich unweigerlich zusammenkrümmt …«.
Noch heute gibt es unwegsame Wildnis, und manche Gegenden können tatsächlich immer noch Grauen erregen. Ich habe selbst eine solche Gegend durchstreift. Sie liegt am Nordufer des Western Brook Pond, eines Gletscherfjords auf der Insel Neufundland in der östlichsten kanadischen Provinz. Dort kann man – rüderweise – am eigenen Leib erleben, wie segensreich ein gut sichtbarer Weg ist.
Um das stygische Wasser des Fjords zu überqueren, musste ich die Fähre nehmen. An Bord erklärte mir der Kapitän, das Wasser unter dem Boot sei derart rein – oder wie der Hydrologe sagt: ultraoligotrophisch –, dass es fast scheine, als fließe hier gar kein Wasser; da es keinen elektrischen Strom leite, seien sogar die Sensoren der modernen Wasserpumpen verwirrt.
Am anderen Ufer des Fjords ging ich mit vier weiteren Wanderern am Anfang einer breiten Schlucht von Bord; durch den dichten Dschungel aus Farn führten mehrere Wildpfade bergauf zu einer Granitwand, die von einem Wasserfall durchschnitten wurde. Es war die erste Wanderung seit meiner Rückkehr vom Appalachian Trail. Ich fühlte mich stark; mein Rucksack war leicht. Während ich mich durch den hohen Farn wand, hatte ich die anderen Wanderer bald hinter mir gelassen. Über der Schlucht erreichte ich schließlich eine weite grüne Hochebene. Hier verblasste der Trampelpfad, dem ich gefolgt war, und verschwand. Vom Aufstieg verschwitzt, machte ich Rast und ließ die Füße über die Klippe baumeln. Am zerklüfteten westlichen Rand der Hochebene fiel der Fels jäh zum indigoblauen Fjord ab.
Auf der Klippe sitzend beobachtete ich, wie sich die anderen Wanderer die Schlucht heraufkämpften. Oben angekommen, folgten alle vier der Panoramaroute in Richtung Süden. Ich blickte ihnen nach, den schwer Gebeutelten, und verspürte plötzlich eine große Zuversicht. Ich stand auf, nahm Karte und Kompass in die Hand und wandte mich nach Norden. Das wird ja wohl zu schaffen sein, dachte ich. Sind doch nur fünfundzwanzig Kilometer.
Aber sobald ich mich wieder in Bewegung setzte, schwand die Zuversicht. Eigentlich hätte ich erleichtert darüber sein müssen, frei in jede Richtung gehen zu können, nachdem ich mich mein Leben lang in der strengen Enge von Pfaden und Wegen – von den Wanderwegen der Wildnis bis zu den Laufbändern der Flughäfen – bewegt hatte. Nein, im Gegenteil. Bei jeder zu treffenden Entscheidung durchfuhr mich ein Basston der Angst. Ich war allein und mein einziges Kommunikationsmittel eine vom Park ausgehändigte Funkbake, die aussah wie eine große Plastikpille mit herabbaumelndem Kabel. Damit könne man mich aufspüren, hatte man mir versichert, falls der Ranger vierundzwanzig Stunden nach meiner geplanten Rückkehr noch nichts von mir gehört habe. Das Gerät schien mir wunderbar geeignet, um Leichen zu bergen.
Noch qualvoller indes war die schiere Zahl winzigster Entscheidungen, die ich an jeder Ecke fällen musste. Mochte ich auch eine ungefähre Vorstellung von der Richtung meines Ziels haben, so musste ich doch unzählige Male eine Wahl aus dem Moment heraus treffen: ob ich bergauf oder bergab gehen sollte; ob dieser oder jener Grassoden mein Gewicht tragen würde, während ich auf Zehenspitzen durch ein Sumpfgebiet tapste; ob ich am Seeufer über die Steine hüpfen oder mich lieber durch den Busch schlagen sollte. In jeder Landschaft führen wie in einem mathematischen Beweis unzählige Wege zur Lösung, wobei manche elegant sind und andere nicht.
Ungleich schlimmer noch machten meine navigatorische Pein die neufundländischen »Tuckamore« – Haine aus windgebeutelt zwergenhaften Fichten und Tannen. Aus der Ferne glichen sie einer dichtgedrängten Schar buckliger, krallenhändiger Hexen. Wie in den meisten Zwergwäldern können die Bäume hier jahrhundertelang wachsen, ohne auch nur Kinnhöhe zu erreichen. Doch was ihnen an Höhe fehlt, gewinnen sie an Widerstandskraft.
Unzählige Male kam ich auf meiner Wanderung an eine Stelle, wo der Weg zu meinem nächsten Ziel von einem solchen kleinen Tuckamore versperrt war. Dann sah ich auf die Uhr, merkte mir die Zeit und schätzte, in zehn Minuten würde ich den Hain wohl durchquert haben. Ich atmete tief ein und trat in den dunkelgrünen Niederwald. Es war buchstäblich ein Albtraum. Urplötzlich stand ich in Düsternis und Chaos. Mit jedem Schritt, den ich mich durchs Dickicht kämpfte, kratzten mir Äste rote Scharten in die Haut und zerrten an den Wasserflaschen in den Seitentaschen meines Rucksacks. Frustriert versuchte ich, auf die Bäume zu treten, um sie zu brechen oder zumindest zu strafen, aber vergebens; unversehrt bogen sie sich zurück. Da und dort bildeten Abdrücke von Elchen oder Rentieren einen schmalen, schlammigen Wildwechsel, der aber bald wieder verblasste oder abschweifte. Als sich zu meiner Linken eine sonnige Lücke auftat, lief ich darauf zu, nur um an einem Schlammloch zu enden. Es war wie in einem Labyrinth, das mir keine andere Wahl ließ, als wieder und wieder mit gesenktem Kopf durch die Wand zu laufen.
Irgendwann trat ich erschöpft und blutend wieder hinaus. Der Blick auf die Uhr führte mir vor Augen, dass eine ganze Stunde vergangen und ich kaum fünfzig Meter vorangekommen war.
Mit der Zeit lernte ich, mich durch die Irrgärten zu winden, indem ich das Bewegungsverhalten der Elche nachahmte. Einer ihrer Tricks bestand darin, den Wasserrinnen zu folgen, die zwar schlammig sind, aber oft den zielführendsten Weg durchs Dickicht weisen. Außerdem treten Elche mit hohem Bogen auf, sodass sie die Zweige niederdrücken können. Diese Technik perfektionierend, kam ich zu meiner größten Offenbarung: Gegen Ende der Wanderung fand ich heraus, dass es das Beste war, dem gesunden Menschenverstand zu entsagen und mir gerade die dichtesten Tuckamore auszusuchen, um mich darin in die Höhe zu wuchten und wie ein Wuxia-Krieger über den Baumwipfeln zu laufen.
Zur Abenddämmerung des zweiten Tages war ich mindestens drei Kilometer vom Kurs abgekommen. Schon für die fünfundzwanzig Kilometer hatte ich einen ganzen Tag länger gebraucht als erwartet, und nicht eine Nacht hatte ich auf ebenem Boden oder in der Nähe einer Wasserquelle geschlafen.
Die ganze Nacht fiel leichter Regen. Kurz vor Sonnenaufgang erwachte ich in meinem Lager hoch oben auf einem Berggrat und sah ein breites Band hyazinthfarbenen Himmels auf mich zukommen. Anfangs hielt ich dieses herrliche Bild für eine Wolkenlücke und legte mich wieder schlafen. Doch als ich gerade zurück in den Schlafsack steigen wollte, fiel mir auf, dass der violette Streifen von feinen Blitzen geädert war. Was ich da sah, war kein klarer Himmel, sondern eine riesige, sich über den gesamten Horizont erstreckende Gewitterwolke, der ein leises Verdauungsgrummeln entfuhr.
Keine halbe Stunde später stürmte die Gewitterwolke über mich hinweg. Regen peitschte durch die Luft. Aus Angst vor einem Blitzschlag stieg ich aus dem Schlafsack, krabbelte unter der Zeltplane hervor und rannte zum tiefsten Punkt, den ich finden konnte. Dort hockte ich mich auf den Fußballen auf meine Isomatte und legte zitternd und durchnässt die Hände über den Kopf, während rundum die feinen Lichtfäden detonierten.