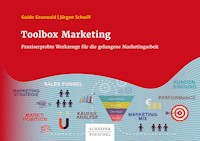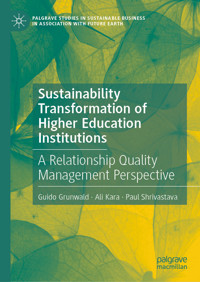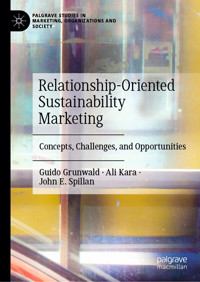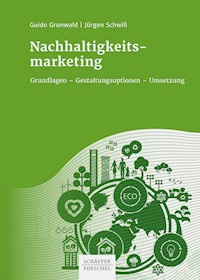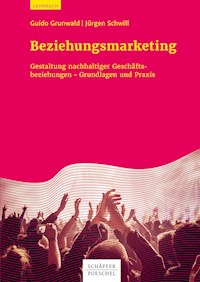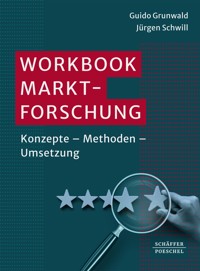
39,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schäffer Poeschel
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Sowohl für die eigene Durchführung von Marktforschungsstudien als auch für die Interpretation und Beurteilung von in Auftrag gegebenen Studien sind profunde Marktforschungskenntnisse unverzichtbar. Mit welcher Erhebungsmethode können Daten möglichst unverzerrt gewonnen werden? Wie ist das Erhebungsdesign festzulegen, um einen hohen Datenrücklauf zu erreichen? Wie können die Daten analysiert und interpretiert werden? Wie lässt sich die Qualität der Studie und der Ergebnisse einschätzen? Wie können die Ergebnisse zielgruppengerecht präsentiert werden? Das Workbook Marktforschung bietet Praktiker:innen und Studierenden einen schnellen Überblick über die Methoden und Werkzeuge zur Konzeption, Durchführung und Beurteilung von Marktforschungsstudien. Dabei werden die zentralen Methoden der qualitativen und quantitativen Forschung zur Erhebung und Analyse von Marktdaten abgedeckt. Die Tools werden in kompakt-strukturierter Form präsentiert und anhand von Beispielen erläutert. Zu jedem Tool gibt es hilfreiche Tipps für die praktische Umsetzung. Mit Zusatzmaterial auf myBook+. Die digitale und kostenfreie Ergänzung zu Ihrem Buch auf myBook+: - Zugriff auf ergänzende Materialien und Inhalte - E-Book direkt online lesen im Browser Jetzt nutzen auf mybookplus.de.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 360
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
InhaltsverzeichnisHinweis zum UrheberrechtImpressumAbbildungsverzeichnisTabellenverzeichnisVorwort1 Grundlagen der Marktforschung1.1 Begriff, Bedeutung und historische Entwicklung1.2 Ziele, Aufgaben und Erscheinungsformen1.3 Entwicklungen und Trends 1.4 Rahmenbedingungen1.5 Marktforschungsprozess2 Untersuchungsziel: Was soll mit der Studie erreicht werden?2.1 Problemstellung und Zielformulierung2.2 Hypothesenableitung und -formulierung3 Studientyp: Wie sollen Erkenntnisse gewonnen werden?3.1 Sekundär- vs. Primärforschung3.2 Qualitative vs. quantitative Forschung4 Durchführender: Wer führt die Studie durch?4.1 Eigen- vs. Fremdmarktforschung4.2 Erhebungstool und Marktforschungsinstitut5 Erhebungsumfang: Welche und wie viele Elemente werden erhoben?5.1 Grundgesamtheit5.2 Voll- vs. Teilerhebung5.3 Auswahlverfahren5.4 Stichprobenumfang6 Erhebungsmethode und -form: Wie werden Daten gewonnen?6.1 Befragung vs. Beobachtung6.2 Experiment6.3 Querschnitts- vs. Längsschnittstudie7 Erhebungsinstrument: Wie werden Daten erfasst und gemessen?7.1 Operationalisierung7.2 Fragebogen7.3 Interviewleitfaden7.4 Beobachtungsanleitung/-bogen8 Erhebungsablauf und -durchführung: Wo wird wann wie lange erhoben?8.1 Klärung rechtlicher Fragen8.2 Ankündigung und Anschreiben8.3 Incentivierung8.4 Feldzeit und Nachfassaktion9 Datenanalyse: Wie leiten sich welche Erkenntnisse aus den Daten ab?9.1 Vorbereitende Maßnahmen9.2 Anwendung von Analyseverfahren9.3 Ergebnisinterpretation10 Qualitätsbeurteilung: Wurde das Untersuchungsziel erreicht?10.1 Qualitätssicherung in unterschiedlichen Phasen10.2 Gütekriterien zur Qualitätsbeurteilung11 Ergebnispräsentation: Wie lassen sich Ergebnisse passend kommunizieren?11.1 Ziel- und Zielgruppenfokussierung11.2 Präsentationsformat, Ergebnisdarstellung und -formulierung11.3 Einholung von Feedback11.4 Klärung weiterer BedarfeLiteraturGlossarDie AutorenStichwortverzeichnisBuchnavigation
InhaltsubersichtCoverTextanfangImpressumHinweis zum Urheberrecht
Alle Inhalte dieses eBooks sind urheberrechtlich geschützt.
Bitte respektieren Sie die Rechte der Autorinnen und Autoren, indem sie keine ungenehmigten Kopien in Umlauf bringen.
Dafür vielen Dank!
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Print:
ISBN 978-3-7910-6249-5
Bestell-Nr. 12056-0001
ePub:
ISBN 978-3-7910-6251-8
Bestell-Nr. 12056-0100
ePDF:
ISBN 978-3-7910-6252-5
Bestell-Nr. 12056-0150
Guido Grunwald/Jürgen Schwill
Workbook Marktforschung
1. Auflage, August 2024
© 2024 Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft · Steuern · Recht GmbH
Reinsburgstr. 27, 70178 Stuttgart
www.schaeffer-poeschel.de | [email protected]
Bildnachweis (Cover): © simarik, iStock
Produktmanagement: Dr. Frank Baumgärtner
Lektorat: Anette Villnow, Wiesbaden
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere die der Vervielfältigung, des auszugsweisen Nachdrucks, der Übersetzung und der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, vorbehalten. Der Verlag behält sich auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor. Alle Angaben/Daten nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.
Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart Ein Unternehmen der Haufe Group SE
Sofern diese Publikation ein ergänzendes Online-Angebot beinhaltet, stehen die Inhalte für 12 Monate nach Einstellen bzw. Abverkauf des Buches, mindestens aber für zwei Jahre nach Erscheinen des Buches, online zur Verfügung. Ein Anspruch auf Nutzung darüber hinaus besteht nicht.
Sollte dieses Buch bzw. das Online-Angebot Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte und die Verfügbarkeit keine Haftung. Wir machen uns diese Inhalte nicht zu eigen und verweisen lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung.
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Planungsprozess einer Marktforschungsstudie (Quelle: vgl. Grunwald/Hempelmann 2012, S. 17; Homburg 2017, S. 253)
Abb. 2: S-O-R-Modellstruktur (Quelle: Grunwald/Hempelmann 2017, S. 48)
Abb. 3: Visualisierung von Hypothesen (Quelle: eigene Darstellung)
Abb. 4: Vollerhebung und Teilerhebung bei gegebener Grundgesamtheit(Quelle: eigene Darstellung)
Abb. 5: Arbeitsschritte zur Festlegung eines Auswahlplans(Quelle: vgl. Fantapié Altobelli 2023, S. 197)
Abb. 6: Auswahlverfahren im Überblick(Quelle: Grunwald/Hempelmann 2012, S. 38)
Abb. 7: Zirkuläres Modell qualitativer Forschung(Quelle: vgl. Flick 2002, S. 73; Wrona 2005, S. 14)
Abb. 8: Vorgehen bei der Berechnung des Stichprobenumfangs bei Zufallsstichproben (Quelle: eigene Darstellung)
Abb. 9: Funktionsweise eines Online-Access-Panels (Quelle: Grunwald 2016, S. 937)
Abb. 11: Beispielhafte Variablen zur Messung der Verkaufsqualität am Point of Sale (POS) im Rahmen teilnehmender Beobachtung durch Mystery Shopping (Quelle: eigene Darstellung)
Abb. 12: Typischer Ablauf einer Delphi-Befragung (Quelle: vgl. Grunwald/Hempelmann 2017, S. 105)
Abb. 13: Anwendungsbeispiel einer Means-End-Kette (Quelle: in Anlehnung an Kuß/Tomczak 2000, S. 62)
Abb. 14: Quantitative Messung von Kundenzufriedenheiten am Beispiel des Automobilkaufs (Quelle: vgl. Gelbrich et al. 2007, S. 907)
Abb. 15: Blueprint für den Neuwagenkauf (Quelle: vgl. Gelbrich 2007, S. 621)
Abb. 16: Mixed-Methods-Ansatz am Beispiel des Automobilkaufs (Quelle: vgl. Gelbrich et al. 2007, S. 916)
Abb. 17: Prozess der Operationalisierung (Quelle: eigene Darstellung)
Abb. 18: Beispiel zur Paarvergleichsmethode (Quelle: eigene Darstellung)
Abb. 19: Beispiel zum Rangordnungsverfahren (Quelle: eigene Darstellung)
Abb. 20: Beispiel zum Konstantsummenverfahren (Quelle: eigene Darstellung)
Abb. 21: Beispiel zur Likert-Skala (Quelle: eigene Darstellung)
Abb. 22: Beispiel zum Semantischen Differenzial (Quelle: vgl. Grunwald/Hempelmann 2012, S. 61)
Abb. 23: Ablaufschritte bei der Fragebogengestaltung (Quelle: vgl. Grunwald/Hempelmann 2012, S. 62)
Abb. 24: Beispiel für einen Fragebogen zur Kundenzufriedenheit(Quelle: vgl. Grunwald/Hempelmann 2013, S. 33 f.)
Abb. 25: Beobachtungsbogen einer Kundenlaufanalyse im Shopping-Center(Quelle: vgl. Weis/Steinmetz 2008, S. 442)
Abb. 26: Beobachtungsanleitung für Mystery Shopper zur Beurteilung der Servicequalität von Bankangestellten(Quelle: Fantapié Altobelli 2007, S. 104 f.)
Abb. 27: Checkliste: Wettbewerbsbeobachtung im Handel
Abb. 28: Beispielhafte Ankündigung einer Kundenbefragung(Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Theobald 2017, S. 45)
Abb. 29: Beispielhaftes Einladungsschreiben einer Kundenbefragung(Quelle: in Anlehnung an Theobald 2017, S. 45 ff.)
Abb. 30: Beispielhafte Einleitungsseite zu einer Kundenbefragung(Quelle: Theobald 2017, S. 46)
Abb. 31: Ablauf von Nachfassaktionen(Quelle: vgl. Faulbaum 2019, S. 167)
Abb. 32: Schritte zur Vorbereitung der Datenanalyse (Quelle: vgl. Fantapié Altobelli 2011, S. 214)
Abb. 33: Datenmatrix am Beispiel des Dateneditors im Programm SPSS (Quelle: eigene Darstellung)
Abb. 34: Einflussfaktoren auf die Datenqualität von Online-Befragungen (Quelle: Grunwald 2016, S. 939)
Tabellenverzeichnis
Tab. 1: Informationsbereiche der Marktforschung
Tab. 2: Historische Meilensteine in der Entwicklung der Marktforschung
Tab. 3: Funktionen der Marktforschung
Tab. 4: Erscheinungsformen der Marktforschung
Tab. 5: Anwendungsgebiete von Big Data in der Marktforschung
Tab. 6: KI-Tools zur Datenanalyse
Tab. 7: Grundsätze der Datenschutz-Grundverordnung und allgemeine Regelungen des Datenschutzes in der Marktforschung
Tab. 8: Richtlinien und Inhalte der deutschen Markt- und Sozialforschungsverbände
Tab. 9: Untersuchungsziele der Marktforschung
Tab. 10: Beispiele für Organismusvariablen im Überblick
Tab. 11: Hypothesenarten im Überblick
Tab. 12: Exemplarische Hypothesenformulierungen
Tab. 13: Phasen einer Metaanalyse
Tab. 14: Informationsbedarfs-Sekundärdaten-Matrix
Tab. 15: Grundlegende Studientypen
Tab. 16: Vor- und Nachteile der Eigenmarktforschung
Tab. 17: Vor- und Nachteile der FremdmarktforschungEigenmarktforschung
Tab. 18: DIY-Lösungen in der Marktforschung
Tab. 19: Checkliste zur Auswahl von Marktforschungsinstituten
Tab. 20: Vor- und Nachteile der Auswahl aufs Geratewohl
Tab. 21: Vor- und Nachteile der Quotenauswahl
Tab. 22: Vor- und Nachteile des Konzentrationsverfahrens
Tab. 23: Vor- und Nachteile der einfachen Zufallsauswahl
Tab. 24: Vor- und Nachteile der Klumpenauswahl
Tab. 25: Vor- und Nachteile der geschichteten Auswahl
Tab. 26: Maßnahmen zur Steigerung von Rücklauf und Ausschöpfung
Tab. 27: Qualitätskriterien zur Beurteilung von Online-Access-Panels und Crowdsourcing-Plattformen
Tab. 28: Vor- und Nachteile unterschiedlicher Formen standardisierter Befragungen
Tab. 29: Fallstudienarten
Tab. 30: Beispiel für einen SERVQUAL-Fragebogen
Tab. 31: Design der empirischen Untersuchung im Rahmen der integrierten Zufriedenheitsmessung
Tab. 32: Beispiel eines Zwischengruppendesigns
Tab. 33: Beispiel eines Innergruppendesigns
Tab. 34: Beispiel eines gemischten Designs
Tab. 35: Beurteilung von Zwischengruppen-, Innergruppen- und gemischtem Design
Tab. 36: Charakterisierung einzelner Panelarten und Panelformen
Tab. 37: Zusammenfassende Bewertung von Querschnitts- und Längsschnittstudien
Tab. 38: Beispiele für Reliabilitäts- und Validitätsprobleme bei der Operationalisierung
Tab. 39: Darstellung des Ergebnisses der Operationalisierung am Beispiel des Konstrukts »Situationskontrolle«
Tab. 40: Beispielhafte Messung des Konstrukts »Nachhaltiges Konsumbewusstsein« (Consciousness for Sustainable Consumption – CSC) nach Balderjahn et al.
Tab. 41: Fragearten nach den Antwortmöglichkeiten
Tab. 42: Fragearten nach dem Frageinhalt
Tab. 43: Beispiele zur Illustration problematischer versus unproblematischer Fragenformulierungen
Tab. 44: Die SPSS-Methode nach Helfferich
Tab. 45: Beispiele für Fragen und Formulierungen in der qualitativen Einzelinterviewführung
Tab. 46: Beispielhafte Inhalte eines Beobachtungsbogens
Tab. 47: Checkliste zur Klärung rechtlicher Fragen
Tab. 48: Zentrale Kommunikationselemente bei Ankündigungs- und Einladungsschreiben
Tab. 49: Beispielhafte Incentiveformen
Tab. 50: Beispiele für nachhaltige Incentivierung in der Marktforschungspraxis
Tab. 51: Prüfkriterien bei der Editierung
Tab. 52: Beispiel eines Kodierplans zu einem Fragebogenausschnitt
Tab. 53: Maßnahmen im Rahmen der Datenüberprüfung
Tab. 54: Item-Skala-Statistiken
Tab. 55: Systematisierung von Datenanalyseverfahren
Tab. 56: Überblick über ausgewählte multivariate Verfahren der Dependenzanalyse
Tab. 57: Überblick über ausgewählte multivariate Verfahren der Interdependenzanalyse
Tab. 58: Kombination von Analyseverfahren
Tab. 59: Gütestandards quantitativer und qualitativer Forschung
Tab. 60: Ziel- und Zielgruppenfokussierung bei der Ergebnispräsentation
Tab. 61: Alternative Formate zur Vermittlung von Marktforschungsergebnissen
Tab. 62: Leitfaden zur Umsetzung von Storytelling bei der Präsentation von Marktforschungsergebnissen
Tab. 63: Prinzipien für die Ergebnisformulierung
Tab. 64: Ethische Aspekte bei der Darstellung und Formulierung von Marktforschungsergebnissen
Tab. 65: Alternativen zur Einholung von Feedback bei Marktforschungspräsentationen
Vorwort
Zur fundierten Entscheidungsfindung im Marketing werden Daten über Märkte benötigt. Diese werden von der Marktforschung erhoben, analysiert, aufbereitet und durch Interpretation in dem jeweiligen Sachkontext zu verwertbaren Informationen (»Insights«) für die jeweiligen Auftraggeber angereichert. Die Untersuchungsziele der Marktforschung sind sehr vielfältig. Sie reichen von der Identifikation neuer Zielgruppen und Wettbewerber über deren Beschreibung und Gruppierung (Segmentierung) bis hin zur Erklärung ihres derzeitigen und der Prognose ihres zukünftigen Verhaltens. Angesichts sich dynamisch entwickelnder Märkte, geprägt von Digitalisierung, einer Vielzahl genutzter Vertriebs- und Kommunikationskanäle und verfügbarer Daten, Nachhaltigkeitsorientierung, Netzwerkgesellschaft und Krisen, sind die mit der Bearbeitung der Untersuchungsziele verbundenen Aufgaben der Marktforschung sehr komplex.
Ihre Bearbeitung erfordert zum einen Fachkompetenz in Bezug auf die zu untersuchenden Inhalte, wie etwa bestimmte Produktmärkte oder Kundentypen, sowie methodische Kompetenzen für die sachgerechte Planung und Durchführung von Datenerhebung und Datenanalyse. Darüber hinaus werden von Marktforschern kommunikative und kooperative Kompetenzen verlangt, um im Team, etwa gemeinsam mit Psychologen und Soziologen, Sinnzusammenhänge in komplexen und umfangreichen Datenbeständen aufzuspüren, Verfahrensschritte im stetigen Austausch mit externen oder internen Auftraggebern zu gestalten und Ergebnisse verständlich und zielführend, zum Nutzen aller Beteiligten, zu kommunizieren.
Mit dem vorliegenden »Workbook Marktforschung« soll ein Beitrag zur Herausbildung dieser Kompetenzen geleistet werden, indem die einschlägigen Konzepte und Methoden der Marktforschung anwendungsnah vermittelt werden. Hierbei wird auf sämtliche Phasen einer Marktforschungsstudie eingegangen – angefangen von der Festlegung der Untersuchungsziele über die Planung und Durchführung von Datenerhebung und Datenanalyse bis hin zur Aufbereitung und Präsentation der Ergebnisse. Der Fokus wird dabei auf die Datenerhebung gelegt.
Der Anwendungscharakter dieses Workbooks kommt in den zahlreichen Beispielen und Leitfäden sowie Tabellen und Checklisten mit Empfehlungen zur Umsetzung zum Ausdruck. Das Buch richtet sich an Studierende der Betriebswirtschaftslehre und angrenzender Disziplinen im Bachelor- wie im Masterstudium an Hochschulen, Universitäten und Akademien, die Marktforschungsstudien selbst konzipieren und durchführen oder einzelne Methoden schnell verwertbar nachvollziehen möchten. Auch Praktiker erhalten einen schnell verwertbaren Überblick über die einschlägigen Konzepte und Methoden der Marktforschung sowie Anregungen für deren praktische Umsetzung.
Sehr herzlich danken möchten wir Dr. Frank Baumgärtner und Claudia Dreiseitel vom Schäffer-Poeschel Verlag sowie Anette Villnow (freie Lektorin) für die stets engagierte Begleitung und konstruktive Zusammenarbeit.
Lingen/Ems und Brandenburg an der Havel, im März 2024
Guido Grunwald und Jürgen Schwill
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern in diesem Buch das generische Maskulinum verwendet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.
1 Grundlagen der Marktforschung
In diesem Kapitel werden die begrifflichen und konzeptionellen Grundlagen sowie die aktuellen Rahmenbedingungen und Entwicklungen der Marktforschung erörtert. Zudem wird der Planungsprozess der Marktforschung skizziert, der den weiteren Kapiteln dieses Buches zugrunde gelegt wird.
1.1 Begriff, Bedeutung und historische Entwicklung
Marktorientiert agierende Unternehmen müssen sich den permanent ändernden Bedingungen und Anforderungen des Marktes stellen, um adäquate Entscheidungen treffen zu können. Dazu ist es erforderlich, dem Management auf empirischem Wege eine relevante Informationsgrundlage zu liefern, um wahrgenommene betriebliche Defizite in den Informationsbereichen des Marketings zu beheben (vgl. Grunwald/Hempelmann 2012, S. 1; Böhler 2004, S. 19; Pfaff 2005, S. 9).
Je nach Informationsfokus lassen sich unterschiedliche Informationsbereiche differenzieren mit diversen Indikatoren und Analyseansätzen, wie sie in Tabelle 1 zusammengefasst werden.
Informationsfokus
Informationsbereich
Beispielhafte Indikatoren/Analyseansätze
Informationsbereiche
Globale Umwelt
Wirtschaft
• Bruttonationaleinkommen
Wechselkursentwicklungen
Inflationsraten
Rohstoff- und Energiepreise
…
Gesellschaft
• Gesellschaftliche Struktur
Gesellschaftliche Trends
Demografische Entwicklung
…
Politik
• Gesetzgebung
Steuern und Subventionen
Politische Stabilität
Zwischenstaatliche Abkommen
Regulierungen/Deregulierungen
…
Technologie
• Ausgaben für Forschung & Entwicklung
Patentanmeldungen
Produkt- und Prozessinnovationen
Technologische Dynamik
…
Natürliche Umwelt
• Klima
Ressourcen
Infrastruktur
…
Märkte
Regionen
• Regionale Märkte
Nationale Märkte
Internationale Märkte
…
Branchen
• Konsumgüter (B-to-C)
Investitionsgüter (B-to-B)
Dienstleistungen
…
Strukturen
• Marktpotenzial
Marktvolumen
Marktanteile
Marktsegmente
…
Entwicklungen
• Markttrends
Marktprognosen
Chancen- und Risiken-Analysen
…
Marktpartner
Käufer/Konsumenten/Kunden/Nutzer
• Käuferstrukturen/-segmente
Käuferverhalten
Kundenzufriedenheit/-loyalität
Kundenpanels
Kundenfluktuation
Nutzerprofile
…
Konkurrenten
• Konkurrenzbeobachtungen
Konkurrenzanalysen
Benchmarking
…
Absatzmittler
• Standortanalysen
Sortimentsanalysen
Analysen des Bestellverhaltens
Handelspanels
…
Lieferanten
• Beschaffungsmarktanalysen
Standortanalysen
Lieferantenanalysen
…
Marketing-Mix
Produkt
• Produktakzeptanztests
Verpackungstests
Markierungstests
Produkttestmärkte
…
Kommunikation
• Werbemitteltests (Pre- und Posttests)
Werbewirkungsanalyse
Werbeerfolgskontrollen
Werbeträgeranalysen
Social-Media-Analysen
…
Preis
• Preisanalysen
Preisakzeptanztests
Preiselastizitäten
…
Distribution
• Absatzwegeanalysen
Imageanalysen von Absatzmittlern
Storetests
Mystery Shopping
Vertriebsaudits
…
Tab. 1: Informationsbereiche der Marktforschung
(Quelle: vgl. Fantapié Altobelli 2023, S. 15; Koch et al. 2016, S. 3)
Welche Informationen von bzw. mit Unterstützung der Marktforschung zu generieren sind, hängt im Wesentlichen von der konkreten unternehmerischen Zielsetzung ab.
Praxisbeispiel: Vertrieb von Akku-Rasenmähern
Ein Hersteller von Akku-Rasenmähern, der seine Produkte bundesweit vertreiben möchte, benötigt eine breite Palette von Marktinformationen, um eine erfolgreiche Vertriebsstrategie zu entwickeln. Nachfolgend aufgeführt sind einige wichtige InformationenInformation, die für diese Unternehmensentscheidung relevant sein können:
Informationen über Marktgröße und -wachstum: Wie groß ist der Markt für Rasenmäher in Deutschland? Gibt es einen wachsenden Trend hin zu umweltfreundlicheren und akkubetriebenen Rasenmähern?
Informationen über Wettbewerber: Wer sind die Hauptkonkurrenten in diesem Marktsegment? Welche Art von Rasenmähern bieten sie an (z. B. Benzin-, Elektro- oder Akkumäher)? Wie sind ihre Preise und Positionierungen?
Informationen über Marktsegmente/Zielgruppen: Wer sind die potenziellen Kunden für Akku-Rasenmäher? Gibt es bestimmte Marktsegmente oder Zielgruppen, die besonderes Interesse an Akku-Rasenmähern haben?
Informationen über Kundennachfrage und Bedürfnisse: Welche spezifischen Bedürfnisse und Anforderungen haben Kunden an Rasenmäher in Deutschland? Gibt es bestimmte produktspezifische Funktionen oder Merkmale, die besonders gefragt sind?
Informationen in Bezug auf die Kommunikationsstrategie: Welche kommunikationspolitischen Maßnahmen sind geeignet, um die Bekanntheit und den Absatz von Akku-Rasenmähern zu steigern?
Informationen über Vertriebskanäle und -logistik: Welche Vertriebskanäle (Baumärkte, Online-Handel, Verkaufsplattformen etc.) sind in Deutschland geeignet, um Rasenmäher zu vertreiben? Wie werden der Vertrieb und die Versorgungskette organisiert, um bundesweit zu liefern?
Informationen in Bezug auf die Preisfindung: Welche Preisspanne ist für Akku-Rasenmäher akzeptabel und wettbewerbsfähig? Wie gestaltet sich die Preissituation im Vergleich zu anderen Arten von Rasenmähern?
Informationen in Bezug auf regulatorische Anforderungen: Gibt es bestimmte Vorschriften oder Umweltauflagen für Rasenmäher, die berücksichtigt werden müssen?
Informationen in Bezug auf After-Sales-Aktivitäten: Welche Arten von Kundendienst- und Supportleistungen sind notwendig, um die Kundenzufriedenheit und nachhaltige Produktnutzung sicherzustellen?
Definition Marktforschung
Gegenstand der MarktforschungMarktforschung, Begriff ist die Bereitstellung von Informationen, die für spezifische Fragestellungen (siehe o. g. Beispiel) im Speziellen oder für unternehmenspolitische Entscheidungen im Allgemeinen relevant sind. Marktforschung kann somit als »die systematische Erhebung (Gewinnung, Beschaffung) und Analyse (Auswertung) samt Aufbereitung und Interpretation von Daten über Märkte« (Grunwald/Hempelmann 2012, S. 1) verstanden werden.
Bedeutung
Die Bedeutung der MarktforschungMarktforschung, Bedeutung liegt in ihrer Fähigkeit, Unternehmen beispielsweise dabei zu helfen,
NachfragerbedürfnisseNachfragerbedürfnis zu verstehen: Marktforschung hilft dabei, die Bedürfnisse, Erwartungen und Vorlieben der Nachfrager (Verbraucher, organisationaler Kunden) zu identifizieren, sodass Unternehmen gezielt Produkte und Dienstleistungen entwickeln können, die diese Bedürfnisse erfüllen.
WettbewerberWettbewerber einzuschätzen: Durch die Erfassung von DatenDaten über Wettbewerber können Unternehmen ihre Position im Markt besser einschätzen und Strategien entwickeln, um sich gegenüber Konkurrenten zu differenzieren.
TrendsTrend vorherzusagen: Die Analyse von Markttrends ermöglicht es Unternehmen, frühzeitig auf Veränderungen im Markt zu reagieren und ihre Strategien entsprechend anzupassen.
Risiken zu minimieren: Marktforschung reduziert das Risiko von Fehlinvestitionen. Durch das Verständnis des Marktes können Unternehmen Risiken besser einschätzen und potenzielle Probleme frühzeitig erkennen.
MarketingstrategienMarketingstrategie zu optimieren: Marktforschung hilft bei der Entwicklung effektiver Marketingstrategien, um sich langfristig auf ausgewählten Märkten erfolgreich zu positionieren.
MarketinginstrumenteMarketinginstrument effektiv einzusetzen: Mithilfe von Marktforschung lassen sich beispielsweise Produkte und Dienstleistungen entwickeln, die den tatsächlichen Bedürfnissen des Marktes entsprechen. Dies führt zu innovativeren und erfolgreicheren Leistungsangeboten. Das generierte Datenmaterial kann zudem dazu genutzt werden, Erfolg versprechende Kommunikationsmaßnahmen oder Vertriebsaktivitäten abzuleiten.
Zusammengefasst trägt die Marktforschung dazu bei, bessere Entscheidungen zu treffen, die zur Förderung eines langfristigen (Marketing-)Erfolgs von Unternehmen beitragen. Sie ist daher ein unverzichtbares Tool für Unternehmen in allen Branchen und ein unverzichtbarer Teilbereich des Marketings.
Historische Entwicklung
Die historische Entwicklung der MarktforschungMarktforschung, historische Entwicklung kann in mehrere Phasen unterteilt werden, die den Fortschritt und die Veränderungen in dieser Disziplin im Laufe der Zeit widerspiegeln. Wichtige zeitliche Phasen in der Geschichte der Marktforschung zeigt Tabelle 2, die die historischen Meilensteine markiert (vgl. dazu auch Rumler/Lütters 2019, S. 44 ff.; Kuß/Kleinaltenkamp 2013, S. 96).
Zeitraum
Meilensteine
Frühe Ansätze
(18. Jahrhundert bis Anfang des 20. Jahrhunderts)
• Sammlung von Informationen über Märkte, Preise und Kunden von Händlern und Kaufleuten, um fundierte Handelsentscheidungen treffen zu können
Eher informelles und unstrukturiertes Vorgehen
Entwicklung der Massenproduktion
(spätes 19. Jahrhundert bis frühes 20. Jahrhundert)
• Einführung der Massenproduktion in der Industrie und Notwendigkeit für Unternehmen, den Markt genauer zu untersuchen
Beginn der Anwendung statistischer Methoden und weiterer Forschungsmethoden, um Märkte und Kunden besser analysieren zu können
Frühe Marktforschungsinstitute
(1920er- und 1930er-Jahre)
• 1923: Gründung des Marktforschungsinstituts »Daniel Starch and Staff« in den USA durch Mathematiker, Psychologe und Harvard-Professor Daniel Starch; Popularität erlangte der Starch-Test zur Werbewirksamkeitsmessung
1923: Gründung der A.C. Nielsen Company in Chicago
1925: Gründung des Instituts für Wirtschaftsbeobachtung der deutschen Fertigware durch Wilhelm Vershofen an der Handelshochschule Nürnberg
1932: Entwicklung der mehrpoligen Skala durch Rensis Likert
1934: Überführung des Instituts für Wirtschaftsbeobachtung der deutschen Fertigware in die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) durch die I.G. Farbenindustrie sowie unter Beteiligung weiterer Unternehmen
Zweiter Weltkrieg und Nachkriegszeit
(1940er- und 1950er-Jahre)
• Entscheidende Rolle der Marktforschung bei der Unterstützung von Kriegsanstrengungen und auch nach dem Krieg Einsatz im politischen Kontext
Im Zuge des Koreakrieges 1950/51 vom Gallup Institut durchgeführte Studien, die erstmalig mit Manipulationen in den Fragestellungen bei Fragebögen experimentierten, um die sich daraus ergebenden Effekte auf die Beantwortung der Fragen zu untersuchen (gilt als Meilenstein der Entwicklung der Einstellungsmessung)
Zunehmende Bedeutung der Marktforschung im kommerziellen Bereich
1945: Gründung der Gesellschaft für Marktforschung (GfM) durch Clodwig Kapferer und zwei Partner
1947: Gründung des Instituts für Demoskopie Allensbach durch Elisabeth Noelle-Neumann
1947: Formierung des Instituts zur Erforschung der Wirkung publizistischer Mittel an der Universität München; nach mehreren Umbenennungen bekannt geworden als TNS Infratest (seit 2017 zur Kantar Group gehörend)
1948: Entstehung des Dachverbandes Europäischer Marktforschungsinstitute, die ESOMAR (European Society for Opinion and Market Research)
1955: Gründung weiterer Institute wie etwa Berufsverband Deutscher Markt- und Sozialforscher (BVM) oder Arbeitskreis für betriebswirtschaftliche Markt- und Absatzforschung (ADM)
Entwicklung quantitativer Methoden
(1950er- und 1960er-Jahre)
• Zunehmende Bedeutung quantitativer Forschungsmethoden wie Umfragen und statistische Analysen
Verbesserungen des Entwurfs von Fragebögen und Ausbreitung experimenteller Untersuchungen
Internationalisierung und Computerisierung
(1960er-Jahre und später)
• Zunehmende Bedeutung internationaler Marktforschung aufgrund der Globalisierung der Wirtschaft
Zunehmende Erforschung und Ansprache von ausländischen Märkten durch Unternehmen
Effizientere Datensammlung, -verarbeitung und -analyse aufgrund der Fortschritte der elektronischen Datenverarbeitung
Seit ca. 1970 starke Resonanz komplexer (multivariater) Datenanalysen
Zunehmende Bedeutung der Verbraucherforschung in der Übergangszeit zu den 1970er-Jahren
Seit ca. 1980 Validierung von Erhebungsmethoden
Erheblicher Einfluss auf die Marktforschung durch die Erfindung des Personal Computers durch IBM im Jahr 1981; dadurch Computer Assisted Personal Interviews (CAPI) und Computer Assisted Telephone Interviews (CATI) möglich
Verfügbarkeit von Analysesoftware wie SPSS und SAS auch für Personal Computer seit den 1990er-Jahren; dadurch erhebliche Kosteneinsparungen bei der Datenanalyse
Aufkommen des Internets und Aufstieg des Online-Marketings
(spätes 20. Jahrhundert bis heute)
• Einfachere Datenerhebung (auch auf globaler Ebene) mit dem Aufkommen des Internets und durch Nutzung digitaler Technologien
Verstärkte Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnik zur Datenerhebung seit den 1990er-Jahren
Schnellere und kostengünstigere Möglichkeit zur Sammlung und Analyse von Daten (auch Echtzeitdaten) durch Online-Umfragen und Nutzung sozialer Medien
Wachsende Bedeutung des Social Listening bzw. Social-Media-Monitoring als neue Methode; hierbei geht es um die Überwachung von Social-Media-Kanälen im Hinblick auf die Erwähnungen bestimmter Marken, Wettbewerber, Produkte sowie unternehmensbezogener Keywords
Big Data und künstliche Intelligenz
(21. Jahrhundert)
• Verarbeitung von großen Datenmengen und Nutzung von künstlicher Intelligenz (KI) gewinnen eine immer wichtigere Rolle in der Marktforschung
Eröffnung neuer Möglichkeiten der Datenerhebung und -auswertung durch Big-Data-Techniken und Data-Mining-Algorithmen
Gewinnung tieferer Einblicke (etwa im Verbraucherverhalten), Ermöglichung der Verarbeitung riesiger Datenmengen und Ableitung präziserer Prognosen durch die Anwendung moderner Technologien
Tab. 2: Historische Meilensteine in der Entwicklung der Marktforschung
(Quelle: vgl. Zweigle 2021, S. 167 f.; Rumler/Lütters 2019, S. 44 ff.; Kuß/Kleinaltenkamp 2013, S. 96)
Die zunehmende Verfügbarkeit von Daten und weitere technologische Fortschritte versprechen, dass die Marktforschung auch in Zukunft eine bedeutende Rolle nicht nur im Marketing spielen wird.
1.2 Ziele, Aufgaben und Erscheinungsformen
Das zentrale Ziel der MarktforschungMarktforschung, Ziele besteht in der zeitgerechten Bereitstellung von InformationenInformation für die Entscheidungsträger in Unternehmen bzw. Organisationen. Konkret auf das Marketing bezogen bedeutet dies, marketingrelevante Sachverhalte
zu erkunden,
zu beschreiben,
zu erklären und
zu prognostizieren.
Diese Erkenntnisse bilden die Grundlage für Marketingentscheidungen (vgl. Fantapié Altobelli 2007, S. 7).
Aufgaben und Funktionen
Aus dieser zentralen ZielsetzungZielsetzung lassen sich diverse TeilaufgabenMarktforschung, Aufgaben bzw. FunktionenMarktforschung, Funktionen ableiten, wie sie in Tabelle 3 zusammengefasst werden.
Funktionen
Beschreibung
Innovationsförderung/Innovationsfunktion
• Erkennen von Chancen, Risiken und Trends aus den Analysebereichen Umwelt und Markt zur Ableitung innovativer Ideen (z. B. für die Produktneu- oder -weiterentwicklung)
Frühwarnfunktion
• Frühzeitiges Erkennen von Risiken, um erforderliche Entscheidungs- oder Anpassungsprozesse rechtzeitig einleiten zu können
Intelligenzverstärkungsfunktion
• Unterstützung der Willensbildungsprozesse der Entscheidungsträger durch Förderung der Methodenkenntnisse und des Wissens über marktrelevante Zusammenhänge
Unsicherheitsreduktionsfunktion
• Verringerung der Unsicherheit durch Zurverfügungstellung zuverlässiger Informationen, die die Auswahl der »richtigen« Handlungsalternative ermöglichen
Strukturierungsfunktion
• Förderung des Verständnisses von Zielvorgaben und Lernprozessen bei den Entscheidungsträgern durch die Transparenz von Daten bzw. Informationen; dadurch höhere Qualität und Effizienz der Marketingplanung
Selektionsfunktion
• Auswahl und Aufbereitung relevanter Sachverhalte aus der Fülle verfügbarer Informationen
Prognosefunktion
• Aufzeigen der relevanten Veränderungen des marketingrelevanten Umfelds und Abschätzung der Auswirkungen auf das eigene Unternehmen
Kommunikations- und Beziehungsmarketingfunktion
• Integration von Stakeholdern (wie Kunden, Händler, Mitarbeiter) durch Marktforschungsmethoden (wie Produkt-/Markttests, Kundenbefragungen); Demonstration von Kundennähe durch Einholen von Kundenfeedback
Tab. 3: Funktionen der Marktforschung
(Quelle: vgl. Fantapié Altobelli 2023, S. 18; Pepels 2008, S. 17 f.; Kamenz 2001, S. 8 f.)
Um die Funktionen zu erfüllen, stehen den Unternehmen verschiedene Erscheinungsformen der MarktforschungMarktforschung, Erscheinungsformen zur Verfügung. Sie werden in Tabelle 4 dargestellt.
Unterscheidungsmerkmal
Erscheinungsformen mit Erläuterungen
Erscheinungsformen
Bezugszeitraum
• Einmalige Erhebung (Ad-hoc-Forschung, Querschnittsanalyse)
Mehrmalige Erhebung (Panelforschung, Tracking-Forschung, Längsschnittanalysen)
Art des Untersuchungsobjekts
• Ökoskopische Marktforschung (empirische Untersuchung objektiver Marktgrößen wie Umsätze, Preise, Mengen, Anbieterzahl)
Demoskopische Marktforschung (empirische Untersuchung der Marktteilnehmer als Handlungssubjekte z. B. in Bezug auf Alter, Geschlecht, Einkommen, Wohnort)
Untersuchte Märkte
• Beschaffungsmarktforschung
Absatzmarktforschung
Finanzmarktforschung
Form der Informations-gewinnung
• Primärforschung (Gewinnung neuer Daten)
Sekundärforschung (Nutzung vorhandener Daten)
Erhebungsmethode
• Befragung
Beobachtung
Experiment
Panel (s. o.)
Untersuchte Marketing-instrumente
• Produktforschung
Preisforschung
Kommunikationsforschung
Vertriebsforschung
Untersuchte Marktteilnehmer
• Konsumentenforschung
Konkurrenzforschung
Absatzmittlerforschung
Methodischer Ansatz
• Quantitative Marktforschung
Qualitative Marktforschung
Träger der Marktforschung
• Betriebliche Marktforschung
Institutsmarktforschung
Ort der Messung
• Laboruntersuchung
Felduntersuchung
Räumlicher Geltungs-bereich
• Nationale Marktforschung
Internationale Marktforschung
Tab. 4: Erscheinungsformen der Marktforschung
(Quelle: vgl. Fantapié Altobelli 2023, S. 17)
Die aufgeführten Formen der Marktforschung sind zwar nicht gänzlich überschneidungsfrei, liefern aber einen Überblick über die zentralen Unterscheidungsmerkmale. Sie zeigen zudem die breiten Anwendungsfelder bzw. Einsatzmöglichkeiten der Marktforschung.
1.3 Entwicklungen und Trends
Die Marktforschung ist ein sich ständig entwickelndes Feld, das eng mit den sich rasch ändernden Umweltbedingungen, technologischen Fortschritten und der digitalen Transformation verbunden ist. Gleichzeitig stehen Unternehmen vor der Herausforderung, auf diese Änderungen und die damit einhergehende permanente »Informationsflut« adäquat zu reagieren. Hierzu sind Investitionen zur Steigerung der Qualität der Marktforschung und damit auch der Qualifikation der Marktforschungsakteure unvermeidlich. Sie sind erforderlich, um die folgenden Entwicklungen und Trends, die in Bezug auf die MarktforschungMarktforschung, Entwicklungen und Trends zu erkennen sind, aufzugreifen und in der Marktforschungspraxis zu berücksichtigen (vgl. dazu auch Zweigle 2021; Adolph/Binder 2021):
DigitalisierungDigitalisierung und AutomatisierungAutomatisierung: Die Digitalisierung hat die Marktforschung grundlegend verändert. Die Datenerfassung erfolgt immer häufiger online, und automatisierte Tools ermöglichen eine schnellere Datenerhebung, -analyse und auch -interpretation.
Big DataBig Data und Analytics: Die Verfügbarkeit großer Datenmengen aus verschiedenen Quellen hat dazu geführt, dass Unternehmen vermehrt auf Big-Data-Analysen setzen, um umfassendere Einblicke vor allem in das Verhalten von Verbrauchern zu erhalten (Generierung von »Consumer Insights«).
Künstliche IntelligenzKünstliche Intelligenz(KI) und maschinelles LernenMaschinelles Lernen (ML): KI wird in der Marktforschung eingesetzt, um Muster und Trends in großen Datenmengen zu identifizieren, automatisierte Berichte zu erstellen und sogar Vorhersagen zu treffen. Der Einsatz von KI ermöglicht eine wesentlich schnellere und kostengünstigere Marktforschung. Maschinelles Lernen stellt einen Teilbereich der KI dar und konzentriert sich darauf, Computer-Algorithmen zu entwickeln, die automatisch aus Daten lernen können. ML imitiert also den menschlichen Lernprozess auf der Basis von Daten und Algorithmen.
Mobile MarktforschungMobile Marktforschung: Durch die verbreitete Nutzung von Smartphones hat die mobile Marktforschung an Bedeutung gewonnen. Sie ermöglicht Echtzeitdatenerfassung und die Verbindung mit Verbrauchern oder anderen Zielgruppen beispielsweise über mobile Apps.
Online-CommunitiesOnline-Community und soziale MedienSoziale Medien: Unternehmen richten Online-Communities ein und beobachten soziale Medien, um Kundenmeinungen und -feedbackFeedback in Echtzeit zu sammeln, zu analysieren und auszuwerten.
VerhaltensökonomieVerhaltensökonomie: Die Integration von Erkenntnissen aus der Verhaltensökonomie in die Marktforschung hilft Unternehmen, das Verhalten der Verbraucher besser zu verstehen und ihre Marketingaktivitäten anzupassen.
Multisensorische ForschungForschung, multisensorische: Marktforscher nutzen nicht nur traditionelle Methoden wie Umfragen oder Beobachtungen, sondern auch neurowissenschaftliche Messmethoden, um tiefer gehende Einblicke in die Forschungsteilnehmer zu erhalten wie etwa unterbewusste Wünsche der Verbraucher.
GlobalisierungGlobalisierung der Märkte: Mit der Zunahme internationaler Geschäftsbeziehungen ist die Marktforschung globaler geworden. Unternehmen müssen kulturelle Unterschiede, lokale Präferenzen und auch unterschiedliche Rahmenbedingungen (z. B. nationale Datenschutzbestimmungen) berücksichtigen.
Ethnografische ForschungForschung, ethnografische: Bei dieser qualitativen Forschungsmethode werden Forschungsteilnehmer (z. B. Verbraucher) in ihrem realen Umfeld untersucht, um etwa ihren Lebensstil oder ihr Verhalten besser verstehen zu können. Zur Datenerhebung werden vor allem Methoden der Beobachtung und Befragung eingesetzt (vgl. ausführlich dazu Knoblauch/Vollmer 2019).
DatenschutzDatenschutz und EthikEthik: Aufgrund der verstärkten Erfassung sensibler Verbraucherdaten sind Datenschutz und Ethik in der Marktforschung von entscheidender Bedeutung. Unternehmen müssen sicherstellen, dass sie die geltenden Datenschutzvorschriften einhalten und ethische Standards wahren. Der Schutz der Privatsphäre und die Einwilligung der Befragten sind dabei von großer Bedeutung (zu berufsethischen Prinzipien vgl. Fantapié Altobelli 2023, S. 40 ff.; zur Forschungsethik vgl. Friedrichs 2019; zum Forschungskodex vgl. ICC/ESOMAR 2017).
Predictive AnalyticsPredictive Analytics: Unter Verwendung von Big DataBig Data und Machine-Learning-Technologien können Unternehmen mithilfe prädiktiver Modelle historische und aktuelle Daten analysieren, um zukünftige Ereignisse, Trends und Resultate vorherzusagen.
Augmented RealityAugmented Reality (AR) und Virtual RealityVirtual Reality (VR): Mit AR- und VR-Technologien können Marktforscher realistische virtuelle Umgebungen erstellen, um das Nutzerverhalten zu analysieren. Dies ermöglicht es Unternehmen, ihre Marketingaktivitäten in einer immersiven, computerbasierten Umgebung (sog. Metaverse) zu testen, bevor sie in die reale Welt umgesetzt werden. Marktforschung und insbesondere DatenanalyseDatenanalyse spielen eine entscheidende Rolle im Metaverse-MarketingMetaverse-Marketing. Unternehmen können Daten über das Verhalten, die Vorlieben und die Interaktionen der Nutzer in den Metaversen sammeln und analysieren, um ihre Marketingmaßnahmen daran auszurichten und zu optimieren.
Agile MarktforschungMarktforschung, agileAgile Marktforschung: Sie stellt einen iterativen und inkrementellen Ansatz dar, der es Unternehmen ermöglicht, durch die Nutzung agiler Methoden (z. B. Sprints oder Retrospektiven) schneller auf sich ändernde Marktbedingungen zu reagieren.
Nachhaltige MarktforschungMarktforschung, nachhaltigeNachhaltige Marktforschung: Angesichts ökologischer, gesellschaftlicher und ökonomischer Problembereiche (vgl. Grunwald/Schwill 2022, S. 11) muss sich auch die Marktforschungsbranche zunehmend mit der Thematik auseinandersetzen und Lösungsansätze bieten, wie Unternehmen nachhaltiger agieren können. Einzelne Unternehmen haben sich bereits darauf spezialisiert, Marktforschung und Beratung für Unternehmen und Organisationen mit einer nachhaltigen Vision anzubieten (vgl. z. B. Green Vision. Research + Strategy). Zum einen geht es um die Beantwortung der Frage, welche Faktoren den Kauf bzw. die Nutzung nachhaltiger Angebote beeinflussen und was tatsächlich gekauft bzw. genutzt wird. Zum anderen interessieren auch Antworten auf die Frage, wie Nachhaltigkeitskampagnen auf die ZielgruppenZielgruppe wirken (vgl. Grunwald/Ostendorf 2013). Auch orientieren sich Marktforschungsinstitute selbst vermehrt an den Prinzipien einer nachhaltigen Entwicklung, die sie proaktiv fördern (z. B. durch Wahl von Formen der nachhaltigen IncentivierungIncentivierung, vgl. Kap. 8.3).
Big Data und Marktforschung
Tabelle 5 zeigt mögliche Anwendungen von Big DataBig Data in der Marktforschung im Überblick (vgl. Wachter 2018, S. 19 ff.). Hierbei erfolgt i. d. R. eine Anreicherung der durch Befragung gewonnenen Daten mit anderen Datenbeständen wie z. B. Trackingdaten. Die Anreicherung von Daten wird auch als Data EnrichmentData Enrichment bezeichnet (vgl. Kap. 9.1).
Anwendung
Erläuterung/Beispiele
Messung, Beobachtung, Tracking und Verknüpfung von Kommunikation und Verhalten im Internet und auf Webseiten einschließlich durchgeführter Kaufhandlungen und genutzter Webapplikationen
Analyse der Sitebesucher zur Entwicklung von Kennzahlen zur Kundengewinnungsrate oder zu Käufen pro Shop-Besucher zur Optimierung von Websites und Webanwendungen sowie nachgelagerten Prozessen; kontinuierliche, automatisierte Auswertung von Social-Media-Inhalten zur Erfassung von Meinungen, Urteilen, Emotionen bzw. Stimmungen hinsichtlich der Marke, sog. Sentiment-AnalysenSentiment-Analyse(vgl. Liu 2020, S. 18 ff.; Siegel/Alexa 2020). Bei der Sentiment-Analyse erfolgt eine Auswertung von Texten im Internet mit dem Ziel, eine geäußerte Haltung als positiv, neutral oder negativ zu erkennen. Dies kann als Frühwarnsystem klassische Image-Trackings ergänzen.
Anreicherung von Befragungsdaten um zusätzliche Nicht-
Befragungsvariablen
Anreicherung von Daten einer Kundenzufriedenheitsbefragung mit bereits gespeicherten Daten aus dem Customer Relationship Management (CRM)-System (z. B. Kaufhistorie, Kennziffern zur Kundenbindung) oder umgekehrt
Analyse von Befragungsdaten
nach aufgrund von Trackingdaten gebildeten Verhaltenssegmenten
Befragungsdaten (z. B. zu Interessen, Kaufabsichten und -motiven, Einstellungen) werden mit gemessenen Webverhaltensdaten angereichert, aus denen dann typische Verhaltensmuster identifiziert und mittels der Interviewergebnisse erklärt werden. Auch offline gebildete oder definierte Zielgruppensegmente können mit gruppenähnlichen Verhalten abgeglichen werden. So kann relevanter Content je Nutzer zielgerichtet definiert werden.
Tab. 5: Anwendungsgebiete von Big Data in der Marktforschung
(vgl. Wachter 2018, S. 19 ff.)
Diese Trends in der Marktforschung sind vor allem aufgrund der technologischen Weiterentwicklungen – insbesondere in Bezug auf KI – stetig fortzuschreiben, um die sich daraus ergebenden Marktforschungstools anpassen zu können. Bereits jetzt bieten sich den Unternehmen eine Vielzahl an Marktforschungsmöglichkeiten allein durch die Nutzung von KI-ToolsKI-Tool für die Datenanalyse an, wie Tabelle 6 entnommen werden kann.
KI-Tool
Erläuterung
KI-Tools
Adverity
Erfasst Daten automatisiert und macht Vorschläge zur Verbesserung der Performance
Akkio
Ist ein Geschäftsanalyse- und Prognosetool, mit dem Benutzer ihre Daten analysieren und potenzielle Ergebnisse vorhersagen können; mit dem KI-Tool können Benutzer ihren Datensatz hochladen und die Variable auswählen, die sie vorhersagen möchten; es ist nützlich für prädiktive Analysen, Marketing und Vertrieb
Albert
Liefert kanalübergreifende Insights und Analyseberichte
Crystal
Führt durch komplexe und verschachtelte Daten in Echtzeit und macht Analysen zugänglich und verständlich
Caliber Mind
Misst die Marketingperformance und gibt Empfehlungen entlang der gesamten Buyer Journey
Einstein
Lernt aus Daten und liefert Prognosen und Empfehlungen, die auf den individuellen Geschäftsprozessen basieren
HubSpot
Analysiert komplexe Datensets zur Erschaffung personalisierter Erfahrungen
Julius AI
Interpretiert, analysiert und visualisiert komplexe Daten auf intuitive und benutzerfreundliche Weise; die Stärke diese Tools liegt in seiner Fähigkeit, Datenanalyse zugänglich und umsetzbar zu machen selbst für diejenigen, die keine Datenwissenschaftler oder Statistiker sind
Market Logic
Analysiert Markt und Wettbewerber
Microsoft Power BI
Stellt eine Business-Intelligence-Plattform dar, die es Benutzern ermöglicht, Daten zu sortieren und für Erkenntnisse zu visualisieren; Daten können aus nahezu jeder Quelle importiert werden, sodass sofort mit der Erstellung von Berichten und Dashboards begonnen werden kann
MonkeyLearn
Hilft Benutzern bei der Visualisierung und Neuanordnung ihrer Daten; es umfasst mehrere KI-gestützte Textanalysetools, die Daten sofort entsprechend den Anforderungen des Benutzers analysieren und visualisieren; außerdem können damit Textklassifikatoren und Textextraktoren eingerichtet werden, die dabei helfen, Daten automatisch nach Thema oder Absicht zu sortieren sowie Produktmerkmale oder Benutzerdaten zu extrahieren
Pave AI
Liefert automatisierte Google-Analytics-Berichte und macht Vorschläge zur Verbesserung der Performance
Polymer
KI-Tool, das Daten in eine optimierte, flexible und leistungsstarke Datenbank umwandeln kann; Benutzer muss lediglich seine Tabelle auf die Plattform hochladen, um sie sofort in optimierte Daten umzuwandeln, die dann nach Erkenntnissen durchsucht werden können
Pythia
Erstellt Trendanalysen für kommende Marktnachfragen
Radarly
Liefert mit Social Data wertvolle Erkenntnisse über Kunden und Märkte
Tableau
Ermöglicht Benutzern, mit ihren Daten zu interagieren; es können Berichte erstellt werden, die auf Desktop- und mobilen Plattformen geteilt werden können
Tab. 6: KI-Tools zur Datenanalyse
(Quelle: vgl. Terstiege 2021, S. 9; https://www.unite.ai/de/KI-Tools-Datenanalysten/)
Chatbots
Künstliche IntelligenzKünstliche Intelligenz wird zunehmend auch in der Marktforschungspraxis eingesetzt. So können beispielsweise Spracherkennungssoftware, Sprachassistenten oder Chatbots für die Umfrageforschung genutzt werden. Hier scheint sich ein enormes Potenzial zu ergeben, zumal auch eine steigende Akzeptanz der Konsumenten von Sprachassistenten wie Alexa oder Siri konstatiert werden kann (vgl. Zweigle 2021, S. 174). Wie etwa Chatbots als Interviewform umgesetzt werden können, beschreibt folgendes Beispiel.
Praxisbeispiel: Chatbot-Einsatz in Kombination mit Facebook
»Die Kantar-Gruppe hat Konsumenteninsights zum Thema ›How to sell more chocolate on a Thursday‹ mittels Facebook-Chatbots generiert. Anstelle einer klassischen Online-Tagebuchstudie (Nethnografie) befragte der mit einer weiblichen Stimme agierende Facebook-Chatbot ›Serena‹ die Studienteilnehmer tagsüber regelmäßig und ausführlich über ihre Essgewohnheiten. Die offenen Antworten wurden gesammelt und mittels künstlicher Intelligenz aufbereitet und analysiert. Rekrutiert wurden die Teilnehmer nach demografischen Kriterien über Facebook-Ads. Incentives gab es für jeden Tag, an dem sie mit Serena chatteten. Der Vergleich mit klassischen Usage & Attitude-Studien zeigte, dass die Antworten sehr viel detaillierter waren und alle Fragen zum Nahrungsmittelkonsum, das Wann, das Was und das Warum ausführlich beantwortet wurden. Die Akzeptanz der Befragung war so groß, dass auch nach der Studie die Befragten mit Serena weiter chatten wollten.«
(Zweigle 2021, S. 175).
1.4 Rahmenbedingungen
Die Rahmenbedingungen der MarktforschungMarktforschung, Rahmenbedingungen umfassen verschiedene Faktoren, die bei der Durchführung von Marktforschungsprojekten zu berücksichtigen sind. Hierzu gehören vor allem rechtliche, ethische und institutionelle Rahmenbedingungen (vgl. zum Folgenden auch Magerhans 2016, S. 35 ff.).
Rechtliche Rahmenbedingungen
Marktforschungsprojekte müssen sich an nationale und internationale Gesetze halten, die den DatenschutzDatenschutz, die Verwendung personenbezogener Daten und andere rechtlich relevante Aspekte regeln.
Den Umgang mit personenbezogenen Daten regelt die Datenschutz-GrundverordnungDatenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Sie gilt einheitlich in der ganzen EU (EU-DSGVO). In Deutschland gelten neben der EU-DSGVO noch das BundesdatenschutzgesetzBundesdatenschutzgesetz Deutschland (BDSG-neu) und das Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-GesetzTelekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz (TTDSG) (vgl. Suske 2023).
Wenn im Rahmen der Marktforschungspraxis sensible Daten von Personen erhoben werden, dann sollten die in Tabelle 7 aufgeführten Grundsätze der Datenschutz-Grundverordnung beachtet werden.
Grundsätze
Beschreibung
Verbot mit Erlaubnisvorbehalt
Es dürfen grundsätzlich keine personenbezogenen Daten erhoben, verarbeitet oder genutzt werden – es sei denn, es liegt eine Erlaubnis vor; diese kann entstehen aus:
Gesetz, z. B. aus dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG-neu), EU-DSGVO
Einwilligung der betroffenen Person
Datensparsamkeit
Es dürfen nur die und so viele Daten erhoben und verarbeitet werden, wie tatsächlich benötigt werden (Datenminimierung).
Zweckbindung
Daten dürfen nur zu dem Zweck verarbeitet werden, für den sie erhoben worden sind.
Datenrichtigkeit
Daten müssen inhaltlich und sachlich richtig und aktuell gehalten sein.
Datensicherheit
Personenbezogene Daten müssen geschützt werden. Je schützenswerter – z. B. je sensibler – die Daten, desto höher muss das Schutzniveau sein. Welche Maßnahmen angemessen sind, orientiert sich am Stand der Technik, den notwendigen Kosten sowie den Umständen und Risiken.
Datenübermittlung
Marktforschung erfolgt in aller Regel nur im Auftrag durch eine nicht öffentliche oder öffentliche Stelle. Im Regelfall ist der Auftraggeber dabei jedoch nicht berechtigt, auf sämtliche personenbezogene Daten zuzugreifen, die erhoben wurden. Einzig die abschließenden Ergebnisse der Auswertung dürfen dem Auftraggeber zumeist zugänglich gemacht werden.
Anonymisierung und Pseudonymisierung
Das alte Bundesdatenschutzgesetz sah zwingende Pseudonymisierung der verarbeiteten Datensätze vor; diese Eindeutigkeit fehlt jedoch nach der Neufassung. Allerdings ergibt sie sich über Regelungen der DSGVO. Die Aufhebung der Bindung an eine identifizierbare natürliche Person sollte deshalb weiterhin erfolgen, zumal diese für die Abbildung von bestimmten Aussagen zu Personengruppen nicht erforderlich ist.
Wissenschaftliche Grundlage
Der Erhebung und Verarbeitung muss ein geeignetes wissenschaftliches Verfahren zugrunde liegen, das dem Zweck auch dienlich ist.
Tab. 7: Grundsätze der Datenschutz-Grundverordnung und allgemeine Regelungen des Datenschutzes in der Marktforschung
(Quelle: vgl. Suske 2023; Datenschutz in der Marktforschung 2023)
Praxistipp: Rechtliche Rahmenbedingungen
Merke: »Der Datenschutz gibt der Marktforschung ebenso wie allen anderen Datenverarbeitern auf, die Betroffenenrechte zu achten (insbesondere Widerrufsrecht, Recht auf Löschung und Auskunft). Von diesen kann gemäß Art. 89 Abs. 2 DSGVO jedoch vereinzelt auch abgewichen werden, wenn dies zu statistischen, wissenschaftlichen oder Forschungszwecken erforderlich ist« (Datenschutz in der Marktforschung 2023).
Eine Checkliste mit den wichtigsten Informationen zur DSGVO sowie weitere auch für die Marktforschung relevante Hinweise sind abrufbar unter https://www.e-recht24.de/datenschutzgrundverordnung.html#1 sowie https://www.datenschutz.org/marktforschung/.
Einen Überblick über den Rechtsrahmen der Marktforschung und damit verbundene Leitregeln speziell für den Mittelstand liefern Zerres/Zerres 2017, abrufbar unter https://www.zerres.marketing/wp-content/uploads/2018/10/ap_17_rechtsrahmen-der-marktforschung.pdf.
Ethische Rahmenbedingungen
Trotz aller Bemühungen zur gesetzlichen Regulation der Marktforschungspraktiken ergeben sich zunehmend auch ethische Fragestellungen. Folgende Beispiele sollen diese Problematik belegen.
Praxisbeispiel: Ethische Fragestellungen in der Marktforschung
»Ist eine Marktforschung ethisch vertretbar, die zum Ziel hat, den Konsum von Süßigkeiten zu erhöhen, die zu Übergewicht führen und Karies verursachen?
Ist der Einsatz von ›Mystery Shoppern‹ ethisch vertretbar, die die Beratungsqualität des Personals testen, auch wenn die durch diese bewusste Täuschung gewonnenen Ergebnisse u. U. zu arbeitsrechtlichen Konsequenzen für die getesteten Mitarbeiter führen?
Ist die Erstellung von individuellen Konsumprofilen auf Basis von durch Unternehmen wie beispielsweise Paypal gesammelten Kundendaten ethisch vertretbar?«
(Magerhans 2016, S. 38; im Original kursiv)
Ob derartige Fragestellungen und die sich daraus ergebenden Marktforschungsaktivitäten ethisch vertretbar sind, ist zum einen abhängig von den zu beurteilenden situativen Bedingungen und zum anderen von der individuellen ethisch geprägten Einstellung des jeweiligen Forschers. »Als ethisch werden gemeinhin solche Verhaltensweisen angesehen, die in einer bestimmten Situation als angemessen gelten« (Magerhans 2016, S. 38). Insofern geht es im Rahmen der Marktforschung weniger um ein kontextbezogenes richtiges oder falsches Verhalten, sondern vielmehr um ein insgesamt ethisch vertretbares Handeln.
Um Marktforschung nicht nur gesetzeskonform, sondern auch nach ethischem Anspruch durchzuführen, gibt es diverse Standards und Richtlinien, wie etwa die Richtlinien der deutschen Markt- und Sozialforschungsverbände. Sie sind von den Branchenverbänden Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute e. V. (ADM), Bundesverband Deutscher Markt- und Sozialforscher e. V. (BVM), Deutsche Gesellschaft für Online-Forschung e. V. (DGOV) und Arbeitsgemeinschaft Sozialwissenschaftlicher Institute e. V. (ASI) erstellt worden und enthalten verbindliche Vorgaben. Diese Richtlinien ergänzen die gesetzlichen Normen und den »ICC/ESOMAR Internationaler Kodex zur Markt-, Meinungs- und Sozialforschung sowie zur Datenanalytik« (vgl. ADM e. V. 2023). Tabelle 8 fasst die zentralen Richtlinien und ihre spezifischen Inhalte zusammen.
Richtlinien
Inhalte/Quelle
Richtlinie zum Umgang mit Adressen in der Markt- und Sozialforschung
Definiert und präzisiert die Anwendung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen auf den Umgang mit Adressen und anderen personenbezogenen Daten.
Schreibt berufsethische und berufsständische Verhaltensregeln fest
Link: https://www.adm-ev.de/wp-content/uploads/2021/01/RL-Adressen-neu-2021.pdf
Richtlinie für die Befragung von Minderjährigen
Als Minderjährige im Sinne der Richtlinie gelten Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren.
Für Interviews mit diesen Personen gelten grundsätzlich dieselben Regelungen wie mit Volljährigen, d. h., es ist auf die Freiwilligkeit der Teilnahme hinzuweisen und eine Einwilligung zur Verarbeitung und anonymisierten Nutzung der erhobenen Daten einzuholen.
Weist vor allem auch auf berufsethische Überlegungen in Bezug auf diese Zielgruppe hin
Link: https://www.adm-ev.de/wp-content/uploads/2021/07/RL-Minderjaehrigen-neu-2021-23.7.2021.pdf
Richtlinie für Aufzeichnungen und Beobachtungen in der Markt- und Sozialforschung
Bei Audio-/Videoaufzeichnungen werden der Originalton bzw. Originalton und Originalbild gespeichert; dazu bedarf es neben der Bereitschaft zur Teilnahme auch einer Einwilligung der betroffenen Personen zur Speicherung.
Die Einwilligung muss explizit auch über die Empfänger aufklären, denen die Daten übermittelt werden.
Enthält einen Mustertext »Einwilligung zur Video-/Audioaufzeichnung und Beobachtung« im Anhang zu dieser Richtlinie
Link: https://www.adm-ev.de/wp-content/uploads/2021/07/RL-zum-Aufzeichenen-und-Beobachten-2021-19.7.2021.pdf
Richtlinie für Online-Befragungen
Zur Online-Befragung zählt hier jede qualitative oder quantitative Umfrage mittels oder über das Internet oder mit einem elektronischen Datenaustausch. Nicht gemeint sind rein passive Erhebungsverfahren oder VoIP-Telefonie (»Voice over Internet Protocol«, also die Möglichkeit, über eine Internet-Verbindung zu telefonieren).
Regelungen finden sich in Bezug auf die Wissenschaftlichkeit der Vorgehensweise, die Freiwilligkeit der Teilnahme, die Anonymisierung der erhobenen Daten und die strikte Trennung von Forschung und forschungsfremden Tätigkeiten.
Link: https://www.adm-ev.de/wp-content/uploads/2021/07/RL-Online-2021-19.7.2021.pdf
Richtlinie für telefonische Befragungen
Für telefonische Befragungen gelten grundsätzlich dieselben Regeln wie für persönlich-mündliche, schriftliche und online durchgeführte wissenschaftliche Befragungen.
Regeln beziehen sich u. a. auf die Anonymität der Befragten, auf das Einholen der Einwilligung in das telefonische Interview und auf die Aufbewahrung und Löschung der personenbezogenen Daten.
Link: https://www.adm-ev.de/wp-content/uploads/2022/09/RL-Telefon-neu-2021-20221509.pdf
Richtlinie zum Umgang mit Datenbanken in der Markt- und Sozialforschung
Regelt vor allem den wissenschaftlichen Umgang mit Datenbanken und die in den Qualitätsstandards der Markt- und Sozialforschung dokumentierten methodischen Anforderungen und die Prinzipien forschungsethischen Verhaltens
Link: https://www.adm-ev.de/wp-content/uploads/2021/01/RL-Datenbanken-neu-2021.pdf
Richtlinie für Untersuchungen in den und unter Einsatz der sozialen Medien (Soziale Medien Richtlinie)
Beschreibt die spezifische Anwendung der Grundprinzipien des berufsethischen und berufsständischen Verhaltens auf Untersuchungen in den und unter Einsatz der sozialen Medien
Link: https://www.adm-ev.de/wp-content/uploads/2022/08/RL-Soziale-Medien-neu-2021.pdf
Richtlinie für die Veröffentlichung von Ergebnissen der Wahlforschung
Bezieht sich in erster Linie auf die Veröffentlichung von Ergebnissen der quantitativen Wahlforschung mit repräsentativen Bevölkerungsumfragen;
Für die qualitative Wahlforschung (z. B. Plakat- oder Slogantests mittels Gruppendiskussionen) gelten grundsätzlich dieselben Regeln bei der Veröffentlichung von Forschungsergebnissen. Allerdings müssen ihre Ergebnisse – wie in anderen Bereichen der Markt- und Sozialforschung auch – unter wissenschaftlichen Kriterien (z. B. Repräsentativität) anders dargestellt und interpretiert werden.
Link: https://www.adm-ev.de/wp-content/uploads/2021/03/RL-Wahlforschung-neu-Maerz-2021.pdf
Richtlinie für Studien im Gesundheitswesen zu Zwecken der Markt- und Sozialforschung
Für die Studien im Gesundheitswesen gelten dieselben forschungsethischen und berufsständischen Verhaltensregeln und methodischen Qualitätsstandards wie bei allen Studien der Markt- und Sozialforschung.
Die Berufsgrundsätze und Standesregeln der Markt- und Sozialforschung verlangen unter anderem einen deutlichen Hinweis auf die Freiwilligkeit der Teilnahme, die strikte Wahrung der Anonymität der Teilnehmer und die klare Abgrenzung der Markt- und Sozialforschung gegenüber anderen Tätigkeiten.
Regelungen beziehen sich u. a. auf Terminvereinbarung und auf die Gewährung von Incentives zur Teilnahme an einer Studie
Link: https://www.adm-ev.de/wp-content/uploads/2022/08/RL-Gesundheitswesen-2013-akt.pdf
Richtlinie für den Einsatz von Mystery Research in der Markt- und Sozialforschung
Mystery Research wird hier als Messverfahren definiert, mit denen das unbefangene Verhalten von Personen in bestimmten öffentlichen Situationen untersucht wird und die den Personen aus methodischen Gründen verborgen bleiben müssen, weil sonst die Unbefangenheit der Situation aufgehoben und damit das Forschungsziel nicht erreicht wird.
Regelungen finden sich u. a. in Bezug auf Anonymisierung sowie rechtliche und forschungsethische Anforderungen innerhalb und außerhalb des Verantwortungsbereichs des Kunden
Link: https://www.adm-ev.de/wp-content/uploads/2022/05/Mystery-RL-2022-18.05.2022.pdf
Tab. 8: Richtlinien und Inhalte der deutschen Markt- und Sozialforschungsverbände
(Quelle: vgl. ADM e. V. 2023: Richtlinien)
Der ADM e. V. hat zudem einen verbindlichen Katalog von Standards für gute Forschung erarbeitet, der einen umfassenden Orientierungsrahmen für in der Marktforschung Verantwortliche darstellt. Die dort formulierten Standards zur Qualitätssicherung beinhalten einen Katalog von verbindlichen Zielen, die zur Sicherstellung der Qualität von Forschungsergebnissen zu erreichen sind. Zudem sind spezifische Standards zur Qualitätssicherung für Online-Befragungen hinterlegt (vgl. ADM e. V. 2023: Qualitätsstandards).
Praxistipp: Informationssicherheit
Im »Praktischen Ratgeber« des ADM e. V. finden sich folgende wichtige Tipps, Leitfäden, Checklisten und Empfehlungen, die für die Marktforschungspraxis hilfreich sind (abrufbar unter https://www.adm-ev.de/standards-richtlinien/#anker6):
Leitfaden zur Informationssicherheit in der Markt-, Meinungs- und Sozialforschung
IT-Sicherheit in der Markt- und Sozialforschung: Empirische Befunde und Checkliste relevanter Anforderungen
Checkliste für Auftraggeber von Online-Befragungen