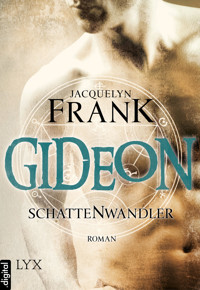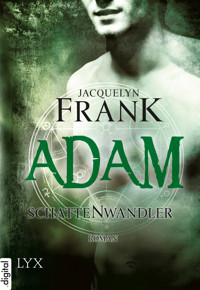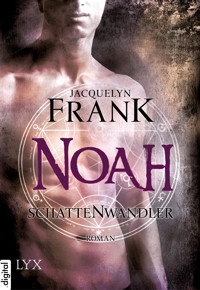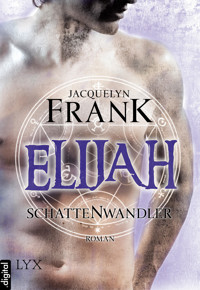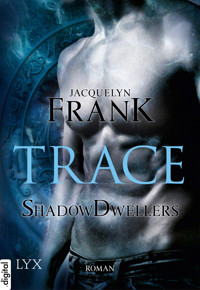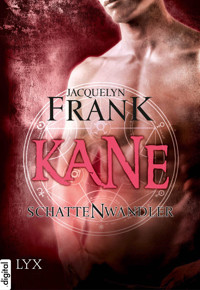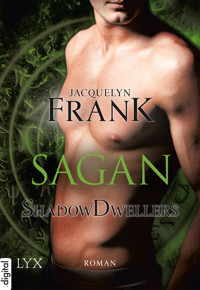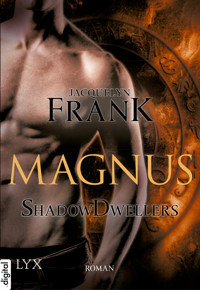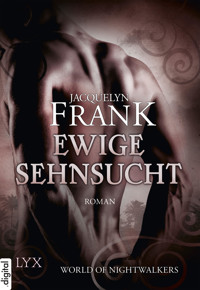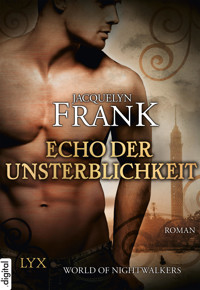9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: World-of-Nightwalkers-Reihe
- Sprache: Deutsch
Der Krieger Ram ist auf der Suche nach der passenden Gefährtin für seinen König. Er findet sie in der jungen Sterblichen Docia, die er fortan beschützen soll. Doch dann verliebt er sich in sie. Kann er eine Frau für sich beanspruchen, die vom Schicksal dazu auserkoren wurde, Gemahlin eines Königs zu sein?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 473
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Inhalt
Titel
Zu diesem Buch
Widmung
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Epilog
Glossar und Aussprachehinweise
Danksagung
Die Autorin
Die Romane von Jacquelyn Frank bei LYX
Impressum
JACQUELYN FRANK
World of Nightwalkers
Verbotenes Begehren
Roman
Ins Deutsche übertragen
von Beate Bauer
Zu diesem Buch
Docia Waverley wird auf dem Weg zur Arbeit von Unbekannten von einer Brücke gestoßen. Eigentlich müsste sie tot sein, doch in einer seltsamen Vision erscheint ihr eine Frau, die ihr eine zweite Chance zu leben bietet. Dafür muss sie ihre Seele mit der der Fremden verschmelzen. Als Docia im Krankenhaus aufwacht, kann sie sich zunächst an nichts mehr erinnern. Aber kurz darauf wird sie erneut angegriffen und von einem mysteriösen Krieger gerettet. Dieser nennt sich Ram und behauptet, sie sei seine Königin, die er mit allen Mitteln beschützen müsse. Erst langsam begreift Docia, dass etwas Außergewöhnliches mit ihr geschehen ist – dass sie die Seele eines uralten unsterblichen Wesens in sich trägt. Schon bald wandelt sich ihr Misstrauen gegenüber Ram in tiefe Gefühle. Auch Ram spürt die rätselhafte Anziehungskraft – zwischen ihnen scheint eine seltsame, elementare Verbindung zu bestehen. Doch Docia ist tabu für ihn, ist sie doch einzig und allein für seinen König bestimmt, sobald dessen Seele ebenfalls in die Welt zurückgekehrt ist. Ram ist zerrissen zwischen seiner Pflicht und einem schier unstillbaren Verlangen – dem er niemals nachgeben darf, steht doch nicht weniger auf dem Spiel als das Überleben seines Volkes.
Für Natalie und Melena
Ihr dürft nie denken, dass ich nicht zu schätzen weiß,
was ihr für mich getan habt,
als ihr mein Dramaqueen-Getue über euch habt ergehen lassen.
Melena, du bist mit Leib und Seele dabei und
hast mitgeholfen, meinen Figuren Leben einzuhauchen.
Das werde ich nie vergessen.
Und für Susan …
Großmutter von zwei wunderbaren Downsyndrom-Jungs.
Danke, dass du mich verstanden und
mir geraten hast, die Herausforderung anzunehmen.
Prolog
Gegenwart
England
»Au. Au. Au. Ach, habe ich Au gesagt?«
Kestra kicherte, als sie der hochschwangeren Frau dabei half, sich mit einem halben Dutzend Büchern und Schriftrollen aus dem Dämonenarchiv zu schlängeln, das im Keller des Schlosses des Dämonenkönigs lag. Besagter Dämonenkönig war Noah, der Gatte von Kestra, und besagtes Schloss war ihrer beider Heim.
»Man sollte meinen«, schimpfte Isabella, die ein Hybrid aus Druide und Mensch war, »die Tatsache, dass ich ein halber Schattenwandler bin, eine mächtige, hoch talentierte, schnell heilende Spezies, würde mich vor solchen Dingen wie einem schmerzenden Rücken und geschwollenen Fußknöcheln schützen. Aber neeeiiin …«
Kestra war an solche Klagen gewöhnt und nahm sie als so gutmütig, wie sie gemeint waren. Und Kestra vergab Bella das, was davon doch nicht so gutmütig gemeint war. Sie konnte es verstehen. Wie ihr Dämonengatte Jacob gehörte Bella zu den Vollstreckern. Normalerweise war es ihre Aufgabe, hinauszugehen und Abreibungen zu verteilen, sich ein paar Namen zu notieren und fehlgeleitete Dämonen davon abzuhalten, Dämonengesetz zu brechen. Doch weil sie in anderen Umständen war, war sie gezwungen, zu Hause zu bleiben und mit ihrer Tochter zu spielen oder sich in Noahs Bibliothek mit alten Schriftrollen und Manuskripten die Zeit zu vertreiben. Bellas überbehütender Dämonenehemann wollte in seiner gewohnt selbstherrlichen Art nichts davon wissen, dass sie auch nur einen Fuß vor das schützende Köngishaus setzte, während er unterwegs war, um seiner Arbeit nachzugehen.
Jacob, Bella und beider Tochter Leah waren ein paar Monate zuvor auf Noahs riesiges Schloss zurückgekehrt, als Bella beim Kampf gegen den giftigen Zauber der Nekromanten grauenvolle schwächende Nebenwirkungen erlitten hatte. Es war der Beginn einer großen Schlacht, die in der Gefangennahme der verräterischen Dämonin Ruth gegipfelt hatte, die schon lange ein Stachel in ihrem Fleisch gewesen war. Jetzt war Ruth für alle Zeit in einer Kristallkugel gefangen, die den Frisiertisch der Vampirin Jasmine zweifellos schmückte, und Bella war auf dem Weg der Besserung … doch sie hatten beschlossen, dass die Familie einstweilen dortbleiben würde, solange Bella von der Anfälligkeit während ihrer Rekonvaleszenz in die Anfälligkeit während der letzten Schwangerschaftswochen überging.
Bella war nicht immer so aufgebracht darüber, wie sie sich gern den Anschein gab. Immerhin standen ihr das riesige Dämonenarchiv und die Bibliothek zur Verfügung. Was ein Paradies war für eine Frau, die vor einer halben Ewigkeit einmal Bibliothekarin gewesen war. Eine ihrer Eigenschaften als Druidin war außerdem, dass sie beinahe jede Sprache entziffern konnte, wenn sie sich nur lange genug damit beschäftigte.
»Du solltest keine schweren Sachen tragen. Ich habe dir gesagt, dass Jaleal dir dabei helfen kann.«
»Es ist gar nicht so schwer.« Bella ließ ein Buch auf den Tisch fallen, und der dumpfe Knall hallte vom Deckengewölbe wider und wirbelte eine Staubwolke auf. »Jedenfalls wollte ich dir diese seltsame kleine Schriftrolle zeigen, die ich gefunden habe.«
Vergeblich versuchte sie, mit ihrem dicken Bauch dicht an den Tisch zu treten, schnaubte verärgert und hielt stattdessen Kestra die Rolle hin. Kestra half ihr, indem sie die Schriftrolle entrollte und sie mit Gegenständen vorsichtig festmachte. Die Rolle war sehr alt und hatte die Zeit nicht gut überstanden. Bella nahm an, dass sie aus der ehemals schlecht geschützten Schattenwandler-Bibliothek stammte, einer feuchten Höhle, die erst vor ein paar Jahren wiederentdeckt worden war. Dank Ruth war sie jetzt zerstört, doch was davon übrig geblieben war, hatte man in die Archive der Dämonenbibliothek gebracht, wo es sicherer war … besser geschützt vor dem Zahn der Zeit und auch vor … anderen Einflüssen. Wäre es eine von Noahs historischen Dämonenschriftrollen aus dem Archiv gewesen, wäre sie viel sorgsamer behandelt worden.
»Das sind … was ist das? Ägyptische Hieroglyphen?«
»Jawohl«, sagte Bella, als wäre das Lesen von Hieroglyphen etwas ganz Alltägliches. Sie beugte sich vor. »Also gut, lass mich mal lesen.«
»Na klar«, sagte Kestra trocken. Obwohl auch sie eine Druidin war, hatte sie doch ganz andere Anlagen als Bella. Wenn es darum ging, etwas in die Luft zu sprengen, war sie die Richtige, doch das hier war wirklich zu hoch für sie.
Die Verlorene Schriftrolle der Stämme … und so wird es in Zukunft geschehen, dass die Völker der Schattenwandler geschwächt, auseinandergerissen und einander fremd werden. Durch unglückliche Umstände und verquere Machenschaften werden diese zwölf Völker unterschiedliche Ziele anstreben und aus dem Leben der jeweils anderen verschwinden. Fürderhin werden diese Völker Kämpfen ausgesetzt sein, wie sie noch nie da gewesen waren, und nur indem sie wieder zusammenfinden, gibt es Hoffnung, dem Bösen entgegenzutreten, das über uns hereinbrechen wird. Doch sie sind füreinander verloren und werden es bleiben, bis ein großer Feind besiegt ist … und ein neuer wiederaufersteht ∞
»Was, glaubst du, bedeutet das?«, fragte Kestra vorsichtig.
»Wenn ich das nur wüsste. Ich meine, es klingt nach einem großen Krieg zwischen den Schattenwandlern oder so ähnlich. Eine beängstigende Vorstellung, wenn man darüber nachdenkt. Doch ich habe keine Lust, Ratespiele zu spielen. Der Teil, den ich interessant fand, war das mit den ›zwölf Völkern‹.«
»Aber es gibt nur sechs. Dämonen, Lykanthropen, Druiden, Vampire, Schattenbewohner und Mistrale.«
»Bilden natürliche Hexen ein Volk? Das wären dann sieben. Und was, wenn wir, wie bei den natürlichen Hexen, von den anderen einfach nichts wissen?«
Sie schauten sich an und brachen in Lachen aus angesichts der Unwahrscheinlichkeit.
»Viel wahrscheinlicher ist es, dass diese anderen ausgelöscht sind«, sagte Kestra.
»Weitere Völker würden zumindest diese vielen Bücher in den ganzen fremden Sprachen erklären, die wir in der Bibliothek der Schattenwandler gefunden haben«, stellte Bella fest. »Doch wenn es sie immer noch gäbe, hätten wir inzwischen bestimmt irgendwelche Hinweise auf sie gefunden.«
»Außer den Büchern? Ja, stimmt.«
»Wie traurig«, sagte Bella, und ihre violetten Augen füllten sich mit Tränen.
»Na, na«, tröstete Kestra ihre von Hormonen gebeutelte Freundin, indem sie sie ganz fest an sich zog und Bellas Wange auf ihre Schulter bettete, über die ihre schneeweißen Haare fielen. »Das ist alles schon so lange her. Das hat überhaupt nichts mehr mit uns heute zu tun.«
»Nein«, stimmte Bella zu. »Das hat überhaupt nichts mehr mit uns heute zu tun.«
1
Saugerties, New York
Docia stieß einen verärgerten Laut aus. Fast hätte sie sich ihren Kaffee auf die Schuhe gekippt, als sie mit einem Satz einem Wagen auswich, der dicht an dem Gehsteig entlangraste, von dem sie gerade hatte treten wollen. Es war ein Wunder, dass sie nicht überfahren worden war, dass der größte Teil ihres Kaffees noch im Becher war und ihr das Mobiltelefon nicht aus der Hand fiel.
»Hallo? Jackson?«, sagte sie rasch. »Den letzten Teil habe ich nicht mehr mitbekommen.«
»Nicht so wichtig, Sissy. Ich habe nur über Landon gelästert. Ich glaube, ich wandere bald wegen Mordes in den Knast.«
»Das kannst du nicht tun«, entgegnete sie. »Du weißt, was mit Cops im Gefängnis passiert?«
»Ach, Mist. Du hast recht. Ich bin total neben der Spur.«
Docia biss sich auf die Lippen und versuchte nicht zu lachen. Obwohl er scherzte, wusste sie, dass ihr Bruder wirklich außer sich war. Und ganz und gar nicht in Form. Das war so, seit sein Partner Chico vor sechs Monaten eine Kugel in den Schädel bekommen hatte. Jackson trauerte auf seine Weise, und das hieß, dass er viel weniger Geduld hatte, als er normalerweise an den Tag legte. Leider war Landon kein gefühlsbetonter Typ, der Verständnis dafür hatte, dass Jackson sich einfach aus dem Staub machte. Es war wichtig, dass sie ihrem Bruder half, sich wieder zu fassen.
»Wie geht es Sargent?«
Jackson hielt einen Moment inne. »Er ist undiszipliniert und geht mir auf die Nerven. Außerdem läuft er immer weg.«
»Ach du Schande!« Das war nicht gut. Wenn Jackson Sargent nicht unter Kontrolle hatte, zog das einen Haufen Probleme nach sich. Doch ihr Bruder hatte eine besondere Vorliebe für diese Polizeihundewelpen. Kein Hund könnte Chico wohl jemals ersetzen. Vielleicht war es noch zu früh für einen neuen Hund. Er hätte warten sollen. Sich mehr Zeit lassen. Doch als einer von nur zwei Hundeführern bei der Polizei von Saugerties konnte er es sich nicht leisten, zu warten, bis er einen getöteten Hund ersetzte. Vor allem, wenn man bedachte, wie viel Zeit, Geld und Anstrengung in die Ausbildung eines Hundes flossen. Das Department brauchte den Hund dringend, und er musste gut trainiert sein. Sie wussten auch, dass Jackson der beste Mann dafür war. »Nun, du bekommst ihn schon noch in den Griff«, sagte sie ohne den geringsten Zweifel daran. »Er ist erst ein Jahr alt.«
»Ja, na ja, als Chico ein Jahr alt war, hat er auf ein Fingerschnippen gehorcht.«
»Ja«, sagte sie und trat erneut vom Gehsteig, »aber er ist nicht Chico, mein Schatz. Es ist nicht fair ihm gegenüber, das von ihm zu erwarten. Du hast ihn noch nicht so lange.«
Wieder war da dieses kurze Schweigen. Docia konnte beinahe sehen, wie er zustimmend nickte. Jackson war sachlich, engagiert und sehr ehrgeizig. Es lag ihm nicht, eine Niederlage hinzunehmen. Er musste mit dem Herzen dabei sein.
»Ich weiß«, sagte Jackson nur, und sein Tonfall verriet, dass er den klugen Rat seiner Schwester aufgenommen hatte. »Wo bist du denn?«
Docia musste lächeln über den Themenwechsel. Er brauchte ein wenig Raum, und den würde sie ihm geben. Sie war einfach froh, dass er mit ihr darüber sprach. Er war in ein tiefes Loch gefallen, als Chico gestorben war. Ein paar Leute zuckten nur mit den Schultern und sagten, es war ja »bloß ein Hund«, doch Chico war für Jackson genauso ein Partner gewesen wie ein Mensch. Unter den Kollegen spottete kaum einer. Sie hatten Chico als Polizeihund respektiert. Sogar der lästige Polizeichef Avery Landon.
»Nun, ich bin gerade an Kiss My Feet vorbei, was mich daran erinnert, dass ich schon lange keine Pediküre mehr hatte. Oder ein Waxing.«
»Okay, das muss ich nicht unbedingt wissen, Sissy.«
»Pff«, erwiderte sie. »Tu bloß nicht so, als würdest du es nicht mögen, ein Mädchen mit einem …«, sie nahm die Hand mit dem Kaffee und machte eine kreisende Bewegung vor ihrem Körper, so als könnte er sie sehen, »gestutzten Busch.«
»Ich spreche nicht über den Busch meiner Schwester!«, brachte er mühsam heraus.
»Du Weichei!«
»Du Biest!«
Sie drückte einen Knopf und lächelte, als die Verbindung abbrach. Sie liebte es, ihn so in Verlegenheit zu bringen. Dabei freute sie sich diebisch. Nun, er hatte das Thema wechseln wollen. Das hatte er jetzt davon. Sie steckte das Telefon in ihre Tasche, eine hübsche kleine rosa-graue Tasche, die sie in einer Wiederauferstehungsboutique hier am Ort gesehen hatte. So nannte sie Trödel- und Secondhandläden gern. Nur in ihren Träumen konnte sie sich eine neue Designer-Handtasche leisten. Die leicht abgewetzten Kanten auf dem Boden sah man fast gar nicht, und zu ihrer Winterjacke mit der Kunstfellkapuze sah sie einfach entzückend aus. Sie würde die Kombination den ganzen Winter über tragen, weil sie sich keine andere leisten konnte, doch sie war völlig zufrieden mit dem, was sie hatte, und verschwendete keine Zeit und keine Gedanken an das, was sie nicht hatte.
Sie richtete den Blick bewusst geradeaus, als sie an Krauses Süßwarenladen vorbeiging. Die rot-weiß gestreifte Dekoration an den Säulen schrie geradezu danach, dass man sich die Nase am Schaufenster platt drückte und die Berge von köstlicher Schokolade roch. Doch sie hielt tapfer stand. Sie war sowieso schon ziemlich spät dran. Sie war auf dem Weg zu einem netten kleinen Büro mit einem mürrischen Chef, mit dem sie Ärger bekäme, wenn sie zu spät kam.
Ein paar Minuten später trat sie auf die grüne Stahlbrücke mit dem taillenhohen Betongeländer, das jedoch niedrig genug war, um ihr einen Blick auf das Wasser des Esopus River zu gewähren, der in den größeren und viel majestätischeren Hudson River mündete. Die Strömung war stärker als normalerweise zu dieser Jahreszeit, weil das Wetter für den Winter ungewöhnlich warm war … wenn man fünf Grad als warm bezeichnen konnte. Es fror also nicht, daher schwamm auf dem Hudson zu ihrer Linken nicht eine einzige Eisscholle, und der Fluss unter ihr strömte nicht träger dahin auf dem kurzen Stück, bis er über trügerisch warm aussehende braungraue Felsen hinabstürzte. Doch das war nichts im Vergleich zum Sommer. Da rauschte der reißende Strom in rasender Geschwindigkeit hinab, was viel eher einem heftigen Vulkanausbruch glich.
Sie war in romantischen Tagträumen gefangen, wie sie feststellte, und beschleunigte den Schritt, während sie über die Brücke ging. Die Brücke selbst war ein Überbleibsel aus einer Zeit, als die Fahrzeuge noch nicht besonders schnell fuhren und die Fahrer die Kurve auf die Brücke und die schmale Brücke selbst noch nicht entgegen jeder Vernunft und entgegen den Verkehrsregeln in zu gewagtem Tempo nahmen. So war kaum genug Platz, dass ein Fußgänger sie sicher überqueren konnte. Es war jedoch der einzige Weg, auf dem sie zur Arbeit kam, nachdem ihr schwerer Volvo letzte Woche wegen kaputter Lichtmaschine liegen geblieben war und sich nicht mehr vom Fleck bewegte. Das kostete schlappe zweihundertfünfzig Dollar, die sie aber erst hatte, wenn sie am Freitag ihren Gehaltsscheck bekam. Zum Glück war es nur noch ein Tag bis dahin.
»Bad Boys«, der Titelsong der TV-Serie Cops erklang in ihrer Tasche, als sie fast in der Mitte der Brücke war. Geschickt zog Docia das Handy ganz unten aus ihrer kleinen Tasche und hielt es ans Ohr.
»Ich dachte, ich hätte dich mit meinem Gerede über das Büschestutzen abgeschreckt«, sagte sie und unterdrückte ein Kichern, als Jackson ins Stottern geriet.
»Das – das hast du auch. Bitte sprich einfach nicht mehr davon. Nicht so früh am Tag. Nein, streich das für den Rest des Tages.«
»Rufst du nur an, um mich herumzukommandieren, oder gibt es einen anderen Grund?«
»Ich meine es ernst, Sissy! Versprich mir, dass du es nicht mehr erwähnst.«
»Ich leg gleich auf«, drohte sie.
»Du benimmst dich wie ein kleines Kind«, schimpfte er.
Docia kicherte und hatte bereits die perfekte Retourkutsche. Von wegen. Doch als sie den riesigen SUV entdeckte, der auf ihrer Seite der Brücke auf sie zuraste, sodass ein Funkenregen sprühte, als er das Geländer streifte wie ein Liebhaber, der mit der Zunge über den Hals seiner Partnerin fährt, blieb ihr die deftige Erwiderung im Halse stecken.
Sie ließ alles fallen. Kaffeebecher. Telefon. Hübsche grau-rosa Handtasche. Und irgendwie gelang es ihr, auf das Geländer zu klettern, damit sie nicht zu Hackfleisch wurde, als der SUV so nah an ihr vorbeirauschte, dass er ihren Rock erfasste und zerriss.
So nah, dass der Beifahrer sich mit seinem mächtigen Oberkörper aus dem Fenster lehnen und sie mit einem kräftigen Stoß vom Geländer schieben konnte.
Einen Moment lang war um sie herum nichts als Luft, ein Augenblick, in dem sie scharf einatmete und schwerelos durch die Luft zu schweben schien. Die eingesogene Luft hörte sich in ihren Ohren so laut an, und der Schrei, der folgte, nicht laut genug. Und kurz bevor sie in die Schlucht aus Felsen und Wasser unter sich stürzte, weil die Schwerkraft doch nicht außer Kraft gesetzt war, hatte sie nur einen einzigen Gedanken, nämlich dass die Strömung hoffentlich stark genug war, um ihren toten Körper aus dem Zuständigkeitsbereich von Jackson fortzutragen.
Mehr Zeit hatte sie nicht, bevor sie mit Kopf und Rücken auf den Felsen aufschlug und ein Strom eisigen Wassers sie mitriss und gegen eine weitere Felsgruppe schleuderte, so als hätte jemand sie in eine mit Steinen gefüllte Teufelsmaschine im Waschsalon geworfen, die im letzten kalten Spülgang lief. Das Wasser drang ihr in die Nase und strömte ihr übers Gesicht und in den zum Schreien weit geöffneten Mund und in die Kehle. Es lief ihr in die Lungen, die sich instinktiv dagegen wehrten. Sie hätte nie gedacht, dass es so wehtun würde, wenn man Wasser einatmete. Sie wollte schreien vor Schmerz, doch ihre Lungen waren wie gelähmt vom eisigen Wasser.
Kurz darauf verschwand Docia aus der Welt, wie sie sie gekannt hatte.
»Hallo? … Halloooo? … Sis?« Mit gerunzelter Stirn blickte Jackson auf das Telefon und unterbrach dann mit einem Knopfdruck die Verbindung. Das Telefon seiner Schwester war Schrott. Er wusste, dass sie sich von ihrem Gehalt kein besseres leisten konnte, doch es nervte ihn, dass die Gespräche mit ihr dauernd unterbrochen wurden und sie oft kein Netz bekam. Irgendwann würde sie einmal Hilfe brauchen, und dann würde ihr dieses mickrige Telefon keinen guten Dienst erweisen.
Er machte sich eine gedankliche Notiz, ihr zu Weihnachten ein neues zu schenken.
* * *
Du bist viel zu jung zum Sterben, hauchte eine wunderschöne Stimme in Docias Kopf.
Dem stimmte sie aus vollem Herzen zu. Doch soweit sie das beurteilen konnte, hatte sie keine Wahl in der Sache. Wer hatte die schon? Wenn das Ticket gelocht war, war es gelocht. Da war nicht viel zu machen.
Du gibst einfach auf. Ich habe kein Verständnisfür eine solche Schwäche.
Ach, leck mich, fauchte sie in Gedanken den Geist aus dem Jenseits an – oder was es auch immer war –, der sich anscheinend entschlossen hatte, sie im Augenblick ihres Todes zu belästigen. Da es sich hier um meinen ersten Tod handelt, wirst du verdammt noch mal entschuldigen, dass ich nicht weiß, was von mir erwartet wird!, schimpfte sie mit der Stimme, die in ihrem Geist herumspukte. Wo zum Teufel war das matte warme Licht und der Frieden, den sie angeblich spüren sollte? Niemand hatte je ein nörgelndes Miststück mit einem fremdartigen Akzent erwähnt, das auf ihren Schwachstellen herumhackte.
Dann stellte Docia auf einmal fest, dass sie in einer angenehmen Umgebung stand. Sie nahm den intensiven Geruch nach Weihrauch wahr, durchdringend und süß, und gleichzeitig moschusartig und irgendwie exotisch. Sie war umgeben von einem wirbelnden Grau aus Nebelschwaden, die wie eine Strömung an ihr vorbeizogen, genauso unaufhaltsam wie die, in die sie hineingestürzt war.
Hineingestoßen worden war.
He, was zum Henker sollte das?, wollte sie wissen. Wenn sie wirklich mausetot war, sollte sie dann nicht auf die Welt hinabblicken können und all die Antworten finden, die sie zeit ihres Lebens nicht hatte finden können? Ach … zum Teufel … konnte sie überhaupt ein Engel sein, wenn sie so oft Schimpfwörter benutzte? Ach ver…! Sie wollte wirklich gern ein Engel sein. Nicht dass sie sich vor der Hölle gefürchtet hätte – nein, halt, sie fürchtete sich doch –, sondern eher, weil sie die Möglichkeit haben wollte, Jackson zu beobachten. Um sicherzugehen, dass es ihm gut ging. Engel sollen doch auf ihre Angehörigen aufpassen, oder? Sie vielleicht beschützen?
Tot nützt du ihnen nichts, sagte dieses nervige Miststück in ihrem Kopf deprimierenderweise. Doch dieses Miststück war jetzt weniger in ihrem Kopf als vielmehr vor ihr. Sie materialisierte sich vor Docia, eine kleine, zierliche Gestalt, gekleidet in Gold und Rohdiamanten, die das stärker werdende Sonnenlicht einzufangen schienen, das um sie herum erstrahlte. Hier war also die erstaunliche Wärme, die sie erwartet hatte, auch wenn sie nicht erwartet hatte, dass es sich so anfühlte, als läge man am Strand … diese sengende Hitze, die ihr in den Nasenlöchern brannte. Je klarer der unsichtbare Geist wurde, desto schöner schien er zu sein. Straff zusammengebundenes schwarzes Haar, glatt zurückgekämmt unter einen schimmernden goldenen Kopfputz und auf der Stirn zu einem schlangenähnlichen Gebilde gedreht wie bei einer Ägypterin. Ihre Haut war von einem dunklen Nussbraun und ihre Augen von einem schimmernden Schwarzbraun, wie sie es noch nie zuvor gesehen hatte. Sie hatte immer gedacht, dass braune Augen wie ihre eigenen langweilig und gewöhnlich waren, doch diese Augen, die sie von Kopf bis Fuß musterten, waren alles andere als langweilig. Tatsächlich schienen sie durchdringend und abschätzend zu sein, lebendig und herrisch, wie Docia es bei starken Frauen, die sie in den Medien gesehen hatte, stets bewunderte. Sie hatte sie um deren Mut beneidet und um deren scheinbar unbezwingbaren Willen. Eigenschaften, die von dieser Frau vor ihr auszugehen schienen.
»Willkommen im Äther«, begrüßte sie Docia knapp. Nicht dass sie unfreundlich geklungen hätte, sie klang nur etwas ungeduldig, so als bedauerte sie es, Zeit mit Förmlichkeiten zu verschwenden. Die folgenden Worte bestätigten das. »Wir haben nicht viel Zeit. Du scheinst vielversprechend zu sein. Du bist stärker, als dir bewusst ist.«
»Gut zu wissen«, sagte Docia trocken und verdrehte die Augen.
Die Frau zischte missbilligend. »Sie ist ungeduldig.«
»Sie braucht eine Form, Liebling.« Eine körperlose männliche Stimme erwachte zum Leben, und ihr tiefer dunkler Klang schien machtvoll von allen Seiten zu kommen. »Du wirst ihr alles geben, was sie braucht.«
Die königliche Gestalt neigte den gekrönten Kopf und verengte die mit Kajal umrandeten Augen auf Docia. Die Betonung von Schwarz und Gold hätte ihr eigentlich das Aussehen einer herausgeputzten Proletin geben sollen, doch irgendwie war das nicht der Fall. Es machte sie sogar noch schöner, noch eindrucksvoller, und die braunen Augen noch exotischer.
»Sie hat ein Herz«, sagte sie nach einer langen Pause.
»Der Rest kommt dann schon«, versicherte die widerhallende körperlose Männerstimme.
Docia öffnete den Mund, um etwas zu sagen, und war ein wenig verärgert, als sie sah, wie die Frau die Hand hob, um sie daran zu hindern. War sie nicht eben erst gestorben und so?
»Nein«, berichtigte diese. »Noch nicht tot. Aber auf der Kippe. Das ist der einzige Grund, warum du Zugang zum Äther hast und mich sehen kannst«, sagte sie eindringlich. »Du musst eine Entscheidung treffen. Ob du leben willst oder sterben. Nur jetzt, auf der Schwelle des Todes, während du offen bist, um mich einzulassen … nur jetzt hast du diese einzigartige Gelegenheit. Ich kann nicht versprechen, dass es immer gut und wundersam sein wird, doch wenn du mich einlässt, könnte das uns beiden helfen, dass wir uns in die Wesen verwandeln, die wir gerne sein wollen.«
»Ich soll mich zwischen Leben und Tod entscheiden? Also. Darüber muss ich wohl nicht lange nachdenken«, sagte Docia.
»Aber du wirst nicht mehr Docia sein«, warnte die majestätische Schönheit sie. »Du wirst alles, was dich betrifft, von jetzt an mit mir teilen. In gewisser Weise wirst du deine sterbliche Hülle ersetzen. Nichts wird für dich mehr so sein wie zuvor.«
»Nichts? Du meinst, ich werde meinen Bruder nicht mehr sehen?«
Die ägyptische Schönheit zögerte und blickte dann über die Schulter, als wäre da jemand. Zweifellos der körperlose Mann mit der volltönenden Stimme.
»Doch, du wirst ihn sehen. Aber … alle deine Beziehungen werden sich verändern. Dagegen kann man nichts tun. Menschen können Veränderungen oft nicht akzeptieren. Und es wird viele Veränderungen geben. Jetzt entscheide dich schnell. Die Zeit läuft dir davon. Deine Verbindung zum Äther wird schwächer.«
Leben oder Tod. Sie selbst, aber anders. Jackson verlassen und ihm damit noch einen schweren Verlust zufügen oder bleiben und …
»Geh oder bleib einzig wegen dir selbst, Docia«, drängte die Fremde sie. »Die Liebe zu deinem Bruder ist bewundernswert, doch er darf nicht der Grund sein, dass du bleibst. Du musst diese Entscheidung allein um deinetwillen treffen. Aus keinem anderen Grund.«
Aus keinem anderen Grund. Aus keinem anderen Grund, bis auf den, dass sie zu jung war zum Sterben. Verdammt, sie hatte ja noch gar nicht richtig gelebt. Sie war noch nie aus New York hinausgekommen. Sie hatte sich noch nie verliebt oder überwältigenden Sex gehabt. Sex ja, doch es hatte sie nicht überwältigt. Sie wollte gern Wildwasserkanu fahren … Ach. Warte mal. Streichen wir das lieber. Von Wildwasser hatte sie erst einmal genug.
Und sie wollte herausfinden, wer zum Teufel sie von der Brüstung gestoßen hatte. Dieses Schwein. Sollte das ein Scherz sein? Nicht mit ihr! Sie würde nicht einfach durchgehen lassen, dass jemand sie umbrachte!
»Ich will leben«, sagte sie schnell, bevor die Königin des Äthers ihr sagen konnte, dass Rache kein annehmbarer Grund war zu leben. Es war außerdem nur einer. Und es ging nicht so sehr um Rache als vielmehr um Gerechtigkeit.
»Gerechtigkeit ist einer der besten Gründe, aus denen man ums Überleben kämpft«, erwiderte die Frau, während sie die Hand ausstreckte, um Docias Gesicht zu berühren. Doch kurz bevor sie sie berührte, hielt sie inne. Docia bemerkte, dass die ägyptische Schönheit schwer atmete und dass die Hand, die sie zögernd nach ihr ausgestreckt hatte, zitterte. Docia erkannte, dass die eindrucksvolle und beherrschte Frau ziemlich ängstlich war. Wieder blickte diese über die Schulter, und es gab einen weiteren Schwall Wärme, als würde die Sonne von aufgeheiztem Sand abstrahlen.
»Geh. Deine Zeit ist schon um, Liebling. Du wirst dringend gebraucht«, ermutigte der Mann sie mit einem liebevollen Flüstern, das von überall her zu kommen schien.
»Wir sehen uns wieder«, flüsterte die Schönheit, bevor sie Docias Wange berührte, sich vorbeugte und sie auf die Lippen küsste. Zuerst war es ein zärtlicher, beinahe sanfter Kuss, der rasch fester und leidenschaftlicher wurde. Docia war schockiert von der aggressiven Zunge, die ihre Lippen teilte und ihre Zunge zu berühren versuchte. Sie wollte es verhindern … sie hätte es verhindert … doch in dem Moment, als die Zunge ihre Zunge berührte, drang, angefangen bei ihrem Mund, ein sengendes goldenes Licht durch sämtliche Öffnungen in sie ein.
Sie atmete ein, eine reflexartige Reaktion, und genau wie das Einatmen von eiskaltem Wasser war das Einatmen dieses brennend heißen Lichts ungeheuer schmerzhaft. Sie hatte das Gefühl, als würden ihr Körper und ihre Seele auseinandergerissen und sich in ihren molekularen Zustand auflösen und in sämtliche Teilchen und Atome zerfallen und in diesem heißen goldenen Licht schweben. Dann setzten sich die Moleküle langsam wieder zusammen … nur dass diesmal neue Atome in die Struktur mit eingewoben wurden.
Als sie wieder ein Ganzes war, war sie bewusstlos zusammengebrochen, und tröstliche Dunkelheit umhüllte sie.
Sie beide.
2
»Jackson!«
Jackson Waverly spürte ein leichtes Prickeln im Nacken, als er das vertraute Bellen seines Chefs hörte. Doch eigentlich klang alles, was sein Chef von sich gab, wie ein schlecht gelauntes Bellen. Nur dass es ihm manchmal mehr auf die Nerven ging als sonst. Und heute war es so, heute war so ein Tag. Er hatte Sargent, seinen Hund, aus Versehen an sich vorbeigelassen, sodass der eine volle Stunde in der Nachbarschaft herumlaufen konnte, bis der untrainierte und ungehorsame kleine Racker erschöpft auf sein Rufen hörte und ihn hechelnd und mit heraushängender Zunge anblickte, als wollte er sagen: »Das hat Spaß gemacht! Können wir das morgen wieder tun?«
Mmm. Nein.
Doch zweifellos würde Sargent seinen Willen durchsetzen. Aber das war im Moment sein geringstes Problem. Seine größte Sorge war sein Chef, der mit weit ausholenden Schritten auf ihn zukam. Jackson meinte zu sehen, dass Rauch aus Landons Ohren drang. Wobei das nicht gerade unerwartet oder überraschend war, nachdem er beinahe eine ganze Stunde zu spät zur Arbeit erschienen war und deshalb das morgendliche Briefing versäumt hatte.
»Wo zum Teufel waren Sie heute Morgen!«, verlangte Landon zu wissen.
Eine Tausende Dollar schwere Investition der Polizeistelle über einen vierspurigen Highway jagen.
Mmm. Nein.
»Probleme mit dem Wagen«, log Jackson ruhig. »War nichts zu machen. Sagen Sie, wann fangen wir mit dem Gruppentraining für Sargent an?« Er war überzeugt, dass Sargent einer von den Hunden war, bei denen das Training in der Gruppe besser und schneller fruchtete.
Landon öffnete den Mund, doch der seltsame Themenwechsel brachte ihn durcheinander. Landon begriff nicht, dass sie noch immer über das gleiche Thema sprachen.
»Ich denke, Sie sind bei dem neuen Programm dabei. Vorausgesetzt, Sie schaffen es, pünktlich zu sein.«
»Elf Jahre bei der Einheit, und ich bin vielleicht drei Mal zu spät gekommen. Sollen wir uns wirklich deswegen die Köpfe einschlagen, Landon? Brauche ich etwa einen Gewerkschaftsvertreter oder so etwas? Wollen Sie mich offiziell aufschreiben? Oder soll ich beschämt den Kopf senken? Wie werde ich Sie los?«
Jackson hatte keine Ahnung, was diesen plötzlichen Ausbruch bewirkt hatte, doch irgendwie war ihm der Geduldsfaden gerissen, und nicht nur mit seinem Chef, sondern auch mit seinem Hund und der Welt ganz allgemein. Genau hier und jetzt.
Ihm wurde klar, wie untypisch dieser Stimmungswandel für ihn war … und wie ungehörig vielleicht … als es ganz still wurde im Raum. Sei’s drum. Wenn Landon sich wie ein Arschloch benehmen konnte, konnte er das auch. Stimmt’s? Und er hatte viel eher das Recht, aus der Haut zu fahren, als Landon mit seinem ständigen Genörgel und seiner verbissenen Art, Schwächen seiner Leute aufzudecken, wo es keine gab. Das hier war ein gutes Polizeiteam. Bei einer Kleinstadtpolizei, die es sich nicht leisten konnte, Spezialeinheiten Vollzeit zu beschäftigen, wurden jeder Mann und jede Frau in verschiedenen Bereichen ausgebildet, damit sie jederzeit für jemand anderen einspringen konnten. Jackson war nicht nur einer der beiden Hundestaffelführer, er war auch Sprengmeister und Mitglied eines SWAT-Teams. Zum Teufel, er wäre auch beim Geiselrettungsteam, wenn er könnte, doch SWAT, Bombenentschärfungsteam und Geiselrettung hatten manchmal gegensätzliche Ziele, und er konnte sich nicht dreiteilen.
Jackson fuhr sich mit der Hand durch die widerspenstigen Locken, die etwas zu lang waren, ein weiteres Zeichen dafür, dass er sein Äußeres in letzter Zeit vernachlässigte. Und jetzt gab ihm auch noch Landon eine dieser schlechten Beurteilungen, auf die unweigerlich folgte …
»Jackson, muss ich Sie zum Psychologen schicken?«
Das war es also. Als ob alles auf einmal wieder gut wäre, weil man einem weichherzigen, gefühlvollen Seelenklempner mit einem Stift in der einen und einem Aufnahmegerät in der anderen Hand gegenübersaß, als würde man einen magischen Zauberstab schwingen. Na ja, außer dieser Zauberstab könnte Chico von den Toten auferstehen lassen … danke, aber nein danke.
»Nö. Nicht nötig. Ich habe meine Zeit abgeleistet. Ich bin wieder zum Dienst zugelassen. Haben Sie den Bericht nicht bekommen? Man hat mir sogar einen neuen Hund und alles gegeben. Ich will den kleinen Mistkerl nur trainieren und einsatzbereit machen.« Jackson bedachte seinen Chef mit dem falschesten breiten Lächeln, das er zustande brachte. Alles, nur das Arschloch nicht umarmen. »Es war ein blöder Morgen, und ich würde gern wieder an die Arbeit gehen, Chef.«
Landon runzelte die Stirn und glotzte Jackson an, als wäre der ein Stück C4-Sprengstoff voller Sprengkapseln. Jackson biss die Zähne zusammen und zählte die Sekunden, bis Landon endlich zu dem Schluss käme, dass er seine Zeit verschwendete. Schließlich nickte Landon, und der perfekte Igelschnitt betonte seinen Quadratschädel, sodass er aussah wie ein typischer Marineinfanterist, was er früher ja auch gewesen war.
Jackson lehnte sich erleichtert zurück, als Landon sich in sein Büro zurückzog. Es war nicht so, dass der Mann seinen Job nicht verdientermaßen innehatte. In Wahrheit war er ein guter Captain, der, wie Jackson sich mühelos vorstellen konnte, ein anstrengendes Kommando hatte. Er respektierte Landon, es war nur so, dass jeder von ihnen einen eigenen Kopf hatte, und so gerieten sie oft aneinander. Außerdem gefiel es Jackson nicht besonders, dass Landon ihm anscheinend nicht genug vertraute, um ihm ein wenig Selbstständigkeit zuzugestehen. Jackson nahm es nicht persönlich, weil Landon ein Kontrollfreak war und mit allen so umging. Es war nur eine nervige Eigenschaft bei einem Vorgesetzten von starken Persönlichkeiten, und Jackson fragte sich, wer auf die glorreiche Idee gekommen war, Landon eine Führungsposition zu geben. Doch dann kamen ihm wieder Zweifel, ob Landon sich überhaupt jemals nicht buchstabengetreu an die Regeln gehalten hatte. In einem bürokratischen Umfeld wie den höheren Rängen der Polizei von Saugerties war das ganz sicher eine hervorragende Eigenschaft. Und eine angenehme obendrein, jedenfalls für diejenigen, die bei einem Lieutenant der Polizei sicher sein wollten, dass er nicht eigenmächtig handelte.
Jackson beschloss, sich an den Rat seiner Schwester zu halten und seine Aufmerksamkeit von den nervigen Eigenschaften seines Chefs abzuwenden. Er berührte die Maus seines Laptops und erweckte den Bildschirm zum Leben. Dann ging er direkt zum Dienstplan, und tatsächlich war er die nächsten drei Wochen nicht auf der Straße im Einsatz. Es war ein Intensivprogramm nur mit ihm und Sargent und einer ganzen Klasse von Polizeihundewelpen aus der Region von Catskill, die nichts anderes lernen sollten, als auf ihren Partner zu hören und eine Vorstellung davon zu bekommen, was es hieß, ein Polizeihund zu sein.
Es war nicht so, dass Sargent nicht das Zeug dazu hatte. Er war stark, furchtlos und forsch. Doch an seinem Willen musste man arbeiten. Ihn nicht brechen, denn das war eine Stärke, die ihm einmal sehr nützlich sein würde, sobald er richtig abgerichtet war.
Die Wahrheit war, dass Jackson ihn nicht abgerichtet hatte. Jedes Mal, wenn er den tollpatschigen kleinen Lümmel betrachtete, fühlte er sich … betrogen. Wütend.
Schwachsinn.
Jackson blickte durch das Großraumbüro den Gang hinunter, wo das blau umrandete Glas in der Tür von Dr. Marissa Andersons Büro hervorstach. Doch das war eine ganz andere komplizierte Geschichte, dachte er, als die Tür plötzlich aufging und sie heraustrat und sich in das Gewimmel auf dem Gang mischte. Als wollte sie mit ihrer Umgebung verschmelzen und ein Teil davon werden.
Schon bei dem Gedanken stieß er ein kurzes, scharfes leises Lachen aus. Eine lächerliche Vorstellung, dass die große, makellose Frau, die in einem eng anliegenden grauen Businessrock und einer schlichten weißen Bluse steckte, unbemerkt in einem Meer von blauen Uniformen und älteren ungekämmten Detectives mit ihren Donutbäuchen untergehen könnte. Als sie sich umdrehte und auf das Großraumbüro zuging, wippten bei jedem Schritt in ihren High Heels ihre Brüste und die gelockten Enden ihres langen bronzefarbenen Haars, und er erinnerte sich, weshalb er es nicht hatte erwarten können, dass man ihn wieder für diensttauglich erklärte und die verlangten Sitzungen mit ihr ein Ende hatten. Sie war einfach zu sexy für so eine kopfgesteuerte Doktorin, vor der er das ganze Männlichkeitsgehabe ablegen sollte, um tief in die Trauer über den Verlust seines Gefährten einzutauchen. Er hätte sich schon fast dafür entschieden, einen Doktor von außerhalb aufzusuchen, aber nein, verdammt noch mal, er war nicht gewillt, vor ihr davonzulaufen, nur weil er jedes Mal, wenn er sie ansah, einen trockenen Mund und eine Erektion bekam. So etwas Ähnliches passierte jetzt, als sie das Großraumbüro in Richtung Landons Büro durchquerte.
Doch bevor sie das Büro seines Lieutenants betrat, blickte sie in seine Richtung, wobei sie ihn aus ihren blaugrünen Augen besorgt ansah und ihn damit aus der primitiven Betrachtung ihrer Person riss und ihm ein beunruhigendes Prickeln über den Nacken jagte.
Jackson setzte sich in seinem Stuhl auf und sah dabei durch die Glaswand, wie sie Landon in knappen Worten etwas mitteilte, woraufhin Landon in seine Richtung blickte. Landon bellte Marissa etwas zu und nahm den Telefonhörer ab. Der Anruf dauerte ungefähr dreißig Sekunden, wenn überhaupt. Dann blickte Landon wieder zu Jackson herüber und bemerkte, dass dieser ihn noch immer interessiert beobachtete. Sein Chef erhob sich augenblicklich und machte ihm mit zwei Fingern ein Zeichen, zu ihm zu kommen.
Jackson blickte sich um, nur um sicherzugehen, dass diese Aufforderung nicht jemand anderem galt.
Doch er hatte kein Glück.
Auf dem Weg zu Landons Büro schossen ihm die verschiedensten schrecklichen Gedanken durch den Kopf. Doch im Grunde kreisten sie um die paranoide Vorstellung von einer Verschwörung, zu der sie sich zusammengefunden haben mussten, um ihn wieder aus dem aktiven Dienst zu entfernen. Wenn das der Fall war, war das absolut schwachsinnig! Er hatte alles getan, was man von ihm erwartet hatte, und keiner von ihnen konnte etwas anderes behaupten. Sie konnte nicht plötzlich ihre Meinung über seine Zulassung zum Dienst ändern, oder? Als er die Tür öffnete, fragte er sich, ob er die Telefonnummer seines Gewerkschaftsvertreters griffbereit hatte, und fasste mit der freien Hand an die Hosentasche, in der er seine Brieftasche mit einer Reihe wichtiger Karten stecken hatte, deren Namen und Nummern er noch nicht in seinem Mobiltelefon gespeichert hatte. Er schloss die Tür. Zum Glück war das Großraumbüro beinahe leer; alle anderen hatten ihre Schicht auf Streife begonnen oder bearbeiteten irgendwelche Fälle.
Jackson spürte ein Brennen im Bauch, als Marissa mit geübten Bewegungen die Jalousien an den Glaswänden herunterließ. Er konnte ihr feines Parfüm riechen, als sie dicht an ihm vorbeiging, doch es brachte ihn nur noch mehr auf, während das Adrenalin in seinem Blut die Furcht in ihm zugleich verstärkte.
»Setzen Sie sich, Sergeant Waverly«, bat Landon ihn, während ein Muskel in seinem Kiefer vor Anspannung zuckte, so fest biss er die Zähne aufeinander.
»Ich stehe lieber. Worum geht es?«, fragte Jackson, während er seine Abwehrhaltung zu mäßigen versuchte. Er wollte sich so gelassen geben wie möglich. Wollte seine Gefühle im Griff haben. Ihnen beweisen, wie beherrscht er war.
»Sergeant, Sie sollten sich wirklich hinsetzen«, wiederholte Marissa, und diese freundlichen Augen waren so klar wie das karibische Meer, doch viel tosender als die sanften Wellen, die an den Strand von Aruba schlugen. Es war so nervenaufreibend wie das Geräusch von Kreide an einer Tafel, und er war kurz davor durchzudrehen.
»Jackson«, überging Landon Jacksons feindselige Haltung mit einem schroffen, nüchternen Tonfall, »man hat gerade die Leiche Ihrer Schwester aus dem Hudson River gezogen.«
Sein Blick fuhr zu seinem Boss. Die Worte waren wie Eishagel, der hart und kalt auf seinen nackten Körper einprasselte. Dann, als hätte jemand ihm die Wirbelsäule herausgerissen, sodass er sich nicht mehr aufrecht halten konnte, gaben seine Knie nach, doch ein überraschend kräftiger weiblicher Körper war plötzlich dicht bei ihm wie eine warme, exotisch duftende Krücke. Allerdings war sie nicht in der Lage, einen Mann festzuhalten, der sie um fast einen Kopf überragte und dessen zweihundertfünfzehn Pfund aus reiner Muskelmasse bestanden. Und das ganze Männlichkeitsgehabe, das er in den drei Monaten während ihrer Sitzungen so sorgfältig aufrechterhalten hatte, fiel in sich zusammen.
Landon war inzwischen um den Schreibtisch herumgekommen und bewahrte ihn davor, zu Boden zu gehen, indem er Marissa dabei half, ihn auf den schon zweimal angebotenen Stuhl zu setzen.
Jackson holte tief Luft. Dann schien sein Verstand schlagartig wieder einzusetzen, und er lachte.
»Das ist ja lächerlich«, sagte er. Er fühlte sich auf einmal wieder stark und stieß die Hände weg, die ihm plötzlich unangenehm waren. »Das ist Quatsch! Es ist nicht einmal zwanzig Minuten her, dass ich mit ihr telefoniert habe! Auf dem Weg zur Arbeit!« Er tastete nach seiner Uhr und schaute nach der Zeit. Gott, es war schon länger her. »Na gut, dreißig Minuten. Immer noch nicht genug Zeit, um irgendetwas aus dem Fluss zu fischen, geschweige denn zu identifizieren, falls es tatsächlich meine Schwester wäre. Was ist nur los mit euch? Überprüft ihr nicht die Fakten, bevor ihr jemandem so etwas sagt?« Er brüllte sie an, und seine Hände zitterten in einer unguten Mischung aus Angst und Wut.
»Sie ist am Zufluss von der Brücke gestürzt, direkt hinter …« Landon hielt inne und blickte auf eine hastig hingekritzelte Notiz.
»Kiss My Feet«, krächzte Jackson.
… Ich bin gerade an Kiss My Feet vorbei …
»Jemand ist wie ein Irrer um die Kurve gefahren. Diese Kurve auf die Brücke ist berüchtigt …«, sagte Landon und verstummte, weil er nicht wusste, was er sonst noch sagen sollte. Jeder Cop in Saugerties kannte diese Kurve. Da er dort aufgewachsen war, wusste Jackson auch, was sich unter der Brücke befand.
Sie hatten sie aus dem Hudson gefischt. Das heißt, sie war ins Wasser gestürzt. Auf die Felsen. Sie hatte bestimmt während des Falls die ganze Zeit geschrien.
Jacksons Telefon am Waffengürtel meldete sich. Benommen stellte er es aus.
»Wo ist sie?«, fragte er heiser.
»Kingston Hospital. Der Beamte vor Ort hat mich angerufen und gesagt, sie sei …« Marissa schien ihre professionelle Haltung zu verlieren und war nicht imstande, das Wort auszusprechen.
»Das mit dem Krankenhaus ist reine Routine, wie Sie wissen.«
Jacksons Telefon begann erneut zu klingeln.
Es war eher das als irgendetwas sonst, was die Hiobsbotschaft bestätigte. Freunde in der Einheit und im Krankenhaus versuchten ihn zu erreichen, wurde ihm bewusst. Sie brachen ihre Schweigepflicht und verstießen gegen die Dienstvorschriften, um ihn als Erste vorzuwarnen.
Jackson erhob sich mühsam und taumelte zur Tür, doch Marissa stellte sich ihm in den Weg, und ihr warmer weicher Körper vermittelte erneut Stärke und Trost. So unerwartet. So provozierend und tröstend zugleich.
Er blickte in ihr Gesicht, und sein ganzer Körper bebte vor aufflackerndem Zorn, der rasch hohe Flammen schlug. Er schwankte zwischen Benommenheit und einer Wut, wie er sie noch nie empfunden hatte. Nicht einmal als er zugesehen hatte, wie dieses mit Meth zugedröhnte Schwein seinen Hund erschoss, als wäre der nichts. Wie er ihn gepackt und weggeworfen hatte, als wäre er Altpapier. Nicht einmal da hatte er so eine verzehrende und heftige Wut empfunden.
»Atmen«, flüsterte sie, während sie die Hände um sein Gesicht legte und ihn zwang, sie anzuschauen. »Atmen Sie langsam ein und wieder aus.«
Hatte sie überhaupt eine Ahnung, wie provozierend und lächerlich dieses schwachsinnige Psychogewäsch in einem solchen Augenblick war?
»Atmen, Jackson«, sagte sie bestimmter, wobei sie ihn schüttelte und ihn damit zwang, in einem Augenblick anwesend zu sein, in dem er gar nicht anwesend sein wollte.
Er schwankte und versuchte seine Kräfte wieder zu sammeln, die er stets gehabt hatte, sodass er auch dem Schlimmsten ins Auge hatte blicken und einfach weitermachen können, doch aus irgendeinem Grund hatten sie ihn im Stich gelassen, als er sie am meisten gebraucht hätte. Und jetzt blieb ihm nur noch diese nervtötende Frau, die sich aufführte, als bräuchte er so etwas wie einen Geburtshilfekurs, um die Kontrolle und die Konzentration wiederzugewinnen.
»Jackson!«
Sie schlug ihn. Nicht so, dass Landon es sehen konnte, doch ein verstecktes Knie, das kurz vor seinem Schritt innehielt, brachte ihn dazu, instinktiv zurückzuzucken und die dringend benötigte Luft einzuatmen.
Sauerstoff strömte in sein Blut und in sein Gehirn, und er packte Marissa und knallte sie gegen die Tür, wobei das blecherne Geräusch von Jalousien, die wackelten, verriet, wie alt dieses Gebäude war. Dieses kleine Detail, das sich in einem Mahlstrom von Trauer herauskristallisierte, gab ihm kurz Halt und hielt ihn davon ab, eine großartige rothaarige Ärztin zu erwürgen, die immer so wunderbar roch und ihm immer einen Schritt voraus zu sein schien. Jackson ließ sie los, bevor Landon sich einschalten und den rettenden Marineinfanteristen geben konnte. Er holte noch einmal tief Atem, während er ihre beherrschten Gesichtszüge betrachtete, und er nahm es ihr übel, dass er mit jedem Atemzug wieder mehr zu sich kam.
»Tiefschlag, Doktor«, sagte er rasch mit freudloser Stimme, um seine Gefühle im Zaum zu halten. »Ich bezweifle, dass man Ihnen das in der gefühlsduseligen Doktorausbildung beigebracht hat.« Er beugte sich leicht vor, wobei ein Muskel an seinem Kiefer zuckte, als er die Zähne aufeinanderbiss. »Wie wär’s, wenn Sie mich ins Krankenhaus bringen würden, damit ich meine Schwester identifiziere, und wir sind quitt?«
3
Eigentlich wäre Docia mit einem tiefen Atemzug erwacht, doch der Tubus in ihrer Luftröhre spielte nicht mit. Sie würgte, wollte sich übergeben, ruderte schwach mit den Armen und versuchte irgendwie zu atmen. Außerdem musste sie dringend pinkeln.
»Docia!«
Ein plätscherndes Geräusch auf dem Boden war zu hören, und dann blickte sie auf einmal in Jacksons Gesicht, das furchtbar blass war und dem man den Stress sofort ansah. Doch sie konnte sich auf solche Einzelheiten nicht richtig konzentrieren, weil sie am Ersticken war.
Rasch war ein Schwarm von Leuten über ihr, Krankenschwestern und Ärzte nach der Kleidung und den beruhigenden Dingen, die sie sagten, zu urteilen. Doch das einzig Tröstliche war Jacksons vertrautes Gesicht. Sie hatten versucht, ihn auf den Flur zu schicken, doch er hatte darum gekämpft, zu bleiben, und anscheinend war er ihre geringste Sorge, also achteten sie nicht auf ihn, sondern konzentrierten sich auf sie.
Schließlich wurde ihr der schreckliche Tubus aus dem Hals gezogen, und sie würgte und schnappte keuchend nach Luft, sodass ihre schwer strapazierten Lungen brannten wie Feuer. Irgendein Dummkopf befahl ihr die ganze Zeit zu atmen, als hätte sie irgendeine Wahl. Als wäre sie darauf gar nicht gekommen.
Sie hörte Jackson ungläubig lachen und wurde sich dann bewusst, dass es ihr gelungen war, so etwas wie »Fick dich ins Knie« zu der Krankenschwester zu sagen oder wer auch immer da auf sie einredete.
Obwohl es guttat, erschrak sie über sich selbst, als sie es laut aussprach, anstatt es für sich zu behalten, wie sie es normalerweise tat. Wenn sie nicht so dringend Luft gebraucht hätte, hätte sie vielleicht die Hand vor den Mund geschlagen. Doch wegen Jacksons Lachen und weil die Krankenschwester nun tatsächlich verstummt war, hielt sich ihr schlechtes Gewissen in Grenzen.
Schließlich hörte das Würgen auf, und sie konnte wieder atmen. Anscheinend so weit, dass sich das medizinische Personal zurückzog. Dann war Jackson auf einmal über ihr und umarmte sie gleichzeitig so behutsam und so fest wie möglich.
»Oh mein Gott, Sissy, wegen dir bin ich gerade um fünfzig Jahre gealtert«, krächzte er an ihrem Ohr, als würde er ihr ein furchtbares Geheimnis erzählen. Seine Verzweiflung war klar und kalt, und seine Erleichterung angenehm und rührend. Falls sie irgendeinen Zweifel an der Liebe ihres Bruders gehabt hatte, war der in diesem Moment ausgeräumt worden. »Es hieß, du seist tot. Drei Stunden und siebenundzwanzig Minuten lang dachte ich, du wärst tot, und das waren die schlimmsten dreieinhalb Stunden meines Lebens.«
Docias Augen füllten sich mit Tränen, als sie spürte, wie ihr Bruder litt, und als sie sich daran erinnerte, wie sie ins Wasser gefallen war und an ihn gedacht hatte. Wie sie gehofft hatte, dass er nicht auf einer seiner Streifenfahrten ihre Leiche am Ufer finden würde. Und sie hatte die seltsame Gewissheit, dass er davor bewahrt worden war. Aber dennoch hatte er ihren Verlust durchlitten, obwohl sie das scheinbar Unmögliche überlebt hatte.
»Ich bin hier«, flüsterte sie, nicht sicher, ob ihre geschundenen Lungen und ihr Hals mitmachten, doch trotzdem entschlossen, ihm diese Gewissheit zu geben.
»Damit hast du verdammt recht«, sagte er barsch und löste sich von ihr, um ihr Gesicht mit den Händen zu umschließen und sie ein wenig zu schütteln. »Wir Waverlys sind aus hartem Holz geschnitzt. Du hast es dem Fluss gezeigt.«
»Erst hat er es mir gezeigt«, krächzte sie.
»Unwichtig«, sagte er mit einem Grinsen und zuckte die Schultern. »Man kann einen Waverly zwar niederschlagen, doch er wird immer wieder aufstehen.«
Sie nickte zustimmend. »Doch jetzt muss dieser Waverly ganz dringend pinkeln. Und könntest du die Vorhänge zuziehen? Die Sonne sticht wahnsinnig.«
Jackson blickte an der Seite des Bettes hinab, als er aufstand, um ihrer Bitte nachzukommen. »Du hast einen Katheter«, sagte er und trat ein wenig zurück, sodass sie den Beutel, der teilweise mit Urin gefüllt war, sehen konnte, bevor er die Vorhänge schloss, um das Sonnenlicht auszusperren.
»Igitt! Sag ihnen, dass sie ihn herausnehmen sollen!«
»Dieser Schlag auf den Kopf hat dich ziemlich herrisch gemacht«, stellte er trocken fest.
»Ich war schon immer herrisch«, entgegnete sie.
»Warst du nicht.«
»War ich doch! Und jetzt ruf die Krankenschwester!«
Jackson grinste und ging von ihr weg, wenn auch sehr langsam, so als hätte er Angst, sie aus den Augen zu lassen. Er ging zögernd zur Tür, doch schließlich trat er hinaus, um zu tun, worum sie ihn gebeten hatte. Erst jetzt bemerkte Docia, dass ein Polizist in Uniform vor ihrer Tür stand. Jackson war in Zivil, weshalb sie sich fragte, wie lange sie bewusstlos gewesen war und was genau eigentlich passiert war.
Dann erinnerte sie sich wieder an die kräftigen Hände, die sie gepackt und über das Brückengeländer gestoßen hatten. Sie erinnerte sich in aller Klarheit daran, wie die Funken gesprüht hatten, als das Fahrzeug versucht hatte, sie gegen den Stein zu quetschen.
»Was zum Teufel geht hier vor?«, fragte sie ihren Bruder, als er zurückkam. »Was ist passiert? Und warum?«
»Wirklich gute Fragen«, sagte er grimmig, wobei er anscheinend sofort wusste, worauf sie sich bezog. »Woran kannst du dich denn erinnern?«
Sie erzählte es ihm und war überrascht über die vielen Einzelheiten, an die sie sich erinnerte. Zumindest erzählte sie ihm alles, was geschehen war, bevor sie auf dem Wasser aufschlug. Die verrückte Nahtoderfahrung, die sie gemacht hatte, behielt sie für sich. Wahrscheinlich war das sowieso nur eine von einem Hirnschaden verursachte Halluzination. Außerdem kam die Krankenschwester herein, um ihr wieder die Kontrolle über ihre Blase zurückzugeben, und scheuchte Jackson hinaus. Unter normalen Umständen hätte sie die Gelegenheit genutzt, ihren Bruder wegen seiner Empfindlichkeit zu piesacken, was die Privatsphäre zwischen Bruder und Schwester betraf … Doch sie hatten beide zu viel durchgemacht, um rasch wieder in alte Muster zurückzufallen.
Nachdem er aus dem Raum geflogen war, stand Jackson sich auf dem Flur die Beine in den Bauch. Es hätte ihm nichts ausgemacht, seiner Schwester den Hintern abzuwischen, während sie auf dem Weg der Besserung war. Er würde alles tun, wenn sie nur lebte und wieder gesund wurde.
Doch dann dachte er an den Verrückten, der sich einen Spaß daraus gemacht hatte, sie von der Straße zu scheuchen und, damit nicht genug, sie dann auch noch von der Brücke zu stoßen. Obwohl Überwachungskameras gezeigt hatten, dass beide Nummernschilder fehlten, hatten ihm die Detectives versichert, dass ein Fahrzeug mit einer solchen Schramme an der Seite leicht zu finden war. Jetzt, wo Docia wach und auf dem Weg der Besserung war, würde er dafür sorgen, dass niemand es mehr wagte, sie erneut von dieser Straße zu stoßen.
»Tolly.«
»Mmm?« Der uniformierte Cop hatte den Auftrag, auf Docia aufzupassen, weil es sich aus polizeilicher Sicht um einen Mordversuch handelte. Die Detectives glaubten, dass es sich um einen perversen Streich handelte, doch für den Fall, dass es sich anders verhielt, und weil Docia für die halbe Polizei von Saugerties wie eine Schwester war, hatten sie ein Auge auf sie.
»Ich gehe in ein paar Minuten«, sagte Jackson.
»Keine Sorge. Ich lasse sie nicht aus den Augen.«
»Besser, du gehst jetzt pinkeln, falls du musst«, sagte Jackson streng, während er auf den Kaffee in der Hand des Mannes blickte.
Tolly lächelte ihn nachsichtig an, stellte den Becher ab und begab sich zur Toilette.
Docia sog die klare kalte Luft ein. Ein Wintersturm zog auf, sie konnte ihn um sich herum spüren. Es war erst drei Tage her, dass sie auf der Intensivstation erwacht war, und Jackson hatte sie in den drei Tagen kaum aus den Augen gelassen, und wenn, dann hatte er ihr Officer Tolliver wie einen tollwütigen Pitbull auf den Hals gehetzt. Der Mann saß im Flur, und sie hätte schwören können, dass er nicht einmal blinzelte. Er blätterte auch nicht in einer Zeitschrift, um sich die Zeit zu vertreiben. Er saß einfach nur in höchster Alarmbereitschaft da und beäugte jeden, der den Gang entlangging.
Ein bisschen unheimlich war das schon.
Und trotzdem beruhigend.
Zur Überraschung aller war sie dann vorzeitig entlassen worden, und Jackson hatte sie nach Hause gebracht. Tolliver nahm seinen Dienst wieder auf, und Jackson kümmerte sich um sie. Doch sie wollte nicht bloß herumsitzen. Es hatte einer halbstündigen Diskussion bedurft, bis er sie so lange allein ließ, dass er ein paar Lebensmittel für ihren leeren Kühlschrank besorgen konnte. Sie freute sich über die Zeit, die sie für sich allein hatte, denn sie brauchte Normalität. Und frische Luft. Und einen Fußmarsch. Obwohl ihr Wagen repariert in der Einfahrt stand, wollte sie zu Fuß gehen. Obwohl es Nacht war und der Sturm den klaren dunklen Himmel und alle seine funkelnden Sterne verdeckte, wollte sie draußen sein. Sie stand auf dem Gehsteig und starrte auf ihre Veranda … ihre geschützte Veranda … und rümpfte die Nase. Sie würde nicht zulassen, dass zwei abartige Sadisten ihre Liebe zu der Stadt zerstörten, in der sie aufgewachsen war.
Doch sie schaffte es nicht, sich aus der näheren Umgebung ihres kleinen Häuschens und der sicheren kleinen Veranda zu entfernen.
Das reicht! Du bist stark. Du kannst das! Basta!
Seit dem Unfall ertappte sie sich dabei, wie sie mit dieser schrillen, selbstsicheren Stimme zu sich sprach. Die war zuversichtlicher und willensstärker, als sie sich selbst fühlte, und sie schätzte deren Sturheit. Die verlieh ihr Rückgrat, wenn sie es am meisten brauchte.
Sie ermöglichte es ihr, einen Fuß vor den anderen zu setzen, den vertrauten Gehweg ihres Blocks entlangzugehen. Dabei richtete sie ihr Gesicht unverwandt zum Himmel, als würde die Sonne scheinen und als könnte sie die Wärme und das Licht in sich aufnehmen. Nur dass die Sonne nicht schien. Es war eine angenehme Dunkelheit und eine frische Kälte, und sie wartete darauf, dass diese schwarzgrauen Wolken kalte Flocken auf sie herabrieseln ließen. Docia genoss diesen Spaziergang, jeden einzelnen Schritt, was, wie ihr klar wurde, daran lag, dass sie eigentlich gar nicht hier sein sollte. Sämtliche Ärzte und Krankenschwestern … einfach alle, die mit ihr zu tun gehabt hatten, verstanden nicht, wie sie hatte überleben können. Sie waren verwundert darüber, wie sie, die dem Tod so nah war und … eine zweite Chance bekommen hatte. Wobei sie wusste, dass jede Kleinigkeit dieses Spaziergangs sie auf eindringliche und wunderschöne Weise berührte. Der raue Asphalt unter ihren Sneakers, das entfernte Bellen eines Hundes, das eher fröhlich als bedrohlich klang. … das Rascheln ihres dicken Wintermantels, der nur ein armseliger Ersatz war für denjenigen, den sie zu Beginn des Winters wieder hervorgeholt hatte und der von den Rettungssanitätern aufgeschnitten und entsorgt worden war. Sie hatten es vorgezogen, ihr das Leben zu retten, und sie war damit einverstanden.
Docia konnte den Frost beinahe spüren, der sich auf jedem Grashalm um sie herum bildete. Die Kälte verursachte ihrem geschundenen Körper Schmerzen, doch auch das betrachtete sie als gutes Zeichen dafür, dass sie am Leben war. Sie hatte nichts dagegen einzuwenden. Nicht heute jedenfalls. Vielleicht würde sie mit der Zeit all die Kleinigkeiten wieder als selbstverständlich hinnehmen, und sie würde sich zu Murren und Klagen über kalte und nasse Tage hinreißen lassen; doch vielleicht auch nicht. Zumindest hoffte sie das. Sie hoffte, dass sie nicht einmal die Fähigkeit zu atmen je wieder als selbstverständlich betrachten würde.
Vielleicht war es dieses geschärfte Bewusstsein für alles um sie herum, weshalb sie spürte, dass jemand sie beschattete. Zuerst tat sie es ab, als im Licht der vereinzelten Straßenlaternen nichts zu erkennen war, doch nur Minuten später wurde sie übermannt von einem Prickeln in ihrem Nacken, das sie zwang, auf ihren Instinkt zu hören.
Sie hätte es sich wohl nicht so deutlich anmerken lassen sollen, sie hätte wohl lässiger und cleverer sein sollen, wie die tolle Heldin in einem Spionagefilm, die immer perfekt frisiert und modisch gekleidet war, während sie es mit einem ebenso geheimnisvollen und schicken Helden zu tun bekam. Doch sie war noch immer übel zugerichtet und trug deshalb eine dicke Jacke, die schon seit zwei Jahren aus der Mode war, also war charmant und cool wirklich Zeitverschwendung. Sie verrenkte sich den Hals auf der Suche nach dem, was bei ihr diese überdeutliche Wahrnehmung verursachte. Vielleicht war da ja gar niemand. Vielleicht hatte ja ihr paranoider Bruder auf sie abgefärbt. Oder vielleicht waren es diese bescheuerten Arschlöcher, die es lustig fanden, Mädchen von Brücken zu stoßen, und die nun hinter ihr her waren, um sie zur nächsten Brücke zu schleifen und es noch einmal zu versuchen.
Bei diesem letzten Gedanken atmete sie schwer, und sie verspürte eine leichte Panik und fühlte sich sehr einsam in der kalten dunklen Nacht. Alles, was eben noch so tröstlich gewesen war, erschien auf einmal waghalsig und höchst gefährlich, und sie bereute es, ihr sicheres Zuhause verlassen zu haben. Ihr Herz hämmerte neben ihren empfindlichen Lungen. Das erinnerte sie daran, wie geschwächt und verletzlich sie noch immer war … jetzt und bereits vor der ganzen Sache. Mit dem Unterschied, dass sie sich dessen zuvor überhaupt nicht bewusst gewesen war.
Sie machte kehrt. Ihr kleiner Spaziergang hatte sie nur anderthalb Blocks weit geführt. Zu weit. Was, wenn …?