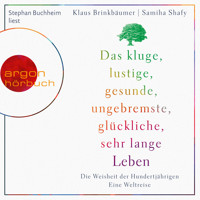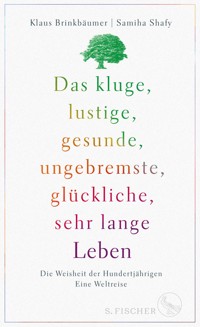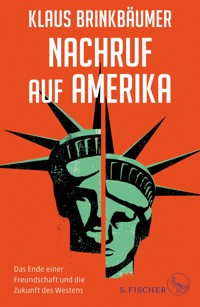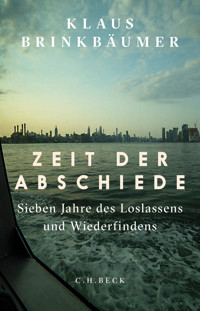
20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Da ist diese Zeit im Leben, in der sich die Abschiede häufen: von Träumen, Gewohnheiten und Gewissheiten, von Vertrauten, Partnerinnen, Freunden – und von jenen Menschen, die uns geprägt und am längsten begleitet haben, unseren Eltern. In dieser Lebensphase löst sich die Zuversicht auf, dass alles weitergehen werde wie bisher.
«Am Schreibtisch meines Vaters blicke ich mich um. Hinter mir die Lateinbücher, Cicero, Vergil, Cäsar: Der Gallische Krieg. Blicke ich nach vorne, sehe ich Fotos von Jutta und mir. Ich sehe den Spruch an der Wand, den er liebte: Wenn die Kinder klein sind, gib ihnen ein Nest; sind sie groß, gib ihnen Flügel. Und ich denke zurück und nach vorn und verstehe: Trauer gehört zum Leben, weil Abschied zum Leben gehört. Beides ist Teil der menschlichen Erfahrung, es gibt kein Leben ohne Abschied und Trauer. Sei dankbar, für alles, für die gesamte menschliche Erfahrung, lasse sie also zu, und nimm dir Zeit, und nimm die Abschiede und die Trauer wahr und nimm sie an, denn nur so kannst du das ganze Leben wahrnehmen und annehmen und leben … Trauer ist nichts Schlimmes, Trauer ist unsere Antwort auf etwas Schlimmes.»
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Titel
KLAUS BRINKBÄUMER
ZEIT DER ABSCHIEDE
C.H.BECK
Übersicht
Cover
Inhalt
Textbeginn
Inhalt
Titel
Inhalt
Widmung
Motto
I. Der Himmel über New York
II. Die Zeit, die bleibt
Dank
Editorische Notiz
Referenzen
Zum Buch
Vita
Impressum
Widmung
Für meine Eltern. Und für Jutta, Samiha, Cora und Alexej.
Motto
I didn’t waste my time on things I didn’t love.
Patti Smith
I woke up this morning to an empty sky.
Bruce Springsteen
I.
Der Himmel über New York
Warum hat mich mein Vater nicht angerufen, in diesem einen Augenblick, der wichtiger war als alle anderen Augenblicke? Wollte er diesen letzten Montag für sich haben? Diese Stunden, den letzten Nachmittag, den Abschied, diesen letzten Moment?
Wollte er mir zeigen, wer die Kontrolle hatte, immer noch, wer die Macht hatte, wenn es galt?
Dabei hatte ich ihn darum gebeten, am Freitag noch, 48 Stunden zuvor: Bitte sag mir Bescheid, wenn es irgendwelche Nachrichten gibt, ich komme so schnell wie möglich. Ein kurzer Anruf, 30 Sekunden nur, mehr hätte es nicht gebraucht. Ich war drei, vier Stunden entfernt in Hamburg, wäre also um 15 oder 16 Uhr in Hiltrup gewesen, rechtzeitig, wenn man das so sagen kann, ich hätte ihre Hand halten können.
Aber er rief mich nicht an.
Und wir fuhren zurück nach Leipzig, wo wir lebten, und nicht nach Hiltrup, wo die Eltern lebten.
Meine Mutter Anne Brinkbäumer, am 3. September 1939 geboren, starb am 3. Oktober 2022 in Hiltrup bei Münster. Es war 18.10 Uhr, und ich war nicht dort, obwohl ich hatte dort sein wollen.
Ich hätte dort sein können.
Mein Vater, der um 12 Uhr mittags von der Pflegerin erreicht worden war und dem gesagt worden war, dass es schlecht stehe, rief nicht an.
«Ich habe dich doch am Abend angerufen, als die Mami gegangen ist.»
Das sagt der Vater gekränkt und versteht nicht, was ich ihm sagen will: Warum hast du mich nicht sofort benachrichtigt?
«Aber ich bin doch zur Mama gefahren, habe doch bei ihr gesessen, habe doch ihre Hand gehalten. Der Pastor war auch da, hat gefragt, ob er sie segnen dürfe, dann saßen wir zu zweit bei ihr, und ich habe doch gesungen und gesummt, und sie war ganz still. Dann hat sie zweimal gestöhnt, heftig ausgeatmet, und so ist sie gegangen.»
Niemand kann besser aneinander vorbeireden als Väter und Söhne.
Die Wochen danach rauschten dahin. Ich verbrachte Tage mit Alexej, meinem Sohn, der toben will, rennen, klettern, der Nein zu sagen gelernt hat und wochenlang nichts als immer nur Nein sagt.
Wir verfassten die Todesanzeige, schrieben oben rechts: «Die Vernunft sagt: Der Tod ist Teil des Lebens und manchmal kommt er sogar als Erlösung.» Wir blätterten durch einen Katalog und wählten die bläulich silbrige Urne aus, sagten: «Die würde sie mögen», aber wer mag schon die eigene Urne?
In der Kirche, in der ich als Grundschüler Messdiener gewesen war, sangen und beteten wir, es war ein Donnerstag, 11 Uhr, drei Wochen nach ihrem Tod. Ich staunte, weil die Marienkirche verändert war, der Altar näher an uns herangerückt, der einstmals riesige Innenraum künstlich verengt. Mein letzter Besuch in dieser Kirche lag über 40 Jahre zurück, damals war ich vom österlichen Weihrauch ohnmächtig geworden und auf der harten Kirchenbank liegend wieder aufgewacht. Es war ein Abschied gewesen: vom römisch-katholischen Universum meiner Kindheit.
Auf dem Friedhof, am Grab, konnte ich nicht hinabsehen. Ich schaufelte etwas Erde hinein, ließ weiße Blütenblätter fallen, hielt meine Tochter, meine Ehefrau, meine Schwester, meinen Vater und wurde gehalten, und niemand hier oben war allein.
Trauer nimmt die Trauernden gefangen und verunsichert die Nichttrauernden, weshalb sie aus deren Sicht gezähmt und überwunden werden sollte. Trauernde können seltsame Vereinigungen formen, es ist «etwas Beklemmendes um den Totenkult von anderen», wie Elias Canetti schreibt. Wir fuhren zu dem Café an der Westfalenstraße, die von Hiltrup geradewegs nach Münster führt. «In die Stadt» sagten wir damals, als ich ein Hiltruper Kind und Münster die ferne, mondäne Welt und meine Mutter eine junge Frau war. Wir aßen Suppe, aßen Pflaumen- und Apfelkuchen, und ich redete erstmals seit Jahren mit meinem Onkel, ihrem Bruder, dann setzte ich mich zu meinen Cousins und Cousinen, die mir fehlen und von denen ich wenig hören werde bis zur nächsten Beerdigung.
Und während all dieser Wochen war ich wütend auf meinen Vater, gekränkt.
Ich sagte es ihm: Wie konntest du nur.
Und er sagte mir: «Ich war doch bei ihr.»
Traurig blickte er mich an.
Ich dachte daran, dass Telefonieren bei uns immer ein Thema gewesen war. Früher, wenn meine Schwester Jutta stundenlang mit ihrer besten Freundin Katrin telefonierte, die 200 Meter entfernt wohnte, oder wenn ich stundenlang mit Christiane oder mit Stefan über Christiane reden musste – dann verschwendeten wir telefonierend das Geld des Vaters, so sah er es. Später dann, als Jutta und ich in Frankreich und den USA lebten, waren die Telefongespräche kurz, weil der Vater sparen wollte. Er rief so gut wie nie an. Meine Mutter rief ihre Kinder an, die Kinder riefen ihre Eltern an, der Vater kam manchmal dazu und rief seiner Ehefrau manchmal «grüß’ schön» aus dem Wohnzimmer zu.
Es dauerte mehrere Wochen, bis ich mich in jenen Sonntag aus seiner Perspektive hineindenken konnte. Der Anruf aus dem Heim. Der Vater steht im Flur, den alten Hörer am Ohr, und der Vater ist so wackelig auf den Beinen, aber er muss sich jetzt schnell anziehen, wie kommt er bloß schnell genug zu seiner Frau, wird er zu spät sein, und was nimmt sie wahr, weiß sie, dass sie heute sterben wird? Ist es möglich, dass mein Vater in diesen Minuten gar nicht daran gedacht hat, mich anzurufen, nicht jetzt, nicht sofort?
Es dauerte deshalb lange, viel zu lange, bis ich verstand, was ich da eigentlich tat: Ich lenkte mich mit meinen Vorwürfen ab, schon wieder. Ich belog mich, auch das: Ich hätte seinen Anruf ja durchaus offensiver einfordern können, ich hätte auch ohne diesen Anruf nach Münster fahren können, ich wusste, dass es ihr nicht gut ging.
So aber war das, wenn ich trauerte: Ich trauerte nur ein bisschen, nicht ganz und gar.
Ich betrachtete, bedachte und verlängerte stattdessen den Konflikt mit meinem Vater – statt mich auf das Eigentliche einzulassen.
Denn wenn unsere Mutter stirbt, was zählt dann, worum geht es dann?
Nur um sie. Um ihr Leben. Um das Ende ihres Lebens.
Es geht nur um die Trauer um unsere Mutter.
Es ist ein eisig windiger Winterabend in New York, als ich verstehe, wo meine Gedanken in all diesen Wochen waren, es ist der Moment, als ich in der 23. Straße in Richtung Westen zum Stehen komme, vom Rad steige und mich nicht mehr bewegen kann. Mich nicht mehr bewegen will. Es gibt im Leben ja manchmal diese Momente des plötzlichen Begreifens, in denen ein Weitermachen unmöglich wird, weil es jetzt Dringlicheres gibt. Sekunden stiller Eindeutigkeit: Darum bin ich hier, darum geht es.
Meine Mutter ist tot.
Die Ehefrau meines Vaters ist tot.
Wir trauern beide.
Wir trauern nicht gegeneinander.
Unsere Familie existiert nicht mehr, nicht mehr so, wie sie immer war: Mutter, Vater, Jutta, ich. Ob ich dabei war, als sie starb, ist nicht wichtig, denn sie war nicht allein – das ist wichtig.
Und ich hatte ein paar Tage zuvor Abschied von meiner Mutter genommen – auch das ist wichtig.
Und nun bin ich hier, um all die schmerzhaften Gedanken zuzulassen, um Zeit zu haben für diesen Abschied. Ich bin im fünften Jahr der Abschiede, sieben Jahre werden es am Ende sein. Es ist der 26. November 2022, 15.45 Uhr.
Heute Mittag bin ich gelandet, ich hatte Samiha, meiner Ehefrau, gesagt, dass ich Sehnsucht nach New York habe, hinfliegen und dort sein will, einfach weil ein Sehnsuchtsort hin und wieder aufgesucht werden muss. Mit Trauer, mit Abschied hatte ich diesen Wunsch vor der Reise nicht in Verbindung gebracht. New York war ein Lebensort für mich, kein Trauerort, ein Glücksort zweifellos.
Meine Definition von Glück hat sich über die Jahre verändert. Glück war einstmals: erwiderte Liebe, ein vom seitlichen Wind gefülltes Segel, Reisen, ein Morgen in New York oder der Aufstieg des FC St. Pauli. Glück ist heute: wenn die, die ich liebe, am Leben sind. Die in unserem Leben am meisten unerwiderte Liebe sei die Liebe zu unseren Gestorbenen, hat Olga Martynova geschrieben.
Manche Tage nach dem Tod meiner Mutter verbrachte ich bei meiner Arbeit in einem Geflecht aus Sendern, das die heftigste Krise seiner Geschichte erlebte, sich reformieren wollte und darum immer neue Arbeitsgruppen erfand, als deren Erfolg irgendwann, wenn alle heute Beteiligten tot sein werden, die Abschaffung ebendieser Arbeitsgruppen gelten wird. Kafka kannte die Arbeitsgemeinschaft öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten.
Andere Tage verbrachte ich in Hiltrup bei meinem Vater. Das Zimmer meiner Mutter im Heim musste ich ausräumen, ihre Cremes, ihre Pullover, die geliebten Kaschmir-Schals, die Fotos ihrer Enkel, am Ende kaum noch betrachtet, denn wenn meine Mutter die Augen öffnete, war das, was sie sah, die Zimmerdecke.
Einmal weinte meine Mutter, beglückt, das hoffte ich, als ich ihr Zimmer betrat. Es war ein Moment des Erkennens, ich war mir sicher. Ich setzte mich zu ihr, umarmte sie, küsste sie, und sie weinte, weinte dann nicht mehr, und nach zwei, drei Minuten war sie nicht mehr da, blickte zur Zimmerdecke. Ich hatte Eis mitgebracht für Alexej und mich. Der Sohn blickte aus dem Fenster auf die Marktallee hinab, Hiltrups Broadway, denn er liebt es, den Autos zuzusehen, den Bussen, Lastwagen, Baggern. Ein wenig von dem Eis tupfte ich auf die Lippen meiner Mutter, die eigentlich nicht mehr essen wollte oder konnte. Ihre Zunge leckte sofort das Eis weg, Pistazie. Noch einmal. Und noch einmal. Ein Lächeln mit geschlossenen Augen, zumindest sah ich eines. Diese Minuten des Glücks werden ewig unser Abschied sein.
Es gibt keine Ausnahmen, jeder Mensch kennt Abschiede wie diesen, oder, wenn er bislang Glück hatte, wird er die Brüche, die Trennungen, die Trauer irgendwann kennenlernen, erlebt vielleicht heute einen sanften Ausklang, doch schon morgen einen harten Schlusspunkt. Es gibt nichts, das nicht endet, und darum gibt es niemanden, dem das Abschiednehmen erspart bliebe. Keine Trauerzeit ist exakt wie die andere, aber für mich ballen sich die Abschiede in den sieben Jahren dieses Berichts: den ersten fünf Jahren bis zum Tod meiner Mutter und meiner New Yorker Woche, in der ich die erste Fassung dieses Textes schreibe; dann folgen zwei weitere Jahre mit dem gleichfalls trauernden alten Vater. Von diesen sieben Jahren des Abschieds möchte ich hier erzählen, den ersten fünf im ersten Teil und den zwei folgenden im zweiten, denn die sieben Jahre des Loslassens und Wiederfindens fühlen sich für mich wie ein Block an, wie ein abgeschlossener Zeitraum mit Anfang und Ende, obwohl mir klar ist, dass damit die Abschiede meines Lebens nicht enden werden. Es wird in dieser Geschichte mitunter hin und her gehen, vor und zurück, weil das trauernde Hirn so funktioniert: Bilder, Zeiten, Orte vermischen sich, lange Zurückliegendes verschwimmt mit gerade Geschehendem, und die alte, Hilfe suchende Mutter wird übergangslos zur jungen, abenteuergierigen Frau. Das tut gut, das hilft, weil es die Schmerzen lindert, denn ich habe nicht ausschließlich die Bilder dieses Abschieds und der letzten Wochen im Kopf, sondern weiß auch jetzt noch, dass meine Mutter beides und noch viel mehr war, alles zu seiner Zeit.
Die Wochen zogen vorbei, und ich wollte die Trauer zulassen. Tat es auch, ein bisschen: erzählte Freunden von meiner Mutter, sprach mit meiner Tochter über ihre Omi, dachte, dass ich es nicht schaffen würde, den Text fertigzuschreiben, den ich auf der Beerdigung vorlesen wollte, nahm mir einen halben Sonntag und schrieb den Text.
Olga Martynova hat es so ähnlich erfahren: In jenem Zustand, den der Text erfassen und darstellen möchte, kann man nicht schreiben; und wenn man dann schreiben kann, besteht schon wieder eine Distanz zu eben jenem Zustand, um den es aber geht. Martynova trauert nach dem Tod ihres Ehemanns, des Dichters Oleg Jurjew. 37 Jahre lang waren Dichterin und Dichter ein Paar, in Leningrad haben sie einander kennengelernt, nach Frankfurt zogen sie gemeinsam. Beide schrieben auf Russisch und auf Deutsch, übersetzten auch, und 2018, nach Jurjews Tod, begann Martynova ihr Gespräch über die Trauer.
Und ich tat es doch nicht: trauern. Wenn ich das, was ich nicht zurückholen kann, gar nicht erst vermissen will, ist dies meine Methode: Selbstablenkung durch einen Konflikt mit dem Vater, ansonsten weitermachen, keine Stille zulassen, keine unbefristete Ruhe. Trauer lässt sich nicht in einen Stundenplan einfügen, doch exakt das versuchte ich. Ich räumte ihr ein paar Stunden frei und weiß doch: Trauer lässt sich nicht zähmen, nicht steuern, sie lässt sich auch nicht kategorisieren: dort eine normale Trauer über eine gestorbene Mutter, die halt dazugehört und die wir irgendwann alle erleben, und hier eine existenzielle Trauer, über den Tod der Geliebten oder den Tod der Kinder, unaushaltbare Trauer, die glücklicherweise nicht zu jedem Leben gehört und so unwahrscheinlich ist, dass wir sie nicht einplanen. Es ist anders, Trauer macht, was sie will: Trauer kommt heute ganz sanft und morgen gar nicht und übermorgen mit hundertfacher Wucht.
Meine Mutter lebte nie in der Welt der sozialen Medien. Es gibt kein Facebook-Profil, es gab keine Inszenierung ihrer selbst, es gibt kein digitales Fortleben. Sie hat auch keinen Abschiedsbrief hinterlassen, nur ein Testament, das von 1996 ist, und eine Patientinnenverfügung von 2010. Sie hat keine Tonaufnahme für den jüngsten Enkel erstellt, wir hatten auch keine letzten Gespräche. Sie war noch da, merkte, dass ihr Gedächtnis schwächer wurde, und dann ging alles viel zu schnell. Uns alle überrollte diese Vehemenz, mit diesem Tempo hatten wir ihr Verschwinden nicht vorhergesehen.
Als ich nach New York fliege, denke ich noch, dass es eine ganz normale Heimkehr an meinen liebsten Ort der Welt sein wird, etwas sentimental wie immer, etwas romantisch wie immer, etwas überraschend und neu und vertraut wie immer, eine Woche mit dem besten Freund, mit Eishockey und Basketball und Büchern und Theater und Kino und irgendeiner Party und dem ersten Bier in der Old Town Bar.
In der New York Times aber, im Flugzeug, lese ich von Anderson Coopers Podcast All there is. Cooper, einst blonder, nun weißhaariger CNN-Moderator, gilt als Mann, der nie das Gesicht verzieht: Das Leben ist ernst, das Nachrichtengeschäft ebenso. Nun allerdings erzählt Anderson Cooper von Verlust und Trauer und vom Abschiednehmen. Er begann in sein Smartphone zu sprechen, während er die Wohnung seiner verstorbenen Mutter Gloria Vanderbilt aufräumte und sich durch all die Kisten und Alben und Tagebücher kämpfte. Schillernde Fundstücke: Ein glühend Liebender schrieb vor über einem halben Jahrhundert an Gloria, er denke intensiver an sie, als er sollte. «F. S.» war sein Kürzel, F. S. steht für Frank Sinatra. Traurige Fundstücke auch: Anderson entdeckt im Keller all das, was sein Vater zurückließ, der starb, als Anderson zehn Jahre alt war. Und Anderson findet Briefe und Notizen seines großen Bruders Carter, der sich umbrachte, als Carter 23 und Anderson 21 Jahre alt war. Carter sprang vom Balkon in der Wohnung seiner Mutter, die ihn zu stoppen versuchte. Tatsächlich hielt Carter noch inne, und die Mutter schrie, doch vergeblich.
Ich lese gebannt, glaube mich verstanden. Wie einsam die Erkenntnis macht, der Letzte zu sein, der eine Familiengeschichte erzählen kann – weil alle anderen, die damals dabei waren, nicht mehr da sind. Wie befreiend jener Tag war, an dem Anderson Cooper älter war, als sein Vater je wurde – Anderson hatte fest mit dem eigenen frühen Tod gerechnet. Wie wunderzart das Glucksen, das Lachen der eigenen Kinder inmitten ihres Spiels – und wie gnadenlos, dass auch dieses beginnende Leben enden wird.
Und was wollen wir im Leben am allerwenigsten sein? Einsam. Die Einsamkeit der Trauer schockiert und lähmt uns.
Für sieben Tage werde ich diesmal hier sein. Ich beginne schon in der U-Bahn vom Flughafen nach Manhattan diesen Podcast zu hören, höre dann weiter während meiner ersten Wanderungen von Park zu Park, von Ost nach West nach Süd nach Nord, und ich fühle das, was ich da höre, und so beginnt es, und um 15.45 Uhr an diesem 26. November in diesem fünften Jahr der Abschiede fahre ich gerade mit dem Rad durch die 23. Straße nach Westen, bin in der zweiten Folge, höre fünf Minuten lang zu, steige vom Rad, setze mich auf eine Bank und weine, weil meine Mutter gestorben ist, und verstehe, warum ich hergekommen bin.
Verlust und Abschied gehören zum Menschsein. Es gibt keinen Menschen, der frei davon ist; zu einem kompletten, einem wahren Leben gehören die Dinge, die wir nicht ändern können. Wir im Westen wollen Trauer eher besiegen, auch das höre ich auf meinen Streifzügen, wir wollen die Trauer hinter uns lassen oder gar nicht erst zur Kenntnis nehmen – ein Irrweg. Und ja, wir glauben auch, dass Aufregung, Unterhaltung der Weg zu wahrem Gefühl sei – ein Irrglaube. Wenn wir Trauer zulassen und über Trauer sprechen, kann aus der Höhle, in der wir heute im Dunkel versinken, morgen eine Durchgangshöhle mit vielen Ausgängen werden, und am Ende aller Ausgänge ist Licht. Unser heutiges Gefühl wird nicht das morgige sein, es wird sich verändern, und draußen im Licht sind wir vielleicht ein anderer Mensch. Empathischer? Neugieriger? Erreichbar?
Trauer ist Verlassensein. In früheren Jahrhunderten war der Tod präsent, weil er früher kam, häufiger kam. Heute ist der Tod verbannt, gleichsam verboten, etwas, das wir besiegen wollen, so schnell wie möglich. Aber das geht ja nicht. Wir sollten ihn erspüren und zulassen und wahrnehmen, und wir sollten uns anderen anvertrauen, sollten uns mitteilen und sagen, wie sehr Trauer schmerzt. Und wir sollten andere fragen, andere hören, denn es wird uns allen passieren, wenn wir das Glück haben, lange genug zu leben.
In Gloria Vanderbilts Schlafzimmer fand Anderson Cooper ein Osterei, das sein Bruder Carter für die Mama bemalt hatte, daneben einen Zettel, Love you, daneben einen Kalender, seit über 30 Jahren eingefroren auf den 22. Juli 1988, denn dies war der Tag, an dem Carter vom Balkon sprang wie ein Athlet und sich an der Mauer noch festhielt und einem Flugzeug nachblickte, oben am New Yorker Himmel, und dann, endlich doch, losließ.
Carter liebte Geschichte, liebte Bücher, war hübscher und klüger als Anderson, das sagt Anderson. Aber dann sprang Carter, und seine Mutter stand ein paar Meter entfernt, und dieser Gedanke, dass der sanfte, milde Carter dies tun würde, es auf diese Weise tun würde, ist für Anderson Cooper noch heute nicht zu denken, nicht zu verstehen, nicht zu fühlen, nicht zu ertragen. Und manchmal denkt Anderson an jenen anderen Tag im April 1988, als Carter aus Princeton zurück nach New York gekommen war und bereits im Bett lag, das Zimmer ganz dunkel, und sagte, dass er nur müde sei, aber Anderson spürte, dass der Bruder verschüchtert klang, zweifelnd, traurig auch. Es war das einzige Anzeichen, etwas stimmte nicht, etwas passte nicht mehr, aber Anderson verstand es erst im Nachhinein. Anderson war in Washington, als seine Mutter anrief und sagte: «Carter ist vom Balkon gesprungen.»
Und ja, verdammt: Das Leben bekommen wir nicht ohne den Tod, ich weiß das, aber wie reden wir nun also über Trauer? Wie werden wir selbst gehen, wie lassen wir gehen, und wie trauern wir um die, die gegangen sind? Wollen wir lediglich schnell darüber hinwegkommen, vergessen, weitermachen, oder was wollen wir fühlen, woran uns erinnern? Und wie wollen wir sterben, wie denken wir überhaupt über den eigenen Tod nach? Und was lehrt uns all dies, die Trauer und die Gedanken an den eigenen Tod, über das Leben?
Mit all diesen Erfahrungen, nach all den Abschieden: Wie will ich leben? Dass die Lebenszeit, die bleibt, knapp ist, weiß ich nun, ich habe es gesehen und erfahren. Was will ich tun mit der Zeit, die bleibt?
Über sieben Jahre der Abschiede denke ich nach, denn so viele werden es am Ende sein: sieben Trauerjahre, ich kann es an diesem Winterabend noch nicht wissen, aber ich ahne hier in New York bereits, dass diesem fünften, in dem ich in meiner Sehnsuchtsstadt diesen Text beginne, vermutlich weitere Jahre folgen werden. Und über mir der weite, nahe, immer so kraftstrahlende, heute aluminiumblaue Himmel über Manhattan.
Wie müssen, können, wollen wir trauern? Ich sitze in einer Bar in der Nähe der Wall Street mit meinem besten Freund Caner und dessen Lebensgefährtin Kerry zusammen, wir reden über die vergehende Zeit. Kerry musste sich in den vergangenen Wochen quälend langsam von ihrem sterbenden Vater verabschieden. Ausgerechnet bei ihrer Trauerrede habe sie versagt, sagt sie: «Nur Äh und Oh und nichts als Tränen.» Wie geht das: in Momenten der Trauer angemessen zu reagieren? An diesem New Yorker Abend ergreift mein Freund Caner die Hand seiner Partnerin und sagt: «Ich muss auf einer anderen Veranstaltung gewesen sein. Alle um mich herum haben gelacht und geweint. Du hast uns bewegt. Dein Vater hat in deiner Rede gelebt – so wie er war.»
Joan Didion schreibt, dass der Glaube, vom Tag der Beerdigung an werde die Trauer linear abnehmen, naiv sei: Trauer kommt wüst und bleibt, so lange sie will. Trauer ist Unglaube. Trauer bringt uns aus der Fassung. Didion schreibt, dass der Tod bei uns im Westen seit den 1930er Jahren peinlich geworden und darum aus dem Alltag gedrängt worden sei, weil er dem Ideal permanenter Selbstoptimierung widerspreche.
Wie unangemessen banal angesichts dieser Wucht und dieser Konsequenzen: Zwei bereiten das Abendessen vor, einer trinkt Whiskey, die andere macht Salat, zwei Menschen, deren Stimmen jahrzehntelang einander die Tage füllten, reden miteinander ganz so wie immer, und auf einmal reden sie nicht mehr. Weil einer, Joan Didions Ehemann John Gregory Dunne, genau jetzt an einem Herzinfarkt stirbt. Das Leben, das die beiden Menschen kannten, ist vorbei. Stattdessen die Stille – so plötzlich, so ewig.