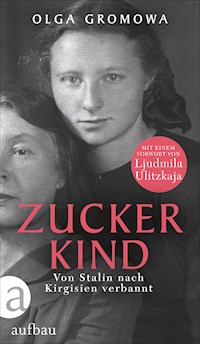
16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
„Ein Lehrstück über den Sieg von Individuen über das große Böse.“ Ljudmila Ulitzkaja.
1937 werden die kleine Stella Nudolskaja und ihre Mutter von Moskau in ein Arbeitslager in Kirgisien geschickt. Den Vater, einen Ingenieur, hatte man von einem Tag auf den anderen verhaftet und als Volksfeind verurteilt. Ein Kampf ums nackte Überleben beginnt, den Stella schonungslos und berührend aus ihrer Perspektive beschreibt. Doch selbst in schlimmsten Zeiten gibt es immer wieder Menschen, die den beiden helfen: Mutter und Tochter finden Obdach bei einer russischen Bauernfamilie, dann in einem kirgisischen Sowchos. Erst zehn Jahre später dürfen sie in eine Kleinstadt im Moskauer Gebiet umsiedeln.
Die Journalistin Olga Gromowa hat die ungewöhnliche Lagergeschichte für die Nachwelt festgehalten. Das Buch wurde in Russland mehrfach ausgezeichnet und in 14 Sprachen übersetzt.
„Diese wahre lichtvolle Geschichte von Stalinistischer Unterdrückung, gesehen mit den Augen eines Kindes, stellt einen bedeutenden Beitrag zur fragilen Erinnerungskultur im gegenwärtigen Russland dar, wo die Erforschung dieser Zeit zunehmend marginalisiert wird.“ Le Monde
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 236
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über das Buch
Die Nudolskis führen das ganz normale Leben einer gebildeten Moskauer Familie, bis 1936 der Vater verhaftet wird und die Mutter und fünf Jahre alte Stella als Volksfeinde nach Kirgisien verbannt werden. Mit unverzagtem kindlichem Selbstvertrauen und Glauben an das Gute erzählt die kleine Stella von den menschenverachtenden Lebensbedingungen im Arbeitslager. Die Mutter ist selbst hier bestrebt, dem Kind humanistische und kulturelle Ideale zu vermitteln, es zu einem gebildeten Menschen zu erziehen. Tatsächlich gelingt es ihr, die lebensfrohe Naivität des Kindes zu beschützen und zu bewahren. In all ihrer Not erfahren Stella und ihre Mutter zudem immer wieder Güte, Hilfe und Solidarität, auch wenn gerade zu Kriegszeiten bedingungslose Anpassung gefordert wird.
"Die Dokumentation eines Wunders – die Erziehung einer menschlichen Persönlichkeit unter unmenschlichen Bedingungen.“ Sergej Lebedew
Über Olga Gromowa
Olga Gromowa, Bibliothekarin und Journalistin, begann 1988 die Geschichte ihrer Nachbarin Stella Nudolskaja aufzuschreiben, die 1937 als Kind mit ihrer Mutter als Angehörige eines Volksfeinds nach Kirgisien verbannt wurde. Das Buch erschien 2014 zuerst als Jugendbuch, später auch für Erwachsene.
Ganna-Maria Braungardt, geboren 1956, studierte russische Sprache und Literatur in Woronesh (Russland), Lektorin, seit 1991 freiberufliche Übersetzerin. Sie übertrug u. a. Swetlana Alexijewitsch, Ljudmila Ulitzkaja, Polina Daschkowa, Boris Akunin, Jewgeni Wodolaskin und Juri Buida ins Deutsche.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Olga Gromowa
Zuckerkind
Von Stalin nach Kirgisien verbannt
Aus dem Russischen von Ganna-Maria Braungardt
Mit einem Vorwort von Ljudmila Ulitzkaja
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Vorwort
Zuckerkind — Geschichte eines Mädchens aus dem vorigen Jahrhundert, erzählt von Stella Nudolskaja
Prolog
1: Spiel
2: Der Krieg gegen den Mausekönig
3 : Kein Spiel mehr
4: Prüfungen
5: Ataman
6: Nicht Haus noch Hof
7: Bei Großvater Saweli
8: Die Jushaks
9: Kant Bala – Zuckerkind
10: Das große Vorlesen
11: Dünnes Eis
12: Die guten Menschen sind immer in der Mehrheit
13: Kant Bala ist nicht süß
14: Der Krieg
15: Manastschi
16: Bei den Pionieren
17: Der schwere Winter 1943
Epilog
Gestatte dir keine Angst — Wie es wirklich war
Erläuterungen
Impressum
Wer von diesem Buch begeistert ist, liest auch ...
Vorwort
Zu allen Zeiten wurde und wird der Kampf zwischen Erinnern und Vergessen geführt. Die Geschichte der Menschheit begann im Grunde in dem Moment, da die Menschen gelernt hatten, ihre Erfahrungen an die nachfolgenden Generationen weiterzugeben, zunächst mündlich, dann auch schriftlich. Erinnerung ist das Festhalten von Vergangenem. Doch sie hat nur dann einen Sinn, wenn es jemanden gibt, der das Festgehaltene zu verstehen vermag. Der Wunsch nach umfassender Erforschung der Geschichte der Menschheit seit ihren Ursprüngen motiviert Historiker, Texte in unbekannten Sprachen zu entschlüsseln, hinterlassen von untergegangenen Völkern.
Doch unendlich viele kleine, private Geschichten von Menschen, die keine Heerführer oder Schriftsteller waren, keine Wissenschaftler oder Philosophen, Geschichten von Millionen einfachen Menschen, gehen verloren, weil sie keine Zuhörer hatten oder weil auch diese Zuhörer gestorben sind. Hinzu kommt, dass wir in der schnelllebigen heutigen Zeit kaum innehalten oder zurückblicken, um die Erfahrungen unserer Vorfahren zu verarbeiten. Doch es ist ein großer Verlust für die Menschheit als Ganzes, wenn sie darauf verzichtet, sich an ihre oft schwere Vergangenheit zu erinnern. Die Ignoranz gegenüber dem Vergangenen birgt die Gefahr, dass die gleichen ungeheuerlichen Fehler wieder und wieder begangen werden.
Dies ist ein Buch, für das es lohnt, ein paar Stunden in der Hektik des Alltags innezuhalten, um es zur Hand zu nehmen und zu lesen. Olga Gromowas »Zuckerkind« erzählt mit literarischen Mitteln von der Kindheit eines ganz außergewöhnlichen und begabten Mädchens – Stella Nudolskaja. Sie erlitt ein Schicksal, das sie mit Tausenden sowjetischer Kinder teilte. Ihre Kindheit fiel in die Vorkriegs- und Kriegsjahre, als die Stalinschen Repressionen das gesamte Land erfassten und Millionen Menschen verfolgt wurden: Manche wurden erschossen, andere für viele Jahre in Lager gesperrt; ihre Angehörigen wurden verbannt, ihre Kinder oft in Kinderheime gesteckt.
Die dramatische Geschichte von Stella Nudolskaja beginnt mit einer erschütternden Szene: Das kleine Mädchen wacht auf und sieht, wie seine Mama und seine Oma den aufgeschlitzten Bauch seines Plüschteddys wieder zunähen. Sie können dem Kind nicht erklären, dass es in der Nacht eine Haussuchung gegeben hat, dass der Vater verhaftet wurde und die KGB-Leute den Teddybauch aufgeschlitzt haben, weil sie darin Belastungsmaterial gegen den Vater suchten.
Stella und ihre Mutter wurden verhaftet und nach Kirgisien geschickt, in ein Lager für Angehörige von Heimatverrätern. Damit begann ein Leidensweg, den Mutter und Tochter mit großem Mut meisterten. Wir erfahren, wie der brutalen, bedrohlichen Staatsmaschinerie immer wieder Wunder menschlicher Güte entgegengesetzt werden, die überleben helfen. Tatsächlich treffen Mutter und Tochter in jeder für sie lebensbedrohlichen Situation auf einen guten Menschen, der sie rettet. Selbst unter den Tscheka-Leuten findet sich ein Mann, der ihnen hilft.
Es ist also eine fast märchenhafte Geschichte. Wenn man so will, eine ganze Kette von Wundern. Und das letzte Wunder in dieser Kette ist womöglich, dass Stella Nudolskaja im hohen Alter auf die Schriftstellerin Olga Gromowa traf, die Stellas erstaunliche Geschichte für uns aufgeschrieben hat.
Doch mir scheint, diese Wunder folgen einer gewissen Gesetzmäßigkeit. Das kleine Mädchen und ihre Mutter sind Menschen von außerordentlicher Aufrichtigkeit, Güte und moralischer Stärke. Sie bewältigen den Weg schrecklicher Prüfungen mit großem Mut und großer Dankbarkeit für die Menschen, die ihnen helfen.
In grausamen Zeiten sterben bekanntlich vor allem die Schwachen. Doch diese beiden Menschen besitzen eine solche moralische Kraft und ein solches Vertrauen in die Welt, dass auch die Menschen um sie herum sich ihnen gegenüber stets großmütig zeigen. Darum liegt vor uns nun eine seltene Geschichte mit glücklichem Ausgang.
Die russische Organisation MEMORIAL veranstaltet seit zwanzig Jahren einen Aufsatzwettbewerb für ältere Schüler: »Der Mensch in der Geschichte«. Dabei werden rund zweitausend Aufsätze aus allen Gegenden Russlands eingereicht, von Archangelsk bis Magadan, und der Großteil dieser Einsendungen beschäftigt sich mit dem Schicksal der Großeltern und Urgroßeltern der Schüler, Altersgenossen von Stella Nudolskaja. Jedes Jahr veröffentlicht MEMORIAL einen dicken Band mit diesen Aufsätzen – ein Konzentrat menschlicher Erinnerung. Diese Aufsätze sind eher historische Forschungen als literarische Prosa, und die Geschichten, von denen sie erzählen, enden bei Weitem nicht immer mit dem Triumph des Guten.
Jeder Mensch hat irgendwann im Leben die Wahl: Willst du dem Guten dienen oder dem Bösen? Diese Frage ist auch heute noch aktuell, vielleicht nur etwas komplizierter, denn das Böse tarnt sich geschickt als das Gute, und es erfordert einige geistige Anstrengung, das eine vom anderen zu unterscheiden.
Olga Gromowas Buch ist ungeachtet seiner dokumentarischen Grundlage ein wunderbares literarisches Werk. Es bietet uns keine Überlebensrezepte an, es erzählt einfach vom Schicksal zweier zarter Wesen, die durch ihren persönlichen Mut und das Mitgefühl anderer Menschen überlebt haben. Es ist ein Lehrstück über den Sieg von Individuen über das große Böse, und damit eine wichtige Lehre für uns alle. Damit wir wissen: Der Schwache kann den Starken besiegen.
Ljudmila Ulitzkaja
Die Orte, an denen das Buch spielt. Karte der Sowjetunion in den Grenzen von 1940.
Zuckerkind
Geschichte eines Mädchens aus dem vorigen Jahrhundert, erzählt von Stella Nudolskaja
Für Stella und Erik Ich habe mein Versprechen gehalten.
O. G.
Prolog
Ich mag nicht mehr an Unterricht denken, generell nicht und konkret nicht an den Deutschunterricht – so schön ist draußen der Frühherbst mit der hellen Herbstsonne, so sehr zieht es mich in den Wald in unserem Moskauer Vorort. Ich höre mit halbem Ohr zu, als die Lehrerin die Ergebnisse der Leistungskontrolle bekannt gibt. »Nudolskaja – eine Drei …« Habe ich mich etwa verhört? Die Klasse brummt verständnislos, verstummt jedoch rasch unter dem strengen Blick der neuen Deutschlehrerin. Meine Mitschüler in den ersten Bankreihen drehen sich erstaunt zu mir um: Meine zweite Drei in Deutsch in einer Woche. Alle wissen, dass ich Deutsch fast so gut spreche wie Russisch und in einem Schuldiktat auf keinen Fall eine Drei geschrieben haben kann.
Und plötzlich verstehe ich. Die kürzliche Drei in Russisch für den Aufsatz (die Lehrerin hat gesagt, ich hätte stilistische Fehler gemacht und das Thema nicht erfasst) und die Drei heute erscheinen mir nicht mehr so verwunderlich. Kränkend – ja, ungerecht – natürlich … Doch in diesem Augenblick wird mir klar, dass sich die Dreien jetzt, in der Abschlussklasse, unweigerlich häufen werden, egal, wie sehr ich mich bemühe. Und am Ende des Schuljahres werde ich in Russisch und in Deutsch nur eine Zwei bekommen. Also keine Gold-, nicht einmal eine Silbermedaille, trotz aller Einserzeugnisse der vergangenen Jahre.
Nun höre ich gar nicht mehr zu. Ich denke nach. Klar, dass die Zwei in Russisch feststeht – also keine Medaille. Zwar kann man sogar mit zwei Zweien auf dem Abschlusszeugnis eine Medaille erhalten, nicht aber mit einer Zwei in Russisch. Das ist Gesetz. Und so wird es wohl kommen. Kränkend und unverständlich finde ich nur, warum ich auch in meinem geliebten Deutsch eine Zwei bekommen soll. Nicht in Mathematik, nicht in Physik … Vielleicht, weil unsere neue Klassenlehrerin Deutsch unterrichtet und es offenkundig nicht besonders gut beherrscht … und deshalb niemanden mag, der es besser kann als sie? Oder wurde sie einfach beauftragt, eine »Weisung« umzusetzen, weil sie erst seit Kurzem in unserer Siedlung wohnt und noch ein bisschen fremd ist?
Meine Mutter unterrichtet auch Deutsch. In derselben Schule. Aber sie darf nicht in den höheren Klassen unterrichten, nur von der fünften bis zur siebten. Wir wohnen bei der Schule – in einer kleinen Dienstwohnung. Mama wird natürlich traurig sein wegen meiner Deutschzensur, aber ich weiß genau, dass weder sie noch ich deswegen streiten werden. Oder irgendwem irgendwas erklären. Und meine Klassenkameraden … ach, die werden sich eine Weile wundern und sich dann daran gewöhnen. In der zehnten Klasse hat jeder mit sich zu tun.
Später, irgendwann einmal … wenn es nicht mehr gefährlich ist … dann werde ich meine Geschichte erzählen, wenigstens den engsten Freunden. Aber das wird nicht so bald sein. Wenn überhaupt jemals. Vorerst kann ich mich nur stumm daran erinnern.
1
Spiel
Heute beim Abendbrot waren wir im Zauberland der Elfen und Gnome, wo, wie jeder weiß, Milch und Honig fließen und die Ufer aus Pudding sind. In den tiefen Tellern mit festem leuchtendem Beerenpudding und einem Ring aus Milch drum herum mussten Staudämme gebaut werden, damit Milchflüsse in Puddingbetten fließen konnten. Tut man das sorgfältig und nicht zu hastig, entsteht auf dem Teller eine Landkarte mit Seen, Flüssen, Bächen und einem Ozean drum herum. Wir bauen lange, dann vergleichen wir, bei wem es am besten aussieht: bei mir, bei Mama oder bei Papa. Papa hat es sogar geschafft, einen Puddingberg zu bauen, und behauptet, in ihm entspringe der Milchfluss. Während wir die Bilder auf den Tellern betrachten, zerfließt der Berg, und es entsteht ein trübes Meer. Mama und ich lachen, und die Njanja knurrt: »Wie die kleinen Kinder, nur Spielereien im Kopf.«
Stella mit ihren Eltern, Moskau, Frühjahr 1932.
»Na schön, Schnuffi«, sagt Papa, »schnell den Pudding aufessen und ab ins Bett.«
»Gibt’s noch ein Märchen?«
»Klar gibt’s ein Märchen. Heute bin ich dran.«
»Kannst du nicht gleich anfangen, damit ich weiß, wovon es handelt, und dann gehe ich mir die Zähne putzen und mich waschen?«
»Vor langer, langer Zeit …«
»Als die Sonne noch heller schien und das Wasser nasser war?«
»Meine Güte, wo hast du das denn her?«
»So erzählt Poljuschka ihr Märchen«, sagt Mama lächelnd.
Poljuschka ist meine Njanja. Sie nennt mich übrigens nie Schnuffi. Sie findet, das ist ein Hundename, und schimpft, wenn mich jemand so nennt. Aber Papa hat keine Angst vor ihrem Schimpfen.
»Lenkt mich nicht ab. Also … Vor langer, langer Zeit lebte in Moskau eine Familie: ein Papa, eine Mama, eine Njanja und ein ganz kleines Mädchen. Der Papa hieß … Papa. Die Mama … Der Papa nannte sie Julenka, Mamas ältere Schwestern sagten Ljusska, ihr Bruder Punetschka.«
»Der Bruder – ist das Onkel Lapa?«
»Na ja, zum Beispiel, obwohl ihn eigentlich niemand so nennt, nur ein kleines Mädchen. Dieses Mädchen aber wurde lange Zeit ganz verschieden genannt, nur nie beim Namen … Denn es hatte keinen Namen.«
»Das ist ein Märchen über mich, ja? Kommen auch Abenteuer drin vor?«
»Ja, ja. Aber erst waschen und ins Bett.«
Die Geschichten, die Mama mir vorliest oder erzählt, oft in verschiedenen Sprachen, handeln von Göttern, Helden und Zauberern. Papa dagegen erzählt selten »richtige« Märchen, also Volksmärchen oder welche aus der Literatur – er erfindet sie meistens aus dem Stegreif. Ich gehe mich schnell waschen, voller Vorfreude auf ein Märchen über mich selbst, denn die wahre Geschichte darüber, dass ich lange keinen Namen hatte und wie ich dann schließlich einen bekam, die kenne ich schon.
Alle Anzeichen sprachen für einen Jungen, und den wollten meine Eltern Genrich nennen. Und plötzlich kam vor der Zeit etwas Winziges auf die Welt, ein Achtel weniger als fünf Pfund1 schwer (so rechnete die Njanja auf alte Weise), gute vierzig Zentimeter lang, und war ein Mädchen. Die Eltern konnten sich eine ganze Weile nicht entscheiden, wie das überraschende Wesen heißen sollte.
Solange noch kein Bett für mich da war, schlief ich in einem Koffer, der auf einem großen Stuhl stand, der Deckel war an der Stuhllehne festgebunden. Und ich wurde Schnuffi, Buba oder sonst wie genannt. Doch das kleine Geschöpf musste einen Namen bekommen. Papa gefielen die einen Namen, Mama hingegen andere, und die beiden stritten endlos.
Ein Freund der Familie schlug vor: »Nennt das Mädchen Mussór – das heißt auf Türkisch ›Stern‹.«
Aber Mama wollte ihre Tochter nicht Mússor nennen, denn das bedeutet auf Russisch Müll. Meine Eltern hätten sich noch lange gestritten, wäre nicht eines Tages ein strenger Brief mit Androhung einer Strafe ins Haus geflattert, der sie ermahnte, sie hätten ihre Tochter in einem Standesamt anzumelden.
Sie gingen zu dritt hin: Papa, Mama und ihr Freund Alexander. Während die Eltern am Fenster im Flur stritten, wie ihr kleines Wunder heißen sollte, übergaben sie das Kind ihrem Freund, er sollte es halten, bis sie sich geeinigt hätten. Der Freund ging leise in die Amtsstube (aus der die Eltern eine halbe Stunde zuvor hinausgeworfen worden waren, damit sie im Flur zu Ende stritten) und meldete das Kind an, zum Glück hatte Onkel Alexander ja sowohl das Kind als auch die nötigen Papiere bei sich. Mit dem Gefühl, seine Pflicht erfüllt zu haben, riet er den Eltern, ein andermal zu Ende zu streiten, denn dieses Kind heiße nun Stella und das bedeute auf Lateinisch »Stern«.
Als die Njanja Polja ins Haus kam, erfand sie eine Koseform des Namens Stella – Elja. Von da an wurde ich von meinen Nächsten so genannt.
An Papas Gesicht kann ich mich nicht erinnern. Dafür an seine Manteltasche. Wenn ich den Arm hineinsteckte (fast bis zur Schulter), fand ich darin immer eine Leckerei. Ich erinnere mich an seine große warme Hand, an der ich mich festhielt, wenn wir an freien Tagen spazieren gingen. Und an seine Stimme – sehr tief und samtig. Und nun erzählt mir Papa ein Märchen. Wie ein kleines, aber mutiges Mädchen seine Mama vor bösen Räubern rettet und sich dabei ihren Namen verdient – Sternchen.
Papa und Mama waren beide sehr musikalisch. Mama setzte sich abends ans Klavier, und sie sangen zu zweit. Das war schön. Ich mochte es sehr, wenn sie Massenets Elegie sangen. Natürlich wusste ich damals nicht, was eine Elegie ist und wer Massenet war, ich hielt das für ein einziges langes Wort »Massneelegie«, aber das Wort war genauso schön wie die Musik.
Meine Eltern arbeiteten beide, und sie arbeiteten viel. Aber wenn sie zu Hause waren und ich noch nicht schlief, schien ihre ganze Zeit mir zu gehören. Nie sagten sie: »Geh weg«, »Beschäftige dich mit deinen Spielsachen«, »Ich hab keine Zeit« oder »Darüber reden wir später«. Heute kommt es mir vor, als hätten wir ständig gespielt.
Stellas junge Eltern, um 1930.
Neben Russisch sprachen meine Eltern mit mir seit meiner frühesten Kindheit auch Deutsch und Französisch, und mit drei Jahren verstand ich alle drei Sprachen gleich gut und sprach sie bald mühelos. Nicht nur russische, sondern auch deutsche und französische Märchen und Geschichten wurden mir in der Originalsprache erzählt.
Meine Mama konnte sehr gut zeichnen und malte beim Erzählen oft gleich Bilder zu ihren Geschichten.
Ich bekam häufig Geschenke – sie waren stets in Papier eingewickelt und mit Bindfaden zugebunden, den ich selbst aufschnüren musste.
Einmal brachte mir Papa ein riesiges Paket mit.
Er stellte es auf den Boden und sagte: »Was mag da wohl drin sein? Schnür es sorgfältig auf und schau nach.«
Zuerst untersuchte ich Papas Manteltasche – darin lag ein kleiner rotbäckiger Apfel. Dann ging ich um das Paket herum. Es stand auf dem Fußboden, war sehr lang, höher als ich, und wackelte leicht. Ich musste alle Knoten aufbinden und nachschauen …
»Na los, kleiner Mensch, keine Bange!«
Stella mit knapp drei Jahren, Mai 1934.
Das waren sehr wichtige Worte. Wenn meine Eltern mit mir zufrieden waren, sagten sie »guter kleiner Mensch«, das höchste Lob war »guter Mensch«.
Der Begriff »guter Mensch« umfasste vieles.
Ein guter Mensch macht alles selbst.
Ein Mensch kann alles selbst, anfangs mithilfe eines anderen, dann allein. Mit dreieinhalb Jahren zum Beispiel kann sich ein Mensch allein anziehen und waschen. Und wenn er etwas älter ist, spielt er natürlich auch allein, weil er schon ziemlich viel weiß und sich aus allen Geschichten, die er kennt, verschiedene eigene ausdenken kann.
Ein guter Mensch fürchtet sich vor nichts.
Angst hat nur, wer sich fürchtet. Wenn du dich vor nichts fürchtest, hast du nie Angst. Dann bist du ein mutiger Mensch.
Ein guter Mensch löst alle Knoten selbst.
Der Mensch stößt im Leben auf viele Knoten, und die muss er lösen können. Am einfachsten ist es, sie zu zerschneiden, aber er muss lernen, sie aufzuschnüren.
An meiner Kinderzimmerwand waren zwei dünne Leinen befestigt, an denen ich Knoten binden und aufknüpfen lernte, ganz verschiedene: Schleifen, Einfach- und Doppelknoten. Papa brachte mir einen Seemannsknoten bei, der hält fest und sicher, lässt sich aber auch leicht wieder lösen.
Also, ich musste die Knoten lösen, und das konnte ich allein.
Ich hatte lange zu tun. Schließlich war das Papier ab, und auf dem Boden stand ein PFERD! Ein Apfelschimmel, Schweif und Mähne hell, Sattel und Zaumzeug rot, und echte Steigbügel!
»Kühn schwing ich mich in den Sattel, bin ein mutiger Kosak!« Hurra! Der Sattel knarrte, das Pferd galoppierte! Hurra!
Das Pferd, ich nannte es Grauer, wurde für lange Zeit mein liebstes Spielzeug. Tauschte ich den Hut mit der Feder gegen einen Papphelm, wurde aus dem schönen Prinzen ein kühner Ritter. Ich befreite eine Prinzessin, indem ich den dreiköpfigen Drachen enthauptete, und kämpfte gegen die Mongolen wie Jewpati Kolowrat2. Ich vermute, meine Verwandlung in den jeweiligen Tageshelden wurde immer von der Einschlafgeschichte des Vorabends beeinflusst.
Auch draußen war ich sehr gern. Da gab es viel Interessantes: Auf dem Boulevard schlenderten Menschen, liefen Hunde herum, zwitscherten allerlei Vögel – hier ging ich mit Mama, Papa oder meiner Njanja spazieren. Auf unserem Hof, auf den ich seit meinem fünften Lebensjahr allein durfte, konnte ich Ball spielen, Springseil springen, im Sandkasten eine Burg bauen und mich manchmal auch ein bisschen raufen. Letzteres war besonders aufregend, vor allem, seit ich gelernt hatte, nicht zu verlieren.
Eines Tages kam ich laut heulend nach Hause, mit aufgeschlagener und geschwollener Nase, aus der Blut tropfte. Bei jedem Tropfen, den ich sah, heulte ich auf.
Papa nahm mich auf den Schoß, bog mir den Kopf in den Nacken, legte ein nasses Taschentuch auf meine Nasenwurzel und fragte: »Es tut weh und ist kränkend?«
Weinend nickte ich.
»Weißt du, bei einer Prügelei verliert immer der, der als Erster anfängt zu weinen. Wer nicht weint, gewinnt immer.«
Ich schluchzte krampfhaft und fing wieder an zu weinen.
»Du kannst das Weinen nicht unterdrücken?«
Nicken.
»Probieren wir es doch mal, vielleicht geht es ja? Wir atmen ein und versuchen es zusammen. Los geht’s … Tief einatmen, anhalten, ausatmen – huuu!«
Der Schmerz verging, und ich musste auch nicht mehr weinen.
»Na, alles gut, kleiner Mensch? Man muss etwas aushalten können, unbedingt. Merkst du dir das?«
Ein guter Mensch kann etwas aushalten.
Wie sich herausstellte, war das Aushalten gar nicht so schwer. Anstatt zu weinen, einfach tief einatmen und warten. Wenn du nicht gleich losheulst, ist es lächerlich, später damit anzufangen. Ich stellte fest, dass das sehr hilfreich war bei Prügeleien. Ich konnte sogar Borka verprügeln, der schon ganze sechs Jahre alt war und mich immer als »Mamakind« hänselte.
Der vierjährige kleine Wildfang, Herbst (?) 1935.
Ich besaß natürlich sehr viel Spielzeug. Erstens mehrere Sätze Alphabet-Bauklötze, außerdem solche, die sich zu Bildern zusammenlegen ließen. Und ganz alte, thematische Bausteine, mit denen schon meine Mama gespielt hatte: Eine Schachtel »Afrika« mit Abbildungen von Wüsten, Savannen, Affenbrotbäumen, Krokodilen, Nashörnern, Sphinxen, Afrikanern, Zebras, Giraffen, ägyptischen Pyramiden und vom Nil; eine Schachtel »Amerika« – Indianer, Bisons, Einbäume, Wigwams, schwarze Sklaven in Ketten auf Plantagen; eine Schachtel »Asien« – Chinesen, Japaner, Hindus, Pagoden, Kobras, Mungos, Elefanten, Affen; eine Schachtel »Australien« – Kängurus, Dingos, Ameisenbären, Aborigins. Die Bilder waren bunt und eindrucksvoll. An den Wänden bei uns zu Hause hingen zwei Karten: eine politische Weltkarte im großen Zimmer und eine riesige Karte der beiden Erdhalbkugeln im Kinderzimmer. Die hing ganz tief, damit ich alle Abbildungen darauf genau erkennen konnte, und ließ sich abnehmen und auf den Boden legen.
Unser Lieblingsspiel war »Wer lebt wo?«. Wir legten uns alle drei auf den Boden, um die Karte herum, und verteilten darauf, zum Beispiel auf Afrika, die Bauklötze mit den afrikanischen Bildern. Nebenbei erzählten mir Mama und Papa von den Bräuchen, der Bevölkerung, dem Klima und der Geschichte der Kontinente und von Menschen, die sie bereist hatten.
Aus dem Stegreif entstanden neue Spiele: Selbst gebastelte Papierschiffchen legten an der Elfenbeinküste an, entführten Afrikaner, brachten sie über den Ozean und verkauften sie auf dem Sklavenmarkt in Amerika, wo Lincoln sie dann befreite. Alle Spiele endeten mit dem Sieg des Guten über das Böse.
Wenn wir an Feiertagen zum Essen den großen ovalen Tisch deckten, spielten wir »König Artus’ Tafelrunde«, mit dem König und seinen tapferen Rittern. Natürlich durfte der tapfere Lancelot – also ich – beim Essen nicht zappeln, schmatzen oder ungeschickt mit Messer und Gabel umgehen.
Oft machten wir Versspiele. Wenn Mama mit mir spazieren ging, wusste sie immer ein schönes Gedicht über das, was wir sahen: Vögel, Hunde, Gras, Bäume, Gewitter, Regen, Frühling, Sommer, Herbst, Winter – praktisch über alles. Es waren schöne und einprägsame Verse. Später wetteiferten wir, wem als Erstem ein Gedicht einfiel über etwas, was wir gerade sahen.
Manchmal spielten wir alle zusammen Jahreszeiten. Zum Beispiel »Herbst« – dann zitierten wir der Reihe nach Zeilen aus Herbstgedichten. Wir spielten gleichberechtigt: Meine Eltern zitierten nie Verse, die ich schon kannte, und ich kannte zu der Zeit schon viele Gedichte.
Überhaupt lasen wir oft Verse. Meine gereimten Lieblingsmärchen lasen wir so oft, dass ich sie bald auswendig kannte. Dann sprachen wir sie abwechselnd: Mama eine Zeile, ich die nächste und so weiter.
Doch das schönste Spiel begann, wenn uns Mamas Bruder Onkel Lapa besuchte! Er lebte damals in der Stadt Gorki und kam manchmal auf Dienstreisen nach Moskau. Das war immer ein großes Fest.
Erstens brachte mir Onkel Lapa immer eine sogenannte Schokoladenbombe mit, eine hohle Schokoladenkugel. Es gab ganz verschiedene: von ganz kleinen, nicht größer als eine Hand, bis zu riesigen, so groß wie ein Ball. Sie waren in Gold- oder Silberpapier gewickelt, und darin lag immer ein kleines Spielzeug. Eine meiner liebsten Spielsachen stammte aus einer großen Schokoladenbombe – der Negerjunge Tom, eine Zelluloidpuppe, so groß wie meine Handfläche, dessen Kopf, Arme und Beine sich bewegen ließen.
Zweitens stand bei uns zu Hause immer alles kopf, wenn der Onkel zu Besuch kam. Aus Tisch und Stühlen wurden Festungen, Fregatten, Kamelkarawanen – überhaupt alles, was wir wollten. Wir entdeckten Amerika, durchquerten auf der Suche nach Schätzen die Wüste, erstürmten die Bastille und sangen auf ihren Trümmern auf Französisch die Marseillaise.
Ein wichtiger Teil unseres Lebens waren die Bücher. Jede Menge Bücher. Auf meinen Regalen standen mehrere Bände »Brehms Tierleben« mit großartigen Abbildungen, Bücher mit Bildern von lebenden und prähistorischen Tieren und viele Kunstbände mit Reproduktionen von Gemälden russischer und europäischer Maler. Ich betrachtete die Bilder sehr gern, obwohl ich die Unterschriften noch nicht selbst lesen konnte.
Wir hatten Kinderzeitschriften abonniert und kauften viele Bücher. Jedes neue Buch lasen wir gemeinsam: Wir setzten uns nach dem Abendessen an den runden Tisch, und Mama las vor. Das konnte sie wunderbar!
Es wurmte mich immer, dass ich tagsüber nicht allein lesen konnte, ich musste warten, bis die Njanja Zeit hatte. Eines Tages nahm ich mir vor lauter Ärger die Puschkin-Märchen, die ich schon auswendig kannte, schlug die Seite mit dem Bild der »Drei Mädchen am Fenster« auf, stellte das Buch auf den Tisch und legte Buchstabenklötze in derselben Reihenfolge aneinander wie die Buchstaben im Märchenband. Eine Zeile reichte über den ganzen Tisch. Ich weiß nicht mehr, was daraus wurde, aber ich erinnere mich, dass ich ein gewaltiges Geheul anstimmte, als mich die Njanja vor dem Essen aufforderte, alles wegzuräumen. Wie ich lesen gelernt habe, weiß ich nicht mehr, aber im August 1935, als ich vier Jahre alt wurde, las ich schon sicher, wenn auch noch nicht sehr flüssig.
Unter den vielen Geschenken zu diesem Geburtstag war auch ein dickes großes Buch, auf dessen blauem Kalikoeinband in Silberprägung der Titel »Zaubermärchen« stand. Die meisten Märchen kannte ich, die hatte mir Mama erzählt. Doch nun konnte ich sie selbst lesen! Am nächsten Tag, als die Njanja für längere Zeit außer Haus war, begann ich zu lesen, das Märchen »Riquet mit dem Schopf«. Ich hatte fast zwei Seiten gelesen, als ich auf das seltsame Wort »jeje« stieß. Das war mir noch nie begegnet, ich wusste nicht, was es bedeutet. Hätte ich den Satz bis zum Ende gelesen, würde ich es bestimmt verstanden haben, aber ich erlag einem Tabu: Man darf nichts auslassen und einfach etwas Neues anfangen, bevor man das Angefangene zu Ende gebracht hat. Also blieb ich stecken. Erst grübelte und überlegte ich, was das seltsame Wort heißen könnte, doch schließlich fing ich an zu weinen. Wütend auf das Buch und auf das gemeine Wort, befeuchtete ich meinen Finger mit Spucke und wischte es weg. Es entstand ein Loch. Düster verkroch ich mich unterm Tisch und wartete auf die Erwachsenen. Das aufgeschlagene Buch mit dem Loch auf der Seite lag neben mir.
Als Erste kehrte die Njanja zurück.
Stella mit ihrer Njanja, 1933.
Ich erzählte ihr von der Gemeinheit im Buch und bekam zur Antwort: »Wenn zwei ›je‹ nebeneinanderstehen und es kein Wort ergibt, dann ist ein ›je‹ ein ›jo‹3. Versuch’s mal.«
Natürlich funktionierte es! So beruhigt, vergaß ich sogar, dass das Loch im Buch eine Schande war (genau das sagte Mama dann: »Eine Schande! Das Buch kann doch nichts dafür, dass du etwas nicht weißt. Jemand hat sich damit Mühe gegeben, und du hast es verdorben.«), setzte mich hin und las weiter. Allerdings muss ich gestehen, dass die Zaubermärchen in diesem Buch weniger spannend waren als die von Mama. Und Mamas Fee aus der Geschichte vom Aschenputtel war eine viel bessere Zauberin als die im Buch. Mamas Fee machte die Kutsche, die Pferde, den Kutscher und die Diener aus nichts, sie schwenkte nur den Zauberstab, die Fee im Buch dagegen benutzte einen Kürbis, Mäuse und Ratten, was natürlich viel einfacher ist.
Ich war sehr stolz darauf, dass ich nun selbst alles lesen konnte, was ich wollte. Am liebsten las ich die Bildunterschriften unter den Gemäldereproduktionen in den Kunstbänden, obwohl ich die Hälfte der Worte nicht verstand. Außerdem las ich gern die winzigen Minibücher mit Versen und kurzen Geschichten.
Als ich älter war, erfand ich ein neues Lieblingsspiel, mit dem ich mich tagsüber beschäftigte, wenn meine Eltern nicht da waren. Ich versuchte, reale Geschichten oder Märchen so umzudichten, dass der Held gerettet wird und alles ein glückliches Ende nimmt. Dabei rief ich sämtliche historischen und Märchenfiguren zu Hilfe, von denen mir meine Eltern erzählt hatten. Ich überlegte mir, was zu tun war, und abends hörte sich Papa alles an, gab mir Ratschläge und verwies auf Schwachstellen in meinem Plan.
Ein Beispiel: Jeanne d’Arc soll vor der Hinrichtung gerettet werden.





























