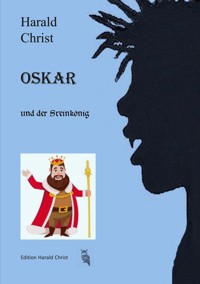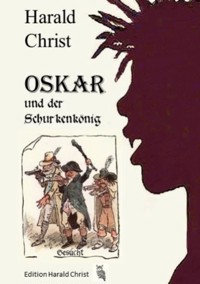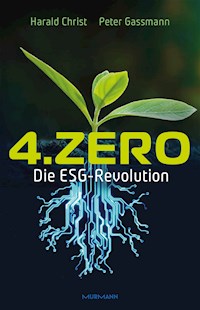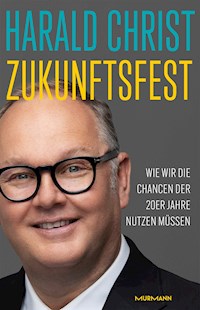
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Murmann Publishers GmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Jetzt geht's ums Ganze: Wer den weltweiten Wettbewerb um die Bildung verliert, setzt die Zukunft des Landes, den Wohlstand und die Finanzierbarkeit der sozialen Marktwirtschaft aufs Spiel. Einer der wichtigsten Unternehmer im politischen Berlin fordert deshalb einen gigantischen Bildungsaufbruch. Ohne Schönfärberei. Harald Christ ist einer der bestvernetzten Unternehmer im politischen Herzen der Republik. Während der Koalitionsverhandlungen zur Ampel war er sogar der einzige Nicht-Berufspolitiker. Der ehemalige Bundesschatzmeister der FDP meldet sich jetzt kritisch zu Wort. Er fordert einen mächtigen Pakt zwischen Wirtschaft und Politik. Raus aus der jeweiligen Komfortzone. Hinein in die Kampfzonen um die wirtschaftliche Zukunft Deutschlands und Europas. Harald Christ kennt beide Welten aus dem Eff-Eff. Er ist Unternehmer, Politiker, Hochschuldozent, der seine Karriere aus einfachen Verhältnissen gestartet hat und zunächst in der SPD seine politische Heimat fand. Dieses Buch ist ein politisches Unternehmerbuch. Christ mischt sich ein, Christ argumentiert als Unternehmer für Unternehmer, Christ sorgt sich um die Zukunft des Landes. Vor allem um die Bildungschancen. Messerscharf seziert er den Abwärtstrend im internationalen Vergleich, das Abrutschen ins Mittelfeld innovativer Leistungsfähigkeit. Es brauche vor allem mutige Unternehmer, so Christ, welche die Abwärtsspirale zu drehen beginnen. Und keine längeren ideologischen Debatten, die Stillstand bedeuten und Deutschland im internationalen Wettbewerb immer weiter den Anschluss verlieren lassen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 217
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
WIE WIR DIE CHANCEN DER 20ER JAHRE NUTZEN MÜSSEN
HARALD CHRIST
ZUKUNFTS-FEST
Inhalt
Editorial
Vorwort
01Mein Vorbild Helmut Schmidt oder: Wie ich zum Thema dieses Buches komme
02Die 20er-Jahre des 21. Jahrhunderts warten auf uns. Wir sollten uns nicht weiter verspäten
03Der Bildungssektor in Deutschland – nach wie vor ineffizient, unterfinanziert und sozial ungerecht
04Warum Unternehmer in Deutschland so leise geworden sind – und wie das wieder anders wird
05Wohlstand für alle durch Bildung und Unternehmertum
Über den Autor
EDITORIAL
Wenn ein Buch erscheint, so steht zunächst der Autor im Vordergrund. In diesem Fall soll es aber nicht um mich gehen, sondern um das Ermöglichen und Befähigen. Anlässlich meines 50. Geburtstages habe ich die Harald Christ Stiftung für Demokratie und Vielfalt ins Leben gerufen. Diese wird Kinder und Jugendliche unterstützen, die durch ihre Familien- und Lebensverhältnisse benachteiligt sind. Sie sollen ihre Potenziale entwickeln und Chancen nutzen. Ich selber hatte das große Glück, diese Unterstützung von meinen Eltern zu erfahren. Sie haben immer an mich geglaubt und mir trotz großer Herausforderungen einen Weg geebnet, um etwas Besonderes zu schaffen. Das bleibt mir unvergessen, und dafür danke ich ihnen von Herzen. So wie ich denjenigen danke, die in Politik und Wirtschaft ebenfalls nie den Blick für die Allgemeinheit verlieren. Ich danke den Unternehmerinnen und Unternehmern, die fördern und fordern – auch in dem Wissen, dass es unser aller Wohlstand sichert, wenn die Starken den vermeintlich Schwächeren helfen. Darum und um die Potenziale unseres Landes, die wir nicht brachliegen lassen dürfen, soll es in diesem Buch gehen.
Harald Christ
0
»Es gibt nur eins, was auf Dauer teurer ist als Bildung, keine Bildung.« – Ein Plädoyer für die berufliche Bildung
John F. Kennedy
VORWORT
Uns allen ist bewusst: Wir sind von der Industriegesellschaft in die Wissensgesellschaft übergetreten. Was sind die Grundlagen, um zu einer führenden Wissensgesellschaft zu werden? Ganz klar: Bildung.
Ein Kernelement der sozialen Marktwirtschaft ist das Versprechen, dass jeder durch Fleiß den sozialen Aufstieg schaffen kann. Leistung soll sich lohnen. Deswegen liegt der Schlüssel einer guten Wirtschaftspolitik auch in der Erhöhung der sozialen Mobilität durch Bildung.
Es kann uns nicht ruhen lassen, dass in unserem reichen Land jeder fünfte Jugendliche nicht richtig lesen kann. Dass es zu oft mehrere Generationen braucht, bis jemand in die Mittelschicht aufsteigt.
Bildung zielt aber nicht allein auf individuelle Lebens- und Karrierewege. Denn das Wissen jedes Einzelnen ist Grundlage für neues Wissen für die Gesellschaft und damit für Innovationen. Bildung und Forschung haben also eine immense gesamtgesellschaftliche Bedeutung. Denn Innovationen spielen die entscheidende Rolle für den weiteren Wohlstand.
Die Tatsache, dass laut KfW-Innovationsbericht im Mittelstand die Innovationskraft seit eineinhalb Jahrzehnten nachlässt, muss ein Warnsignal sein. Keine Nation wurde jemals Innovationsweltmeister, indem sie sich auf ihrer technologischen Vorreiterrolle der Vergangenheit ausruhte. Und dazu braucht sie gut ausgebildete Fachkräfte.
Bildung wird in den Augen vieler schlicht mit akademischer Bildung gleichgesetzt. Rekordstudierendenzahlen wären also Zeichen erfolgreicher Politik. Dabei ist über alle Branchen hinweg der Mangel an Talenten in der beruflichen Bildung das drängendste Thema noch vor steigenden Rohstoffpreisen oder Regulierung. Hier gibt es viel zu tun, um unser Land zukunftsfest zu machen.
Nehmen wir die digitale Revolution: Wer heute seinen Berufsweg startet, muss schneller neue Tätigkeiten erlernen – über den gesamten Berufsweg hinweg. Weiterbildung und ein Neustart »mitten im Leben« müssen möglich sein. Einige Berufsbilder werden in den nächsten zehn Jahren aussterben – andere dafür entstehen. Noch vor einigen Jahren hatten wir keine Vorstellung, was ein Industrial Data Analyst sein soll. Wir dürfen nicht schlafen, sondern müssen zügig diese Ausbildungswege gestalten. Mit einem Digitalpakt 2.0 geben wir Berufsschulen nicht nur die Hardware, sondern investieren auch in die Köpfe hinter den Geräten und Leitungen. Sie müssen im 21. Jahrhundert ankommen.
Eine Exzellenzstrategie berufliche Bildung muss ihre Bedeutung klar deutlich machen. Durch Auslandspraktika während der Ausbildung steigt die Attraktivität und können internationale Kompetenzen vermittelt werden.
So vielfältig wie unsere Talente muss die Begabtenförderung sein. Wir können es nicht hinnehmen, dass mehr als zehnmal so viel für Stipendien für Studierende im Vergleich zur beruflichen Qualifikation ausgegeben wird. Die Begabtenförderwerke müssen sich für die Berufsbildung öffnen. Nur so wird die Gleichwertigkeit und Durchlässigkeit in unserem Land verwirklicht.
Unser Auftrag heute ist: mit der besten und modernsten Bildung Lebenschancen zu schaffen. Mit bester Forschung die Lösungen für die Herausforderungen nicht in den Antworten der Vergangenheit, sondern in den Technologien der Zukunft zu suchen.
Bettina Stark-Watzinger
Bundesministerin für Bildung und Forschung
0
01 MEIN VORBILD HELMUT SCHMIDT ODER: WIE ICH ZUM THEMA DIESES BUCHES KOMME
Deutschlands ungenutzte Ressourcen
Mitte 2009 meldete sich der damalige Kanzlerkandidat der SPD Frank-Walter Steinmeier bei mir und bot mir an, in sein Kompetenzteam zu kommen. Ich hatte das Management der Berliner Weberbank und der Muttergesellschaft WestLB Mitte 2008 verlassen und konnte guten Gewissens sein Angebot annehmen. Steinmeier war sich der Tatsache bewusst, dass die SPD in Sachen Wirtschaft und Unternehmertum Nachholbedarf hatte. Deshalb hatte er mich angesprochen. Und deshalb gab es damals auch den wirklich innovativen »Deutschland-Plan«, von dem der damalige Chefkommentator der Süddeutschen Zeitung, Heribert Prantl, schrieb, er sei »pfiffig – und interessanter als das, was die Union zu bieten« habe. Und: Steinmeiers »Deutschland-Plan« verlasse die Bahnen der gewohnten SPD-Politik. Denn: Das Fundament sei sozusagen grün, es sei auf den klugen Überlegungen eines »Green New Deal« gebaut, also eines ökologischen Um- und Ausbaus der Wirtschaft. Es gehe um »bahnbrechende Veränderungen im Autobau, im Klima- und Umweltschutz und bei der Nutzung erneuerbarer Energien«.1 Das klingt selbst ein Jahrzehnt später immer noch ausgesprochen aktuell – nicht nur in meinen Ohren, wie ich vermute. Prantl hatte schon recht: Hätte der damalige Kurzzeit-Wirtschaftsminister Karl-Theodor zu Guttenberg Steinmeiers Plan vorgestellt, hätte man ihn in manchen Kreisen wohl »als den Propheten einer neuen Arbeitsgesellschaft« gepriesen. Immerhin war er damals sozusagen mein Gegenspieler auf dem Feld der Wirtschaftspolitik. Und schon damals, wie ich fand, auf groteske Weise überschätzt, denn er verfügte über keinerlei vorzeigbare Erfahrungen als Unternehmer, als Manager oder Wirtschaftspolitiker.
Dass pflichtschuldige Kritik vom damaligen Koalitionspartner CDU/CSU kam, war erwartbar. Wenig überraschend war auch, dass sich viele glühende Sozialisten über den Plan echauffierten: Es komme darin viel zu oft »das Wort Deutschland« vor (nämlich 149-mal), das Begriffspaar »soziale Gerechtigkeit« dagegen nur zweimal. Und weiter: »Unablässig geht es darum, dass Deutschland ›Leitmärkte der Zukunft erkennen und ansteuern‹, die deutsche Softwarebranche auf ›Augenhöhe mit den USA‹ gebracht werden und Deutschland ›beim Leitmarkt Elektromobilität zum Durchbruch‹ verholfen werden müsse. Auch bei erneuerbaren Energien soll Deutschland bald den ›Spitzenplatz‹ einnehmen.« Ja, das hatten die Linken, die dagegen auf »sozialistische Maßnahmen« gegen das »kapitalistische Profitsystem« setzen wollten, richtig erkannt: Steinmeiers Deutschland-Plan war innovativ, wirtschaftsfreundlich und arbeitnehmerfreundlich – und seiner Zeit wahrscheinlich etwas voraus.2 Leider: Auch wer zu früh kommt …
Was unterging im Wahlkampf des Jahres 2009: Steinmeier wollte die SPD damals mit einer Bildungsoffensive als »Partei des Aufstiegs« positionieren. Auch das war ein Grund für mich gewesen, in sein Team zu gehen.
An den Spirit im Team um Frank-Walter Steinmeier denke ich noch heute gerne zurück. Er erinnert mich an das Jahr vor der Bundestagswahl 2021, als sich die FDP überlegte, wie sie im Falle einer Regierungsbeteiligung wichtige Reformvorhaben durchsetzen könnte. Und an die Koalitionsverhandlungen im Herbst 2021, als sich alle Beteiligten schnell darauf verständigten, dass man nur eine Regierung bilden kann, wenn man nach vorne blickt und das ins Visier nimmt, was man zusammen anpacken kann, statt sich darüber zu zerstreiten, wo man zu weit auseinanderliegt.
Zurück zum Jahr 2009: Ich fühlte ich mich sofort sehr wohl in der Rolle des »Schatten-Wirtschaftsministers«. Auch wenn wir das so bewusst nicht genannt hatten. Der Fokus sollte nicht abstrakt auf »der« Wirtschaft liegen, sondern auf der mittelständischen Wirtschaft: Einerseits hatten gerade viele kleine und mittelständische Unternehmen im Zuge der Wirtschaftskrise nach der Pleite der US-Investmentbank Lehman Brothers Probleme bei der Erlangung oder Verlängerung von Krediten. Und andererseits war Frank-Walter Steinmeier sehr bewusst, dass der Innovationstreiber der deutschen Wirtschaft die mittelständische Industrie war. Das waren die beiden hauptsächlichen Gründe, warum er auf mich zugegangen war und nicht auf eine vielleicht bekanntere Persönlichkeit eines großen Unternehmens. Denn ich stand – und stehe – für die mittelständische Sicht auf die Dinge. Und ich hatte Erfahrungen bei Banken gesammelt und wusste um die Probleme bei der Kreditvergabe.
Die innovative Herangehensweise, die Idee, einen dritten Weg zu versuchen zwischen altbackenem rheinischem Kapitalismus, der erkennbar ausgedient hatte, und neosozialistischen Ideen, die unverdrossen von links kamen, entsprach ganz und gar meiner Lebensphilosophie. Denn eines war mir damals schon völlig klar: Die soziale Marktwirtschaft braucht Menschen, die unternehmerisch handeln, Arbeitsplätze schaffen und Erfolg haben.
Oder anders gesagt: Die soziale Marktwirtschaft ist nicht nur deshalb »sozial«, weil es Mitbestimmung, gute soziale Sicherungssysteme und Rechte für abhängig Beschäftigte gibt, sondern weil sich Wettbewerb und freies Unternehmertum mit sozialem Ausgleich verbinden. Weil ein freies Unternehmertum jenen Wohlstand erwirtschaftet, der als Steuereinnahmen an den Staat fließt. Und weil jeder Mensch zählt.
Wie wir alle wissen, schnitt die SPD bei dieser Bundestagswahl ausgesprochen schlecht ab. Und ich war nicht nur um einige Erfahrungen reicher, ich hatte auch ziemlich viel gelernt. Über mich, über Deutschlands Wirtschaft und die Rolle der Politik – und über meine damalige Partei, die SPD.
Nachdem die SPD sich also in der Opposition wiederfand, wollte ich ein Buch über die Gründe dieser herben Niederlage schreiben. Und darüber, was sich in der SPD alles ändern müsste. Wochenlang habe ich an meinem Manuskript gefeilt. Vieles ging mir durch den Kopf. Die SPD, in die ich im Alter von 16 eingetreten war, schien 2009, nach sieben Jahren Regierungsverantwortung unter Gerhard Schröder und weiteren vier Jahren unter Angela Merkel, an einem toten Punkt angekommen.
Als ich nach Wochen harter Arbeit die ersten Kapitel fertig hatte, packte ich sie in einen Umschlag und schickte sie Helmut Schmidt, zu dem ich einen besonderen Draht besaß und den ich mir sozusagen als Mentor auserkoren hatte. Er war damals hochgeachteter Herausgeber der Wochenzeitung Die Zeit. Bald darauf fuhr ich nach Hamburg und durfte ihn treffen. Ich rechnete es ihm hoch an, dass er mir auch diesen Termin wieder schnell und unkompliziert gewährte, denn er war ja schon betagt und musste mit seinen Kräften mehr haushalten als in früheren Jahren.
Und nun saß ich ihm wieder einmal gegenüber: Ich, der Ex-Schatten-Wirtschaftsminister, der Rheinhesse aus Worms, 38 Jahre jung, der seiner sozialdemokratischen Partei den deutschen Mittelstand näherbringen wollte. Ich schaute in die ironisch blitzenden Augen des 91-jährigen Alt-Bundeskanzlers, einem hanseatischen Elder Statesman durch und durch. Selbstsicher, beinahe schmerzhaft distanziert und mit einem scharfen Urteilsvermögen gesegnet. Schweigend blätterte er in meinem Manuskript, das vor ihm auf dem Tisch lag. An den vielen Anstreichungen sah ich, dass er nicht nur hineingeschaut hatte, sondern die ersten sechs Kapitel meines geplanten Buches über unsere Partei wirklich gelesen hatte. Was mich mit Stolz, aber auch einer gehörigen Portion Nervosität erfüllte. Ich dachte, er würde jede Sekunde loslegen: mit Kritik. Mit Anregungen. Doch der Hanseat Schmidt schwieg und blätterte. Dann brummte er, zog den Aschenbecher heran und steckte sich eine seiner berüchtigten Mentholzigaretten an. Nach gefühlt zwei sehr langen Minuten schaute er schließlich auf und sagte: »Herr Christ, lassen Sie es. Dieses Buch braucht die Welt nicht.«
Ich war einigermaßen vor den Kopf gestoßen.
»Wissen Sie, Herr Christ«, und dann musste er kurz husten und nahm einen Schluck Cola light, »ich entnehme Ihrem Manuskript, dass Sie das Bildungsthema umtreibt. Dass Sie verstanden haben, dass Wohlstand, Globalisierung und die Finanzierung unserer Sozialsysteme mit dem Thema Bildung zu tun haben. Dass unsere Wirtschaft von nur einer einzigen Ressource wirklich abhängig ist: von gut ausgebildeten Leuten. Von Facharbeitern. Von Leuten, die etwas können. Schreiben Sie doch darüber. Schreiben Sie über das Querschnittsthema Bildung. Damit können Sie nicht nur in unserer Partei viel Gutes tun, sondern auch für unser Land.«
Helmut Schmidt war einer der weitsichtigsten und intelligentesten Politiker, die ich in meinem Leben kennengelernt habe. Ich bin stolz darauf, dass ich die Möglichkeit hatte, ihn und seine liebe Frau Loki viele Jahre immer wieder getroffen zu haben und dass ich sie dabei immer besser kennenlernen konnte. Wir haben dabei viel geraucht – ich bekenne, das ist ein Laster, das ich noch immer nicht abgestellt habe. Wir haben viel diskutiert. Und vor allem ich habe sehr viel gelernt.
Schmidt hatte, wie so oft, recht: Statt sich an einer verdienst- und traditionsreichen, komplizierten und in weiten Teilen leider auch reichlich verstockten Partei abzuarbeiten, könnte ich alles das zusammenfassen und aufschreiben, was mir, dem Mittelstandsversteher, der aus einfachen Verhältnissen kommt und sich nach oben gearbeitet hat, wirklich wichtig war. Was ich erfahren und erkannt hatte und was meines Erachtens geändert werden müsste. Anderthalb Jahre später publizierte ich in einem kleinen Verlag das Buch Deutschlands ungenutzte Ressourcen. Darin habe ich viele Statistiken und allerlei Fakten zusammengetragen und versucht, die Defizite Deutschlands beim Thema Bildung darzustellen. Und zwar nicht aus bildungspolitischer Perspektive, schließlich bin ich da Laie, sondern aus makroökonomischer Perspektive. Denn diese Sichtweise ist in Deutschland chronisch unterbelichtet.
Seitdem hat mich dieses Thema nicht mehr losgelassen, und das hat mehrere Gründe. Zum einen hat es natürlich mit meiner Herkunft und meiner eigenen Bildungsbiografie zu tun. Den Wert von Bildung als Startrampe für Erfolg im Beruf, für gesellschaftlichen Aufstieg und finanzielle Unabhängigkeit habe ich selbst erfahren. Zum anderen bin ich im Laufe meiner beruflichen Karriere dem Thema in vielerlei Gestalt begegnet. Als ich dieses Buch nach einigen Jahren wieder in die Hand nahm, war ich verblüfft und erschrocken, wie wenig sich seither geändert hatte. Im Gegenteil: Vieles hat sich eher verschlimmert. Weil es politisch verdrängt und nicht angepackt worden ist. Bis jetzt.
Bildung, Ausbildung, Kompetenzen
Als ich 1988 in die SPD eintrat, in der rheinland-pfälzischen Heimat, war das noch eine Partei von altem sozialdemokratischem Schrot und Korn. Das war selbst bei den Jusos zu spüren, auch wenn wir natürlich begeistert Systemfragen diskutierten und uns am Kapitalismus – oder daran, was wir dafür hielten – abarbeiteten.
Ich komme aus einem Arbeiterhaushalt. Abitur habe ich nie gemacht, und studiert habe ich auch nicht. Aber ich habe eine solide Ausbildung als Industriekaufmann bei den Stadtwerken in meiner Heimatstadt Worms gemacht. Dazu berufsbegleitend eine Zusatzausbildung in der Bank- und Versicherungswirtschaft absolviert, und zwar bei der BHW Bausparkasse, die heute zur Deutschen Bank gehört. Seitdem wurde ich schon oft nach meiner Ausbildung gefragt. Die Antwort ist immer die gleiche: Die kaufmännische Lehre und die berufsbegleitende Zusatzausbildung auf dem zweiten Bildungsweg war und ist für mich die Basis für alles Weitere auf meinem beruflichen Lebensweg. Auf dieser Basis waren Learning by Doing und eine Karriere durch Fleiß und Engagement möglich. Ich hatte das Glück, im Vertrieb der Bausparkasse eingesetzt zu sein. Dort wurde einerseits gute Leistung unmittelbar sichtbar und auch belohnt, andererseits hatte ich dort viel und ganz direkt mit Menschen zu tun. Und wenn ich etwas mag, dann ist es das: mit und für unterschiedliche Menschen zu arbeiten, etwas aufzubauen und Möglichkeiten auszuloten, um die Lebensverhältnisse für diese Menschen zu verbessern.
Je mehr Verantwortung ich im Laufe der Zeit übernahm und je länger ich in Unternehmen in Führungspositionen tätig war, desto klarer wurde mir, dass Bildung und alles, was damit zusammenhängt, vom »Training on the Job« über die Ausbildung an Berufs- und Fachhochschulen bis hin zur universitären Ausbildung, nicht nur der Schlüssel für privates Fortkommen und Zufriedenheit ist, sondern auch Grundvoraussetzung für gesellschaftlichen Wohlstand.
Selbst der Begriff »Herzensbildung« trägt das, was Bildung umfasst, in sich, und das ist kein Zufall. Denn es geht immer um das Miteinander von Menschen. Das ist mir wichtig.
Ein kluger Mensch hat einmal das Bonmot geprägt: »Bildung fängt da an, wo Wissen aufhört.« Dieser Satz gefällt mir. Denn er verweist darauf, dass es oft gar nicht so sehr auf auswendig gelerntes Detailwissen ankommt, sondern auf Kompetenzen. Ein Mitarbeiter in der verarbeitenden Industrie muss ein Gefühl dafür haben, ob die Maschinen rundlaufen, ob irgendetwas nicht in Ordnung ist und welche Abläufe vielleicht verändert werden sollten, um etwas qualitativ zu verbessern. Man könnte es auch Erfahrung nennen. Gleichzeitig müssen natürlich erst einmal die Grundlagen geschaffen sein, um sich Kompetenz und Erfahrung erwerben zu können und daraufhin ständig dazulernen zu können.
Um nicht falsch verstanden zu werden: Der pädagogischen Mode, nur noch von Kompetenzen und Kompetenzzielen, ja von »Kompetenzkompetenz« zu fabulieren, folge ich ausdrücklich nicht. Gute Bildung und eine fundierte Ausbildung sind nicht zu ersetzen. Sie sind nötiger denn je, gerade weil das Wissen explodiert, Verfahrenstechniken sich schnell wandeln und die voranschreitende Digitalisierung auch in Zukunft zu disruptiven Veränderungen in Produktions- und Vertriebsprozessen führen wird. Und: Nein, es reicht nicht, ein Smartphone in der Tasche zu haben. Motto: Man kann ja alles »im Internet« schnell nachsehen, weshalb man selbst keinerlei Bildung, keinerlei Wissen, keinerlei Know-how mehr brauche. Diese Antwort auf die digitale Revolution und ihre Möglichkeiten einerseits und die exponentielle Vermehrung von Wissen andererseits ist die ignoranteste, die man geben kann.
Es lohnt sich hingegen, einen Schritt zurückzutreten: Das alte humanistische Verständnis von Bildung meinte eine Art »Programm der Selbstbildung des Menschen«, die Entwicklung einer Persönlichkeit, die Entfaltung von Körper, Geist und Seele sowie das Entdecken von Talenten und Begabungen. Alles das galt als Voraussetzung für persönliche Mündigkeit, auch und gerade als Staatsbürger. Und auch als Voraussetzung von Zivilisation.3 Deshalb knüpfte Wilhelm von Humboldt, der große preußische Bildungsreformer, auch an genau dieses Bildungsideal an. Mit Erfolg. Noch heute funktionieren die führenden amerikanischen Universitäten nach seinem Masterplan.
Natürlich sind die Herausforderungen im 21. Jahrhundert andere. Vor allem geht es um sehr viel mehr als Schule und Universität. Es geht um das Zusammendenken der Voraussetzungen von wirtschaftlichem Erfolg, persönlicher Zufriedenheit und gesellschaftlicher Prosperität.
Das Schielen auf die Zahlen derjenigen, die eine Universität besuchen, reicht allerdings nicht. Rein akademisches Know-how ist bei weitem nicht alles – heute nicht und auch nicht in absehbarer Zukunft. Ganz im Gegenteil. In vielen Industriezweigen wird es immer anspruchsvoller, Systeme, Anlagen und Gerätschaften zu programmieren, zu konfigurieren und zu überwachen. Viele klassische Handwerksbetriebe kommen ohne komplizierte technische Hilfsmittel nicht aus. Auch der gute alte Automechaniker heißt nicht umsonst schon lange Mechatroniker. Die Mechatronik stellt eine Schnittstelle der Gebiete Mechanik und Maschinenbau, Elektronik und Elektrotechnik sowie Informatik und Informationstechnik dar. Im Berufsalltag heißt das dann interdisziplinäres Zusammenwirken in Bereichen wie der Automatisierungs- oder der Systemtechnik.
Auf Feldern wie diesen müssen wir als Industrienation auf der Höhe der Zeit bleiben und weltweit zu den Besten gehören. Wir müssen genügend junge Leute zu kompetentem Nachwuchs ausbilden, der dann den Staffelstab übernehmen kann. Und der wiederum in der Lage ist, ganz eigene Akzente zu setzen. Mit anderen Worten: Unsere Schulabgänger brauchen das schulische Rüstzeug, anspruchsvolle Ausbildungsberufe erlernen zu können. An Fronten wie dieser tun wir aber als Volkswirtschaft deutlich zu wenig. Wir gefährden unsere Handwerkstradition, die wir aber brauchen: Für unser Netz von hoch spezialisierten kleinen und mittelständischen Betrieben, für unsere verarbeitende Industrie, für unsere Volkswirtschaft insgesamt.
In vielerlei Hinsicht sind wir eben keine Bildungsnation mehr – auch wenn dieses Ideal in Sonntagsreden immer aufs Neue beschworen wird. Doch Sonntagsreden und Absichtserklärungen werden nicht reichen. Wir müssen als Industrienation, deren einziger Rohstoff Bildung und Know-how ist, wieder zukunftsfest werden.
Warum also dieses Buch?
Die halbe Welt beneidet uns um das duale Ausbildungssystem. Wir könnten es zu einem Exportschlager machen – und es mit Engagement und viel politischer Rückendeckung auf kluge Weise weiterentwickeln. Es wäre einen bundesweiten Masterplan wert. Oder zumindest eine Reihe von Zoom-Konferenzen des Bundeskanzlers mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten. Nicht nur die Corona-Pandemie ist eine große Aufgabe!
Es erfüllt mich mit Sorge, wie sehr das weite Feld der Bildung noch immer stiefmütterlich behandelt wird in Deutschland. Ich beobachte seit Jahren, wie sich Bildungspädagogen ideologische Scheingefechte auf dem Rücken unserer Jugend liefern. Besonders unverständlich finde ich es, dass die Erfahrungen von Unternehmen mit ihren Nachwuchskräften nicht aktiver geprüft und übernommen werden – in der beruflichen und berufsbegleitenden Bildung, in den Lehrplänen aller Schultypen, in Fortbildungen für Erwachsene.
Und in Kursen für Migranten, die mit den Standards unseres Landes vertraut gemacht werden müssen.
Gerade mittelständisch geprägte Unternehmen, die fest in ihrer Region verankert sind, machen es oft vor, wie erstklassige Ausbildung und Bildung im Allgemeinen zu verbinden sind. Und wie man dabei erfolgreich und pragmatisch mit Behörden und den Politikern der Region zusammenarbeitet.
Der Zusammenhang von Bildung und wirtschaftlichem Erfolg und Wohlstand treibt mich um – und das seit Jahren. Zu viele Ressourcen in diesem Land bleiben nach wie vor ungenutzt. Wir werden die wirtschaftlichen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts nur meistern, wenn wir unsere wichtigste Ressource, unser Humankapital, wieder mehr schätzen und sie mobilisieren. Nach wie vor produzieren unsere Schulen zu viele Bildungsverlierer. Tendenz eher steigend als fallend. Zu viele Kinder aus Migrantenfamilien erhalten nicht die Chance, in Deutschland richtig anzukommen, aufzuschließen und beruflich erfolgreich zu werden. Was im Übrigen nicht nur volkswirtschaftlich von Belang ist, sondern auch gesellschaftlich. Denn ohne Bildung werden sich diese verlorenen Kinder und Jugendlichen kaum in unser Land integrieren können – und es auch wollen.
Hinzu kommt die Tatsache, dass wir in eine demografische Falle hineinlaufen, und das schon seit Jahren. Die deutsche Bevölkerung altert. Die sogenannten Babyboomer stehen kurz vor dem Rentenalter. Bald werden jedes Jahr viele Hunderttausend Fachleute, Ingenieurinnen und Ingenieure, Pflegekräfte, Computerspezialisten und viele andere Spezialistinnen und Spezialisten in Rente gehen. Jahr für Jahr. Wir haben zwar Zuwanderung, seit 2015 sogar in siebenstelliger Höhe. Aber sie ist völlig ungesteuert und nicht am Bedarf unserer Wirtschaft ausgerichtet. Auch das muss sich ändern, wenn wir nicht in eine krisenhafte und sehr unangenehme Gemengelage hineinlaufen wollen. Wir brauchen also auch einen »Import von Bildung« in Form von Fachleuten, die wir für unser Land gewinnen sollten.4 Und denen wir großzügige Bedingungen bieten müssen. Doch dafür gibt es – immer noch – weder die passenden Gesetze noch kompetente Stellen, die den Zuzug von Fachleuten organisieren und empathisch begleiten sowie konkrete Hilfestellung leisten.
40 Berufspolitiker und ich
Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Unternehmer und Manager dieses Landes sich wieder stärker in die gesellschaftliche Diskussion einbringen müssen. Nicht nur beim Thema Weiter- und Fortbildung. Was sehen Menschen, die wichtige Funktionen in Unternehmen haben, als wichtig an? Wo gibt es Schieflagen? Woran denken sie konkret, wenn sie an die nächsten fünf, zehn oder fünfzehn Jahre denken?
Viel zu selten hören wir in Fernseh-Talkshows von Erfahrungen, Alltagssorgen oder sich bietenden Chancen aus dem Mund von Selbstständigen, von Unternehmern, von Managerinnen und Managern. Die Podcast-Landschaft explodiert momentan geradezu. Wo sind interessante Podcast-Formate, die so aufbereitet sind, dass sie breitere Bevölkerungskreise erreichen? Warum wird nicht mehr darüber debattiert, dass im überbordenden Angebot von öffentlichen-rechtlichen Radiosendern, Internetformaten und Podcasts das Thema Wirtschaft ausgesprochen stiefmütterlich und wenn überhaupt, dann völlig unterkomplex behandelt wird? Oder gar mit einem unschönen Unterton, der suggeriert, dass Unternehmer ja »Kapitalisten« sind und ihnen schon deshalb mit Misstrauen begegnet werden müsse.
Es ist auch kritikwürdig, dass viel zu oft nur Verbandsvertreter, Lobbyisten und Sprecher von Gewerkschaften zu Wort kommen. Nichts gegen Interessenvertretungen, die laut sind und ihren Job machen. Aber wirklich weiter bringen uns deren rituelle Streitereien zumeist nicht. Leider spielen die Medien dieses rituelle Spiel nur zu gerne mit. Informativer wäre es, zum Beispiel einzelne Unternehmer zu ihren konkreten Herausforderungen und Erfahrungen zu befragen. Wie muss man sich das China-Geschäft für einen Hidden Champion aus der deutschen Provinz vorstellen? Wie bereitet man seine Mitarbeiter auf diese Herausforderungen vor? Was sind die konkreten Erfahrungen von Unternehmen mit Flüchtlingen aus fremden Kulturkreisen, und wie werden diese angelernt und in eine Belegschaft integriert? Am konkreten Beispiel lernt es sich zumeist am besten.
Mehr und mehr hat sich in den vergangenen zehn, fünfzehn Jahren die Haltung durchgesetzt, dass die Wirtschaft irgendwie abseits steht oder gar als Antipode zur Zivilgesellschaft zu sehen ist. Oft genug wird selbst in Kinderbüchern oder Lernmaterialien an Schulen über Unternehmerinnen und Unternehmer mit einem abfälligen Unterton geschrieben. Motto: Unternehmer sind letztlich Ausbeuter. So ist es aber nicht. Und dieses angeblich kritische, im Kern aber reichlich uninformierte Zerrbild des Unternehmers spiegelt auch nicht die Wirklichkeit in unserem Land wider.
Leider ist die Situation der Politik nicht wesentlich besser.
Als die Sondierungsgespräche zwischen SPD, FDP, Union und Grünen am 1. Oktober 2021 begannen, war ich der einzige unter den 41 Verhandlern (SPD: 6; CDU: 10; CSU: 5; FDP: 10, Grüne: 10) , der nicht Berufspolitiker war oder werden wollte. Nur die wenigsten hatten früher in der freien Wirtschaft gearbeitet oder waren Unternehmer gewesen. Bei den eigentlichen Koalitionsverhandlungen mit vielen Arbeitsgruppen, an denen bis zu 300 Fachpolitikerinnen und -politiker der drei Parteien teilnahmen, war die Quote nach meiner Beobachtung keineswegs besser (als Bundesschatzmeister meiner Partei war ich dort nicht mehr dabei).
Für ein Land, dessen Wohlstand und dessen soziale Sicherungssysteme zu 100 Prozent darauf fußen, dass es eine wettbewerbsfähige Wirtschaft gibt, die trotz hoher Löhne und hoher Sozialabgaben wettbewerbsfähig ist und ihre Produkte und Dienstleistungen verkaufen kann, ist das eine inakzeptable Situation.
Das Ende von Angela Merkels Großer Koalition oder: Die Parallelen zum Jahr 1969
Am 26. September 2021 hat Deutschland ein neues Parlament gewählt. Und damit auch entschieden, wer in den kommenden Jahren die Regierung bilden wird. Nach 16 Jahren und vier Regierungen unter Angela Merkel bricht mit der neuen Regierung auch eine neue Zeit an. Endlich!, möchte man ausrufen. Denn die 20er-Jahre des 21. Jahrhunderts müssen endlich gestaltet werden. Einfach so weiterwurschteln wie bisher, nichts erklären, sich als Land, als Gesellschaft nichts vornehmen und ansonsten hoffen, dass alles schon irgendwie klappt und der Wohlstand erhalten bleibt, das ist jedenfalls meiner Ansicht nach keine akzeptable Regierungspolitik.
Besonders die letzten zwei Großen Koalitionen von CDU/CSU und SPD ab 2013 empfand ich als zunehmend unbefriedigend. Zu viel ist liegen geblieben, zu sehr haben sich die beiden Koalitionsparteien gegenseitig blockiert. Viel wurde geredet von der fehlenden Digitalisierung, den gefährdeten sozialen Sicherungssystemen, von Infrastruktur und Überbürokratisierung. Gestaltet wurde kaum etwas. Zu »faul« waren die vielen Kompromisse, die in der immer kleiner werdenden »Großen Koalition« gemacht wurden.