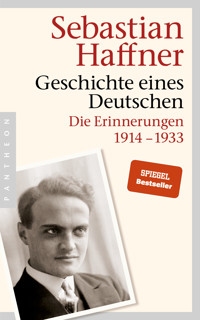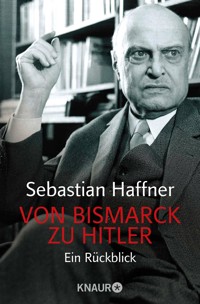9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Meisterstücke historischer Essayistik Nüchtern und doch mitreißend setzt Sebastian Haffner sich mit markanten Personen und Ereignissen aus Geschichte und Zeitgeschichte auseinander, greift politische Probleme, Phänomene und Theorien auf. Seine Ausführungen, die teils Zustimmung, teils Widerspruch provozieren, geraten dank seines Formulierungsvermögens zu Literatur: Sebastian Haffner erweist sich hier als großer Schreiber deutscher Sprache. »Das publizistische Werk Sebastian Haffners ..., das sich durch Originalität und Klarsicht auszeichnet, leistet einen wesentlichen Beitrag zum Verständnis unferner deutscher Vergangenheit und damit auch der unmittelbaren Gegenwart.« Das war die Begründung für die Verleihung des Heine-Preises an diesen Autor. Über Haffners Arbeiten zu historischen und zeitgeschichtlichen Themen schrieb Joachim Fest, vielfach seien »stimulierende, gedankenreiche und überdies stilistisch glanzvolle, kurz meisterliche Stücke der historischen Essayistik« entstanden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 319
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Sebastian Haffner
Zur Zeitgeschichte
36 Essays
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Meisterstücke historischer Essayistik
Nüchtern und doch mitreißend setzt Sebastian Haffner sich mit markanten Personen und Ereignissen aus Geschichte und Zeitgeschichte auseinander, greift politische Probleme, Phänomene und Theorien auf. Seine Ausführungen, die teils Zustimmung, teils Widerspruch provozieren, geraten dank seines Formulierungsvermögens zu Literatur: Sebastian Haffner erweist sich hier als großer Schreiber deutscher Sprache.
Über Sebastian Haffner
Sebastian Haffner, geboren 1907 in Berlin, war promovierter Jurist. Er emigrierte 1938 nach England und arbeitete als freier Journalist für den «Observer». 1954 kehrte er nach Deutschland zurück, schrieb zunächst für die «Welt», später für den «Stern». Sebastian Haffner starb 1999.
Inhaltsübersicht
Statt eines Vorworts
Es ist mit Meinungen, die man wagt, wie mit Steinen, die man voran im Brette bewegt; sie können geschlagen werden, aber sie haben ein Spiel eingeleitet, das gewonnen wird.
Goethe, Maximen und Reflexionen
Wenn ich die Meinung eines anderen anhören soll, so muß sie positiv ausgesprochen werden; Problematisches hab’ ich in mir selbst genug.
Derselbe, ebenda
Über Geschichtsschreibung
Geschichtsschreibung ist in erster Linie eine Kunst; wie jede Kunst besteht sie hauptsächlich im Weglassen. Die meisten englischen und französischen Geschichtsschreiber wissen das instinktiv; deswegen sind sie so lesbar und so wirksam. Die meisten deutschen und amerikanischen Geschichtsschreiber wissen es nicht; fast alle ihre Werke sind überdokumentierte, unlesbare Wälzer (die Unlesbarkeit fängt schon damit an, daß man sie im Bett, wo die meisten Leute lesen, nicht in der Hand halten kann). Die meisten deutschen Historiker wollen dem Leser mit ihren Detailkenntnissen imponieren und ertränken ihn in Material. Der Historiker ist aber gerade dazu da, dem Leser die Materialverarbeitung abzunehmen und ihm Extrakte und Resultate zu liefern, und zwar in pointierter, griffiger Form. Das ist schwerer, als einfach seine Zettelkästen über den Leser auszuschütten; aber man wird auch dafür belohnt: Man wird gelesen, und zwar mit Genuß und Dankbarkeit.
Geschichtsschreibung ist aber auch eine Art Wissenschaft. Ich sage vorsichtig »eine Art Wissenschaft«, denn eine wirkliche Wissenschaft, wie etwa Philologie und Mathematik, Physik und Biologie, ist sie nicht. Das Material ist zu widerstrebend, und die Werkzeuge sind zu stumpf. Die »Quellen« – du lieber Gott! Die Quellen sind hauptsächlich die Zwecklügen von verstorbenen Politikern oder Höflingen. Politische Geschichte ist ja, ähnlich wie Kriminalistik, immer mit der Sisyphus-Arbeit beschäftigt, Taten aufzuklären, deren Täter alles Interesse daran hatten, sie der Aufklärung zu entziehen; während Sozialgeschichte und Ideengeschichte wiederum nachträglich wissen und verstehen möchten, was die Leute damals, als sie es erlebten, selber nicht wußten und nicht verstanden. Im Grunde genommen versucht die »Geschichtswissenschaft« ständig das Unmögliche.
Trotzdem, wenn die Geschichtsschreibung den Versuch der Wissenschaftlichkeit ganz und gar aufgibt, artet sie in reine Legendenproduktion und Propaganda aus, und das ist auch wieder nichts. Mindestens zwei wissenschaftliche Erfordernisse muß ein Geschichtswerk erfüllen: Es muß sein Thema definieren, sozusagen eine beantwortbare Frage stellen; und es muß ein Denk- und Begriffssystem erkennen lassen, mit dem es seinem Material zu Leibe geht. Viele Historiker sind sich selbst nicht darüber im klaren, von welchem Standpunkt aus und mit welchem begrifflichen Koordinatensystem sie eigentlich arbeiten, sie betrügen sich und ihre Leser mit der Illusion der »Voraussetzungslosigkeit«. Dabei kann nichts Brauchbares herauskommen.
Arthur Rosenberg stellt sich in der »Entstehung der Weimarer Republik« eine klare Frage, er operiert wie ein Physiker, der ein Experiment macht und Nebenerscheinungen möglichst eliminiert. Er will wissen – genau wissen –, wie aus dem Bismarckschen Kaiserreich die Weimarer Republik geworden ist. Dazu muß er die Vorgeschichte und Geschichte des Ersten Weltkrieges erforschen, erzählen und zum Teil analysieren, und das tut er – knapp, glänzend, pointiert, sozusagen mit zusammengekniffenen Augen scharf hinsehend; aber immer nur unter dem ihn interessierenden Gesichtspunkt der verfassungspolitischen Transformationen, die damals unter dem Druck der Ereignisse erst fast unmerklich, dann immer überstürzter in Deutschland vonstatten gingen. Er läßt sich durch die (an sich ja hochinteressanten) außenpolitischen und militärischen Seiten des Ersten Weltkrieges nicht ablenken, er bleibt streng bei der Sache, und das macht seine Darstellung schlüssig, sinnvoll und, nebenbei, enorm spannend.
Diese Konzentration aufs Thema, die übrigens eine höllische Selbstdisziplin erfordert – es gibt, wenn man in eine Geschichtsperiode forschend eindringt, immer so viele verlockende Seitenwege, es ist immer noch so viel anderes passiert, was eigentlich auch schrecklich interessant war –, ist meiner Lesererfahrung nach das Hauptgeheimnis erfolgreicher Geschichtsschreibung. Dadurch schaltet der Historiker nämlich den Zufall aus.
In gewissem Sinne könnte man ja sagen, daß Geschichte nur aus Zufall besteht, und das ist es, was sie oft so langweilig macht. Was ist ermüdender als eine unabsehbare Folge und Häufung von Zufällen? Aber wiederum, was ist Zufall? Nur eine Frage der Betrachtungsweise. Stell dich quer zur Geschichte, sieh das Geschehen eines Tages oder eines Jahres oder auch einer ganzen Epoche sozusagen von der Seite an, wie es die Zeitungen tun, und du siehst nur Zufall. Stell dich längs, konzentriere dein Fernrohr auf eine und nur eine Frage, schirme alles ab, was nicht zur Sache gehört, und der Zufall verschwindet wie durch Zauber. Das ist Historik, im Gegensatz zum Journalismus. Leider sind viele Historiker nur Journalisten des Gestern. (Rankes berühmtes Leitziel, wissen zu wollen, »wie es eigentlich gewesen ist«, ist als Arbeitsanleitung nicht ungefährlich. Man muß sofort zurückfragen: »Wie was eigentlich gewesen ist?«).
Rosenberg ist ein Marxist, also ein Mann, für den der Klassenkampf der Schlüssel zur Geschichte ist. Das mag manchen nichtmarxistischen Leser abschrecken (ich bin selber kein Marxist), aber es hat seine Vorteile. Mindestens hat er überhaupt einen Schlüssel, mindestens weiß man, woran man bei ihm ist, und fühlt sich nicht, wie bei so vielen Historikern, in der Hand eines Fremdenführers, der sich in der Gegend, durch die er einen führt, selber nicht auskennt. Außerdem aber ist die marxsche Kartographie gerade für die Periode, durch die Rosenberg seine Leser führt, eben doch sehr ergiebig; man kommt mit ihr auf manche Aussichtspunkte, die anders kaum zugänglich sind.
Marx war ja nicht nur ein Prophet, sondern auch ein Wissenschaftler; nicht nur der Erzvater aller kommunistischen Parteien, von denen heute freilich keine mehr marxsche Politik macht, sondern auch der eigentliche Begründer der wissenschaftlichen Soziologie, die sich seither freilich auch von Marx wegentwickelt hat. Marx’ Soziologie war sozusagen soziologische Mechanik; die heutige ist mehr soziologische Chemie. Marx sah die Klassen als gegebene feste Größen und analysierte ihre Beziehungen, die sich bei ihm fast wie Beziehungen zwischen Staaten ausnehmen: Herrschaft, Unterwerfung oder Kompromiß, Kampf, Waffenstillstand, Bündnis. Heute interessiert man sich mehr dafür, was Klassen eigentlich sind, wie sie entstehen und vergehen, sich wandeln, verschmelzen, scheinbar verschwinden und sich unversehens neubilden. Man kann mit dem Marxschen Begriffsinventar den heutigen sozialen Entwicklungen gerade in den sozialistischen Ländern nicht beikommen und denen in den kapitalistisch gebliebenen oft auch nicht mehr so recht.
Aber für sein eigenes Jahrhundert, das europäische Jahrhundert zwischen der Französischen und der Russischen Revolution, bleibt der wissenschaftliche Marxismus eine sehr fruchtbare Betrachtungsweise; und mit diesem Jahrhundert hat es Rosenberg ja zu tun.
Dies Jahrhundert war nämlich wirklich das klassische Jahrhundert des Klassenkampfs, und ein sozialanalytischer Geist wie Marx wurde auf seine Theorien und Doktrinen geradezu mit der Nase gestoßen durch das, was rund um ihn herum überall vor sich ging. Das 19. Jahrhundert war, sozusagen, das marxistische Jahrhundert. Seine aristokratischen und bürgerlichen Politiker ebenso wie seine Revolutionäre waren im Grunde alle gute Marxisten, wenn auch natürlich gänzlich unbewußte; sie alle machten in aller Unschuld im Interesse der einen oder anderen Klasse die Art von Klassenpolitik, die Marx analysierte. (Wo Marx meiner Meinung nach irrte, war darin, daß er den Klassenkampf seiner Zeit in die gesamte Vergangenheit zurückprojizierte und aus der gesamten Zukunft verbannen zu können glaubte.) Heutige Klassenpolitik wird in Ost und West etwas anders gemacht; sie wartet noch auf ihren Marx. (Es ist ähnlich wie mit Freud, dessen Entdeckungen auch nur so lange stimmten, wie sie noch schockierten; als man aufhörte, die Sexualität zu verdrängen, füllte sich das Unterbewußtsein alsbald mit anderen, neuen Verdrängungen, die noch auf ihren Freud warten.) Da Rosenbergs Geschichte sozusagen in der spätmarxistischen Periode spielt, vor der russischen Revolution, trifft es sich sehr gut, daß sie von einem Marxisten erzählt wird; er kann sie uns viel besser erklären, als es z.B. ein Katholik oder ein Liberaler könnte.
Es ist ja überhaupt so, daß zeitgenössische Geschichte die beste Geschichte ist. Thukydides bleibt nicht zufällig das unerreichte Vorbild aller Historiker. Im Grunde weiß eben doch nur der Zeitgenosse, »wie es eigentlich gewesen ist«. Alle Quellenforschung und Quellenkritik ersetzt nicht die eigenen Augen, die es wirklich gesehen haben, und vor allem nicht die eigene Nase, die es wirklich gerochen hat. Es gibt für den Historiker räumlich und zeitlich eine Art Idealdistanz zu seinem Gegenstand: räumlich die des gerade noch Beteiligten, der dabei war und ein bißchen mitgemischt hat, ohne geradezu im Mittelpunkt zu stehen; zeitlich ungefähr zehn bis zwanzig Jahre danach, wenn sich die Erinnerung gesetzt hat, aber noch nicht verblichen ist. Genau dies war Rosenbergs Distanz von den Ereignissen, als er die Entstehung der Deutschen Republik schrieb. Daß er außerdem noch ein Mann von hoher Wahrheitsliebe und Fairneß war, ein gelernter Fachhistoriker und ein glänzender Schriftsteller, ergab einen Glücksfall, für den ich in Deutschland im 20. Jahrhundert keine Parallele weiß.
Arthur Rosenberg
Entstehung der Weimarer Republik
Europäische Verlagsanstalt, Frankfurt/Main
Der Dreißigjährige Krieg (geschrieben 1965)
C.V. Wedgwoods »Dreißigjähriger Krieg«, den ich gerade zum zweitenmal gelesen habe, ist immer noch die beste Monographie über den Dreißigjährigen Krieg, die es gibt, immer noch das letzte Wort der Geschichtsschreibung über diesen Gegenstand, und es ist heute aktueller als je – wie ich beim Wiederlesen, auf Kosten meines Schlafs, bemerkt habe.
Als ich das Buch zum erstenmal las, noch in meiner Londoner Zeit, las ich es hauptsächlich mit ästhetischem Vergnügen. Es ist wunderbar geschrieben (für meinen Geschmack viel besser als Ricarda Huchs überopulent instrumentierter »Großer Krieg in Deutschland« – viel sparsamer, präziser, federnder), und es ist wunderbar komponiert. Die ganze Wirrnis wird durchsichtig, die verschlungene politische Handlung verständlich, das Ineinandergreifen der Motive, die Riesenbesetzung an dramatis personae – alles ist so sauber und appetitlich auseinanderseziert wie eine Wagnerpartitur in einer Toscanini-Aufführung. Außerdem hat man ein höchst angenehmes Gefühl von Verläßlichkeit, man fühlt sich sozusagen in guten Händen. Denn Miß Wedgwood ist die Fairneß selbst, nicht nur gegenüber den historischen Personen, mit denen sie es zu tun hat (sie nimmt nicht Partei, sie nimmt es niemandem übel, daß er seinen eigenen Interessen und auch seinen eigenen Vorurteilen folgt, sie schreibt mit Nachsicht und Mitleid, sie versteht und verzeiht sogar viel Fanatismus und Uneinsichtigkeit, nur gegen eitle Unzulänglichkeit wird sie manchmal empfindlich) – aber sie ist vor allem fair gegenüber dem Leser. Wenn sie etwas nicht weiß oder wenn etwas verschiedene Auslegungen zuläßt, dann sagt sie das. Welche Wohltat!
Damals also, vor fünfzehn Jahren in London, habe ich das Buch einfach genossen. Jetzt aber, 1965 in Deutschland, als ich den Genuß wiederholen wollte, bin ich erschrocken und habe mehrfach nach der Lektüre nicht schlafen können, denn ich habe mit Bestürzung in dem Deutschland des Dreißigjährigen Krieges das Deutschland von heute wiedererkannt. Es ist vollkommen unheimlich, wie porträtgetreu alles damals schon da war – die schreckliche Mittelmäßigkeit der Politiker, der kleinkarierte, pedantische Stil, die phrasendrescherische Wichtigtuerei, die Freude an der Rechtsfiktion als Mittel der Politik, die ständige Bereitschaft, ein Haus anzuzünden, um eine Suppe daran zu kochen, die Realitätsblindheit, die selbstverständliche und ungraziöse Korruption, die (damals theologischen) großen Worte für kleinste und kleinlichste Interessen, die jederzeitige Bereitschaft, fremde Mächte als Verbündete gegen den andersgläubigen Landsmann und Nachbarn zu suchen, das Sture, Enge, Verbiesterte, Unduldsame, Verfolgungssüchtige – und unten, beim Volk, die Lammsgeduld, die unerschütterliche Untertänigkeit, die unerschöpfliche Bereitschaft, alles mit sich machen zu lassen, aber leider auch die unbegrenzte Bereitschaft zur Brutalität auf Befehl – o Gott, o Gott! Es war alles ganz genauso schon damals da. Und es hat damals immerhin schon einmal Deutschland an den Rand der Selbstausrottung gebracht – obwohl es damals noch keine Atombomben gab.
Auf Schritt und Tritt begegnet man in dieser vor fast dreißig Jahren geschriebenen Geschichte einer mehr als dreihundert Jahre zurückliegenden deutschen Katastrophe lieben bekannten Gesichtern aus der deutschen Gegenwart. Soviel vertraute Mittelmäßigkeit – und so ungeheuerliche Resultate! Auf den ersten Blick scheint das Mißverhältnis zwischen Taten und Tätern unfaßbar. Aber es ist wohl so, daß eine bestimmte Sorte von Dummheit das Allerschrecklichste auf der Welt anrichtet. Diese Art von Dummheit, und dazu die heutigen Waffen – nicht auszudenken.
Die ungeheure Verwüstung Deutschlands durch den Dreißigjährigen Krieg bleibt übrigens etwas Rätselhaftes – auch wenn man, mit Miß Wedgwood, ausrechnet, daß Deutschland in den dreißig Jahren nicht, wie die Legende behauptet, drei Viertel, sondern »nur« etwas über ein Drittel seiner Bevölkerung verlor, etwas über sieben von ungefähr einundzwanzig Millionen. Es gab ja damals noch nicht einmal Sprengstoff, Gas und Flammenwerfer; die Artillerie war nach heutigen Begriffen spielzeughaft, und die Armeen waren klein; selten mehr als 20000 bis 30000 Mann, und selten operierten mehr als höchstens drei oder vier davon gleichzeitig – in einem Gebiet, das ja auch damals schon ebenso groß war wie heute. Wie brachten sie es fertig, halb Deutschland zur Wüste zu machen und mehr als sieben Millionen Menschen umzubringen?
Offensichtlich nicht mit dem bloßen Säbel. Offensichtlich wurde der allergrößte Teil der Verwüstung nicht direkt angerichtet, sondern indirekt. Die wenigsten Opfer fielen in der Schlacht oder bei Plünderungen, die meisten kamen durch Seuchen um oder durch Hunger und Kälte, und die wenigsten Landstriche wurden direkt verwüstet, die meisten verkamen durch die Flucht ihrer Bewohner – die dann ihrerseits irgendwo starben und verdarben. Offenbar begann von einem gewissen Zeitpunkt an – besonders im letzten Drittel des Krieges – die aus ihrer Ordnung geworfene, in ihren Funktionen gestörte Gesellschaft hilflos gegen sich selbst zu wüten, so wie heute eine bombardierte Großstadt selbst für ihre Bewohner tödlich wird, so daß am Ende die einstürzenden Häuser und die ausströmenden Gasleitungen mehr Leute töten als die Bomben selbst. Der Krieg selbst schuf nur eine Infektion, die dann unkontrollierbar um sich griff.
Offensichtlich hantierte die damalige Strategie mit Mitteln, deren Auswirkungen sie nicht im Griff hatte und nicht berechnen konnte; sie wußte ganz buchstäblich nie, was sie tat. Die Art der Kriegführung sprengte den Rahmen der damaligen Zivilisation – genau wie heute, wo ja die Kriegsmittel noch deutlicher den Rahmen der gegebenen Zivilisation sprengen und vollkommen unabsehbare Kettenreaktionen von Zerstörung auslösen würden. Diesmal weiß man das ja sogar im voraus.
Wenn man sich dadurch nur abschrecken ließe! Aber gerade in Deutschland tut man das ja keineswegs. Die Politik, die man heute hier macht, ist bis in Einzelheiten dieselbe, die man damals machte. Dieselbe behagliche Unduldsamkeit, die in aller Unschuld bis zur Ausrottung des Andersdenkenden zu gehen bereit ist; und dieselbe naive Unbedenklichkeit in der Wahl der Mittel, die dann schließlich auch die eigene Ausrottung in Kauf nimmt. Die deutschen Politiker, die heute die Freiheit mit Atombomben retten wollen, sind getreue Nachfolger des Kaisers Ferdinand II., eines persönlich liebenswürdigen Mannes, der erklärte, er wolle lieber keine Untertanen haben als ketzerische.
Die allerunheimlichste Parallele aber bietet die Bereitschaft, ja die Sucht der damaligen Deutschen, sich zum Zweck der gegenseitigen Ausrottung mit fremden Mächten nicht nur zu verbünden, sondern zu identifizieren. Damals genau wie heute waren die Deutschen geradezu darauf versessen, gegeneinander übernationale, ideologisch bestimmte Verbindungen einzugehen und einen deutschen Bürgerkrieg nach Möglichkeit zum Weltkrieg in Deutschland zu machen. Die Protestanten holten nacheinander die Dänen, Schweden und Franzosen ins Land, die Katholiken die Spanier und Italiener. Die deutschen Fürsten und ihre Kanzler und Berater kamen sich genauso weise und staatsmännisch vor wie die heutigen deutschen Politiker, wenn es ihnen mit Gottes Hilfe glücklich gelungen war, sämtliche fremden Konflikte nach Deutschland hereinzuhüten. Und genau wie heute mußte das Supranationale dazu herhalten, das Subnationale möglich zu machen, und der Separatismus spielte sich als Kreuzzug auf. Die eigentlich furchtbarste Pointe des Dreißigjährigen Krieges ist noch nicht einmal, daß sämtliche in Europa schwelenden Brände allmählich nach Deutschland wie in einen Feuerwirbel hereingesaugt wurden und daß Deutschland darüber beinah zugrunde ging: sondern daß genau dies von den maßgebenden deutschen Politikern der Epoche ständig als ihr höchstes Interesse (wohl gar als höchstes deutsches Interesse) angesehen wurde, und daß sie mit dem besten Gewissen selbst in den letzten und schlimmsten Jahren alles taten, um diesen erwünschten Zustand nach Kräften zu erhalten und zu verlängern. Die Veranstalter der Katastrophe präsidierten über sie bis zum Ende mit störrischer Selbstzufriedenheit und bieder-behaglicher Pedanterie, vollkommen überzeugt, alles prächtig gemacht zu haben.
1643, nach fünfundzwanzig Jahren Krieg, bot der Kaiser, inzwischen Ferdinand III., allen seinen deutschen Feinden einen Reichsdeputationstag in Frankfurt an und allen fremden Mächten einen Friedenskongreß in Münster. Aber die Reichsstände – heute würde man sagen: die deutschen Parteien – bestanden darauf, die innerdeutschen Streitigkeiten auf den internationalen Kongreß zu tragen – heute würde man sagen: die vier Mächte nicht aus ihrer Verantwortung für Deutschland zu entlassen; und hielten dann den Doppelkongreß von Münster und Osnabrück fünf Jahre lang durch gegenseitige Nichtanerkennung, Verhandlungsverweigerung und genießerisch ausgetüftelte protokollarische Haarspalterei auf (die Unmöglichkeit, nichtanerkannte und daher nichtexistente Potentaten am selben Ort zu treffen, spielte eine große Rolle), während Deutschland fünf Jahre lang weiter verwüstet wurde. Das alles ist heute unheimlich zu lesen.
Vielleicht wird man sagen, daß ja heute immerhin nicht geplündert und gebrandschatzt wird und daß wir, während die Politiker ihren Vorfahren aus den 1640er Jahren nacheifern, in den 1960er Jahren immerhin ganz behaglich in Deutschland leben. Das stimmt schon. Wenn sich nur nicht inzwischen immer mehr und immer bessere Atomwaffen in Deutschland anhäuften. Wozu die Dummheit damals dreißig Jahre brauchte, das könnte sie heute schließlich doch noch in dreißig Stunden schaffen; sogar in dreißig Minuten.
C.V. Wedgwood
Der Dreißigjährige Krieg
List Verlag, München
Preußen
Wenn man anfängt, über Preußen ernsthaft nachzudenken, kommt man aus dem Staunen nicht mehr heraus. Die Geschichte Preußens ist die phantastischste Geschichte, die es gibt.
Sie ist kurz wie ein Gewitter. Bis 1700 hat es kein Preußen gegeben, und jetzt gibt es auch keins mehr. Kein europäischer Staat ist je so spurlos, so gänzlich unwiederherstellbar von der Bildfläche verschwunden wie Preußen.
Aber keiner hat in so kurzer Zeit so viel erlebt und so viel getan. Preußen, das war ein ununterbrochenes Drama, ständige Hochspannung, ständige Entladungen, Schlag auf Schlag. Und alles aus dem Nichts. Und danach plötzliche Stille – und wieder: nichts.
Die eigentliche preußische Geschichte dauerte nur gut anderthalb Jahrhunderte, von Friedrich Wilhelm I. bis Bismarck. Die sogenannte Vorgeschichte ist nichtssagend. Die Kurfürsten von Brandenburg waren Duodezfürsten wie viele andere; die Ordensritter längst nur noch dekorative Scheinexistenzen (was sie nicht hinderte, aufs heftigste dagegen zu protestieren, daß der Kurfürst von Brandenburg sich 1701 »König in Preußen« nennen durfte; wenn es nach ihnen gegangen wäre, hätte es Preußen nie gegeben). Im übrigen hatte das Königtum Friedrichs I. ja wirklich etwas nicht ganz Ernstzunehmendes, etwas von Großtuerei.
Und dann geht es plötzlich los: unter Friedrich Wilhelm I. die unheimliche, gewaltsame Machtakkumulation in diesem armen kleinen Sandstaat, und unter Friedrich dem Großen dann seine unglaubliche internationale Karriere: erst nur ein frecher Raubritterstreich, aber dann die sagenhafte Zähigkeit und Tapferkeit, mit der Preußen, seinen Raub verteidigend, sich gegen drei Großmächte durchbeißt. Und nun, ehe man sich’s versieht, ist es selber Großmacht und beginnt, in Europa herumzuregieren …
Bei alldem ist es immer noch ein merkwürdig künstliches Gebilde, auf der Landkarte wie ein dünner Bumerang anzusehen, mit überlangen Grenzen und einem lächerlich schmalen, wurmförmigen Körper, übrigens immer noch arm wie eine Kirchenmaus, ganz Knochen und Muskel, keine Unze Fett. Aber dann setzt es auch Fett an oder wenigstens Fleisch: 1795 bedeckt Preußen, jetzt ein Zweivölkerstaat, fast dasselbe Gebiet wie heute die DDR und Polen zusammen (wenn sie sich zusammentäten, könnten sie sich mit historischem Recht Preußen nennen), und gleichzeitig beginnt es in Preußen auf einmal kulturell hoch herzugehen: In Berlin blüht die romantische Schule auf, in Königsberg lehrt Kant. Außerdem wird Preußen hochmodern. 1799 kann ein preußischer Minister zum französischen Gesandten sagen: »Die heilsame Revolution, die ihr von unten nach oben gemacht habt, wird sich in Preußen langsam von oben nach unten vollziehen. Der König ist Demokrat auf seine Weise« – wie Friedrich Wilhelm I. Sozialist gewesen war, auf seine Weise.
Die preußische Geschichte, die meine Generation auf der Schule gelernt hat (und die wohl noch heute in manchen deutschen Schulen spukt), redet um diese glänzende Periode schamhaft herum, genau wie um die Zusammenarbeit mit Napoleons Frankreich nach dem Frieden von Basel, die Preußen die Vorherrschaft in ganz Norddeutschland eintrug – 1806 war Preußen schon nicht mehr nur Polen plus DDR, sondern Polen plus DDR plus die halbe Bundesrepublik; es regierte vom Bug bis zum Niederrhein. Dann wurde es übermütig, und dann war plötzlich alles vorbei, und 1807 existierte Preußen überhaupt nur noch von Gnaden Rußlands, und zwar wieder nur als Friedrichs schmaler Bumerangstaat. Und 1815 ist es dann doch, fast ebenso plötzlich, wieder eine Beinah-Großmacht und Deutschlands Nummer zwei, aber nun mit einem ganz anderen Staatskörper: ohne Polen (bis auf einen kleinen Rest), dafür mit dem ganzen Rheinland und dem halben Sachsen, ein merkwürdig zerrissener norddeutscher Staat, dessen getrennte Teile einander, ohne sich zu berühren, die Zeigefinger entgegenstrecken wie Gottvater und Adam bei Michelangelo.
Abenteuer genug, aber das größte und tollste Abenteuer kommt erst noch. Immerhin, der Charakter Preußens ist jetzt etabliert. Er hat vier Merkwürdigkeiten.
Erstens: Preußen existierte immer am Rande des Nichts. Eben noch ganz unbedeutend, dann Großmacht, dann zweimal plötzlich fast wieder ausgelöscht (1761, 1806), dann doch wieder Großmacht. Graf Thun, der österreichische Vertreter beim Frankfurter Bundestag, sagte 1851 zu Bismarck: »Preußen ist wie ein Mann, der in der Lotterie gewonnen hat und seitdem einen solchen Gewinn jedes Jahr in seinen Haushalt einsetzt.« Bismarck antwortete: »Wenn Sie das meinen, werden wir wohl noch einmal in dieser Lotterie spielen müssen.« Tat’s und behielt recht. Aber der Österreicher hatte auch recht. Preußen hatte wirklich immer etwas Hochgefährdetes, bei aller Tüchtigkeit fast Unwirkliches, fast Spukhaftes – man konnte es sich jederzeit wegdenken, es konnte plötzlich wieder ganz zu nichts werden, so wie es ja jetzt tatsächlich ganz zu nichts geworden ist.
Zweitens: Es hatte keine geographische Stabilität. Es dehnte sich aus und zog sich wieder zusammen wie ein Schifferklavier, und es rollte auf der europäischen Landkarte hin und her wie eine Quecksilberkugel auf einer Glasplatte – reichte einmal bis Warschau und dann wieder nur bis Frankfurt an der Oder, einmal bis Aachen und dann wieder nicht einmal bis Magdeburg. 1795 war Preußens Strom die Weichsel, zwanzig Jahre später hielt es die Wacht am Rhein. Es war unverwechselbar immer derselbe Staat – aber mit immer wechselnden Untertanen. Von denen es übrigens hieß:
»Niemand wird Preuße denn durch Not.
Ist er’s geworden, dankt er Gott.«
Drittens: Es hatte den widersprüchlichsten politischen Charakter – es war, und zwar fast sein Leben lang, zugleich das reaktionärste und das fortschrittlichste, zugleich das ungemütlichste und das duldsamste Land Europas. Der Militarismus, die barsch in alles hineinredende Bürokratie, die Steuerlast, die Junkerherrschaft, der Korporalstock – das alles war preußisch, ohne Zweifel. Aber preußisch war auch vollkommene Religionsfreiheit und Toleranz zu einer Zeit, als man anderswo noch nicht einmal davon zu träumen wagte, das weitherzigste Asylrecht, Volksschulen in jedem Dorf, eine Justiz ohne Folter, Aufklärung, Freigeisterei, sogar, schon im 18. Jahrhundert, eine gewisse Pressefreiheit. Fontane schrieb 1892 in einem Brief: »Solange in den obersten Behörden der altpreußische liberale Geist lebt und sich nicht bange machen läßt, so lange ist keine Gefahr.« Der altpreußische liberale Geist! Klingt ungewohnt, aber es gab ihn tatsächlich, und nicht nur in den Zeiten Humboldts und Hardenbergs. Aber immer zugleich mit einer furchtbar harten und fordernden, manchmal brutalen Staatsdisziplin.
Viertens: Preußen war reiner Staat – der Staat an sich, der abstrakte Staat wie kein anderer. Es gab kein preußisches Volk, keine preußische Nation; nicht einmal einen preußischen Stamm. Der König war bekanntlich der erste Diener des Staates, der Adel war privilegiert, aber nur, damit er dem Staat seine Offiziere und Beamten stellen konnte (einen privilegierten Adel gab es im 18. Jahrhundert überall in Europa; was es nur in Preußen gab, war ein privilegierter Adel, der seine Privilegien nicht genießen durfte, sondern lebenslänglich für den Staat schuften und bluten mußte). Alle Preußen dienten dem Staat. Aber wem diente der preußische Staat? Nur sich selbst – das war das Erschreckende. Keiner Idee oder Ideologie, keiner »Sendung«, keiner Religion, keiner Nation. (Gerade das erklärt vielleicht seine eigentümlich kühle Liberalität.) Dieser Staat war Selbstzweck. Niemals und nirgends sonst hat es ein solches l’art pour l’art reiner Staatlichkeit gegeben, und von hier aus wird es verständlich, daß Hegel, immerhin ein unbestechlicher Denker und obendrein ein Schwabe, den preußischen Staat als die vollkommenste Verkörperung der Staatsidee schlechthin ansehen konnte.
Aber die Menschen mögen die Abstraktion und das l’art pour l’art nicht, ertragen es vielleicht nicht einmal, es ist ihnen unheimlich. Preußen war unheimlich. Und von 1815 an ließen die Deutschen nicht ab, diesem unheimlichen Preußen, da es offenbar nicht abzuschaffen war in seiner trotzigen Zwecklosigkeit, einen Zweck anzudienen und anzuhexen, eine Aufgabe, eine Mission, eine Sendung. Und zwar eine »deutsche Sendung«. Die nachnapoleonischen Deutschen wollten ihren Nationalstaat – und Preußen sollte ihn schaffen. Das sollte Preußen von seiner Zwecklosigkeit befreien, es mit einer Aufgabe und Sendung versehen. Schmeichelhaft für Preußen, verführerisch – und tödlich.
»Preußens deutsche Sendung« – das ist Treitschkes große Erfindung, er hat die ganze deutsche und preußische Geschichte daraufhin neugedichtet, und später haben es ihm dann alle nachgebetet. Preußen, der Einiger Deutschlands – das war nun seine historische Bestimmung und war es immer gewesen, dazu 1740 und 1757 und 1807 und 1813, dafür hatte es sich großgehungert und großgekämpft, das war seine Tat und sein Ruhm. Alles Unsinn. Die Preußen wollten gar nicht. Fünfzig Jahre wehrten sie sich verzweifelt gegen die ihnen aufgedrängte Sendung. Selbst Bismarck sprach in den 1850er Jahren noch von dem »deutschnationalen Schwindel«. Er wollte preußische Politik machen, weiter nichts. Und als seine preußische Politik ihn dann doch, im Zuge des preußischen Duells mit Österreich, zum Bündnis mit dem deutschen Nationalismus und zur Reichsgründung führte, war niemand unglücklicher als die Altpreußen. Mit Recht. Für Preußen war das Bismarcksche Abenteuer glorios, aber auch paradox und der Anfang vom Ende.
Bismarcks Reich ließ drei Deutungen zu. Er selbst wollte es als ein Großpreußen, aber das blieb es nicht einmal in den zwanzig Jahren, die er es regierte. Denn das deutsche Bürgertum wollte es als deutschen Nationalstaat, in dem Preußen aufgehen sollte; und zwischen 1871 und 1918 setzte es seine Vorstellung durch. Schließlich aber steckte in »Kaiser und Reich« auch noch der alte römische und mittelalterliche Gedanke der europäischen Universalherrschaft – und am Ende wurde auch daraus noch Ernst. Mit Preußen hatte das alles nichts mehr zu tun; nicht erst der Untergang des Reichs brach ihm endgültig das Genick, sondern schon sein Aufgang, nicht erst 1945 und 1947, sondern schon 1932 und 1933. Ja, als Keim lag das alles schon in Bismarcks Tat – wenn man nicht gar sagen will: Auf die eine oder andere Art war ein tragisches Ende von vornherein in Preußens Wesen und Geschichte angelegt.
Immerhin: Was für eine Geschichte! Sie ist wie ein Drama von Kleist – fulminant, extrem auf eine auch wieder kecke Art, gleichzeitig befremdend und hinreißend, endlos interessant und jedenfalls großartig. Es ist begreiflich, daß sie zur Nacherzählung reizt wie nichts sonst in der deutschen Geschichte. Und erst jetzt, da sie wirklich ganz zu Ende ist und überschaubar vor Augen liegt, kann sie richtig erzählt werden. Die vielen Darstellungen, die glaubten, Preußens Geschichte von dem scheinbaren Happyend von 1871 aus deuten zu können, sind überholt.
Die beiden Bücher, die mir zu dieser kleinen Betrachtung Anlaß gegeben haben, sind allerdings wohl nur Vorläufer der neuen preußischen Geschichte, die jetzt möglich ist. Professor Schoeps schreibt als Apologetiker. Es ist immer sympathisch, wenn ein Historiker seinen Gegenstand mit den Augen der Liebe betrachtet. Aber Liebe macht bekanntlich auch blind – und manchmal nicht nur für die Fehler und Schwächen, sondern gerade für die interessantesten Eigenschaften und Eigentümlichkeiten des geliebten Gegenstandes. Wer verteidigt, verharmlost – und Verharmlosung ist das letzte, womit man Preußen gerecht wird. Schoeps ist gut über die Epoche Friedrich Wilhelms IV., die sein Spezialgebiet ist, und interessant in seiner verhaltenen Kritik Bismarcks. Vorher bleibt doch manches recht konventionell.
Das andere Buch, keine zusammenhängende Darstellung, sondern eine Folge von sechs Einzelvorlesungen über Spezialthemen, ist literarisch anspruchsloser, aber inhaltlich wichtiger. Fast jeder der sechs Essays enthält neues Material oder neue Gesichtspunkte; der des Herausgebers, Richard Dietrich, über Preußen und Deutschland im 19. Jahrhundert, sogar so etwas wie einen neuen Denkansatz. Auch die beiden vorangehenden, über den Kampf zwischen Monarchie und Junkertum unter Friedrich Wilhelm I. und den sehr eigenartigen Kompromiß zwischen beiden unter seinem Nachfolger, sind, auf eine etwas trockene Weise, höchst lehrreich, und die Ehrenrettung des republikanischen Nachpreußen im Weimarer Staat (von Professor Kotowski) läßt sich hören. Wenn nur das peinliche Ende nicht wäre – jener ewig blamable 20. Juli 1932, den auch der andere 20. Juli, zwölf Jahre später, nicht ungeschehen macht. Für die, die es nicht mehr wissen: Am 20. Juli 1932 wurde Preußen vom Reich die Gurgel durchgeschnitten – und zwar durch einen General aus preußischer Junkerfamilie, von Rundstedt; und Preußen wurde von einem Sozialdemokraten, Severing, verteidigt – nein, eben nicht verteidigt. An diesem 20. Juli 1932 hätte Preußen, indem es sich selbst verteidigte, vielleicht noch Deutschland retten können, vor Hitler und vor sich selbst. Es war seine allerletzte Chance. Die Preußen des 20. Juli 1944 konnten es schon nicht mehr.
Hans-Joachin Schoeps
Preußen, Geschichte eines Staates
Propyläenverlang, Berlin
Richard Dietrich (Hrsg.)
Preußen, Epochen und Probleme
seiner Geschichte
Walter de Gruyter, Berlin
1870/71 – Vorspiel zum 20. Jahrhundert
»Das ist eine blöde Geschichte von lang nachwirkenden schädlichen Folgen« – so beginnt das Kapitel »1870« in Golo Manns »Deutscher Geschichte«, und damit ist die heutige Einstellung der bundesrepublikanischen Öffentlichkeit zu dem deutsch-französischen Krieg von damals wohl ziemlich treffend umrissen: Verlegenheit, leises Bedauern, im Grunde ein Wunsch, zu vergessen. Verglichen mit dem Hurrapatriotismus, der sich früher von der Erinnerung an 70/71 nährte – in meiner Kindheit war der Sedantag noch ein alljährlicher Nationalfeiertag –, ist das zweifellos ein Fortschritt, aber der Weisheit letzter Schluß ist es nicht. Was sich 1870/1871 zwischen Deutschland und Frankreich – und in Deutschland und Frankreich – abgespielt hat, ist schon wert, daß man es sich einmal wieder vor Augen führt und darüber nachdenkt. Denn der Krieg von 1870/71 ist sozusagen ein Scharnier der Kriegsgeschichte, zugleich der letzte Kabinettskrieg und der erste Volkskrieg, zugleich ein Nachhall Friedrichs und Napoleons und eine Vorstudie für Mao. Gerade aus der Perspektive des Vietnam- und Palästinakriegs ist er nach mehr als hundert Jahren wieder aktuell. Wenn man gewissermaßen noch einmal zum Augenzeugen gemacht wird, kann man gar nicht umhin, zu bemerken, wie brandaktuell diese Geschichte ist.
Die Franzosen waren nämlich 1870 ganz dicht daran, das zu entdecken, was dann in den dreißiger Jahren unseres Jahrhunderts Mao entdeckt hat: Die Unüberwindlichkeit des Volkskriegs im eigenen Land. Sie scheiterten daran, daß sie eine bürgerliche Gesellschaft waren; eine bürgerliche Gesellschaft kann einen Volkskrieg nicht führen – auch das wurde 1870 zum erstenmal sozusagen experimentell erwiesen. Sie waren aber immerhin weit genug in der Mobilisierung der Massenguerilla gegangen, um zu bewirken, daß nach der Kapitulation die entfesselten Volkswiderstandskräfte (die sie losgelassen hatten, ohne ganz zu wissen, was sie taten) im Bürgerkrieg auf sie zurückschlugen: Mit der Pariser Kommune, diesem Vorklang der Revolutionen des 20. Jahrhunderts, explodierte die freigesetzte und dann frustrierte Massenenergie sozusagen nach innen. Es ist, als ob Leute mitten im 19. Jahrhundert ein dilettantisches Experiment mit Kernenergie gemacht und ganz aus Versehen eine kleine Atombombe gezündet hätten.
Bekanntlich hatte der siebziger Krieg drei Phasen: den »schönen« Krieg des August, kulminierend am 1. und 2. September in der klassischen Vernichtungsschlacht bei Sedan – ein Duell gleichartiger, konventioneller, im Kern professioneller Armeen, das die Deutschen dank Moltkes überlegener Generalstabsarbeit glatt und einwandfrei für sich entschieden; den »häßlichen« Winterkrieg, der auf der französischen Seite der mißglückte Versuch eines improvisierten Volkskriegs war und der mit seinen vielen furchtbaren Episoden Franzosen und Deutsche für drei Generationen zu »Erbfeinden« machte; und schließlich den französischen Bürgerkrieg, der der schrecklichste von allen dreien war und dessen Spuren in der französischen Gesellschaft bis heute nicht getilgt sind.
Die erste Phase – jahrzehntelang nachher als beinah einzige in Deutschland mit immer erneuertem Triumph erinnert und gefeiert – ist heute die uninteressanteste; sie ist eigentlich nur noch von militärgeschichtlichem Interesse. Einen solchen Feldzug hat es später nie wieder gegeben und wird es nie mehr geben. Diese Art von kunstreichem Schachspiel mit lebenden (und sterbenden) Figuren ist ausgestorben; ebenso wie die Art von kuriosem Ehrenhandel, die den Krieg auslöste, das berühmt-berüchtigte Intrigenspiel um die spanische Thronkandidatur der Hohenzollern und die Emser Depesche. Das alles hat mehr Gemeinsamkeiten mit dem Trojanischen Krieg als mit den Konflikten unserer Zeit.
Und dann, unvermittelt, geht dieser altmodisch-ritterliche Feudalkrieg, in dem sich die kriegführenden Potentaten, wenn sie »ihren Degen« übergeben, mit »Mein Herr Bruder« anreden, in Geschehnisse über, die reines vorweggenommenes 20. Jahrhundert sind: Die Revolution in Paris, die nach Sedan das Kaiserreich stürzt, ist eine genaue Parallele der russischen Februarrevolution von 1917, die Revolution der Kommune ein halbes Jahr später eine Vorskizze der Oktoberrevolution; und in dem dazwischenliegenden Winterkrieg tauchen zum erstenmal die Ideen auf, die in den sechziger Jahren unseres Jahrhunderts den Vietnamkrieg beherrschten.
Die bürgerliche französische Revolutionsregierung vom September 1870 stilisierte sich bekanntlich, mit Bismarcks Forderung nach Gebietsabtrennungen konfrontiert, als »Regierung der nationalen Verteidigung«. Was gab ihr den Mut dazu – nachdem doch alle französischen Armeen seit Sedan ausgeschaltet waren? Nichts anderes als die Grundidee, die viele Jahrzehnte später Mao so formulierte: »Die Mobilisierung des gemeinen Mannes im ganzen Land muß ein riesiges Meer schaffen, in dem der Feind ertrinkt.« Der grundrevolutionäre Gedanke, daß nationaler Widerstand nicht das gleiche ist wie konventioneller Krieg nach vorgeschriebenen Regeln, daß ein zum Widerstand mobilisiertes Volk auf die Dauer stärker sein kann – stärker sein muß – als der ins Land gedrungene Fremdkörper relativ kleiner und künstlicher Invasionsarmeen: dieser Gedanke, der im 20. Jahrhundert in China entwickelt worden ist und dann in Jugoslawien, Indonesien, in Algerien, in Vietnam immer wieder triumphiert hat – im Frankreich des Herbst 1870 hat er seinen ersten Auftritt in der Geschichte.
Freilich in sehr unvollkommener, ja dilettantischer Form. Nichts von den tief durchdachten Maoschen Doktrinen der Verbindung von politischer mit militärischer Kriegführung, der Massenindoktrinierung, der Bindung des Kampfwillens an das Klasseninteresse, der ausweichenden und hinhaltenden Ermattungsstrategie, des lang hingezogenen Kleinkriegs, des »Kriegführung-durch-Kriegführung-Lernens«. Die Organisatoren des französischen Widerstands, die Gambetta und Freycinet, waren ungeduldige Leute. Die Energie, mit der sie improvisierte neue Armeen aus dem Boden stampften, muß man bewundern – Trotzkis Leistung 1918 war nicht großartiger. Aber dann sollten diese Armeen auch gleich siegen – so siegen, wie es Napoleons professionelle Soldaten nicht gekonnt hatten. Kaum zusammengestoppelt, kaum bewaffnet, kaum ausgebildet, sollten sie in großen Entscheidungsschlachten mit Moltkes Veteranen fertig werden und Paris entsetzen. Kein Wunder, daß sie ebenso schnell geschlagen und vernichtet wie aufgestellt waren; kein Wunder auch, daß der gleichzeitig proklamierte, unorganisierte, mit der Gesamtkriegführung in keiner Weise koordinierte Volkskrieg der Franctireurs verpuffte – nachdem er furchtbare Repressalien entfesselt hatte. Moltke, der ja alles andere als ein Dummkopf war, merkte damals, daß sich hier eine ganz neue Art von Kriegführung ankündigte, daß ein Experiment gemacht wurde. »Wir erleben jetzt eine sehr interessante Zeit«, bemerkte er im November 1870, »in der die Frage: Miliz oder stehendes Heer durch die Praxis entschieden werden wird. Wenn es den Franzosen gelingt, uns aus dem Lande zu werfen, werden in Zukunft alle Staaten zum Milizsystem übergehen; wenn wir Sieger bleiben, wird jeder Staat unser Wehrpflichtsystem im Rahmen einer stehenden Berufsarmee nachmachen.« Freilich, daß die Frage, die hier aufgeworfen war, weit über Militärverfassung und Militärorganisation hinausreichte, ahnte er so wenig wie seine französischen Gegenspieler.
Diese Gegenspieler, also Gambetta oder auch Trochu, der Militärgouverneur des belagerten Paris und nominelle Präsident der Septemberrepublik, blieben eben doch letzten Endes nicht weniger als Moltke befangen in den Grenzen ihres Klassendenkens. Sie waren eben Bürger, Großbürger. Die Art von Klasseneinebnung und Klassenlosigkeit, die den wirklichen Volkskrieg erst möglich macht, war ihnen unvorstellbar – oder wenn vorstellbar, ein Greuel. Trochu machte, ehe er sein Amt annahm, zur Bedingung, daß die neue Republik »die Religion, das Eigentum und die Familie entschlossen verteidigen« würde – als ob er ahnte, daß sie würden aufgeopfert werden müssen, wenn der Volkskrieg mehr als Rhetorik werden sollte. Und es war wieder Moltke, der, nicht ohne psychologisches Feingefühl, die merkwürdige Passivität, mit der Trochu das schwerbewaffnete belagerte Paris seinem Schicksal entgegentreiben ließ, damit erklärte, daß er im Grunde eben doch die rote Revolution mehr fürchte als die Niederlage.