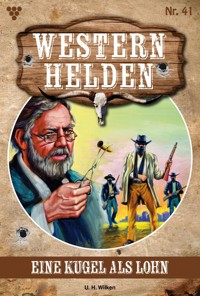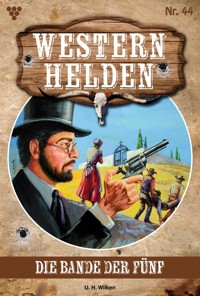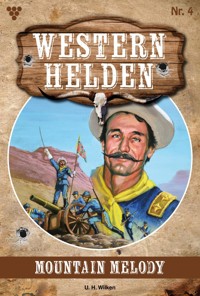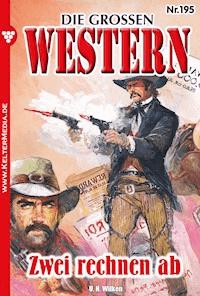
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die großen Western
- Sprache: Deutsch
Der Autor steht für einen unverwechselbaren Schreibstil. Er versteht es besonders plastisch spannende Revolverduelle zu schildern und den ewigen Kampf zwischen einem gesetzestreuen Sheriff und einem Outlaw zu gestalten. Er scheut sich nicht detailliert zu berichten, wenn das Blut fließt und die Fehde um Recht und Gesetz eskaliert. Diese Reihe präsentiert den perfekten Westernmix! Vom Bau der Eisenbahn über Siedlertrecks, die aufbrechen, um das Land für sich zu erobern, bis zu Revolverduellen - hier findet jeder Westernfan die richtige Mischung. Lust auf Prärieluft? Dann laden Sie noch heute die neueste Story herunter (und es kann losgehen). Der ferne Knall eines Schusses hallte nur dünn und schwach herüber. John McCall verhielt oberhalb des flachen Tales und richtete sich horchend in den Steigbügeln auf. Vor ihm brodelte die Masse der Herde, und die zusammengetriebenen wilden Buschrinder der Brasada stampften den Staub zu dicken Wolken auf. Da fiel noch ein Schuß. Jetzt wußte John, daß er sich nicht geirrt hatte. Er ließ sich in den Sattel zurückfallen und jagte ins Tal, vorbei an den Cowboys. Ihre schrillen Pfiffe gellten ihm noch lange in den Ohren. Im halsbrecherischen Galopp ritt er aus dem Tal durch die glühend heißen Senken. Überall waren niedrige Buschinseln, Kakteen, Comas und dornige Hecken. Die rasenden Hufe scheuchten Schlangen auf. Die Sonne brannte vom blassen weiten Himmel hernieder und erhitzte jedes Sandkorn und jeden Felsen. Tiefe Stille umgab John. Er zwang das Pferd vorwärts und folgte der deutlich sichtbaren Spur. An diesem heißen texanischen Tag erstarb irgend etwas Gutes in John McCall. Das dornige Land schien sich ihm entgegenstemmen zu wollen. Er schonte sich und das Pferd nicht. Dann sah er das reiterlose Pferd am Hang stehen, weitab vom Tal, wo sie die Rinder gesammelt hatten. Er riß am Zügel, und als das Pferd hochstieg, sprang er aus dem Sattel und zerrte sogleich das Gewehr hervor. Er hastete durch den körnigen Sand und erreichte den liegenden Mann. »Dad!« schrie er auf. Die Kehle war ihm auf einmal wie zugeschnürt. Er sackte auf die Knie und ließ das Gewehr in den Sand fallen. Vorsichtig und behutsam drehte er den Vater auf den Rücken.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 157
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die großen Western – 195 –Zwei rechnen ab
U.H. Wilken
Der ferne Knall eines Schusses hallte nur dünn und schwach herüber. John McCall verhielt oberhalb des flachen Tales und richtete sich horchend in den Steigbügeln auf. Vor ihm brodelte die Masse der Herde, und die zusammengetriebenen wilden Buschrinder der Brasada stampften den Staub zu dicken Wolken auf. Da fiel noch ein Schuß. Jetzt wußte John, daß er sich nicht geirrt hatte. Er ließ sich in den Sattel zurückfallen und jagte ins Tal, vorbei an den Cowboys. Ihre schrillen Pfiffe gellten ihm noch lange in den Ohren. Im halsbrecherischen Galopp ritt er aus dem Tal durch die glühend heißen Senken. Überall waren niedrige Buschinseln, Kakteen, Comas und dornige Hecken. Die rasenden Hufe scheuchten Schlangen auf. Die Sonne brannte vom blassen weiten Himmel hernieder und erhitzte jedes Sandkorn und jeden Felsen.
Tiefe Stille umgab John. Er zwang das Pferd vorwärts und folgte der deutlich sichtbaren Spur.
An diesem heißen texanischen Tag erstarb irgend etwas Gutes in John McCall.
Das dornige Land schien sich ihm entgegenstemmen zu wollen. Er schonte sich und das Pferd nicht.
Dann sah er das reiterlose Pferd am Hang stehen, weitab vom Tal, wo sie die Rinder gesammelt hatten.
Er riß am Zügel, und als das Pferd hochstieg, sprang er aus dem Sattel und zerrte sogleich das Gewehr hervor. Er hastete durch den körnigen Sand und erreichte den liegenden Mann.
»Dad!« schrie er auf. Die Kehle war ihm auf einmal wie zugeschnürt. Er sackte auf die Knie und ließ das Gewehr in den Sand fallen. Vorsichtig und behutsam drehte er den Vater auf den Rücken. In seinem Gesicht war es furchtbar leer. Es war seltsam leblos, wie abgestorben. Er starrte in das graue Gesicht des Vaters und sah die schreckliche Wunde.
»John««, flüsterte der Mann kaum hörbar, »gut, daß – du mich gefunden hast.
»Wer war es, Dad?« keuchte John verzweifelt und voller Wut. »Sag mir, wer auf dich geschossen hat!«
Der alte McCall hatte nicht mehr viel Zeit. Das Leben wich aus seinem Körper.
»Nicht verfolgen, John«, stöhnte er, »du mußt hierbleiben – bei den Jungs, bei der Herde. Du mußt mit deinem Bruder die Herde nach Norden bringen.«
»Dad, ich will wissen, wer das getan hat!« schrie John. »Ich bringe diese verdammten Halunken zurück, tot oder lebendig – aber ich hole sie mir! Sag es endlich, Dad!«
Der Rancher kämpfte gegen die bleierne Schwäche an. Die Hände glitten zitternd durch den Sand und fielen auf die Knie des großen erwachsenen Sohnes.
»Du wirst – gebraucht, John. Laß die Halunken reiten. Irgendwann wirst du ihnen vielleicht noch begegnen. Bring erst die Herde nach Norden!«
John schüttelte den Kopf. Er sah wild umher, den Hang hinauf. Dort stand noch immer das Pferd seines Vaters. Es wieherte schrill – und es klang wie ein Schrei.
Er zog die Schultern an, krümmte sich, packte die Hände des Vaters.
»Hör zu, Dad. Wir sind die McCalls!« sagte er mit erregter Stimme. »Du bist der Herr vom Brush County! Wer auf dich schießt, der darf nicht entkommen. Himmel, nun sag es mir doch endlich!«
»Mein Junge…« Die Stimme des Sterbenden war nur mehr ein Hauch. »Die Zukunft ist wichtiger. Wir sind ruiniert, wenn du nicht die Herde nach Norden treibst. Vergiß die Halunken. Ich wollte in der Stadt einen Chuckwagen kaufen. Ich habe ihn schon bestellt, John. Die Halunken haben mir das Geld abgenommen und sich davongemacht. Aber das darf dich nicht von der Mannschaft und der Herde wegtreiben. Einmal mußte es doch mit mir so kommen, ich habe zu viele Feinde – Banditen und Plünderer. Ich hab’s immer geahnt, John. Jetzt ist es also geschehen. John, versprich mir, mit deinem Bruder nach Dodge City zu ziehen. Du mußt es mir versprechen, sonst kann ich nicht in Ruhe sterben, mein Junge.«
Wieder sah John zum Hang. Er sah die Luft vor Hitze flimmern, sah den Staub in kleinen Spiralen über den Böden wandern, vom heißen Wind bewegt. Längst waren die Halunken davongeritten. Aber ihre Spur war zu sehen. Er könnte sie in zwei Tagen eingeholt haben…
»John…« Die Stimme des Vaters unterbrach seine wilden, flackernden Gedanken.
»Mein Bruder Lucky taugt nicht viel für den Trail nach Dodge, Dad. Er ist ein Weiberheld, ein Nichtstuer…«
»Du mußt dich mit ihm versöhnen, John. Du bist der ältere McCall. Laß Lucky nie im Stich, John!«
John schluckte schwer. Dann nickte er und preßte die Hände des Vaters.
»Du wirst also nach Dodge treiben, John? Du wirst den Halunken nicht folgen?«
»Ich verspreche es dir, Dad.«
»Gut, mein Junge, das wollte ich hören. Aber wenn du einmal zwei Männern begegnen solltest, einem rothaarigen und einem blonden Kerl, dann hast du meine Mörder vor dir… Der blonde Bursche hat ein zerfetztes Ohr – wie von einem Wolf zerbissen, verstehst du?«
»Ja, Vater.« John schloß einen Atemzug lang die Augen, und alles in ihm bäumte sich gegen das Versprechen auf, aber er würde sein Wort nicht brechen. Er würde das Lebenswerk des Vaters zu Ende führen.
»Bring mich zur Ranch, wenn es aus ist, John.« Der Rancher sah mit kraftlosen Augen seinen Sohn an. Sein trüber Blick tastete noch einmal Johns hartes, verkniffenes Gesicht ab, als müßte er sich das alles für immer und ewig einprägen. Er sah in Johns graue Augen, sah das verstaubte aschblonde Haar und die breiten starken Schultern. Auf einmal verschwamm das alles vor seinen Augen, und er wußte, daß es soweit war. Er hatte noch nicht einmal Schmerzen dabei. Der Atem verwehte. Ein großer, rauher Pionier von Texas war tot. Ein Mann, der in seinem rastlosen Leben immer nur schwer gearbeitet hatte.
Er hinterließ zwei Söhne und ein riesiges Erbe von zehntausend Rindern, die alle hier in Texas nur einen jämmerlichen Dollar wert waren.
Dort im Norden aber, auf der Ebene von Kansas, waren all diese Rinder sehr viel wert.
Darum hatte er den Trail nach Dodge City gewollt – und der ältere Sohn hatte ihm versprochen, diesen Trail auch zu beginnen.
John saß lange bei seinem Vater. Er brauchte diese Zeit, um zu sich selber zurückzufinden. Um den flammenden Haß zu ersticken und an die Zukunft im Norden zu glauben.
»Ja, ich tu’s, Dad«, sprach er in den heißen Wind. »Ich bringe deine Herde nach Dodge. Und niemand soll mich daran hindern.«
Es klang wie ein Schwur – und es war auch ein Schwur, gesprochen in die lastende Stille der Brasada hinein.
Schwerfällig erhob er sich und ging, um das Pferd des Vaters zu holen. Das Gewehr steckte noch im Scabbard. Die Halunken hatten den Vater gnadenlos vom Pferd geschossen…
Dann legte er den Vater über den Sattel und stieg auf sein Pferd. Er nahm den langen Zügel und ritt sehr langsam zurück.
Nachts heulten hier immer die Wölfe, und das Gekläff der Kojoten schwoll an und ab. Jetzt aber, am Tage, war nichts zu hören. Die Grenze war nicht fern. Drüben lag Mexiko. Bestimmt flohen die Mörder nach Mexiko…
Er warf keinen Blick zurück.
Dort vor ihm war die Zukunft. Dort begann der Treck. Drei Monate würden sie unterwegs sein. Neunzig Tage und Nächte. Das konnten nur die besten und härtesten Burschen durchstehen. Nicht so ein Bursche wie Lucky.
Aber er hatte es dem Vater versprochen.
*
Als er ins Tal kam, sah ihn zuerst niemand. Die Männer waren mit harter Arbeit beschäftigt. Alle trugen Halstücher vor dem Gesicht. Cowboys trieben die ungebrändeten Rinder zum Brennplatz. Die Einfänger warfen die Lassos und rissen die Rinder zu Boden. Manchmal mußte der Flanker eingreifen und die Rinder an den Hinterbeinen umreißen. Der Iron Man drückte ihnen das Brandzeichen der McCall Ranch auf die linke Flanke. Es qualmte und stank. Die für den Trail bestimmten Rinder wurden abseits getrieben, wo schon Stiere und Kühe standen. Jedes Tier bekam den Roadbrand.
Langsam ritt John McCall an der Herde vorbei. Erst jetzt sahen die Männer ihn. Einige konnten ihren Arbeitsplatz verlassen und kamen herangeritten. Sie, starrten auf den Rancher und wurden blaß.
John sah sie ausdruckslos an.
»Macht weiter!« sagte er rauh und mit kratzender Stimme. »Das hier ist Sache der McCalls.«
»Wer hat den Boß erschossen?« rief ein Cowboy erregt. »Warum tust du nichts, John?«
John blieb kalt.
»Wir treiben nach Norden! Ich will noch den Chuckwagen aus der Stadt holen. Geht an die Arbeit. In zwei Tagen brechen wir auf. Bis dahin muß die Arbeit geschafft sein.«
Er ritt weiter und kümmerte sich nicht mehr um die Männer. Sie sahen ihm nach, wie er das Tal verließ.
John McCall zog mit seinem toten Vater über die Ebene zur großen Ranch.
Dort waren nur die Ranchhelfer und der Mannschaftskoch.
Er verhielt auf dem Hof.
»Chappie«, sagte er zum Koch, »du kommst mit in die Stadt. Sattle dein Pferd.«
Chappie, der Koch, nickte und ging wortlos zum Stall.
John trug den Vater ins Haus. Das Haus war leer. Lucky war nicht hier. Lucky war überhaupt selten auf dem Land der McCall Ranch…
*
Die Sonne war untergegangen, und draußen herrschte Dämmerlicht. Die Schatten der Nacht fielen über die Stadt und hüllten die schäbigen Adobe- und Holzhäuser ein. Aus vielen Häusern fiel der Lichtschein von blakenden Petroleumlampen und Talglichtern.
Zwei Reiter kamen die Straße herauf.
Im Saloon war der Hufschlag zu hören. Das starkgeschminkte Girl trat ans Fenster und versuchte hinauszusehen, doch die Staubschicht draußen auf dem Fenster war zu dick.
»Komm her«, rief ein junger schwarzhaariger Mann und drückte den schlanken Körper von der langen Theke ab. »Was siehst du hinaus? Komm schon zurück zu mir, Darling.« Er verzog das schmale, gut aussehende Gesicht und blinzelte. Der Blick der dunkelblauen Augen ruhte wohlgefällig auf dem Girl.
»Sie reiten vorbei«, sagte das Girl und kam zurück. »Nichts los heute. Seit ihr die Rinder zusammentreibt, ist es leer im Saloon. Warum gebt ihr den Jungs keine Zeit, mal auf einen Sprung hereinzukommen?«
»Da mußt du den alten McCall fragen, nicht mich«, grinste Lucky und legte den Arm um das Animiergirl. »Willst du noch einen trinken?«
»Ja, gib schon her«, sagte sie mißmutig.
Er sah zu, wie sie trank. Sein Blick war schon ein wenig getrübt. Wenn er sich bewegte, dann war zu erkennen, daß der übermäßig genossene Alkohol bereits in ihm wirkte.
»Ich bin ja da«, sagte er mit schwerer Zunge.
»Warum hilfst du nicht deinem Vater und Bruder, Lucky?« fragte sie. »Dir wird später ja auch was von der Ranch gehören.«
»Stimmt.« Er lächelte nicht mehr. Ihre Frage hatte ihn ernüchtert. Er wollte von der Ranch nichts hören. »Hör auf damit. Ich habe dafür nicht viel übrig. Immer nur schuften, nein, das ist nichts für mich. He, warum fragst du überhaupt? Wartest du etwa auf John McCall?«
Da stieß sie ein erzwungenes Lachen aus.
»John? Der sieht mich doch nicht einmal mit dem Hintern an! Und da sollte ich auf ihn warten? Du bist ja verrückt! Gib mir noch einen, aber nimm endlich den Arm runter. Du bist ja schon schwer wie ein Mehlsack, Lucky.«
»Ja, schon gut«, brummte er, zog den Arm zurück und hielt sich an der Theke fest. »Mir auch noch einen.«
Der Keeper schob ihnen die vollen Gläser zu. Lucky griff schon danach, als die Tür langsam aufgedrückt wurde.
Er spürte den schwachen Luftzug und sah, wie die Talglichter flackerten. Schwerfällig drehte er sich um.
In der Tür stand sein Bruder John.
»Ach, du bist es«, sagte Lucky schleppend. »Komm her, trink mit uns, Bruder.«
John ließ die Türflügel los und kam näher. Hinter ihm schlugen die Türflügel auf und zu. Unter seinen Schritten wallte der feine Staub, der in den Saloon getragen worden war. Etwas Feindseliges war in seinem Blick. Das Gesicht verriet Verdrossenheit und Zorn. Er kam bis zur Theke und stand nun zwischen dem Bruder und dem Barmädchen. Langsam nahm er das Glas des Mädchens und kippte Lucky den Whisky ins Gesicht.
»Sauf, Bruder!« sagte er kalt.
Lucky zuckte zusammen, wich zurück und wischte mit dem Hemdsärmel den Whisky aus dem Gesicht. In der Rechten hielt er noch immer das Glas. Plötzlich warf er es auf John. Der beugte sich blitzschnell zur Seite, so daß das Glas hinten im Raum aufschlug und zersprang.
»Du großspuriger Kerl!« fauchte Lucky wütend, sprang los und wollte John ins Gesicht schlagen.
Doch John fing den Schlag ab und holte aus. Seine Faust traf Lucky am Kinn. Lucky taumelte und knallte gegen die Theke. John rührte sich nicht. Lucky war wie von Sinnen. Er konnte es nicht ertragen, wenn man ihn vor den Augen anderer Leute maßregelte. Er duckte sich, stürzte wieder los und rammte John den Kopf in den Bauch. John prallte gegen einen Tisch, der unter seinem Gewicht zerbrach.
Mit schnellen Schritten war Lucky bei ihm. Im ersten Moment sah es so aus, als wolle er zutreten. Dann aber machte er einen Schritt zurück und wartete, bis John hochkam.
»Darauf habe ich schon lange gewartet, Bruder!« keuchte er und versuchte, John die Faust ins Gesicht zu schlagen. Er traf nicht und verlor das Gleichgewicht. Torkelnd stürzte er nach vorn.
John wich aus, kam hoch und wartete.
»Eine Schande ist das!« flüsterte er. »Mein Bruder besäuft sich, und in der Brasada knallen sie unseren Vater ab!«
Lucky versteifte sich. Er stand halbaufgerichtet vor John. Benommen schüttelte er den Kopf.
»Du lügst doch!« stöhnte er. »Du lügst, um mich hier herauszubekommen!«
Da schlug John zu. Es war eine harte, peitschende Ohrfeige, die Lucky zur Seite schleuderte. Die Sporen rasselten laut, als John zu ihm ging. Er zerrte Lucky hoch und schlug wieder zu. Lucky taumelte rückwärts durch die Schwingtür und stürzte draußen über die Haltestange, fiel in den Staub und lag dicht neben dem Chuckwagen. Und vor ihm stand der Koch Chappie in der Lichtbahn des Saloons und fragte ironisch: »Machst du das immer so, Lucky?«
Fauchend kam Lucky hoch. Er sah zur Tür. John stand davor und fing das Licht auf. »Das vergesse ich dir nie!« keuchte Lucky.
»Mach, daß du auf dein Pferd kommst!« sagte John rauh. »Die Drinks habe ich schon bezahlt. Du kannst verschwinden. Reite zur Ranch. Du kannst Dad nur noch diese Nacht sehen. Morgen werden wir ihm ein Grab geben.«
»Das ist nicht wahr«, flüsterte Lucky erschrocken. »Du machst mir was vor, nicht wahr? Du willst mich verrückt machen! Niemand wird auf Dad schießen. Dafür ist er viel zu groß!«
»Dad ist tot!«
Kalt kamen die Worte über die nächtliche Straße. Lucky zitterte auf einmal. Er sah wild umher und sprang dann aufs Pferd. Im Galopp jagte er die Straße hinauf.
John stand reglos und sah ihm nach. Das Licht umgab ihn mit einem fächerförmigen Schein. Hinter ihm kam das blasse Gesicht des Barmädchens über die Türflügel.
»Ist Mr. McCall wirklich tot?« flüsterte es mit unsicherer Stimme.
John gab keine Antwort. Er stieg die Stufen vom Gehsteig herunter und zog sich aufs Pferd. Schweigend nickte John dem Koch zu. Daraufhin kletterte Chappie auf den Wagenbock, den er von nun an drei Monate lang unter sich haben sollte.
Sie verließen langsam die Stadt. Lucky war schon nicht mehr zu sehen. Der Hufschlag war verklungen.
*
John drückte die knarrende Tür auf und sah den Bruder am Lager des toten Vaters kauern. Auf dem kleinen Tisch brannte ein Licht und schickte sein geisterhaft unruhiges Licht auf das leblose Gesicht.
Lucky hob den Kopf und drehte sich ein wenig.
»Wer war es, John?« fragte er dumpf und schwer. »Du weißt es doch, oder?«
»Es waren zwei Männer. Sie beraubten Dad, nachdem sie ihn niedergeschossen hatten.«
Draußen rollte der Chuckwagen über den Ranchhof, und zwei Cowboys ritten davon.
Lucky richtete sich auf. Er straffte die Schultern. Das geschwollene Kinn schimmerte bläulich. In den Augen flackerte Zorn.
»Und warum bist du Dads Mördern nicht gefolgt und hast sie aus dem Sattel geholt?« fragte er bitter.
»Vielleicht hatte ich gehofft, daß du im Tal sein würdest, daß du mir dann helfen könntest.«
Lucky biß sich auf die Unterlippe. Die Worte des Bruders steigerten seinen Zorn.
»Wenn du es nicht tust, dann tue ich es!« stieß er wild hervor. »Ich hole mir die Halunken vor den Colt!«
»Das tust du nicht.« John sprach kühl, leidenschaftslos und nüchtern. »Du bleibst hier.«
»Wer sollte mir das verbieten, he? Du etwa?«
»Nicht ich. Dad wollte es. Er wollte, daß ich mit der Herde nach Dodge ziehe. Und du kommst mit nach Norden.«
»Verdammt, wir können die Halunken doch nicht laufenlassen?« rief Lucky erregt. »Wir holen sie bestimmt noch ein!«
»Wir werden hier gebraucht, Lucky. Die Herde ist jetzt wichtiger. Und du bleibst, weil Dad es so gewollt hat. Du reitest nicht!«
Lucky sah ihn mit flackernden Augen an und atmete schnell. Er spannte sich, als wolle er sich wieder auf John stürzen – aber dann ließ er die Schultern fallen.
»Wenn Dad es gewollt hat, dann will ich auf die Rache verzichten«, murmelte er und senkte den Blick. »Es fällt mir verdammt schwer.«
»Du hattest ihm nicht geholfen, als er noch lebte, Lucky. Du hast dich im Saloon herumgetrieben und mit dem Geld nur so um dich geworfen. Versuch jetzt nicht, mir was vorzumachen.«
Nach diesen Worten ging John hinaus, mit festen Schritten, die durch das große Haus hallten.
Lucky fluchte, aber er verstummte sofort, als er seinen Vater wieder ansah.
Noch vor Sonnenaufgang hoben sie ein Grab aus und legten den Vater hinein. Im Dunst der Morgendämmerung füllten sie das Grab mit Erde und legten viele schwere Steine darauf. Die Nebelschwaden kamen vom Weideland herüber und machten alles grau und trist. John McCall las aus der Bibel. Lucky stand stumm. Und hinter ihnen stand die ganze Mannschaft.
Dann war es vorbei.
»Geht an die Arbeit«, sagte John rauh.
Schweigend machten sie sich davon.
Düster sah John McCall über das Land. Er hatte sich verändert. Es schien, als könnte und würde er niemals wieder lachen können. Und Lucky, der mit seinen fünfundzwanzig Jahren nur drei Jahre jünger als John war, erkannte, daß sich die zwei Falten in den Mundwinkeln des Bruders vertieft hatten und sich unübersehbar bis zu den Nasenflügeln hinaufzogen. Aber Lucky hatte kein Mitleid mit dem Bruder John. Sie mochten sich nicht. Selbst am Grabe des Vaters konnten sie kein herzliches Wort zueinander finden. Ja, John war härter geworden. Vielleicht, weil jetzt die ganze Verantwortung auf ihm lastete.
Als auch Lucky gehen wollte, sagte John: »Ich habe fünfunddreißig Dollar im Saloon bezahlt, Lucky. Soviel, wie ein Cowboy bei uns im Monat verdient. Du hast es mit diesem Barmädchen vertrunken und verpraßt, anstatt Dad und den Jungs zu helfen. Ich will jetzt das Geld von dir zurückhaben.«
Lucky wandte sich zu ihm um. Er zuckte die Achseln und grinste flüchtig. Er war wieder der leichtlebige und leichtsinnige Bursche, der dem Vater soviel Kummer gemacht und John sooft in Zorn gebracht hatte.
»Was soll ich dir sagen, Bruder?« grinste Lucky und hob die Hände an. »Ich habe das Geld nicht!«
John zog die Augenbrauen zusammen. Er kam näher und verharrte dicht vor Lucky.