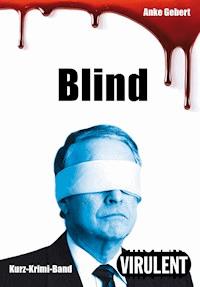Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Virulent
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
"Später gibt es nicht. Das Leben findet jetzt statt, man kann es nicht verschieben." Claudia Kotter erzählt ihre eigene Geschichte. Die Geschichte von einem sehr bewussten Leben, in dem die Krankheit ihr Begleiter und ihre Lunge nicht ihre eigene war. Eine Geschichte von den Grenzen des Körpers, von Freundschaft und vom Mut, alte Regeln zu brechen, um neue zu definieren. In bewegenden, sehr persönlichen Interviews mit Freunden und Ärzten, in Briefen der Familie und Auszügen aus Claudia Kotters Tagebuch verdichtet sich ein Bild von Freundschaft und Liebe – und gleichzeitig illustriert sich das Porträt eines intensiven, unmittelbaren Lebens. Im Juni 2011 verstarb Claudia Kotter im Alter von 30 Jahren. Ihre Geschichte, und vor allem ihr Anliegen, über das Thema Organspende aufzuklären, soll weiter getragen werden. E-Book mit 15 Abbildungen und einem exklusiven Song von Klaas Heufer-Umlauf.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anke Gebert
GUTE NACHTBIS MORGEN
Claudia Kotter erzähltdie Geschichte ihres Lebens
IMPRESSUM
Virulent ist ein Imprintwww.facebook.de/virulenz
ABW Wissenschaftsverlag GmbHKurfürstendamm 5710707 BerlinDeutschland
www.abw-verlag.de
© E-Book: 2012 ABW Wissenschaftsverlag GmbH
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://d-nb.de abrufbar.
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik Deutschland vom 9. September 1965 in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechtsgesetzes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
ISBN 978-3-86474-059-6
Produced in Germany
E-Book-Produktion: ABW Wissenschaftsverlag mit bookformer, BerlinUmschlaggestaltung: BJOERN LOEPER, BerlinE-Book-Korrektorat: Alexandra Kusche, BerlinTitelabbildung: Philipp von Hessen
P110165
Inhalt
Der Verein Junge Helden
Prolog
Christel Kotter
Angela
Christian (Chris)
Katrin (Tati)
Dr. Till Kinkel
Warum eigentlich nicht?
Arend
Loretta
Jürgen
Dr. Ilona Bodnar
Nils
Annika
Paul
Cordula Giesler
Joko
Klaas
Markus
Dr. Tim Carstensen
Angela
Angela
Anna Barbara
Dr. Leif Hanitsch
Ina
Kirsten
Prof. Dr. med. Christian Witt
Nik
Ritchie
Epilog
Danksagung Claudia Kotter
Danksagung Anke Gebert
Musik zum Buch
Video-Links
Endnoten
Abbildungen
DER VEREIN JUNGE HELDEN
www.junge-helden.org
www.junge-helden.org
Claudia Kotter hat den Verein Junge Helden ins Leben gerufen.
Ziel des Vereins ist es, über Organspende aufzuklären.
Jeder ist ein Junger Held, der sich mit dem Thema auseinander setzt und sich die Zeit für eine persönliche Entscheidung nimmt. Lest mehr unter www.junge-helden.org.
Für meine kleine Schwester.Mein Herz, du vervollständigst mich.
PROLOG
PROLOG
Mein Name ist Claudia Kotter.
Wenn dieses Buch erscheint, feiere ich meinen Geburtstag.
Ich werde dreißig Jahre alt.
Und ich habe eine Geschichte, die ich erzählen möchte.
Ich war sieben Jahre alt, als meinen Eltern prophezeit wurde, dass ich keine achtzehn werden würde: Man hatte bei mir eine sehr seltene und unheilbare Erkrankung festgestellt.
Meinen achtzehnten Geburtstag feierte ich dann groß – ohne dass wir an die Prophezeiung von damals dachten. Als ich einige Jahre später in San Diego lebte und das Gefühl hatte, die Welt gehöre mir, kam alles anders.
Zurück in Deutschland eröffnete man mir, dass ich keinen Tag länger leben könnte, wenn mir nicht innerhalb kürzester Zeit eine neue Lunge transplantiert würde. Ich war damals 21 Jahre alt.
Es dauerte weitere vier Jahre, bis ein Spendeorgan für mich gefunden wurde – doch ich wartete nicht, ich lebte.
Als dann endlich eine neue Lunge für mich kam, war ich so geschwächt, dass die Ärzte darüber debattierten, ob man mich überhaupt noch operieren könne. Man transplantierte dennoch. Ich überlebte.
Seitdem sind mehr als drei Jahre vergangen. Und seither werden mir immer wieder dieselben Fragen gestellt: Wie haben Sie das geschafft, Frau Kotter?, Genießen Sie nun jede Sekunde Ihres Lebens?, Haben Sie niemals Angst?
Doch, ich hatte und habe oft Angst. Und nein, ich bin natürlich nicht unverwundbar; ich wurde schon oft körperlich und seelisch verletzt. Doch ich antworte meist gar nicht ernsthaft auf solche Fragen, denn um diese geht es in meinem Leben nicht. Kein Mensch kann jede Sekunde seines Lebens bewusst genießen.
Manchmal werde ich auch gefragt, wie ich das viele Auf und Ab in meinem Leben bewältige. Darauf gibt es viele Antworten. Eine ist: Ich will leben!
Mein ganzes Leben gleicht einer Fahrt in einer Achterbahn. Schon als kleines Kind war ich davon fasziniert. Erst durfte ich nicht mitfahren, weil mein Kopf nicht bis an den roten Strich reichte, der markierte, wie groß man sein muss, um mitfahren zu dürfen. Später war ich oft einfach nicht gesund genug.
Meine erste Fahrt werde ich niemals vergessen: Ich stieg in den Wagen mit Menschen, die ich mochte und denen ich vertraute. Wir schnallten uns an. Dann der erste Ruck, die Fahrt begann, es gab kein Zurück mehr. Langsam tuckerten wir die Steigung hoch, alles klang instabil. Dann, plötzlich dieser Knall, das Abkoppeln der Bahn vom Zugseil, und der Wagen rollte los. Es war wie ein freier Fall. Ich hatte Angst. Und ich habe es gleichzeitig geliebt. Dann plötzlich Ruhe, eine langsamere Fahrt, eine weitere Steigung. Ich konnte nachdenken, doch im nächsten Moment ging es noch steiler bergab. Mir blieb die Luft weg. Wir wurden in Kurven nach links und nach rechts gedrückt. Wir hielten uns an den Händen, schrien und lachten und hatten dabei das intensive Gefühl zu leben. Manchmal trieb der Wind uns Tränen in die Augen.
In einer meiner ersten Kindheitserinnerungen sehe ich mich am Rande eines Fußballfeldes stehen, zusammen mit meiner ganzen Familie. Wir trommeln wie verrückt, schreien aus vollem Hals, werfen die Arme in die Luft, um die Mannschaft meines Cousins Daniel anzufeuern.
Ich, damals vielleicht sechs Jahre alt, war völlig hin- und hergerissen: Ich wollte nicht, dass eine der beiden Mannschaften überhaupt verlieren musste, denn das hatte ich schon immer traurig gefunden. Ich schrie und hielt vor Aufregung und Angst die Luft an, sodass ich nach dem Spiel völlig erschöpft war – aber vor allem begeistert vom Sport, vom gemeinsamen Anfeuern und den Gefühlen, die wir geteilt hatten. Aus dieser Verbundenheit entstand ein starkes und unbändiges Gefühl – das einer großen Gemeinsamkeit.
Diese Verbundenheit ist uns auch zu Hause immer wichtig gewesen: Mein Bruder Christian, meine Schwester Angela und ich hatten eigene Zimmer, doch die benutzten wir kaum, denn wir schliefen grundsätzlich bei unseren Eltern. Wir haben lange zu fünft in einem Bett geschlafen. Abends war es wichtig, schnell zu sein, um den besten Platz zu ergattern: den Platz in der Mitte der Familie.
Angela, Claudia und Christian Kotter
Angela, Claudia und Christian Kotter
Ich wurde am 1. September 1980 in Frankfurt am Main geboren. Indem mein Bruder sich vor seiner Geburt noch mal gedreht hatte, hatte er wohl festgelegt, dass er, ich und später auch meine Schwester Angela per Kaiserschnitt auf die Welt geholt wurden.
Zunächst lebten wir in Mainz, im Ortsteil Bretzenheim, später in Gonsenheim. Wir wohnten in einer schönen Altbauvilla nah an einem Wald. Meine Mutter und ihre jüngere Schwester, meine Tante Margot, bekamen ihre drei Kinder beinahe zeitgleich. Wir Geschwister wuchsen gemeinsam mit unseren Cousinen Evelyn und Christina und unserem Cousin Daniel auf. Wir haben gemeinsame Urlaube verbracht, jeden Geburtstag und jedes Weihnachtsfest miteinander gefeiert. Für mich waren und sind es Geschwister und meine Tante und mein Onkel zweite Eltern. Ich hatte imponierende Großeltern, die alle viel zu früh gestorben sind. An den Vater meines Vaters habe ich sehr starke Erinnerungen und vor allem an die Mutter meiner Mutter, eine faszinierende Frau. Sie fand für jeden den richtigen Ton und war immer aktiv.
Meine Mutter hat BWL studiert und ist Diplom-Kauffrau. 1987/88 machte sie sich selbstständig und stieg in den Bereich Endoprothetik ein. Mein Vater ist Maschinenbauingenieur, hatte das Unternehmen seines Vaters übernommen. Mittags und abends kamen unsere Eltern aus ihren Büros nach Hause, und wir aßen gemeinsam. Wir brauchten keinen Kindergarten, wir hatten uns – unsere Geschwister, unsere Verwandten, Haus, Garten und einen Dachboden.
An meinem ersten Schultag trug ich ein rotes Kleid mit Koffern darauf, und ich hatte eine weiße Schultüte mit bunten Herzen. Das erste Kinderbuch, das ich geschenkt bekam, hatte den Titel Ich mag Rot. Ich besitze es noch heute, und auch meine Vorliebe für die Farbe blieb.
Als ich zur Schule kam, war ich schon krank. Manchmal bin ich morgens aufgewacht, und alles tat mir weh. Wenn ich im Kalten spielte, bekam ich blaue Finger. Ein Kinderarzt erzählte meiner Mutter daraufhin von einer sehr seltenen Krankheit, der Sklerodermie1, bei der solche Symptome auftreten. Er hielt diese aber in meinem Fall nicht für wahrscheinlich, denn normalerweise tritt Sklerodermie nur bei Menschen im Alter zwischen fünfzig und sechzig auf. Doch ich bekam wieder und wieder diese blauen Finger, und der Kinderarzt beschloss, der Sache auf den Grund zu gehen.
CHRISTEL KOTTER
Zu den blauen Fingern kam, dass sich die Haut in Claudias Gesicht sehr straffte. Ein Kinderarzt riet mir, Claudia in der Uniklinik Mainz vorzustellen. Ich weiß es noch genau, als wäre es gestern gewesen: Ein Arzt der Hautklinik untersuchte Claudia, dann holte er kommentarlos einen Kollegen dazu. Daran merkte ich schon, dass etwas nicht stimmte. Ich spürte eine starke Beklemmung und wusste, etwas Bedrohliches kommt auf uns zu, eine Entwicklung, die Schreckliches bedeutet. Der Arzt stellte dann schließlich die Diagnose. Er bedauerte, dass mein Kind keine große Perspektive hätte, weil man Sklerodermie nicht heilen kann und sie meistens einen tödlichen Verlauf nimmt. Er warnte mich davor, aktionistisch nach Lösungen und Heilung zu suchen, und riet mir, lieber die Zeit, die mir mit meinem Kind bliebe, zu genießen.
Der Kinderarzt gab mir dann, ohne dass ich ihn darum gebeten hätte, ein Buch, in dem Beispiele von Patienten mit dieser Krankheit, die katastrophale Verläufe genommen hatte, beschrieben waren.
Sklerodermie ist eine Autoimmunerkrankung, bei der zu viel Kollagen produziert wird; dadurch kommt es zur Verhärtung der Haut und häufig werden auch die inneren Organe angegriffen. Ursachen dafür sind nicht bekannt, und es gibt keine Heilungschancen.
Ich habe das zur Kenntnis genommen und beschlossen, dass das nicht sein kann und darf. Ich habe beschlossen, dass Claudia so lange wie möglich das Leben eines gesunden Menschen leben sollte, einen normalen Alltag also, nicht den eines kranken Kindes. Dafür wollte ich die Verantwortung tragen.
Doch das war schwierig für mich, denn was ist richtig und was ist falsch bei einer Krankheit, mit der sich kaum jemand auskennt und für die es keine gesicherten Therapien gibt? So viel ich gefragt habe, so viele Antworten bekam ich. Und alle meinten es gut. Die, die uns Wunderheiler und Delphinschwimmen empfahlen, und auch die Ärzte, die über das richtige Medikament heftig diskutierten. Es gab keine Erfahrungswerte im Zusammenhang mit Kindern, die an dieser Krankheit leiden. Letztendlich musste immer ich entscheiden und hatte dabei oft die Sorge, meiner Tochter vielleicht das richtige Mittel oder die richtige Therapie verwehrt zu haben, weil ich mich für etwas anderes entschieden hatte. Und doch haben wir immer wieder Ärzte getroffen, die bereit waren, eine Gratwanderung mitzugehen – zwischen notwendigen Klinikaufenthalten, harten Medikamenten und dem normalen Leben mit physiotherapeutischer Begleitung und sportlichen Aktivitäten. Sie haben uns dabei unterstützt, Klinikaufenthalte auf das absolut Notwendige zu beschränken, und haben unsere Reisen, sportlichen Aktivitäten und unseren ausgeprägten Hang zum Feiern im Sinne von Seize the day! erlaubt. Zugegeben, nicht immer mit Begeisterung! Es war eine lange Phase, in der ich nach Wegen suchte, doch davon sollte Claudia so unbehelligt wie möglich bleiben – und das blieb sie auch.
Was wir auf jeden Fall in die Tat umsetzten, war: Claudia muss in die Sonne. So sind wir zum Beispiel seit der Diagnose jedes Jahr am zweiten Weihnachtsfeiertag in den Süden geflogen und haben dort mit der ganzen Familie Ferien gemacht, mit viel Zeit für einander, Zeit auch für Claudias Geschwister Christian und Angela.
Meinen Eltern hatte man prophezeit, dass ich keine 18 Jahre alt werden würde. Doch bis ich so alt war, habe ich mich gar nicht als krank wahrgenommen, ich war höchstens manchmal nicht ganz gesund.
Seit ich eingeschult worden war, hatte ich immer mal Beschwerden, sodass ich als kleines Kind manchmal ins Krankenhaus musste oder Medikamente nahm. Mit zehn Jahren wurde ich zum ersten Mal am Knie operiert, weil sich dort der Schleimbeutel entzündet hatte, mit 17 Jahren noch einmal, nach einem Sportunfall. Ich habe kurz nach der Sklerodermiediagnose mit regelmäßiger Krankengymnastik begonnen, mich dabei aber nie krank gefühlt. Auch wenn ich in der Schule öfter fehlte.
Eines Tages sollten wir einen Aufsatz über einen Raben schreiben, aber mich interessierte dieser Rabe überhaupt nicht. Also gab ich vor, den Aufsatz wegen Schmerzen in der Hand nicht schreiben zu können. Tage später bedauerte die Lehrerin gegenüber meiner Mutter, dass ich, die doch eine so blühende Fantasie hätte, nicht mitschreiben konnte. Meine Mutter nahm mich daraufhin beiseite und sagte, dass ich meine Krankheit nicht als Vorwand benutzen dürfe und auf diese Weise nur das Mitleid anderer erfahren würde. Sie sagte, meine Krankheit dürfte niemals eine Entschuldigung dafür sein, etwas nicht zu tun. Wenn es Probleme gebe, solle ich mit ihr reden, gemeinsam würden wir immer einen Weg finden.
Nach der Grundschule wollte ich unbedingt auf ein katholisches Mädchengymnasium, auf das viele meiner Freundinnen gingen. Die Leiterin des Gymnasiums kam in den Grundschulunterricht, um uns Schülerinnen zu beobachten. Ich wusste damals offenbar sehr genau, wie ich einen guten Eindruck hinterlassen konnte, und setzte das auch gezielt ein.
Auf dem Mädchengymnasium haben sie es dann bald bereut, dass sie mich aufgenommen haben. Wir wurden dort zum Teil von Nonnen unterrichtet. Zum Beispiel wollten sie auf einem Wandertag einen Rollstuhl für mich mitnehmen, für den Fall, dass ich unterwegs plötzlich Beschwerden bekäme. Ich weigerte mich mitzuwandern, wenn der Rollstuhl mitkäme, und setzte den Lehrerinnen auseinander, weshalb.
„Wird denn für alle anderen 28 Kinder auch ein Rollstuhl mitgenommen, für den Fall, dass sie Beschwerden bekommen?“, fragte ich.
Nach zwei Jahren wurde meinen Eltern nahegelegt, mich von der Schule zu nehmen. Ich war denen dort wohl zu eigen willig, und vielleicht hatte ich auch nicht den gern gesehenen Familienhintergrund, zum Beispiel eine Mutter, die sich nicht ausschließlich in der Schule engagiert. Meine Mutter und mein Vater waren beide voll berufstätig, trotzdem waren sie immer für uns da. Mein Vater legte uns jeden Morgen, bevor er in die Firma ging, ein Briefchen oder eine Zeichnung auf den Tisch.
1990, als ich zehn Jahre alt war, passierte dann etwas sehr Einschneidendes: Mein Vater, damals gerade 48, erkrankte schwer und lag plötzlich in der Uniklinik Mainz. Meine Mutter stieg kurz darauf in die Firma meines Vaters ein – achtzig Mitarbeiter, die geführt werden mussten. Mein Onkel Klaus, der in der gleichen Branche wie meine Mutter tätig war, führte die Firma meiner Mutter. Außerdem kümmerte sich meine Mutter natürlich um meinen Vater in der Klinik. Unsere Eltern konnten also plötzlich weniger für uns da sein. Meine Tante Margot und die gesamte Großfamilie versorgten uns abwechselnd. Das war für uns alle eine schwere Zeit. Nach zwei Wochen setzten mein Bruder Christian, der damals 13 Jahre alt war, und ich uns ins Arbeitszimmer meiner Mutter und überlegten, wie wir Struktur in unseren Alltag bekämen. Wir beschlossen, dass Christian sich um das große Ganze kümmern sollte und ich mich um meine kleine Schwester Angela. Das haben wir so gemacht, es hat gut geklappt. Und manchmal machen wir es heute noch so.
ANGELA
Claudia und ich waren als Kinder immer zusammen. Sie war meine große Schwester und mein Vorbild. Claudia hat mir beigebracht, Schuhe zu binden, zu schwimmen, Rad und Rolltreppe zu fahren. Als ich sehr klein war, stritten mein Bruder und sie, in wessen Bett ich schlafen dürfe. Das habe ich genossen, muss ich gestehen. Ich bin lange eher schüchtern, zurückhaltend gewesen. Ich wollte alles nur machen, wenn Claudi es auch machen würde.
Es gibt so viele gemeinsame Erlebnisse, die ich nie vergessen werde. Eines ist mir sofort vor Augen: Wie jedes Jahr hatten wir den Sommer mit unseren Verwandten verbracht. Meine Cousine Evy, die auch meine beste Freundin ist, musste danach zurück nach Freiburg, ich blieb ohne sie in Mainz. Ich war unendlich traurig, hatte Sehnsucht und freute mich auch nicht auf das neue Schuljahr.
Ich zeichnete einen Kalender auf ein großes Blatt, auf dem ich jeden einzelnen Schultag – bis zum Wiedersehen mit meiner Cousine – ausstreichen konnte. Claudia kam ins Zimmer und war entsetzt. Sie sagte: „Angela, du darfst nicht anfangen, die Tage deines Lebens auszustreichen und dich zu freuen, wenn ein Tag vorüber ist. Du musst jeden Tag leben.“
Ich habe das Blatt sofort zerknüllt.
Als mein Vater wieder nach Hause kam, veränderte sich die Situation für alle. Vor der Erkrankung hatte er sich auf dem Höhepunkt seiner Karriere befunden und sich nebenbei stark sozial engagiert. Nun hatte er das Gefühl, uns keine große Stütze mehr sein zu können. Mein Vater war vorher nie krank gewesen, plötzlich hatte ich Angst um ihn. Diese Angst führte dazu, dass ich die Stelle „dein Wille geschehe“ im Vaterunser nicht mehr ertragen konnte. Ich weigerte mich in der katholischen Schule, dieses Gebet laut zu sprechen, denn wenn der Herr gewollt hat, dass meinem Vater etwas so Schreckliches geschieht, war das nicht mein Gebet. Außerdem argumentierte ich gegenüber den Lehrern: „Ich kenne den Menschen ja gar nicht, der das Vaterunser geschrieben hat. Ich würde gern mal wissen, wer das war!“ Stattdessen lernte ich das Glaubensbekenntnis auswendig und betete das in der Schule vor. Für mich bedeutete es, dass es für jedes Problem eine Lösung gibt, dass es immer einen Weg gibt. Damals war ich zehn Jahre alt, glaube aber bis heute daran.
Wie jedes Jahr fuhren wir damals zum Jahreswechsel ins alte Bauernhaus meiner Großmutter in den Schwarzwald. Mein Onkel Klaus spürte wohl, dass ich mir viele Gedanken machte, kam auf mich zu und sagte: „Mach dir nicht so große Sorgen, Claudi. Ich bin immer für euch alle da und werde niemals zulassen, dass euch etwas passiert.“
Klaus hat sein Versprechen bis heute nicht gebrochen.
Darüber, dass ich krank war, wusste ich schon sehr früh fast alles. Meine Mutter hatte es mir genau erklärt und dabei nichts dramatisiert. Sie sagte, dass es Menschen gibt, bei denen sich das Leben etwas anders gestaltet. Sie wüsste zwar nicht, weshalb das so ist, aber manche müssten eben mehr als andere dafür kämpfen oder arbeiten, gut leben zu können. In meinem Fall sei das so. Ich fand das plausibel.
Ich erlebte all die „Pflichtveranstaltungen“, die mit meiner Krankheit zu tun hatten, auch als aufregendes Happening. Wenn ich in das Deutsche Zentrum für Kinder- und Jugendrheumatologie nach Garmisch-Partenkirchen musste, kamen meine Mutter und meine Schwester mit, und ich bin so lange auf die Barrikaden gegangen, bis die beiden und ich in einem Zimmer schlafen durften.
Einmal war ich im Februar dort und sah aus dem Fenster auf die schneebedeckten Berge in der Nähe der Klinik. Ich lag meiner Mutter in den Ohren, weil ich dort unbedingt Skilaufen wollte. In der Klinik wurde Mittagsruhe gehalten. Mittags zu schlafen, erschien mir schon immer unsinnig, also nutzten wir diese Zeit, um Skilaufen zu gehen. Das Ende vom Lied war, dass mein Knie sich wieder entzündete. Mein behandelnder Professor, der meine Mutter sehr schätzte, machte uns jedoch im Nachhinein keinen Vorwurf – und ich hatte meinen Spaß gehabt.
Zu Hause waren wir immer viele Leute. Sämtliche Freunde durften bei uns übernachten, wir hatten Au-pairs, Verwandte gingen ein und aus. Ich habe mich immer für all die Menschen interessiert und überlegte mir, warum sie so sind, wie sie sind. Ich konnte mir noch nie vorstellen, mich nur in einem Mikrokosmos zu bewegen und allein zu reflektieren. Wenn ich wieder mal in die Klinik musste, dann nahm ich so viel Leben von außen mit wie möglich.
Es gab Zeiten, in denen ich durch meine Krankheit auch problematische Erfahrungen machte. So wurde ich in der vierten Klasse einmal nicht zum Kindergeburtstag einer Freundin eingeladen. Die Mutter hatte Angst, dass es mit mir Probleme geben könnte, denn ich hatte damals krankheitsbedingt ein eingegipstes Bein (wäre ich Eislaufen gewesen, hätte es auch dadurch passiert sein können). Ich durfte also als einzige Freundin nicht zu dem Geburtstag. Ich war vorher noch nie bei dieser Familie zu Hause gewesen, danach wollte ich nicht mehr dorthin. Kurze Zeit danach lud mich mein bester Freund Felix ein. Er und seine Eltern arrangierten, dass ich mit dem Gips bequem durch die Wohnung kam. Auf Enttäuschungen und Rückschläge folgten in meinem Leben stets Erlebnisse, die Hochgefühle auslösten. Das sollte so bleiben.
In der siebten Klasse wechselte ich zu meinem Bruder auf eine private Schule in Wiesbaden. Den ersten Schultag werde ich niemals vergessen: Ich kam aus einer reinen Mädchenklasse und saß nun plötzlich in einem Raum mit zwanzig Jungen. Am selben Nachmittag verkündete ich meiner Mutter, dass ich dort nie wieder hingehen würde. Es dauerte jedoch nicht lange und ich war über jedes weitere Mädchen, das in die Klasse kam, sauer.
Ich entwickelte ein Gespür dafür, was für mich relevant war, was Priorität hatte. Bereits mit elf Jahren stand für mich fest, dass ich Medizin studieren wollte, also überlegte ich mir, welche Fächer dafür wichtig sind und konzentrierte mich ausschließlich auf diese. Den Rest vernachlässigte ich.
Ich suchte so gut wie nie Kontakt zu Kranken. Nur ein Mal freundete ich mich in der Rheumaklinik mit einem Mädchen an. Selbsthilfegruppen haben mich schon damals nicht gereizt. Mich regelmäßig mit denselben Leuten zu treffen, die die gleiche Krankheit haben, hätte mich deprimiert. Worüber hätten wir sprechen sollen? Über Dosierungen, Therapien, darüber wie es weiter- oder nicht weitergeht? Es tat mir einfach gut, meine „gesunden“ Freunde um mich zu haben. Vielleicht ist es aber auch Angst vor der Wahrheit, die mich solche Situationen noch heute meiden lässt.
Manche Kranke hadern mit der eigenen Lage oder geben sich auf. Ich kann das nachvollziehen, aber für mich nicht akzeptieren, denn es wäre gegenüber meinem Umfeld unverantwortlich. Ich kann die Menschen, die mich lieben, nicht einfach stehen lassen. Sie haben mich bis hierher begleitet, also möchte ich sie auch weiterhin mitnehmen.
Ich habe im Krankenhaus oft Mütter erlebt, die ihr krankes Kind am liebsten in Watte gepackt hätten. Hatte ein Kind zum Beispiel Lust, über den Gang zu rennen, wurde es von der Mutter aus Angst vor einem Sturz daran gehindert – statt sich zu freuen, dass das kranke Kind Kraft zeigt.
Auch meine Familie musste lernen, mit solchen Situationen umzugehen. Ich erinnere mich an einen Tag in Florida. In einer Klinik sollte mir, ich war damals vielleicht neun Jahre alt, Blut abgenommen werden. Als mein Vater und ich die Klinik betraten, bekam ich vom Personal einen wunderschönen Heliumballon geschenkt. Auf dem Behandlungsstuhl hielt ich den Ballon stolz in der Hand und ließ ihn nicht aus den Augen. Außerdem freute ich mich auf einen Ausflug mit meiner Familie und Freunden zu Sea World, wo ich unter anderem Delfine sehen würde. Es ging mir also gut, während mir die Nadel gelegt wurde. Als ich zu meinem Vater sah, bemerkte ich, dass es ihm nicht gut ging. „Ist alles okay?“, fragte ich.
Später, als sich solche Situationen wiederholten, begriff ich, dass es für meinen Vater sehr schwer zu ertragen war, wenn schmerzhafte medizinische Eingriffe bei mir nötig waren.
Alles im Leben stellt ein Risiko dar. Wenn kranke Kinder dies nicht als normal erleben, dann werden sie bald nur noch ihre Krankheit leben. Manchen Eltern bereiten die Untersuchungen mehr Schmerzen als dem Kind, das untersucht wird. Das ist nachvollziehbar, kann für das Kind aber problematisch werden. Kinder müssen lernen, diese Situationen durchzustehen, sie gehören schließlich zu ihrem Leben. Kinder sind stark, wenn man sie lässt. Was für sie zählt, ist das Gefühl, nicht allein zu sein.
Selbstverständlich hätten sich meine Eltern ein gesundes Kind und meine Geschwister sich eine gesunde Schwester gewünscht. Trotzdem haben sie sich nie gefragt: „Warum passiert ausgerechnet uns das?“ Denn die Frage nach Gerechtigkeit ist eine, auf die es keine Antwort gibt.
CHRISTIAN (CHRIS)
Claudia und Christian Kotter
Claudia und Christian Kotter
Claudia ist nur zweieinhalb Jahre jünger als ich und ist nicht nur meine Schwester, sondern auch eine tolle Freundin. Wenn ich heute ein Problem habe, egal, welcher Art, rufe ich als Erstes meine Claudi an; meistens ist das Problem nach zehn Minuten Telefongespräch dann schon gar keins mehr. (Und bei einem Hypochonder kommen solche Telefonate sehr, sehr oft vor.)
Claudi war immer dabei, oft auch, wenn ich mit meinen Freunden unterwegs war. Sie mochte es schon immer gern, im Mittelpunkt zu stehen, war etwas frecher, hat viel gelacht und ist direkt auf die Leute zugegangen. Stellt man sie in eine Menschenmenge, hat sie kurz darauf fünf neue Freunde. So war sie auch als Kind. Dass sie gehandicapt ist, habe ich erst ziemlich spät wahrgenommen. Claudia wollte nie krank sein; sie meinte, dass Krankheit nicht zu ihr passen würde. Sie hat sich nie mit der Situation abgefunden, sondern einfach immer weitergemacht. Unfair war, dass ihr niemand sagen konnte, welchen Verlauf die Sklerodermie nehmen würde, dass Claudia nie wusste, was auf sie zukommen würde. Auch damit fand sie sich nicht ab. Sklerodermie kann Nieren, Herz, Verdauungstrakt und die Lungen befallen, kann aber auch nichts befallen. Claudia lebte, als würde ihr die Sklerodermie nichts Schwerwiegendes anhaben können – immer aktiv und sogar für mich manchmal in allem viel zu schnell. Als großer Bruder habe ich Claudia dann oft bremsen müssen. Immer der zu sein, der sagt: „So, Claudi, jetzt gehst du aber lieber heim und schonst dich!“, oder „Claudi, hier ist es zu verraucht“, oder: „Das ist doch Quatsch, dafür reicht doch der Sauerstoff gar nicht!“, fiel mir nicht leicht. Ich habe lange gebraucht zu verstehen, dass ich mein kleines Schwesterchen nicht wie ein rohes Ei behandeln darf und nicht immer Angst um sie haben muss. Damals wie heute bewundere ich, wie meine Schwester mit allem umgeht, dass sie alles, was sie anpackt, gut macht, sei es der Umgang mit ihrer Krankheit, mit den Menschen die ihr nahestehen oder ihre Herzenssache, der Verein Junge Helden.
USA, 1997
Zum ersten Mal wirklich krank habe ich mich mit 17 gefühlt. Meine ganze Familie reiste durch Kalifornien. Die Reise von San Diego über L.A. nach Seattle war unheimlich schön und lustig, aber für alle auch sehr anstrengend.
In Portland bekam ich plötzlich keine Luft mehr. Vorher hatte mich schon manches ungewöhnlich stark angestrengt, doch plötzlich konnte ich nicht mehr richtig atmen. An meinen Beinen bildete sich ein Ausschlag und ich hatte Rückenschmerzen. Da wir aber fast jede Nacht in einem anderen Hotel schliefen, schob ich die Schmerzen im Rücken auf die schlechten Betten, den Ausschlag auf das Waschmittel und die Schwierigkeiten beim Atmen auf die Klimaanlagen.
Nach der Ankunft in Deutschland, am nächsten Tag, wurde festgestellt, dass ich eine Lungenentzündung hatte. Es dauerte lange, bis es mir wieder besser ging.
WIESBADEN, 1998
Meinen 18. Geburtstag feierte ich im Opelbad in Wiesbaden, einem Freibad auf einem Berg. Nachts um vier Uhr saß ich neben meiner Mutter und sagte zu ihr: „Ich kann nicht mehr.“ Ich hatte in der Nacht sehr hohes Fieber bekommen, konnte kaum noch gehen und hustete unentwegt. Mein damaliger Arzt in Wiesbaden sah mich an, sagte kein Wort und legte mich auf die Intensivstation. Ich weiß noch, dass ich in diesem Bett lag und mich fragte: „Was passiert hier gerade?“
Es war ein starker Schub meiner Krankheit, der sich unter anderem auf die Lunge ausgewirkt hatte. Bei Sklerodermieschüben wird übermäßig viel Kollagen produziert, das sich im Gewebe anlagert. In meinem Fall in der Lunge, die sich verhärtete; es kostete mich mehr Kraft, zu atmen, wodurch sich die Belüftung der Lungenflügel und der Sauerstoffaustausch erschwerten. Diese Schübe kamen in unberechenbaren Abständen.
Von diesem Tag an wurde ich mit Kortison2 behandelt. Immerhin elf Jahre später, als andere Ärzte es vorgehabt hatten. Mein Körper sprach dann gut darauf an, und mir ging es bald besser. Ich beschloss, Kraft und Kondition zu trainieren, weil ich trotz des Defekts in der Lunge die gleichen Leistungen erbringen wollte wie zuvor.
Kurz darauf stand ich in dem trashigen Fitnessstudio von Alex, den ich über einen Freund kannte, und trainierte zwischen lauter Muskelprotzen. Alex verstand mein Anliegen sofort und kniete sich voll rein. Ich wusste, dass dieses Training genau das Richtige für mich war, dass ich auf keinen Fall in eine Reha oder Ähnliches gehen wollte, ich war überzeugt, dass das Extreme mir helfen würde, in diesem Fall eine Umgebung, in der Leute hardcore trainierten. Zwei Jahre ging ich dorthin, zum Schluss täglich. Ich war so weit stabilisiert, dass ich mit meiner Lunge leben konnte, als hätte ich nie einen schweren Schub gehabt. Ich ging Skilaufen, machte anderen Sport – und eine Infusionstherapie im Krankenhaus.
Die Schule hatte unter all dem gelitten, also suchte ich in Wiesbaden die Schule für Kranke auf, in der die Lehrer zu den Patienten kommen, ob in die Klinik oder nach Hause, um sie zu unterrichten. Meiner Lehrerin, Frau Wiedenrodt, habe ich es zu verdanken, dass ich Abitur machte, sie hat mich wirklich durch die Prüfungen geboxt.
Im Unternehmen meiner Mutter absolvierte ich ein Jahr lang ein Praktikum im Bereich Marketing und Public Relations. Danach begann ich an der Fachhochschule in Wiesbaden BWL zu studieren. Doch ich merkte bald, dass dieser Fachbereich nicht wirklich das Richtige für mich war, ich stellte auch das Studieren an sich in Frage und hatte das Gefühl, Zeit zu verlieren. Nebenbei habe ich soziale Krankenhausprojekte unterstützt. Ich war zwanzig Jahre alt. Und ich verliebte mich das erste, das zweite, das dritte Mal …
Nachdem ich den Sklerodermieschub in der Nacht meines 18. Geburtstags beinahe nicht überlebt hatte, fing ich an, die Dinge anders zu sehen: Leben und Tod passieren. Menschen kommen und gehen. Menschen werden krank, auch wenn uns das nicht gefällt. Man muss aufwachen und das akzeptieren. Dieses „später“ und dieses „eines Tages“ gibt es einfach nicht. Das Leben findet jetzt statt, man kann es nicht verschieben.
Im März 2002 beschloss ich dann, nach San Diego zu gehen.
SAN DIEGO, FRÜHJAHR 2002
Ben, ein Freund, den ich 1997 auf Norderney kennengelernt hatte und der, als er auf Weltreise ging, sporadischen Kontakt zu mir hielt, rief im Februar 2002 an, weil er wissen wollte, wie es mir ging. Kurz darauf besuchte er mich in Mainz und bestätigte mich in meinen Plänen, nach San Diego zu gehen. Er hatte Freunde dort, zu denen ich Kontakt aufnehmen konnte und die ich sicher mögen würde. Außerdem lebten meine Cousine Chrissi und ihr Freund Jojo in San Diego. Ich freute mich auf das bevorstehende Abenteuer. Ich machte noch von Deutschland aus eine Sprachschule ausfindig, eine WG, in der ich mit drei Mädchen wohnen würde, und ein Krankenhaus, in dem ich meine Infusionstherapie fortsetzen konnte. Ich kontaktierte Bens Freund Erik und erklärte ihm vorab, dass ich nicht ganz gesund sei. Es war mir immer wichtig, niemanden diesbezüglich zu verunsichern, jeder sollte das Gefühl haben, mich alles fragen zu können.
Erik holte mich noch am ersten Abend aus der WG ab. Ben hatte mit seiner Vermutung völlig recht: Wir verstanden uns sofort.
Ich lernte über Erik und Emilie, eine meiner Mitbewohnerinnen, eine Menge Leute kennen, die von überall her kamen. In San Diego hatte ich das Gefühl, die Welt gehöre mir, ich war frei, die Tage waren unbeschwert. Ich war dort nicht als Tourist, sondern ich lebte in diesem Land, ich lebte mit meinen Freunden. Ich fühlte mich einfach wohl. Die Tage waren mit alltäglichen Dingen gefüllt, wie Sprachschule, Strand oder einfach nur da sein. Ich polierte meine Sprachkenntnisse auf und ging täglich zu meiner Physiotherapeutin.
Ich war glücklich, so glücklich, dass ich erwog, zum Studieren in San Diego zu bleiben. Ich liebäugelte tatsächlich damit, denn San Diego bedeutete ein Leben am Meer und in der Sonne, beides nicht nur faszinierend, sondern auch gut für mich. Die Winter in Deutschland dagegen bereiteten mir Schwierigkeiten. Ich überlegte mir, in den Fachbereich Meeresbiologie (der mit Sea World zusammenarbeitete) zu wechseln, weil die Meeresbiologen einfach den schönsten Campus hatten – direkt am weißen Sandstrand, das Meer vor der Tür.
Das Leben war unbeschwert und absurd leicht. Wir machten bei Marktforschungsstudien mit, streiften dabei zum Beispiel verschiedene Kondome über Zucchini und testeten die Abrolleigenschaften. An solchen Studien durften Ausländer teilnehmen; wir bekamen dafür 40 Dollar und eine bizarre Erinnerung.
An einem Sonntag waren Chrissi, Jojo und ich Rollschuhlaufen. Ich merkte plötzlich, dass es mich sehr anstrengte, und konnte mir das nicht erklären. Abends lag ich in der WG auf dem Sofa und sah Never Been Kissed mit Drew Barrymore. Ich fing leicht zu husten an. Nachts nahm ich eine ziemliche Menge Codeintropfen gegen den Hustenreiz und konnte am nächsten Tag nicht in die Sprachschule gehen. Mittags fühlte ich mich besser. Wir waren wie immer am Strand. Als ich zur Toilette ging, fiel es mir schwer, die Treppe hochzusteigen; es wurde zu anstrengend. Abends war ich dann mit Erik auf einer Campusparty, als ich plötzlich stark zu husten begann. Im nächsten Moment blutete ich aus dem Mund. Ich blutete so stark, als wäre durch den Husten ein Gefäß geplatzt. Ich stand auf der Toilette, hustete, blutete und dachte: Was passiert mir gerade?