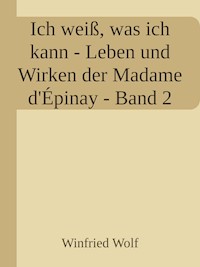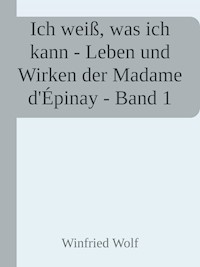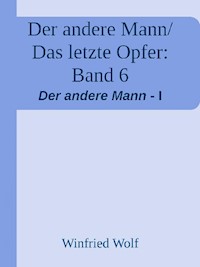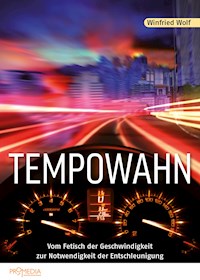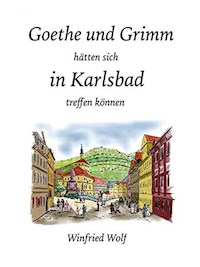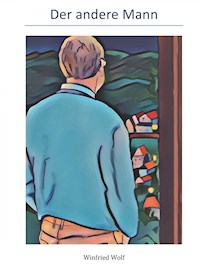Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Als Friedrich Melchior Grimm 1748/49 nach Paris kam, war sein "Rucksack" schon halb gepackt oder besser gesagt: sein Kopf hatte noch viel Platz für Neues. Grimm war der Sohn eines Predigers aus Regensburg, er hatte in Leipzig bei Gottsched und Ernesti studiert, stand nach dem Studium als Hofmeister in Diensten des kursächsischen Gesandten beim Immerwährende Reichstag in Regensburg und hatte sich nichts weniger vorgenommen, als in der Weltkulturhauptstadt Euroas Karriere zu machen. Friedrich Melchior Grimm wusste die vorhandene geistige Gemengelage zu nutzen. Er verstand es, in einem ihm völlig fremden Umfeld in kurzer Zeit auf sich aufmerksam zu machen. Er ergriff Partei für die Gruppe der Aufklärer um Denis Diderot, nahm Stellung zu strittigen Fragen im kulturellen Umfeld seiner Zeit und seine Stimme wurde gehört. Doch Grimm zeigte sich nur kurz auf der für alle einsehbaren Bühne, bald zog er sich hinter den Vorhang zurück und wirkte dort im Stillen für die Sache der Aufklärung. Mit seiner Correspondance littéraire wurde er, ohne dass dies eine größere Öffentlichkeit zur Kenntnis nahm, bald zu einem Kulturvermittler ersten Ranges.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 454
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Winfried Wolf
Neuigkeiten aus Paris
Winfried Wolf
Neuigkeiten aus Paris
Friedrich Melchior Grimm und seine Zeit
Impressum
Texte: © 2022 Copyright by Winfried Wolf
Umschlag:© 2022 Copyright by A. E. Treitinger
Verantwortlich
für den Inhalt:Winfried Wolf
Scharnhorststraße 26
93049 Regensburg
Druck:epubli – ein Service der Neopubli GmbH, Berlin
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Grimm, ein Jünger Gottscheds
Grimm und die Musik
Die Strahlkraft Frankreichs und seiner Denker
Grimm macht sich bekannt
Grimm trifft Rousseau
Grimm triff Diderot
Grimm im Kreis der Enzyklopädisten
Diderots Encyclopédie
Grimm, ein Propagandist der Aufklärung
Grimm bedient sich des „Salons“
Grimms Kritik am Salonleben
Die Männer der Aufklärung
Grimms Berufung
Grimms Correspondance littéraire
Grimms Konzeption einer Correspondance littéraire
Ein Sprachrohr der Philosophen
Kritische Öffentlichkeit als Mittel der Aufklärung?
Grimm grenzt sich ab
Die Correspondance littéraire, ohne Struktur und Ordnung?
Grimms Abonnenten
Grimms Mitarbeiter
Das Autorengespann Diderot und Épinay
Wer ist der Autor?
Das Programm der Correspondance littéraire
Grimms Einsatz für Diderots Enzyklopädie
Philosophen gegen Anti-Philosophen
Die Correspondance littéraire ergreift Partei
Diderots späte Antwort
Kampf um Toleranz und Gerechtigkeit
Die Affäre Calas
Über Verbrechen und Strafen
Der Fall Barre
Ist Grimm ein Aufklärer?
Grimms große Deutschlandreise
Neue Ansätze im Zeitalter der Aufklärung
Grimm ist kein Philosoph, aber er hat eine Einstellung
Alles endet mit Diplomatie
Dann wenigstens den Polarstern!
Literatur
Zeittafel – Friedrich Melchior Grimm
Über dieses Buch:
Zum Autor
Vorwort
In „Neuigkeiten aus Paris“ werden Leser meines Buches „Friedrich Melchior Grimm, ein Aufklärer aus Regensburg“ auf bereits Bekanntes stoßen, was nicht weiter verwunderlich ist, da sich an der Darstellung einer historischen Person wie Grimm in den grundlegenden Lebensdaten so schnell nichts ändern wird. Doch hier sollen nicht die einzelnen Stationen seines Lebens sowie persönliche Verwicklungen des Helden im Vordergrund stehen, sondern, einen Schritt zurücktretend, das geistige Umfeld seiner Pariser Zeit, welches ihn prägte und handeln ließ.
Als Grimm 1748/49 nach Paris kam, war sein „Rucksack“ schon halb gepackt oder besser gesagt: sein Kopf hatte noch viel Platz für Neues. Friedrich Melchior Grimm war der Sohn eines Predigers aus Regensburg, er hatte in Leipzig bei Gottsched und Ernesti studiert, stand nach dem Studium als Hofmeister in Diensten des kursächsischen Gesandten beim Immerwährenden Reichstag in Regensburg und hatte sich nichts weniger vorgenommen, als in der Welt-kulturhauptstadt Europas Karriere zu machen.
Für einen Bürgerlichen, der aus bescheidenen Verhältnissen stammte, damals ein nahezu unmögliches Ding, doch die Umstände waren günstig, eigenes Vermögen und geistiges Umfeld passten zueinander, und so konnte sich etwas Großartiges ergeben.
Friedrich Melchior Grimm wusste die vorhandene Gemengelage zu nutzen. Er verstand es, in einem ihm völlig fremden Umfeld, in kurzer Zeit auf sich aufmerksam zu machen. Er ergriff Partei für die Gruppe der Aufklärer um Denis Diderot, nahm Stellung zu strittigen Fragen im kulturellen Umfeld seiner Zeit und seine Stimme wurde gehört.
Doch Friedrich Melchior Grimm zeigte sich nur kurz auf der für alle einsehbaren Bühne, bald zog er sich hinter den Vorhang zurück und wirkte dort im Stillen für die Sache der Aufklärung.
Mit seiner Correspondance littéraire wurde er, ohne, dass dies eine größere Öffentlichkeit zur Kenntnis nahm, bald zu einem Kulturvermittler ersten Ranges.
Man hielt Grimm lange Zeit, vor allem noch im 19. Jahrhundert, für einen seichten Schwätzer und Erzähler von Anekdoten und übersah dabei geflissentlich, dass er mit seinen Kommentaren und kritischen Stellungnahmen ein beredter Kämpfer für die Aufklärung war.
Er hatte den fürstlichen Abonnenten seiner Correspondance littéraire mehr zu bieten als die Übermittlung des neuesten Theaterklatsches. Grimm scheute sich nicht, wenn ihm dies notwendig und wichtig erschien, eine klare Position zu vertreten; seine eigentliche Bühne aber fand er nicht vor, sondern hinter dem Vorhang, wo er abseits der großen Deklamationen am Schreibtisch seine Fäden zog und seinen Freunden nach Kräften half, die Ideen der neuen Zeit auf seine Art zu verbreiten.
Wir werden in diesem Buch darzustellen versuchen, wie Grimm sich in den geistigen Querelen und Debatten seiner Zeit am Projekt der Aufklärung beteiligte. Als die Gegensätze zwischen Philosophen und Antiphilosophen immer deutlicher zu Tage traten, als die Enzyklopädie gar in ihrem Fortgang gefährdet war, als eine Reform des Theaters anstand und hasserfüllte Kommentare eine Entwicklung unmöglich machen wollten, als Kritik an der französischen Oper alten Stils laut wurde und man der italienischen Oper den Vorzug zu geben begann – da ergriff Grimm Partei für die Enzyklopädisten um Diderot und d’Alembert. Dabei vertrat er durchaus auch einen eigenen Standpunkt und ließ sich von seinen Freunden, den „philosophes“1 nicht kritiklos auf deren Seite ziehen. Vor allem aus dieser Perspektive wollen wir auf Grimm schauen und sein Eintreten für die „neue Philosophie“ würdigen.
Grimm, ein Jünger Gottscheds
„Paris am 23. Juni 1753
Es ist ein Jahrhundert her, mein Herr, dass ich mir vornahm, die Ehre zu haben, auf Ihre letzte Nachricht zu antworten. Meine Ablenkungen, eine Art von Ausschweifung, für die man sich in Paris nie gut absichern kann, und hunderttausend andere Gründe, die alle gleich schlecht sind, sind die Ursache für ein Schweigen, das ich mir jeden Tag regelmäßig zweimal beim Aufstehen und beim Zubettgehen vorwerfe. Ich schmeichle mir, mein Herr, dass Sie nicht an meinen Gefühlen und meiner Anhänglichkeit zweifeln, die sicherlich nur mit meinem Leben enden wird. Ich wage es fast nicht, Ihnen den kleinen Propheten von Böhmischbroda zu schicken, man hat eine Ausgabe davon bei Ihnen gemacht. Es ist schrecklich, dass Sie ihn nicht aus meiner Hand erhalten haben. Ich schicke Ihnen die Schrift mit einer Komödie von Herrn Rousseau, deren Vorwort viel Aufsehen erregt hat. Der Prophet hat in Paris einen ungeheuren Erfolg gehabt, man hat in weniger als einem Monat drei Ausgaben davon gemacht. Um diese Broschüre richtig zu verstehen, müsste man tausend kleine Umstände kennen, die man den Ausländern nicht erklären kann und die das Salz des Witzes ausmachen. Sie haben zweifellos die erste Ausgabe in Leipzig gehabt und müssen über viele Dinge Bescheid wissen, die wir nicht genau kennen.
Maupertius ist seit einem Monat hier, ich habe ihn beim Spaziergang gesehen, und ich werde mit ihm eines Tages bei einem meiner Freunde zu Abend essen. Inzwischen haben wir die Übersetzung Ihrer Grammatik gedruckt. Hier ist, was im Merkur darüber gesagt wurde: ‚Herr Gottsched, der in Deutschland durch den guten Geschmack der Literatur, den er dort verbreitet hat, und in Frankreich durch die Lobeshymnen, die ihm ein Mann von großem Geist, der nur lobenswerte Menschen lobt und sie gut lobt, [...] bekannt ist, ist der Autor der Grammatik, die wir ankündigen. Wir haben darin die Klarheit, Ordnung und Logik gefunden, die man sich in solchen Werken oft unnötigerweise wünscht.‘ Sie sehen, mein Herr, dass in diesem Lob ein Strahl Ihres Ruhmes auf mich gefallen ist, und ich bin stolz darauf. Niemand könnte mehr Verehrung, Anhänglichkeit und Zärtlichkeit für Sie haben, als ich es habe. Ich flehe Sie an, sich davon zu überzeugen. Sie werden die Güte haben, mich Frau Gottsched zu Füßen zu legen und mich dort für den Rest meines Lebens zu lassen. Ich bin völlig unwissend über alles, was auf dem Sächsischen Parnass geschieht, und ich könnte mich nicht besser als an den Präsidenten wenden, um Neuigkeiten zu erfahren. Ich habe die Ehre, mit der vollkommensten Verehrung etc. etc. zu sein.“
Grimm legt die Feder aus der Hand und macht ein zufriedenes Gesicht. Er schreibt seinem Meister in alter und treuer Verbundenheit. Er schickt ihm eine Schrift, die ihn, seinen ehemaligen Schüler, in Paris ins Gespräch gebracht hat, in Paris wohlgemerkt, der Weltkulturhauptstadt. In Deutschland werden sie vielleicht nicht gleich verstehen, worum es geht, aber die Frau Professorin2 wird es ihren Landsleuten schon zu erklären wissen und Gottsched wird erkennen, dass sein Schüler, Friedrich Melchior, nun auch in Frankreich ganz in seinem Sinne die alten Zöpfe abzuschneiden beginnt.
Wer hätte das gedacht! Ein junger Deutscher, gerade erst im Zentrum der geistigen Welt angekommen, erregt hier bereits Aufmerksamkeit. Selbst vom großen Voltaire hört man anerkennende Worte über diesen „Böhmen“.
Nein, aus Böhmen kommt Grimm nicht, das betrifft nur seinen „kleinen Propheten“. Grimm kommt aus Regensburg, der Stadt des Immerwährenden Reichstages, einer Stadt, in der es, wie sich Grimm erinnert, nicht einmal anständige Bücher zu kaufen gab. Wie sehr hatte es ihn damals, neun Jahre ist das her, gedrängt, endlich nach Leipzig zum Studium gehen zu können, um dort den großen Meister zu hören. Leipzig, ja, das war schon etwas anderes als dieses verschlafene Regensburg! Dabei hatte er es ja noch gut getroffen, er wohnte bei seinem Bruder im Haus des kursächsischen Gesandten am Neupfarrplatz, da konnte man auch schon Kontakte zur großen Welt knüpfen.
Grimm dachte an Frankfurt, Graf von Schönberg hatte ihn 1745 mit zur Kaiserkrönung von Franz I. genommen. In Frankfurt, erinnerte sich Grimm, war er Zeuge von allen großen Sachen gewesen, hier gab es großstädtisches Leben, jeden Abend konnte man ins Theater gehen und Bücher gab es zu kaufen, so viele wie der Geldbeutel hergab. Bildete sich damals in ihm schon der Wunsch, später einmal nach Paris zu gehen?
Grimm griff wieder zur Feder, er hatte etwas Wichtiges vergessen. Er musste Gottsched ja noch seine Adresse mitteilen, es sollte schließlich nichts verloren gehen.
„P.S.Meine Adresse lautet: l'hôtel de Frise Rue basse du Rempart Faubourg St. Honoré, ohne andere Eigenschaft, da ich keinen Sekretär des Grafen von Friesland mehr habe. Obwohl ich nicht mehr die Ehre habe, dem Herrn Grafen von Friesland verbunden zu sein, habe ich dennoch die Ehre, in seinem Haus zu wohnen. Ich bitte Sie, mein Herr, für die Sicherheit Ihrer Briefe die Adressen genau anzugeben. Ich sende Ihnen auch die drei Kapitel; Fortsetzung des kleinen Propheten. Sie sollten sie in Sachsen ebenso wie die Propheten drucken, zumal dies hier äußerst selten ist. Der Dorfwahrsager (übrigens) ist ein charmantes Intermezzo, dessen Texte und Musik von Herrn Rousseau stammen.“
Ach ja, der Dorfwahrsager. Er war mit Rousseau und Fräulein Fel zusammen auf Einladung des Königs nach Schloss Fontainebleau gefahren. Die Probe fiel auf der königlichen Bühne wider Erwarten gut aus. Das Orchester zeigte sich ausdrucksstark und die Sänger konnten überzeugen. Das schöne Fräulein Fel entzückte als Colette, da gab es keinen Ton, der nicht zu Herzen ging. Selbst die Mätresse des Königs zeigte sich gerührt und auch Rousseau, dem er vorher noch eindringlich geraten hatte, sich anständig zu kleiden, schließlich war man ja beim König eingeladen, zeigte sich betroffen. Dieser Erfolg hätte ihm den Weg ebnen können, aber der Mann war nicht bereit, seine Selbständigkeit zu opfern. Der Apostel der Wahrheit und der Tugend wollte sich nicht durch eine Pension, die ihm der König versprach, aushalten lassen, Rousseau wollte niemandes Sklave sein. Diderot hatte ihm nahegelegt, die zugesagte Pension anzunehmen, schließlich hätte er Frau und Schwiegermutter zu versorgen, aber der eigenwillige Rousseau hatte abgelehnt. Naja, vielleicht war das ja auch gut so, beim Pariser Publikum kam sein „Dorfwahrsager“ jedenfalls an und konnte sich neben jeder Opera buffa und sogar neben Pergolesis „Serva padrone“3 gut behaupten.
Er und Gottsched waren sich in ihrer Einstellung zum musikalischen Drama schon in Leipzig einig gewesen. Und meine Satire „Le petit prophète de Boehmischbroda“ , dachte Grimm bei sich, muss ganz im Sinne des Meisters ausgefallen sein. Die Kulmus jedenfalls hatte den Text frei ins Deutsche übertragen, um ihrerseits Weisses Operette „Der Teufel ist los“ mit Kritik überziehen zu können.
Er war seinem Meister auch sonst sehr von Nutzen gewesen, seine Bearbeitung und Übersetzung von Gottscheds deutscher Grammatik hatte noch einmal beider gemeinsames Interesse deutlich machen können, noch zogen sie an einem Strang.
Grimm und die Musik
Als Grimm mit seinem Brief über Omphale und seinem Kleinen Propheten von Böhmischbroda in Frankreich an die Öffentlichkeit trat, hatte er sich bereits so viel mit zeitgenössischer Musik beschäftigt, dass er sich zutrauen konnte, auf diesem Gebiet fachkundig Stellung zu beziehen.4 In seinem Brief an Gottsched vom 3. Februar 1752 schrieb er: „Ich habe gestern eine kleine Schrift unter die Presse gegeben, sie hat diese Aufschrift: Lettre de M. Grimm sur Omphale Tragédie lyrique reprise par l’Académie de la Musique le 14. Janvier 1752.“ Und Grimm merkte an: „Obwohl darin verschiedene Stellen in Deutschland nicht verständlich sein können, werde ich doch nicht ermangeln Ew Magnifizenz ein Exemplar davon zu überschicken.“5
Grimms Auseinandersetzung mit der Oper sollte ihn in Paris schlagartig bekannt machen. Mit seinem „Brief über Omphale“ stieg er öffentlichkeitswirksam in die Auseinandersetzungen um die französische Oper ein, eine Auseinandersetzung, die schon lange das französische Musikleben bestimmte. Die Oper Omphale, die zu Beginn des Jahrhunderts auf die Bühne gebracht, öfter wiederholt und am 14. Januar 1752 unter allgemeinem Beifall des Pariser Publikums neuerlich gegeben wurde, bot Grimm den Einstieg in die Musikszene. Den Text der Oper hatte La Motte verfasst und die Musik war von Destouches. Noch Ludwig XIV. hatte Letzteren als würdigsten Nachfolger Lully’s6 bezeichnet, andere sahen in ihm nichts weiter als einen platten Komponisten. In seinem „Brief über Omphale“ zerriss Grimm die Oper in Stücke. Er lobte zwar den Sänger Jélyotte und die Sängerin Fel überschwänglich, seine Abhandlung schien aber nur den Zweck zu verfolgen, Rameau, den neuen Stern am französischen Opernhimmel, im besten Licht erscheinen zu lassen. Grimm ließ Lully zwar als den Urheber der französischen Oper gelten, erklärte aber, dass derselbe jetzt eine abgetane historische Erscheinung sei.
Rameau war nun für Grimm der neue Orpheus Frankreichs, ihm legte er huldigend alle Kränze nieder. Diesem Lob wollten sich einige seiner Freunde, die nur eingeschränkt Rameaus instrumental begleiteten Sprechgesang anerkannten, jedoch nicht anschließen.7 In Hymnen besang Grimm dagegen die Schöpfungen des neuen Orpheus. Rameau’s „Hippolyte et Aricie“8 bezeichnete er als unvergängliche Musiktragödie. Am „Zoroastre“9 rühmte er mit Diderot insbesondere den vierten Akt. Die Schönheit des „Pygmalion“10 kann er nicht genug herausstreichen und die Oper „Platée“11 endlich war ihm ein „erhabenes und vielleicht unerreichbares Werk der komischen Gattung“ - und Rousseau, er teilte hier durchaus Grimms Meinung.
So treffend Grimms Kritiken im Einzelnen waren, so zeigt sich doch gerade am Beispiel Rameaus auch, wie zweifelhaft sein Urteil mitunter war und wie sehr er im Wandel der Zeiten an einmal ausgesprochenen Kunstprinzipien mit einer gewissen Sturheit festhielt. Noch in der „Lettre sur Omphale“ hob Grimm Rameaus Verdienste hervor; mit Begeisterung zählt er dessen bisherige Opern „Hippolyte et Aricie“, „Les Fetes de l’Hymen“ und „L’Amour“ auf. Doch dann wandelt sich Grimms Einschätzung. Die Rezension der Oper „Nais“ fällt schon weniger günstig aus. Grimm hat Einwände an der Harmonie, die Rameau in Anwendung brachte. Noch abfälliger ist die Besprechung der Oper „Zoroastre“, welche er eine „opéra des laites“ (Salatoper) nennt, weil darin nur der poetische Teil gut, die Musik aber höchst mittelmäßig sei: "Es ist mehr als sechzig Jahre her, dass man so viel Pracht in unserer Oper gesehen hat ... Das Gedicht ist gut geschrieben, aber das Verhältnis der verschiedenen Teile ist nicht spürbar ... Das Rezitativ ist schwach, die Symphonien mittelmäßig, die Chöre bewundernswert. Das hat einen schlechten Witzbold dazu gebracht, zu sagen, dass es die Oper der Salate sei, von denen nur das Herz gut ist."
Aber gerade die Oper „Zoroastre“ zeichnet sich durch Individualisierung der dramatischen Bühnencharaktere aus, sie bietet eine reiche Koloratur im Sologesang und enthält in den Stimmen bewegtere Ensemble-Sätze. In der Schlussszene des 4. Aktes verbindet Rameau besonders schön den Chor mit Solostimmen zu einem lebhaften Ensemble. Für solche musikalischen Vorzüge aber besaß Grimm weder das Verständnis noch verfügte er in seiner „Mission“ gegen die französische Oper über die notwendige Objektivität. Der sonst so kühle Grimm, hier trug ihn die Leidenschaft für eine Partei fort.
Grimm selbst konnte recht gut auf dem Cembalo spielen und lobte sich selbst: "Ich war ziemlich gut auf dem Cembalo.“12 Nach den gemeinsamen Mahlzeiten mit Klüpfel, dem Reiseprediger des Erbprinzen von Sachsen-Gotha und Rousseau, seinen „Spießgesellen“ der ersten Zeit in Paris, folgte häufig ein kleines, improvisiertes Konzert der Freunde.13 Aber reichten diese musikalischen Grundfähigkeiten aus, um auf dem musikalischen Kampfplatz als Kritiker auftreten zu können? Obwohl Grimm weder mit der Theorie der Musik noch hinreichend mit deren Geschichte vertraut war, nahm er dieses Recht für sich selbstbewusst in Anspruch. Sein Urteil in musikalischen Dingen stützte sich nahezu ausschließlich auf den Wohllaut des Gehörten und seine Leidenschaft für die Musik ist nicht zuletzt auch dem polemischen Charakter seines Zeitalters geschuldet.
Grimm traute sich zu, über Musik zu sprechen, ohne die Musik wissenschaftlich betrieben zu haben. In seiner „Lettre sur Omphale“ stellt er es so dar: "Ich glaube sagen zu können, dass der Zweck der Musik darin besteht, durch harmonische und rhythmische Sinne angenehme Empfindungen hervorzurufen, und dass jeder Mensch, der nicht taub ist, das Recht hat, zu entscheiden, ob sie ihren Zweck erfüllt hat." Und was sein Verständnis für eine nationale Musik angeht, so fügt er hinzu: "man muss außerdem den Charakter der Sprache in Bezug auf den Gesang kennen ...“
Das Recht, über Musik urteilen zu können, ist allerdings, so Grimm, auch nur dann gegeben, wenn ein ausgezeichnetes Gefühl für die Schönheit hinzukommt. Am Anfang seines „Poeme lyrique“14, Grimms Beitrag für die Encyclopédie, schreibt er: "Musik ist eine Sprache; das lyrische Gedicht drückt sich in einer Sprache aus, die man nicht ohne Genie sprechen kann, aber auch nicht ohne einen feinen Geschmack, ohne erlesene und geübte Organe hören kann."
Grimms Erfahrungen mit der Oper brachte er aus Deutschland mit, dort hatte er Aufführungen italienischer Opern, meist mit italienischen Sängern besetzt, besucht. Das Repertoire der französischen Oper, das bei Grimms Ankunft in Paris von Rameau und Lully und dessen Epigonen beherrscht wurde, musste bei ihm Ablehnung und Langeweile hervorrufen. Die psalmodierenden Rezitative der französischen Oper riefen in ihm die Sehnsucht nach den einschmeichelnden Melodien der Italiener wach. Vor diesem Hintergrund erklärt sich Grimms beständiger Kampf gegen die Königliche Akademie der Musik.
Mit der Wiederaufführung der Omphale bot sich ihm 1752 eine erste Gelegenheit, der französischen Oper den Kampf anzusagen. Für Grimm war die Omphale eine der ödesten Opern des 1749 gestorbenen Komponisten Destouches. Er nennt ihn "den flachsten Komponisten, den Frankreich je hatte, was nicht wenig ist"..15
Man kann wohl sagen, dass Grimm mit seiner „Lettre sur Omphale“ als Erster die Rückständigkeit der französischen Oper öffentlichkeitswirksam aufgedeckt hat. Sein ästhetisches Prinzip gipfelt in den Worten: "Das Ziel aller schönen Künste ist es, die Natur zu imitieren."16
Grimms Vorwürfe richten sich vor allem gegen die Stoffe der Opern, gegen "dieses falsche Genre, wo nichts an die Natur erinnert".17 Opern, in denen es von Göttern, Genien, Feen und Allegorien der Tugenden und Laster nur so wimmelt, sind ihm zuwider.
Über die Oper „Zoroastre“ in der Académie royale de musique schreibt er: "Sie werden alles finden, außer der Natur und ihrem erhabenen Charakter; indem sie sie nachahmt und ewig kopiert, wird das Genie des Menschen immer neue Quellen der Schönheit erschließen und die Meisterschaft erlangen, nach seiner Wahl den Herzen seiner Mitmenschen den Eindruck von Freude oder Traurigkeit zu vermitteln."18 Grimm vergleicht die französischen Stücke mit englischen Theaterstücken und stellt deren Überlegenheit heraus. Den Erfolg und die Stärke der englischen Stücke, er nennt das Beispiel der Oper „Les Gueux“ von J. Gay19, sieht er in deren Inhalt: "Sie befinden sich dort in der schlechtesten Gesellschaft der Welt; die Schauspieler sind Diebe, Schurken, Gefängniswärter, öffentliche Mädchen usw.; trotz alledem gefällt es einem dort und es fällt einem schwer, sie zu verlassen: es gibt nichts Originelleres und Wahrhaftigeres in der Welt."20
Grimm stellt die englischen Operntexte denen der französischen Oper als Muster gegenüber und was den musikalischen Teil angeht, sind es die Italiener, die er als Vorbilder heranzieht. Er rühmt die Oper des Italieners Duni "Der Maler, der in sein Modell verliebt ist", weil sie den französischen Komponisten zeige, wie man es anfangen müsse, Worte in Musik zu verwandeln. Grimm nimmt aber auch die Fehler der italienischen Theater, deren Logen Unterhaltungs-Salons seien, in denen man sich um die Vorgänge auf der Bühne wenig kümmere und nur dann eine Pause in der Unterhaltung eintreten lasse, wenn ein beliebter Sänger gerade eine Arie schmettert, die jedermann schon auswendig kennt, aufs Korn. Er findet es befremdlich, wenn Sänger dazu verführt werden, willkürlich andere Arien einzuschieben, wenn ihnen die ursprünglich vom Komponisten geschriebene Melodie nicht zusagte.
Ein anderer Vorwurf Grimms richtet sich gegen Balletts und Singtänze, welche die französische Oper überfluteten und die Handlung fast in den Hintergrund drängten. Seiner Meinung nach dürften Opern nicht durch Tänze zerschnitten werden und witzig fügt er hinzu: "Die französische Oper ist zu einem Spektakel geworden, bei dem das ganze Glück und Unglück der Figuren darin besteht, dass sie um sich herum tanzen."21
Alle Anklagen Grimms gegen die französische Oper sind in seiner Kritik der Oper „Les surprises de l’amour“ zusammengefasst. Der Beitrag erschien in der Septemberausgabe der Correspondance littéraire im Jahr 1757:22"Er hat unsere Oper zum kältesten, kindischsten und gotischsten Schauspiel gemacht, das es gegenwärtig auf der Erde gibt ... aber alles trägt - so scheint es mir - dazu bei, aus unserer Oper den Geschmack und das Feuer des Genies zu verbannen, ohne die jede Aufführung fade und flach wird. Die Vereinigung oder, besser gesagt, die Vermischung zweier Imitationen, die allen Prinzipien des guten Geschmacks zuwiderlaufen, ist zu einem wesentlichen Punkt unserer Oper geworden; der Gesang wird ständig durch den Tanz unterbrochen, der Tanz durch den Gesang. [...] Die Kunst, die die Natur durch den Tanz nachahmt, darf nichts mit der Kunst gemein haben, die durch den Gesang nachahmt; es ist ein Überbleibsel gotischer Barbarei, sie zu verwechseln. ... Wenn man liebt, hat man wirklich etwas anderes zu tun, als den Tanz um sich herum zu beobachten: Das ist es, worauf sich alle so zahlreichen und so gepriesenen Feste unserer Oper beschränken. Die schwerfällige und monotone Langsamkeit des französischen Gesangs macht es dem Dichter unmöglich, Szenen zu gestalten; so sagen die Figuren in der Oper, abgesehen von Quinaults Gedichten, nie das, was sie sagen sollten; ich bezweifle, dass man mir im gesamten Repertoire der Académie de musique eine Szene zeigen kann, die so gut oder schlecht dialogisiert ist. Die beiden Schauspieler sprechen gewöhnlich in Maximen und Sentenzen, setzen Madrigal gegen Madrigal; und wenn jeder von ihnen zwei oder drei Strophen gesagt hat, muss die Szene enden und der Tanz beginnen, sonst würden wir vor Langeweile sterben. Ich spreche nicht von dem Mangel an Natürlichkeit und der falschen und willkürlichen Deklamation des französischen Rezitativs, während das italienische Rezitativ, indem es sich allen Charakteren anpasst und allen Arten der Deklamation Genialität und Feuer verleiht, dem Dichter erlaubt, die für den Effekt sichersten Szenen der Tragödie und der Komödie auf das lyrische Theater zu bringen."
Der Brief über Omphale sorgte in Paris für großes Aufsehen. Alle, die den Autor kennen, hieß es im Mercure de France, wissen, dass er einen umfassenden Geist, mannigfache Kenntnisse und einen sicheren Geschmack hat.23 Nun weiß das Publikum, dass Grimm ein überlegener Kenner der Musik ist und gut darüber zu schreiben weiß. Sein „Brief“ wurde von einem Anonymus beantwortet, hinter dem man Raynal vermuten darf, weil sich in dessen „Literarischen Neuigkeiten“ ähnlich lobende Worte über Lully fanden. Grimm geht im Mercure de France auf die Bemerkungen des Anonymus mit einem Brief an Herrn Abbé Raynal ein und auf Grimms Einlassungen hin entwickelt sich bald eine lebhafte Kontroverse, in die auch Rousseau eingreift. Er springt seinem Freund Friedrich Melchior zur Seite und verteidigt ihn gegen Kritiker, nicht ohne die Gelegenheit zu nutzen, endlich auch einmal sein eigenes Urteil über die französische Musik öffentlich auszusprechen. Einen ungenannten Kritiker, vermutlich Raynal, überführt er der Unwissenheit und Beschränktheit, gleichzeitig aber mahnt er Grimm, in seinem Beitrag nüchtern und unparteiisch zu bleiben, insbesondere Rameau gegenüber. Rousseau lobt sein Vorbild Rameau und kritisiert ihn aber gleich wieder im nächsten Satz: Rameau gab seinen französischen Landsleuten die komische Oper, wie sie Italien in der Opera buffa längst besitzt, aber er übertrug diese nicht einfach, sondern schuf Neues.
Es ist wahr, schließt Grimms Freund, man wirft dem Meister vor, dass er schlechte Texte komponiert habe. Aber hatte er denn über gute zu gebieten? Man darf aber zweifeln, ob er besseren Libretti gerecht geworden wäre und Rousseau urteilt: „Rameau steht an Geist und Verständnis weit unter Lully, obgleich er diesem in Hinsicht auf den Ausdruck fast immer überlegen ist.“24
In seinen Anmerkungen zu Diderots Roman „Rameaus Neffe“ ist Goethe fünfzig Jahre später auf den sog. Buffonistenstreit eingegangen. Aus dem zeitlichen Abstand heraus kann Goethe einen guten Überblick geben: „[...] In der Hälfte des vorigen Jahrhunderts waren die sämtlichen Künste in Frankreich auf eine sonderbare, ja für uns fast unglaubliche Weise manieriert und von aller eigentlichen Kunstwahrheit und Einfalt getrennt. Nicht allein das abenteuerliche Gebäude der Oper war durch das Herkommen nur starrer und steifer geworden, auch die Tragödie ward in Reifröcken gespielt, und eine hohle, affektierte Deklamation trug ihre Meisterwerke vor. Dieses ging so weit, daß der außerordentliche Voltaire, bei Vorlesung seiner eigenen Stücke, in einem ausdruckslosen, eintönigen, gleichfalls psalmodierenden Bombast verfiel und sich überzeugt hielt, daß auf diese Weise die Würde seiner Stücke, die eine weit bessere Behandlung verdienten, ausgedrückt werde. Ebenso verhielt sich's mit der Malerei. Durchaus war das Fratzenhafte eines gewissen Herkömmlichen so hoch gestiegen, daß es den aus innerer Naturkraft sich entwickelnden trefflichen Geistern der damaligen Zeit höchst auffallend und unerträglich scheinen mußte. Sie fielen daher sämtlich drauf, das, was sie Natur nannten, der Kultur und der Kunst entgegenzusetzen. Wie hierin Diderot sich geirrt, haben wir anderswo, mit Achtung und Neigung gegen diesen vortrefflichen Mann, dargetan. (Siehe ›Propyläen‹.)
Auch gegen die Musik befand er sich in einer besonderen Lage. Die Kompositionen des Lully und Rameau gehören mehr zur bedeutenden als zur gefälligen Musik. Das, was die Bouffons aus Italien brachten, hatte mehr Angenehmes und Einschmeichelndes als Bedeutendes, und doch schlägt sich Diderot, der so lebhaft auf die Bedeutung dringt, zu dieser letzten Partei und glaubt seine Wünsche durch sie befriedigt zu sehen. Aber es war wohl mehr, weil dieses Neue, Bewegliche jenes alte verhaßte starre Zimmerwerk zu zerstören und eine frische Fläche für neue Bemühungen zu ebnen schien, daß er das letzte so hoch in Gunst nahm. Auch benutzten französische Komponisten sogleich den gegebenen Raum und brachten ihre alte bedeutende Weise, melodischer und mit mehrerer Kunstwahrheit, zu Befriedigung der neuen Generation, in den Gang.“
Aber kehren wir in unserer Betrachtung vorerst noch einmal zu Grimm und Gottsched zurück. Das Schüler-Meister-Verhältnis beginnt sich nach mehr als zehn Jahren intensivster Hingabe von Grimms Seite her zu lösen und wie jeder gute Schüler den Meister einmal hinter sich lassen muss, weil der Schüler seinen eigenen Weg geht, so hat auch Grimm einen Weg gefunden, der ganz seinen neu erworbenen Vorstellungen entspricht. Wir wissen nicht, ob sich die beiden nach dem letzten, noch erhaltenen Brief Grimms vom 10. September 1754, weitere Briefe geschrieben haben, aber aller Wahrscheinlichkeit nach kam der Kontakt zwischen den beiden nach 1754 zum Erliegen. Es ist anzunehmen, dass Grimms geistiges Umfeld in Paris den Stern des Meisters allmählich verblassen ließ, vor allem die Nähe zu Diderot und dessen Vorstellungen zur Bühnenkunst ließen ein Festhalten an Gottscheds Critischer Dichtkunst nicht länger zu. Andererseits ist nicht zu übersehen, dass Gottsched im Denken Grimms tiefe Spuren hinterlassen hat. Grimms kritische Vorgehensweise beim Umgang mit Texten aller Art lässt auch dreißig Jahre nach Verlassen der Leipziger Seminare Denkweisen und Methoden seines Lehrers Gottsched in seinen kritischen Beiträgen für die Correspondance littéraire erkennen. Dazu muss allerdings ein wenig ausgeholt und Gottsched mehr in seinen Werken und geistigen Bezügen gesehen werden.
Als Grimm dem großen Gottsched zum ersten Mal einen Brief schickte, war er noch keine 18 Jahre alt und besuchte das protestantische Gymnasium poeticum in Regensburg. Gottsched war 1741 41 Jahre alt und hatte zu dieser Zeit schon mehrere bedeutende Werke veröffentlicht, u. a. den Versuch einer critischen Dichtkunst vor die Deutschen (1729), Erste Gründe der gesamten Weltweisheit (1733) und Ausführliche Redekunst (1736). Unter seiner Regie erschienen die Zeitschriften Die vernünftigen Tadlerinnen (1725-1726), Der Biedermann (1727-1729) und Beyträge zur critischen Historie der deutschen Sprache, Poesie und Beredsamkeit (1732/45).
Gottsched stand, wie er selbst nicht müde wurde, zu betonen, unter dem Einfluss der Philosophie Christian Wolffs, einer Philosophie, die eine systematische Ausprägung des Rationalismus darstellt und sich aus verschiedenen Quellen, Leibnitz, Descartes, der Scholastik Thomas von Aquins und Francisco Suarez‘ speist. Die von Wolff und seinen Anhängern propagierte mathematische Lehrart zielte auf eine strenge Systematik beim Verfassen eines Textes ab. Im günstigsten Falle sollte also jeder einzelne Gedanke mit einer entsprechenden explizit definierten Satzkategorie verbunden werden. Wolff war, das sei an dieser Stelle schon vermerkt, auch ein Anhänger der platonischen Idee des „Philosophenkönigtums“. Wenn Grimm später eine „Aufklärung von oben“ favorisierte, dann findet sich hier eine Wurzel seines Denkens.
Gottsched war ein erklärter Anhänger der Leibnitz-Wolffschen Philosophie, ja, man kann sogar, seine „Critische Dichtkunst“ als Umsetzung der Wolffschen Philosophie betrachten. Gottsched griff dabei zwei Hauptregulative Wolffs auf: den Satz vom verbotenen Widerspruch, der die Möglichkeit einer Erdichtung garantierte, und den Satz vom zureichenden Grund, den er allerdings nur in seiner empirischen, nicht in seiner logischen Form übernahm. Gottsched setzte diese Regulative als Forderungen nach innerer Stimmigkeit und Wahrscheinlichkeit um. Damit gab er der Dichtung ein logisches und ein empirisches Fundament, wobei er die logische Begründung durch einen niedrigeren Grad an Gewissheit, nämlich die Wahrscheinlichkeit ersetzte. Diese war gegeben, wenn der Dichter die Natur nachahmte.
Im Unterschied zur Barockzeit sah Gottsched die Poesie nun nicht mehr als gebundene Rede, der Dichter konnte (oder sollte) von nun an die Natur mittels Fiktionen nachzubilden versuchen, während dem Redner die Aufgabe oblag, pragmatische Zwecke zu verfolgen. Die Aufwertung von Naturnachahmung und Wahrscheinlichkeit lässt sich wissenschaftsgeschichtlich leicht erklären. Mitte des 18. Jahrhunderts kam in Deutschland neben der Philosophie Christian Wolffs der Naturwissenschaft entscheidende Bedeutung zu. Für Gottsched und die Wolffianer bestand das Vollkommene im vernünftig Geordneten. Der Künstler, der die vollkommene Natur nachahmt, konnte somit selbst ein vollkommenes Kunstwerk schaffen. Ausflüge ins Reich der Fantasie sollen dem Dichter allerdings nur dann erlaubt sein, wenn er sich an die Wahrscheinlichkeit hält.
„Gottsched ordnet die Naturnachahmung in drei Stufen an. Auf der untersten Stufe steht die „lebhafte Schilderey von einer natürlichen Sache, die man nach allen ihren Eigenschaften, Schönheiten oder Fehler, Vollkommenheiten oder Unvollkommenheiten, seinen Lesern klar und deutlich vor die Augen malet“, [...]. Auf einer höheren Ebene liegt die zweite Art der Nachahmung: die Personennachahmung, also das Bilden von Charakteren. Auf der höchsten Ebene steht die Fabel – für Gottsched „das Hauptwerk in der Poesie“. Die Fabel ist, wie die berühmte Definition lautet, „die Erzählung einer unter gewissen Umständen möglichen, aber nicht wirklich vorgefallenen Begebenheit, darunter eine nützliche moralische Wahrheit verborgen liegt“.25
Festzuhalten ist, dass es Wolffs Verdienst war, eine deutsche philosophische Terminologie geschaffen zu haben, die in Gottscheds Stilempfehlungen und insbesondere in seine eigene umfangreiche Schriftstellerei eingegangen ist.
Als Paradebeispiel einer Dichtung, die sich Wolffs Philosophie und Gottscheds Regeln zu eigen machte, ist das von Magnus Gottfried Lichtwer publizierte Lehrgedicht „Das Recht der Vernunft“.26 Im Vorwort legitimiert Lichtwer sein Unterfangen so: „Erhabnere und nützlichere Gegenstände kann der Poet niemals wählen; zumal, nachdem sie durch die unwiderleglichen Grundsätze der scharfsinnigsten Weltweisen in ihr völliges Licht gesetzt sind.“ Lichwer folgt nun ausschließlich Wolffs Philosophie und bekundet, dass er die „Hauptlehren des natürlichen Rechtes [...] nach den Begriffen des Freiyherrn von Wolff“ darlege. Zuerst behandelt er „allgemeine Begriffe“, im weiteren Fortgang seines Werkes die drei Arten menschlicher Pflichten. Ein Lehrdichter wie Lichtwer muss einerseits philosophische Kenntnisse besitzen, andererseits genügend poetische Begabung, um die schwierige Materie in ein gefälliges Gewand zu kleiden. Fern jeder Vernunftskepsis betrachtet Lichtwer die Geschichte der menschlichen Vernunft als eine Geschichte des Fortschritts, die allmählich auf das unveränderliche Naturrecht hinführe. Er nennt Männer wie Bacon, Grotius, Pufendorf und Thomasius, sie hätten sich nach Lichtwer die größten Verdienste um die Erkenntnis des Naturrechts erworben. Vor allem die geometrische Methode Wolffs sei Ausdruck der Souveränität menschlicher Erkenntniskraft, die sich auf der ethischen Ebene als „freye Wahl“ manifestiere: „Du sollst das Gute thun, du sollst das Böse lassen. In diesem Götterspruch lässt das Gesetz sich fassen, dass die Natur uns schrieb.“27Lichtwer hält sich streng an die von Wolff formulierten Regeln der Lebensführung, ohne darauf zu achten, dass sich diese eher der Alltagserfahrung als systematischer Deduktion verdanken.Die Fabel, von der in Lichtwers Lehrgedicht die Rede ist, wurde von Wolff als Hilfsmittel zum Erlernen des Guten und Bösen explizit empfohlen. Fabeln würden sich seiner Meinung nach besonders für die Erziehung der Jugend und des einfachen Volkes eignen. Bereits in der „Deutschen Politik“ von 1721 hatte Wolff darauf hingewiesen, dass die Natur die sittlichen Wahrheiten bestätigt: „Wir finden gar deutlich bey den Thieren“ heißt es gleich zu Beginn, „was der Winck der Natur in diesem Stücke ist.“28 Für die nackte Wahrheit übernimmt die Fabel bei Lichtwer die Funktion eines Schleiers. Er illustriert diesen Sachverhalt in seinem Gedicht „Die beraubte Fabel“. Die in den Kleidern einer Frau personifizierte Fabel gerät unter die Straßenräuber, die ihr die Kleider entwenden, so dass die „helle Wahrheit plötzlich nackend dasteht. Es folgt eine unerwartete Wendung: Die Räuber ertragen ihren Anblick nicht: „Die Räuberschar sah vor sich nieder und sprach: Geschehen ist geschehn, man geb‘ ihr ihre Kleider wieder, wer kann die Wahrheit nackend sehn?“29 Die Fabel demonstriert den Triumph der Wahrheit durch „anschauende Erkenntnis“ und sogar die Räuberschar bekehrt sich zur Moral und gibt das Geraubte wieder zurück. Das Naturgesetz im Sinne Wolffs funktioniert wieder.
Nachdem der junge Grimm dem großen Gottsched schon in seinen ersten Briefen nach Leipzig etliche Proben seiner Dichtkunst geschickt hatte, verfiel er 1741 auf die Idee, sich „an ein Trauerspiel zu wagen. Ein Werk, welches eines der schwersten in der ganzen Poesie ist.“ Doch Grimm schränkt sogleich ein: „Eine neue Fabel zu erfinden, war mir zu schwer, und etwas zu übersetzen, war ich noch zu unvollkommen. Ich gerieth daher auf die Banise. Ich hatte sie vor einigen Jahren von unsern saubern Comödianten vorstellen sehen, aber Balacin reiste kreuzweise auf der Bühne herum und wir waren bald in Ava bald in Pegu. So sollte mein Trauerspiel nicht werden.“30Was Grimm damit sagen will: Dieses Werk hält sich nicht an die Vorgaben der Critischen Dichtkunst seines Meisters aus Leipzig, da wollte er wohl Besseres auf die Bühne bringen. Gottscheds Absicht war es, die bis dahin unnatürliche, gekünstelte Redeweise der zeitgenössischen Theatersprache durch Klarheit in Sprache und Handlung zu ersetzen. Er stufte die Tragödie als höchste Gattung der Poesie ein und hielt die Bühne für ein geeignetes Medium zur moralischen Belehrung des Publikums. Bei Gottsched sollte die Dichtung die Aufgabe haben, den Menschen durch Anrühren seines Verstandes sittlich und moralisch zu erziehen. Er forderte, dass der Kernpunkt jeden Dramas ein moralischer Lehrsatz sein müsse. Dieser sollte zuerst formuliert und dann die Handlung des Dramas entsprechend entwickelt werden und zwar nach dem Vorbild der Wirklichkeit, der Natur, ohne das Wahrscheinliche zu überschreiten. Grimm versucht nun, sich streng an die Regeln der Dichtkunst haltend, Einheit der Handlung, Einheit des Ortes und Einheit der Zeit in einen vernünftigen, vor allem aber erlebbaren Zusammenhang zu bringen. Was dabei herausgekommen ist, ist ein weiteres Beispiel dafür, wie sehr sich eine bedingungslose Unterwerfung unter die akribischen Regeln der Gottschedschen Dichtkunst im negativen Sinne auszahlen kann. Dass Grimms Banise letztlich keinen Ehrenpreis erhalten konnte, lieg nicht nur an der Unerfahrenheit des Autors, sondern auch an den Vorgaben, die der brave Schüler einzuhalten geneigt war.
Grimm lässt sich von seinem Vorhaben nicht abbringen, er hofft, die bearbeitete Banise seinem Meister in Leipzig bald zur Beurteilung vorlegen zu dürfen. Im Dezember schickt Grimm einen ersten Vorbericht an seinen Mentor. Zwar versucht er den Vorgaben des Meisters zu entsprechen, schränkt aber bescheiden ein, eine Banise verfertigt zu haben „deren Kräfte sich nicht weiter, als ihres Verfassers, erstrecken.“ Weiter schreibt Grimm „Die Verbesserungen, welche ich hier gehorsamst überschicke, sind aus meiner Feder, ohne, dass ich deswegen von jemand wäre erinnert worden, geflossen. Denn ich weiß dermalen in ganz Regensburg niemanden, welcher nur einige Kenntnis von der Schaubühne31 hat. Mein Bruder, der mir vielleicht an die Hand gehen könnte, befindet sich in Frankfurt beym Wahltage. Und also habe ich außer der critischen Dichtkunst keine Anweisung.“32
Grimms Banise ist eine Dramatisierung des Barockromans Die Asiatische Banise oder Das bluthig-doch muthige Pegu (Erstdruck 1689). Der Roman war im 18. Jahrhundert noch sehr populär, stammte von Heinrich Anshelm Ziegler und Kliphausen und war mehrfach umgeformt oder als Vorlage für Opernlibretti benutzt worden.33 Grimm hat auf Anraten Gottscheds in den folgenden Jahren immer wieder Korrekturen am Text seines Trauerspiels vorgenommen, es sollte das einzige des späteren Kulturkorrespondenten bleiben. Der veröffentlichten Fassung von Grimms Banise im vierten Teil der Deutschen Schaubühne ist also eine von Gottsched veranlasste grundlegende Revision durch den Autor vorausgegangen. Grimms Banise ist schon bei seinen Zeitgenossen auf heftige Kritik gestoßen. In Schützes Hamburgischer Theater-Geschichte sind die kontroversen Meinungen zusammengetragen worden.34 Wir lesen dort u. a.: „Herr Grimm (hat) ein elendes Trauerspiel zusammengeleimt“... Immerhin hebt Belouin, ein anderer Kritiker, drei frühaufklärerische Trauerspiele hervor, eines davon ist die Banise von Grimm; es sei „“avec un peu de bonne volonté“ (mit ein wenig gutem Willen) geschrieben und könne durchaus an die Seite von Goethes Iphigenie gestellt werden.
Um was geht es in Grimms Trauerspiel? Grimm beschreibt in Übereinstimmung mit der Romanvorlage die Befreiung der Prinzessin Banise aus den Händen des Tyrannen Chaumigrem und dessen Tötung durch den Prinzen Balazin. Doch eins nach dem anderen: Kaiser Chaumigrem will Banise, Tochter des ermordeten Vorgängers, heiraten. Bedrängt wird sie auch vom lasterhaften Oberpriester Rolim. Banise, die mit Balazin, dem König von Arakan verlobt ist, weist diese Anträge zurück und soll deshalb dem Gott Karkovit geopfert werden. Der Plan ihres Bruders Xemin, ihr als verkleideter Priester zu helfen, schlägt fehl und deshalb tötet er sich selbst, bevor man ihn ermordet. Balazin, der sich ebenfalls als Priester einschleicht, tötet Chaumigrem und befreit so Banise und Pegu vom Tyrannen.
In Grimms Trauerspiel Banise steht der Gegensatz von positiver und negativer Figur im Mittelpunkt des Geschehens. Auf der einen Seite die tugendsame, aufrechte und standhafte Banise, auf der anderen Seite der lasterhafte und illegitime Tyrann Chaumigrem. Banise zeichnet sich durch ihre hohe sittliche Qualität aus, sie wird einerseits im Affekt dargestellt (Erkennung des Bruders), andererseits auch in einer schwankenden Situation gezeigt (widerwillige Zustimmung zur Flucht) und erst am Ende findet sie zu einer angemessenen Haltung, indem sie sich der göttlichen Führung unterordnet. Chaumigrem trägt ebenfalls mehrere Konflikte aus. Entweder schlägt er aus eigenem Antrieb falsche Wege ein (Negierung der göttlichen Weltordnung) oder er lässt sich von seinem intriganten Oberpriester zu einer sittlichen Fehlentscheidung verleiten. In den Protagonisten des Stücks stehen sich Tugend und Laster gegenüber und Grimm bemüht sich nachvollziehbar um eine begründete und problematisierende Darstellung der beiden Rollen. Die übrigen Figuren erhalten kein markantes Persönlichkeitsprofil.
Grimm arbeitet besonders die Opferrolle seiner Hauptfigur Banise heraus, sie gilt es, dem Gottsched’schen Affekt-Modell folgend, als Instrument zur Rührung der Zuschauer einzusetzen. Die Teilhabe am Schicksal der Banise soll beim Publikum Mitleid und Bewunderung hervorrufen. Beide Affekte erreichen ihren Höhepunkt in den Schlussszenen, als die Opferung Banises unmittelbar bevorsteht: Die stoische Gefasstheit, mit der Banise als weltliche Märtyrerin ihr Schicksal erträgt, nötigt Bewunderung ab, ihr gänzlich unverschuldetes Leiden ruft Mitleid hervor.
Mit dem Schema der belohnten Tugend (der Opferpriester ist in Wahrheit Prinz Balazin, Banises Verlobter und Befreier) und des bestraften Lasters (der Tyrann wird getötet) erfüllt Grimm das Lehrsatz-Konzept Gottscheds. Die vernünftige Weltordnung bestätigt sich und erweist ihre Gültigkeit sogar für den Fall, dass der einzelne situationsbedingt ihre Wirksamkeit nicht erkennen kann. Es verschließt sich dem intellektuellen Vermögen des Menschen, sein Schicksal selbst zu gestalten und sich über die göttliche Allgewalt zu erheben, die – trotz aller Herausforderungen und Prüfungen – schon im Diesseits die ethische Grundordnung zur Geltung bringt.35
In Chaumigrem zeigt Grimm einen tyrannischen Herrscher, der dem aufgeklärt-absolutistischen Staatsideal in jeder Hinsicht widerspricht. Damit ist nun durchaus keine Kritik am zeitgenössischen Absolutismus ausgesprochen. Beim jungen Grimm geht es noch nicht darum, ein ideales Herrschaftsverhältnis zu diskutieren, in Grimms Banise steht vielmehr die Liebesthematik im Vordergrund.Die politische Dimension fehlt aber in Grimms Trauerspiel trotzdem nicht ganz: Der gestürzte und ermordete Xemindo wird abstrakt als „beste(r) Kaiser“ apostrophiert und Chaumigrem als „Afterkaiser“ abgewertet. Der Tyrann Chaumigrem negiert die absolutistische Herrschaftslegitimation, indem er sich über die Götter erhebt und seine Machtposition ausschließlich individualistisch-triebhaft rechtfertigt. Auf ihn häuft Grimm alle nur erdenklichen Abscheulichkeiten: Zorn, Wollust, Rachgier, Mordgier, Grausamkeit. Im Verlauf des Stücks begrenzen sich diese Affekte mitunter wechselseitig: Die Wollust, die durch die schöne Banise immer wieder neue Nahrung erhält, lässt den Tyrannen zögern, seiner Wut zu folgen und sie zur Opferung freizugeben. Banises anhaltende Verweigerung bringt ihn schließlich zum völligen Kontrollverlust: „Ich knirsche schon vor Grimm, ich rase vor Entsetzen.“36 Am Beispiel des sinnlich-lasterhaften Chaumigrem wird dann die verhängnisvolle Wirkung der fehlenden Affektkontrolle vorgeführt.
Im Gegensatz dazu unterwirft sich Banise widerspruchslos der göttlichen Macht. Sie zeigt eine erfolgreiche Affektkontrolle, die letztlich ja auch belohnt wird. Banises Tugend ist stark religiös geprägt: Gelassenheit, Frömmigkeit, Ergebung in die göttliche Fügung, Bereitschaft zu sterben, Verzicht auf weltliches Glück etc. Sie findet Trost in den Gebeten an die Götter. Wie reagiert sie als ihr die Vertraute, Fylane, vorschlägt zum Schein auf Chaumigrems Drängen einzugehen? Banise weist diesen Vorschlag entrüstet zurück:
„Die Tugend herrscht in mir. Es ist der Götter Wille,Den ich voll Großmuth auch im Sterben noch erfüll.Mehr kann ich selbst nicht thun. Ihr Götter, seyd gerecht;Und eurer Macht gefällts, daß heute mein GeschlechtMit mir vergehen soll. Wir mußten ja verderben!“37
In Grimms Trauerspiel, das sich zwar mit der philosophischen Konzeption seines verehrten Lehrers Gottsched vermitteln lässt, bleiben theologische Elemente dominant. Das Stück gibt Beispiele vorbildlicher Affektbeherrschung bzw. völliger Affektverfallenheit, ohne groß die Rolle der Vernunft zu thematisieren. Es sind vielmehr die christlichen Züge des Grimmschen Menschenbildes, die auffallen. Banise besitzt eine Tugend, die ihrer besonderen Frömmigkeit entspricht. Das ist allerdings noch ganz das Theater des Barock!
Grimm hatte vor, ein weiteres Trauerspiel „nebst einem comischen Stück zur Beschäftigung meiner Nebenstunden“ zu schreiben. Einen Titel für das „comische“ Stück hat er auch schon: „Der Schäfer in der Stadt“. „Mein Schäfer“, schreibt Grimm am 30. Juli 1742 an Gottsched, „soll darinnen vornehmlich zeigen, wie thöricht die Menschen beyderlei Geschlechts in ihrem Umgang öfters handeln.“
Fünf Jahre später ist Grimm davon überzeugt, dass er nicht zum Dichter tauge. Zwar hatte Gottsched seine Banise in die deutsche Schaubühne aufgenommen, was Grimm als große Ehre ansah, trotzdem wuchs in ihm die Erkenntnis, dass man aus einem Freundschaftsdienst nicht auf ein Talent schließen könne. In seinem Brief an Gottsched vom 10. April 1747 schreibt Grimm: „Was meine Banise betrifft: so habe ich sie selber allezeit der Ehre, in dieser Sammlung (Schaubühne) zu stehn, unwürdig gehalten. Ich habe nach des Himmels Schluß zu keinem Dichter werden sollen, so sehr ich auch die Poesie liebe und verehre. Theils der Erkänntniß meiner natürlichen Ungeschicklichkeit, theils meine äußerlichen Umstände haben verursachet, daß ich die Poesie oder das Versemachen fast mit dem Anfange meiner akademischen Jahre aufgegeben. Ew. Magnifizenz preiswürdige Gewogenheit, wodurch sie alle jungen Leute in ihren Versuchen aufzumuntern und beherzter zu machen trachten, war es, welche meiner Banise in der deutschen Schaubühne einen Platz angewiesen. Da der Zweck der Aufmunterung bey mir wegfällt, und ich dergleichen Beschäftigungen ganz aufgegeben, so haben Ew. Magnifizenz vollkommenes Recht, bey einer neuen Ausgabe mein Stück auszulassen und durch ein würdigeres zu ersetzen.“
Die Strahlkraft Frankreichs und seiner Denker
Grimm schrieb in einem seiner letzten Briefe an Gottsched, dass er mit Maupertius auf vertrautem Fuß stehe: „Maupertius ist seit einem Monat hier, ich habe ihn beim Spaziergang gesehen, und ich werde mit ihm eines Tages bei einem meiner Freunde zu Abend essen.“
Eine solche Mitteilung könnte bei Gottsched unangenehme Gefühle hervorgerufen haben. Friedrich der Große hatte Pierre Louis Moreau de Maupertius 1740 auf Empfehlung Voltaires nach Berlin eingeladen, um ihm die Leitung der Preußischen Akademie der Wissenschaften zu übertragen. Maupertius, der sowohl Mathematiker als auch Naturforscher und Philosoph war, sollte die Akademie leiten, nicht etwa Christian Wolff, der in Deutschland damals als der führende Philosoph angesehen wurde.
Gottsched war Wolffianer und als solcher hatte er sich ebenso wie sein Geistesbruder Ernst Christoph Graf von Manteuffel Hoffnungen auf künftigen Einfluss seiner und Wolffs Lehren gemacht, als 1740 Kronprinz Friedrich die Nachfolge seines Vaters Friedrich Wilhelm I. antrat. Zunächst schien nach der Zurückberufung Wolffs38 für ihn und seine Anhänger das Spiel gewonnen. Was aber folgte, war eine bittere Enttäuschung. Dabei hatte schon ein Jahr vor der Thronbesteigung der ehemalige kursächsische Kabinettsminister und Mäzen des Aufklärers Wolff, Ernst Christoph von Manteuffel, an den Meister geschrieben, der Kronprinz gebe sich mehr und mehr dem Skeptizismus und den französischen Einflüssen hin. Das musste ausreichen, um den Stifter der „neuern Philosophie“ zu belehren, dass seine Wiederberufung nur eine Maßregel zur Hebung der Wissenschaft war. Wolff sollte nicht in seinen alten Wirkungskreis zurückkehren, sondern Mitglied der Akademie werden und damit der Zwecksetzung durch den König unterworfen sein. Auch sollte er einem Institut angehören, von dem Maupertius und Algarotti eine geringe Meinung hatten.Dieses Missgeschick konnte jedoch abgewendet werden: Wolff kehrte mit Zuwachs an Titeln und Würden auf seinen Lehrstuhl in Halle zurück. Nichtsdestotrotz trat seine Philosophie im Denken des Königs in den Hintergrund. Wolffs Urteil über Friedrichs wissenschaftliches Personal in Berlin fiel vernichtend aus: Euler habe „in der Philosophie nicht das A, B, C gelernet“; Maupertius beherrsche nur die Geometrie und besitze ansonsten allenfalls Vorzeigewert für die Akademie; Algoretti vertrete die „abgeschmackte Freydenkerei der Engeländer“ und werde mehr schaden als nutzen. Kurz: „Die mit der Newtonschen Philosophie schwanger gehen, die ich vor non ens (Nichtseiendes) halte, sind überhaupt hoch intoniret, weil sie der große Name Newtons aufgeblasen macht, und die Freydencker meinen auch den höchsten Gipfel der Vernunft erreicht zu haben, da sie die Vernunft und Missgeburten der Einbildungs-Krafft nicht unterscheiden können.“
Die Akademie, der Liebling des Königs in seiner ersten Regierungszeit, wurde vornehmlich mit Franzosen besetzt. Am 12. Mai 1746 wurde Maupertius offiziell zum Präsidenten der Berliner Akademie ernannt. Maupertius hatte gemeinsam mit Voltaire den französischen Newtonismus erfunden. Mit der Berufung von Maupertius wollte Friedrich II. seine Akademie so in Schwung bringen, dass Preußen sich in Europa sehen lassen konnte und tatsächlich gelang es Maupertius in kurzer Zeit, die Berliner Akademie zu einem zentralen Ort der internationalen Forschung zu machen.
Als La Mettrie 1745 seine Abhandlung „Naturgeschichte der Seele“ veröffentlichte, war sein Landsmann Helvétius gerade 30 Jahre alt geworden. Ihm kamen die materialistischen Argumente von La Mettrie gerade recht, um in die philosophischen Überlegungen des damals noch als Steuerpächter tätigen jungen Mannes eingebaut zu werden. Neben dem Skeptizismus und Universalismus eines Fontenelle, dem Sensualismus eines Locke und dem Materialismus eines La Mettrie gehörten auch noch manche Gedanken von Montesquieu zu den Helvétius` prägenden Einflüssen.
Als Grimm Maupertius im Sommer 1753 in Paris sah, hatte dieser jedoch bereits seinen Abschied als Akademiepräsident genommen und war nach Paris zurückgekehrt. Sein Nachfolger in Berlin wurde der Marquis d’Argens. Der Rückkehr von Maupertius nach Paris war ein heftiger Streit mit Voltaire vorausgegangen, der ihn mit dem anonym veröffentlichten Pamphlet Diatribe du Docteur Akakia attackiert hatte. Das Ergebnis dieser Rivalität war, dass Voltaire dem König im Januar 1753 den Kammerherrenschlüssel und seine Orden übergeben ließ und Ende März nach Sachsen abreiste. Maupertius hatte sich zweifellos einige Ungeschicklichkeiten zuschulden kommen lassen. So wurde ihm etwa vorgeworfen, das 1750 formulierte „Prinzip der kleinsten Wirkung“ von Leibnitz abgeschrieben zu haben. Seine Verdienste um die Wissenschaft überstrahlen jedoch gewisse Ungereimtheiten. Maupertius war nicht nur Mathematiker und guter Kenner der Theorien Newtons und Leibnitz, er ging über deren Ansätze hinaus und erkannte, dass Newtons Theorien nicht ausreichten, um etwa biologische Phänomene zu erklären. Er sprach sich gegen den Präformismus39 und den Newtonschen Determinismus aus und bezog auch Position gegen den Kreationismus40. Dies war auch ein Grund, warum er die Ideen von Leibnitz mit in sein Gedankenkonstrukt aufnahm. Ihm und vor allem auch Voltaires Freundin Émilie du Chatelet ist es zu verdanken, dass nun auch der französische Naturforscher Georges-Louis Leclerc de Buffon von den Leibnizschen Ideen inspiriert wurde.
Als Friedrich Melchior Grimm Anfang der 50er Jahre in Paris Bekanntschaft mit Männern wie Rousseau, Diderot, Holbach, D’Alembert, Maupertius u. a. schloss, war Frankreich nicht nur eine politische, sondern auch eine intellektuelle Großmacht in Europa. „Die französischen Schriftsteller, Philosophen und Politiker empfingen zwar wichtige Anregungen aus England, aber sie bildeten diese in eigenständiger Weise weiter und ergänzten sie durch kühne geistige Entwürfe, die dem modernen Denken seine Grundzüge gaben.“41
In Deutschland blieben bis in die 50er Jahre hinein in der Philosophie Leibnitz und Wolff wichtige Orientierungspunkte und in Berlin blockierte trotz der Franzosen immer noch eine stabile Leibnitz-Wolffsche Front den Vormarsch des Newtonismus. Weder Locke noch Newton übernahmen im Handstreich die geistige Regie in Europa. Newtons Thesen wurden noch lange bezweifelt und Locke galt mehrere Jahrzehnte nach seinem Tod im Jahr 1704 keineswegs überall als Leitstern am Philosophenhimmel. Zudem verstand sich durchaus nicht von selbst, was gemeint war, wenn die Namen der beiden Engländer fielen. Dies galt besonders für Newton: Er bediente ebenso die konservativen Bedürfnisse von Theologen nach einem göttlichen Herrscher und Lenker wie er – gewollt oder nicht – einer materialistischen Weltdeutung Vorschub leistete.
Für Grimm öffnete sich der geistige Himmel über Paris, nachdem er Denis Diderot kennenglernt hatte. Der 10 Jahre ältere Diderot hatte 1746 seine „Pensées philosophiques“42 veröffentlicht. Anschließend begann er mit der Arbeit an der Encyclopédie. Um eine Familie unterhalten zu können, hatte sich der stets klamme Diderot dazu entschlossen, englische Werke zu übersetzen. So wurde er etwa beauftragt, den Essay „An Inquiry Concernig Virtue or Merit“ (Eine Untersuchung über Tugend und Verdienst) des englischen Earl of Shaftesbury zu übersetzen. Das prägte nachhaltig sein Verständnis von Philosophie und regte ihn an, sein erstes eigenständiges Werk, die „Pensées philosophiques“ zu verfassen.
Schon im „Essai sur le mérite et la vertu“, der mehr als eine kritische Auseinandersetzung mit Shaftesburys „Inquiry Concerning Virtue or Merit“, denn als reine Übersetzung angesehen werden kann, stellt Diderot an seinen Bruder Didier-Pierre gewandt klar: „Ja, mein Bruder, die Religion, die richtig verstanden und mit aufgeklärtem Eifer praktiziert wird, kann nicht umhin, die moralischen Tugenden zu erhöhen. Sie verbündet sich sogar mit den natürlichen Erkenntnissen; und wenn sie fest ist, wird sie durch den Fortschritt dieser Erkenntnisse nicht in ihren Rechten beschnitten. Wie schwierig es auch sein mag, die Grenzen zu erkennen, die das Reich des Glaubens von dem der Vernunft trennen; der Philosoph verwechselt die Gegenstände nicht; ohne die chimärische Ehre anzustreben, sie zu vereinen; als guter Bürger hat er für sie Anhänglichkeit und Respekt. Der Weg von der Philosophie zur Gottlosigkeit ist so weit wie von der Religion zum Fanatismus; aber vom Fanatismus zur Barbarei ist es nur ein Schritt. Unter Barbarei verstehe ich, wie Sie, jene finstere Veranlagung, die einen Menschen für die Reize der Natur und der Kunst sowie für die Süßigkeiten der Gesellschaft unempfänglich macht. Denn wie sollte man diejenigen, die die Statuen verstümmelten, die sich aus den Ruinen des alten Roms gerettet hatten, anders als Barbaren bezeichnen? [...]. Ich würde gerne sagen, dass die einen und die anderen von der Religion nur ein Gespenst kennengelernt haben. Was wahr ist, ist, dass sie panische Schrecken hatten, die ihrer unwürdig waren; Schrecken, die einst für die Literatur verhängnisvoll waren und die es für die Religion selbst werden konnten. Es ist sicher, dass in diesen ersten Zeiten", sagt Montaigne, "als unsere Religion begann, durch die Gesetze Autorität zu erlangen, der Eifer viele gegen alle Arten von Büchern bewaffnete, wodurch die Gens de Lettres einen wunderbaren Verlust erlitten. Ich glaube, dass diese Unordnung den Büchern mehr Schaden zugefügt hat als alle Feuer der Barbaren. Cornelius Tacitus ist ein guter Zeuge dafür; denn obwohl sein Verwandter Kaiser Tacitus durch ausdrückliche Verordnungen alle Buchhandlungen der Welt damit bevölkert hatte, konnte ein einziges vollständiges Exemplar der neugierigen Suche derer nicht entgehen, die es wegen fünf oder sechs leeren Klauseln, die unserem Glauben widersprechen, abschaffen wollten. Es bedarf keiner großen Vernunft, um zu erkennen, dass alle Anstrengungen des Unglaubens weniger zu befürchten waren als diese Inquisition. Der Unglaube bekämpft die Beweise der Religion; diese Inquisition tendierte dazu, sie zu vernichten. Noch, wenn der indiskrete und kochende Eifer sich nur durch die gotische Zartheit schwacher Geister, die falschen Anreize der Unwissenden oder die Dämpfe einiger Atrabilisten manifestiert hätte; aber erinnern Sie sich an die Geschichte unserer zivilen Unruhen, und Sie werden die Hälfte der Nation sehen, die sich aus Frömmigkeit im Blut der anderen Hälfte badet und die ersten Gefühle der Menschheit verletzt, um die Sache Gottes zu unterstützen; als ob man aufhören müsste, Mensch zu sein, um sich religiös zu zeigen! Die Religion und die Moral sind zu eng miteinander verbunden, als dass man ihre Grundprinzipien gegeneinander aufwiegen könnte. Es gibt keine Tugend ohne Religion und kein Glück ohne Tugend: Diese beiden Wahrheiten finden Sie in den folgenden Überlegungen vertieft, die mich unser gemeinsamer Nutzen schreiben ließ: Dieser Ausdruck soll Sie nicht verletzen; ich kenne die Festigkeit Ihres Geistes und die Güte Ihres Herzens. Sie sind ein Feind des Enthusiasmus und der Bigotterie und haben es nicht geduldet, dass der eine durch eigenartige Meinungen eingeengt oder der andere durch kindische Zuneigung erschöpft wird. Dieses Werk wird also, wenn Sie wollen, ein Gegengift sein, das dazu bestimmt ist, in mir ein geschwächtes Temperament zu reparieren und in Ihnen noch volle Kräfte zu erhalten; nehmen Sie es bitte als das Geschenk eines Philosophen und das Unterpfand der Freundschaft eines Bruders an.43
Es wäre wohl verfehlt, Diderot zum Zeitpunkt des Verfassens des Textes für einen frommen Christen zu halten, da er hier erstmals die Grundgedanken seiner frühen Religionskritik äußert. In seinem der Übersetzung vorstehenden Brief an seinen Bruder Didier, der als Priester in einer lebenslangen Feindschaft mit dem unchristlichen Diderot lebte, wägt er die Gottlosigkeit mit dem religiösen Fanatismus ab und kommt zu dem Schluss: „Von der Philosophie zur Gottlosigkeit ist es so weit wie von der Religion zum Fanatismus, aber vom Fanatismus zur Barbarei ist es nur ein kleiner Schritt.“ Das bedeutet für Diderot,dass „alle Anstrengungen des Unglaubens weniger zu fürchten waren als diese Inquisition.“
Diderot vertrat damit ganz die Position Shaftesburys, der in seinem Werk zwar tolerant und gemäßigt eine „Versöhnung von Religion und Philosophie, von Naturwissenschaft und Ethik“ vorschlägt, den religiösen Fanatismus aber scharf kritisiert.
Die „Pensées philosophiques“ können als Weiterentwicklung der Anmerkungen, die Diderot in der Shaftesbury-Übersetzung äußerte, verstanden werden. Ähnlich dieser ist der eigentliche philosophische Gehalt eher als „konventionell“ zu bezeichnen, kühn ist er jedenfalls nicht. In seinem Werk veranschaulicht Diderot in 62 unsystematisch, scheinbar zusammenhängenden Reflexionen größtenteils Ideen, die Frühaufklärer wie Voltaire und Montesquieu schon Jahre zuvor aus England mitgebracht hatten.