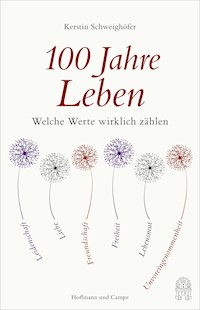
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Der Bestseller jetzt als Geschenkausgabe: Was uns die Weisheit hundertjähriger Menschen über das Leben, das Glück und die Liebe lehrt. Denken wir an Hundertjährige, dann bekommt das ansonsten so gefürchtete Alter etwas Geheimnisvolles. Sie ziehen uns in ihren Bann. Umso mehr, wenn sie uns an ihren hundert Jahren Lebensklugheit teilhaben lassen. Denn wann, wenn nicht dann, weiß ein Mensch, worauf es letztlich ankommt? Diejenigen, die heute hundert Jahre alt sind, haben als Kind den Ersten Weltkrieg erlebt, waren erwachsen, als der Reichstag brannte. Sie wissen, wie Leben und Alltag vor der Erfindung von Fernsehen, Antibiotika oder Kugelschreiber aussahen. Als sich Computer verbreiteten und Deutschland Wiedervereinigung feierte, waren sie längst in Rente. Wer einen solch immensen Wandel von Wertvorstellungen erlebt hat, birgt einen unvergleichlichen Erfahrungsschatz und kann seine Erkenntnisse gelassen weitergeben. Kerstin Schweighöfer hat für dieses Buch zehn Hundertjährige getroffen - von der Bäuerin zur Künstlerin, vom Priester bis zur Geschäftsfrau, von Cannes über München, Jena oder Dortmund bis London. So erfährt sie manch ein Geheimnis und erhält oft verblüffende Antworten auf die großen Fragen des Lebens: Was macht eine gute Freundschaft, Beziehung oder Ehe aus? Wie kann die große Liebe zur Liebe des Lebens werden? Wie soll man umgehen mit Schmerz und Verlust? Welche Werte zählen im Spiegel der Zeit?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 535
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Kerstin Schweighöfer
100 Jahre Leben
Welche Werte wirklich zählen
Hoffmann und Campe
Vorwort
Gedanken an das Altern schrecken uns oft ab. Wir denken an Tod und Einsamkeit, Leid und Siechtum. Wenn es um Hundertjährige geht, ist das merkwürdigerweise ganz anders: Auf einmal bekommt das Alter einen Glanz, etwas Geheimnisvolles, geradezu Mythisches umrankt es. Die Hundertjährigen ziehen uns in ihren Bann. Weil ihre Erfahrungen sie gelehrt haben, welche Werte im Leben wirklich zählen. Weil sie wissen, was es für ein gutes Leben braucht.
»Die Menschen vergessen gerne, dass es im Leben nichts Vollkommenes gibt. Und kein Recht auf Glück«, pflegt Mathilde zu sagen, eine alte Bäuerin aus dem Schwarzwald. Mit ihr hat alles angefangen. Gut ein halbes Jahrhundert liegt zwischen uns, alt ist sie für mich schon immer gewesen, und eigentlich kenne ich sie, seit ich denken kann. Von Schulausflügen und Familienfeiern in ihrer gemütlichen Schwarzwälder Bauernwirtschaft hoch oben auf dem Berg. Wenn Mathilde die Gaststube betritt, verstummen die Leute, um sie dann herzlich zu begrüßen und ihr die mitgebrachten Geschenke zu überreichen. Die alte Wirtin belohnt sie mit einem Gläschen ihrer speziellen Medizin, wie sie es nennt: einem Obstler. Dann streicht sie sich die weißgrauen Haare zurück und ihre Kittelschürze glatt, um mit leuchtend hellblauen Augen hinter silberumrahmten Brillengläsern einen ihrer nicht ganz salonfähigen Witze zum Besten zu geben. Das ist die Mathilde, wie ich sie kannte.
Eine ganz andere Mathilde habe ich kennengelernt, als ich sie kurz vor ihrem 100. Geburtstag bat, mir aus ihrem Jahrhundertleben zu erzählen. Dabei entstand die Idee zu diesem Buch über Menschen, die hundert Jahre alt geworden sind. Jene Zentenare, wie man sie nennt, denen es gelungen ist, sich schon ein ganzes Jahrhundert auf diesem Planeten aufzuhalten. Die ihre Eltern oder Großeltern durch die spanische Grippe verloren, ihre Väter bei Verdun und ihre Brüder oder Männer bei Stalingrad. Sie haben noch mitbekommen, wie Kutschen durch Autos ersetzt wurden, sie haben die ersten Vitamine geschluckt und die ersten Telefone ausprobiert. Die Erfindung von Staubsauger, Reißverschluss, Nylonstrümpfen und Kugelschreiber hat ihnen das Leben erleichtert und die Entdeckung von Insulin und Penicillin das Leben gerettet. Die heutigen Zentenare haben die Einführung des Wahlrechtes für Frauen erlebt, Charles Lindberghs Flug über den Atlantik, den Reichstagsbrand und die Nürnberger Prozesse, Mauerbau und Wiedervereinigung. Sie standen an der Wiege eines Vereinten Europas, waren Zeitzeugen der Gründung des Staates Israel, der Geburtsstunde von UNO und BRD. Aber auch beeindruckende Karrieren, bewegende Liebesgeschichten mit persönlichen Hoch- und Tiefpunkten hat es für sie gegeben.
All das gilt auch für die zehn Zentenare, die ich nach Monaten der Recherche finden konnte und die bereit waren, mir für dieses Buch aus ihrem Leben zu erzählen: angefangen bei Hausfrauen und Bäuerinnen wie Mathilde über Ingenieure und Wissenschaftler bis hin zu Priestern und Künstlern. Aus Deutschland, Frankreich und England, den Niederlanden, Ungarn und der Schweiz. Die meisten von ihnen sind Frauen, was daran liegt, dass wir es mit einer Generation zu tun haben, in der Frauen nicht nur deshalb älter werden konnten, weil sie nicht auf den Schlachtfeldern Europas gefallen sind, sondern auch, weil ihnen männliche Laster wie Rauchen und Trinken noch fremd waren und sie sich auch in dieser Hinsicht noch nicht emanzipiert hatten.
Ihre Lebensgeschichten sind geprägt vom Mut, den es immer wieder braucht, um neue Wege einzuschlagen. Von Lebenslust und Weisheit. Von Reue, Einsichten, Aufbegehren und Akzeptanz. Von Tragödien und Trauer, etwa über den Verlust des Partners oder gar eines Kindes. Vom Hadern mit dem Schicksal und vom Zweifeln an Gott. Was würden sie heute anders machen – und warum? Was gerade nicht? Glauben sie an Zufall, an Vorbestimmung – oder nach wie vor an Gott? Und wie bereiten sie sich auf den Tod vor?
Zwei von ihnen wollten aus Rücksicht auf ihre Angehörigen nicht mit ihrem richtigen Namen genannt werden. Denn im Laufe unserer Gespräche haben sie mir so manches überraschende Geständnis gemacht, so manches Geheimnis preisgegeben. Von Mathilde, der Bäuerin, erfuhr ich, welch hohen Preis sie für ihre Untreue zahlen musste. Annemarie, eine inzwischen 105 Jahre alte Dame aus München, erklärte mir, wie sie ihre Ehe trotz eines Seitensprungs ihres Mannes retten konnte. Und Gerrit aus Rotterdam berichtete mir von seinem Doppelleben, das er bis ins hohe Alter führte, weil eine Scheidung für ihn nicht in Frage kam.
Was ist das Geheimnis einer stabilen Ehe? Nehmen wir Leidenschaft und Sex vielleicht heute zu wichtig? Wie fatal sind Seitensprünge? Sind enge Freunde für ein gutes Leben wichtiger als ein Partner? Braucht es für ein erfülltes Leben Kinder?
Für Jeanne aus Paris waren die Kinder das Wichtigste im Leben, aber sie konnte nicht verhindern, dass ihre Tochter in ihr Unglück lief. Die Schweizer Schreinerstochter Agnes musste akzeptieren, dass ihr Mann keine lebensfähigen Kinder zeugen konnte, führte aber dennoch ein von Liebe erfülltes und darüber hinaus filmreifes Leben, das sie aus der Schweizer Provinz erst in die besten Londoner Kreise und anschließend nach Dakar und Cannes führte. Abenteuerlich auch das Leben von Beatrice, einer englischen Lady wie aus dem Bilderbuch – die trotzdem mit dem Jeep durch Steppen und Wüstenlandschaften bretterte, nachts dem Heulen der Wölfe lauschte und tagsüber mit Steinen wilde Hunde vertrieb. Beatrice war mit Leib und Seele und bis ins hohe Alter hinein Archäologin, immer auf der Suche nach neuen Fundstätten. »Jeder Mensch braucht im Leben etwas, das ihn ganz besonders fasziniert – sonst lebt er nicht«, findet sie. Für sie war der Beruf Berufung, als Arbeit hat sie ihn nie empfunden. Denn, wie sagt es eine Lebensweisheit so treffend: »Wer das tut, was er will, braucht nie zu arbeiten.«
Aber auch Beatrice hatte nicht nur Glück im Leben und viele Widerstände zu überwinden. Der Lebensmut, den viele Zentenare aufgebracht haben, um ihr Leben dennoch selbst in die Hand zu nehmen, hat mich tief beeindruckt. Zumal ich mir wie nie zuvor in meinem Leben darüber bewusst wurde, wie ungeheuer privilegiert ich bin. Dass ich das Recht hatte und habe, lernen zu dürfen und eine Ausbildung zu machen. Dass ich zu einem hohen Grad selbst bestimmen konnte, wie mein Leben bisher aussah. Dass ich selbst entscheiden konnte, wie ich es finanziere und wo ich es mit wem verbringe.
Anno 2015 sind das Selbstverständlichkeiten, zumindest in unserer westlichen Welt. Für die Menschen in diesem Buch, vor allem für die Frauen, war das nicht so. Nicht immer waren die Widerstände überwindbar. Manchmal blieben Freiheit und Selbstbestimmung unerreichbare Ideale. Trotzdem betrachten die meisten ihr Leben nach wie vor als Geschenk.
In diesem Buch können Leserinnen und Leser zehn Hundertjährigen begegnen. Es sind Bekanntschaften, die beeindrucken und die sich lohnen: Ältere werden ihnen regelmäßig beipflichten und manches wiedererkennen können; Jüngere werden zumindest aufhorchen, wenn nicht staunen. Weil die Welt in hundert Jahren eine so völlig andere geworden ist. Und mit ihr unser aller Leben.
Aber ganz egal, in welcher Epoche wir leben und wie unterschiedlich unsere Leben verlaufen: Unsere Wünsche und Sehnsüchte sind dieselben geblieben. Egal, ob anno 1915 oder 2015 – immer noch verlangen wir Treue und Loyalität von den Menschen, die uns nahestehen, immer noch brauchen wir Anerkennung und Lob, nach wie vor streben wir nach Liebe und Glück als höchste Lebensziele.
Die Hundertjährigen in diesem Buch haben in Erfahrung gebracht, was wir vom Leben und unseren Mitmenschen erwarten dürfen und sollten – und was besser nicht. Sie wissen, welche Werte und Konstanten es als Rüstzeug braucht, um aus einem Dasein ein erfülltes zu machen. Ihr Erfahrungsschatz kann für uns zu einer immensen Stütze und Wissensquelle werden – sowohl für die großen Lebensziele, die wir uns stecken, als auch für die kleinen Momente des Alltags.
»Auch wenn einem Schlimmes widerfährt: Das Leben bleibt ein Geschenk«
~Mathilde
*18. Juni 1915 in Konstanz am Bodensee
Es riecht nach frischgemähtem Gras. Schwach klingt das Bimmeln der Kuhglocken herüber. Der Hang neben dem Hof ist noch unberührt, das Gras meterhoch und wie immer um diese Jahreszeit ein einziges wogendes Blumenmeer aus Butterblumen und Löwenzahn. Bruno, der schwarze Labrador von Mathilde, hat sich beim Durchspringen bestimmt wieder eine gelbe Nase geholt. Wo ist er eigentlich? Normalerweise liegt er auf der Terrasse der Bauernwirtschaft in der Sonne, gleich neben der schweren, knarzenden Eingangstür. Das Blumenbeet auf der anderen Seite der Tür ist wie immer picobello gepflegt. Vergissmeinnicht, Akeleien. Die ersten Margeriten. Mathilde ist bekannt für ihren grünen Daumen.
Es ist still an diesem Vormittag. Unter der großen Kastanie nimmt ein Stammgast gerade den letzten Schluck seines Frühschoppens und begibt sich zum Zahlen in die Gaststube. Ein Arbeiter aus dem Dorf unten im Tal. Ich stelle mich einen Moment lang an die hölzerne Balustrade der Terrasse und lasse den Blick über die sanft geschwungenen Kuppen und Hügel der Schwarzwaldlandschaft schweifen. Wie vertraut mir alles doch ist! Unzählige Male schon war ich hier oben bei Mathilde auf dem Hof. Als Kind auf Schulausflügen und an Wandertagen, am 1. Mai oder Christi Himmelfahrt. Dann bekamen wir immer eine Bluna und eine Wurst mit Senf. Auch heute noch zieht es mich regelmäßig hier hoch, an Ostern oder Weihnachten. Um im Kreise meiner Lieben hemmungslos über den Osterbrunch oder das Weihnachtsmenü herzufallen und anschließend einen Spaziergang zu machen.
Und egal ob Sommer oder Winter: Immer erscheint Mathilde irgendwann auf der Bildfläche. In einer ihrer unvermeidlichen Kittelschürzen, die grauen Haare zum Knoten gedreht und auf der Nase eine silberumrandete Brille, hinter der ihre hellblauen Augen erstaunlich klar und wach leuchten. Jahr um Jahr scheint sich nichts zu ändern. Für mich war sie schon immer alt – und ist es geblieben.
Die Sicht an diesem Tag ist grandios, man kann bis über den Rhein hinweg nach Frankreich gucken. In der Ferne zeichnet sich schwach die Silhouette der Vogesen ab. Noch ein paar hundert Kilometer weiter nordwestlich liegt Verdun. Dort ist Mathildes Vater gefallen. Im Ersten Weltkrieg. Vor ein paar Wochen hat sie mir das erst erzählt – und das, obwohl wir uns schon so lange kennen.
Wie immer hatte sie sich an einem Weihnachtstag in der Gaststube überschwänglich von den Gästen begrüßen lassen und dann den Zeitpunkt für gekommen erachtet, allen ein Gläschen ihrer ganz speziellen Medizin zu verordnen: Obstler, den uns ihre auch mittlerweile schon über 70-jährige Tochter Renate manchmal bringt. Wenn Renate dann die Flasche mit dem selbstgebrannten Schnaps auf den Tisch stellt, ist ihre Mutter in der Regel bereits dabei, einen ihrer nicht ganz salonfähigen Witze zum Besten zu geben.
Dieses Mal aber kam es nicht so weit. »Na, Mathilde, für nächstes Jahr solltest du dir aber einen ganz besonders großen Vorrat an Schnapsflaschen anlegen!«, meinte einer der Gäste am Nebentisch. Und seine Frau fügte hinzu: »Für diesen Fall könntest du ja vielleicht sogar ein paar Champagnerflaschen kalt stellen!« Die beiden waren eindeutig besser über die alte Bäuerin informiert als ich. Mir wurde klar, dass ich so gut wie nichts über sie wusste.
Champagner, da war ich mir trotzdem ziemlich sicher, hatte Mathilde noch nie in ihrem Leben getrunken. Und der würde auch gar nicht hierherpassen, auf den Schwarzwaldhof. Neugierig spitzte ich die Ohren.
»Hundert wird man schließlich nicht alle Tage!«, fuhr die Frau fort – laut genug, dass es die gesamte Wirtsstube hören konnte. Worauf es, wie zu erwarten, zu vielen »Ah« und »Oh« kam und alle durcheinanderzureden begannen: »Mathilde, ist das wirklich wahr?« – »Das ist ja allerhand!« – »Hundert Jahre!«
Auch ich konnte es zunächst kaum fassen. Auf einmal war Mathilde nicht mehr einfach nur alt. Nein, sie würde ein Jahrhundertmensch werden. Das schaffen bislang nur die wenigsten. Und das ist vielleicht auch der Grund dafür, dass Jahrhundertmenschen ein geradezu ehrfürchtiger Respekt entgegengebracht wird, ähnlich wie bei Spitzensportlern, die einen neuen Weltrekord aufgestellt haben und beim Weitsprung weiter gesprungen sind als alle anderen Menschen vor ihnen.
Wäre Mathildes Leben ein Weitsprung, würde er die Eckdaten 1915 und 2015 umfassen. Ein gewaltiger Sprung – in jeder Hinsicht: Beim Absprung 1915 gab es noch kaum Telefone. Autos waren eine Seltenheit, ebenso wie Strom und fließend Wasser in den Haushalten. Hundert Jahre später sind für ihre Enkel und Urenkel Smartphones und Laptops zur Selbstverständlichkeit geworden. Wobei die Landung erst noch stattfinden muss, denn noch hat Mathilde die Hacken ja nicht in den Sand gesetzt. Wer weiß, vielleicht wird sie 101, 102 oder auch 105 Jahre alt.
Die alte Bäuerin selbst winkte an diesem Weihnachtsfeiertag nur ganz nüchtern ab: »Ich weiß noch genau, wie meine Mutter achtzig wurde«, meinte sie, als sie sich bei den Leuten am Nebentisch niederließ. Nun habe sie die Mutter um fast zwanzig Jahre überlebt: »Nie hätte ich gedacht, dass ich so alt werde«, sagte sie und machte sich ans Austeilen der ersten Runde Schnaps. »Das muss man halt hinnehmen.«
Hinnehmen. Damit stellte Mathilde ebenso sachlich wie unmissverständlich klar, dass jedenfalls für sie das Erreichen eines bestimmten Alters kein Verdienst war, der sich in irgendeiner Form mit den Leistungen von Spitzensportlern vergleichen ließe. Sondern dass dies ganz ohne ihr Zutun passierte. Trotz oder gerade wegen ihres schweren Lebens hier oben auf dem Hof.
Inzwischen ist es Frühling geworden und dieses Weihnachtsfest gut vier Monate her. Gedankenverloren streiche ich über das Holz der Terrassenbalustrade. Das Bimmeln der Kuhglocken wird von einem Traktor übertönt. Eine schwarzweiße Katze schleicht über den Hof, von Labrador Bruno immer noch keine Spur.
Ob Mathilde jemals etwas anderes als eine Kittelschütze getragen hat? Ob sie sich wohl stattdessen einmal fein herausgeputzt hat, vielleicht sogar eine Spur Lippenstift auf den Lippen – für ein Rendezvous mit einem Kavalier, in den sie sich gerade unsterblich zu verlieben begann? Lag sie jemals träumend im hohen Gras, zwischen Butterblumen und Löwenzahn, und zählte die vorbeiziehenden Wolken am tiefblauen Himmel? Was genau wusste ich eigentlich von ihr? Dass sie seit 24 Jahren Witwe war. Drei Kinder bekommen hatte, sieben Enkel, zwanzig Urenkel. Mehr nicht. Abgesehen von dem Gerede unten im Dorf. Diesem Getuschel, dass sie damals vor achtzig Jahren nicht alleine ins Tal gekommen sei. Dass sie froh sein müsse, dass der Johannes sie zur Frau genommen habe. Weil sie eine mit einem unehelichen Kind gewesen sei.
Ich gucke der Katze nach, die in der Scheune verschwindet, und beschließe, in die Gaststube zu gehen. Sollte die Renate etwa dieses uneheliche Kind sein? Schließlich war sie Mathildes ältestes.
Als damals an Weihnachten schließlich die Obstlerflasche auf unserem Tisch gelandet war, bekam ich zwar auf diese Frage noch keine Antwort, dafür aber die Einladung in ihr ereignisreiches Leben: Mathilde sagte zu, mir ausführlich aus ihrem Jahrhundertleben zu erzählen.
So kam es, dass wir bald darauf einträchtig an ihrem Lieblingsort saßen: dem großen grünen Kachelofen ganz hinten in der Gaststube. Erstmals konnte ich ihr schmales, feines und von unzähligen Falten durchzogenes Gesicht ganz aus der Nähe betrachten. Draußen war es immer noch bitterkalt, an den Fenstern hingen Eiszapfen, auf der Terrasse lag eine dicke Schneeschicht. Es war ein Sonntag, Mathilde kam gerade aus der Kirche. Wenn jemand sie mitnehmen kann, geht sie noch jeden Sonntag: »Weil der Glaube dem Dasein Sinn gibt.«
Ich spürte, wie wichtig Gott in ihrem Leben ist. Hier oben auf dem Berg, weit entfernt von der Großstadt, ist der Alltag noch sehr traditionell und von der Kirche geprägt. »Wenn man im Garten etwas pflanzt, muss man auch warten, bis es wächst und gedeiht«, An etwas glaubt man immer, selbst der Atheist. An etwas muss man glauben.fuhr Mathilde fort. Genauso sei es mit dem Glauben: Ohne ihn nütze alles nichts, ohne ihren Glauben hätte sie es nicht geschafft. Ob jemand Jude oder Moslem ist, Atheist oder Christ so wie sie – das ist ihr egal. Jeder müsse versuchen, nach seiner Fasson glücklich zu werden. »Wer sagt, er glaubt nicht, lügt«, meinte Mathilde. Denn auch Atheisten glaubten. »An irgendetwas glaubt man immer, an irgendetwas muss man in seinem Leben glauben! Das gibt dem Leben Halt und Sinn.«
Aber, so eröffnete sie mir und drückte den Rücken gegen den warmen Ofen: »Ich habe lange Zeit mit Gott gehadert. Und mit dem Schicksal, das er hier auf Erden für mich vorgesehen hat. Ich habe an ihm gezweifelt: Warum hatten andere ein so schönes Leben und ich nicht?« Er habe es nicht immer gut mit ihr gemeint, ihr Gott. Und die Pfarrer, die sie in jungen Jahren hatte, von denen fühlte sie sich auch oft im Stich gelassen.
1915 wurde sie geboren, am Bodensee im Kreis Konstanz. Da, wo ich auch selbst herkomme und aufgewachsen bin. Als ihr Vater bei Verdun den Soldatentod starb, war sie erst zwei Jahre alt. Ihre Mutter heiratete bald darauf einen Mann, der ihr den Hof machte, den sie aber eigentlich nicht mochte – »aus praktischen Gründen«.
Mathilde legte eine wirkungsvolle Pause ein, bevor sie diese drei Worte sagte. Dabei hob sie vielsagend die Hand und beugte sich nach vorne. Geradeso, als könnte sie einem Schüler, dem es einen komplizierten Sachverhalt zu erklären galt, in diesem Falle mir, damit auf die Sprünge helfen, ohne dass es weiterer Worte bedurfte.
»Ihr Frauen heutzutage, ihr habt es ja so viel leichter!«, fügte sie dann doch noch erklärend hinzu und begann einen für ihre Verhältnisse ellenlangen Satz: »Ihr seid ja heute finanziell unabhängig, ihr wisst ja gar nicht, was das für ein Gut ist. Wie oft habe ich mir in meinem Leben gewünscht, so unabhängig und so frei zu sein!«
Dass heute viele Frauen von diesen Freiheiten keinen Gebrauch machen, den Job an den Nagel hängen und es vorziehen, sich wieder abhängig zu machen, das konnte sie nicht nachvollziehen, die alte Bäuerin, das war ihr völlig unverständlich.
Mathilde musste tief Luft holen, denn normalerweise geht sie mit Worten spärlich um. Ihr Redefluss ist wie ein Strahl Wasser, der regelmäßig versiegt, dann aber plötzlich wieder strömt, kurz zwar nur, dafür aber umso stärker und kräftiger. Kompakt, prägnant, auf den Punkt gebracht: Aus praktischen Gründen.
Denn mit diesem zweiten Mann, einem Bauern aus der Umgebung, hatte ihre Mutter wieder finanzielle Sicherheit – und für sich und ihr Kind ein Dach über dem Kopf. Aber der neue Mann trank zu oft und zu viel, dann wurde er gewalttätig. Kamen Frau und Kind ihm in die Quere, verprügelte er sie. Nie habe sie es ihm recht machen können: »Wenn ein Tag verging, an dem ich nur eine Ohrfeige bekam, war das ein guter Tag.«
Erschüttert hörte ich zu. Heute würde dieser Mann zumindest riskieren, dass die Nachbarn das Jugendamt informieren. Doch das gab es damals ja noch nicht. Häusliche Gewalt war allgegenwärtig und noch ein völliges Tabu.
»Aber dann hatte der liebe Gott zum Glück ein Einsehen«, erzählte Mathilde weiter. Der Stiefvater, wieder einmal sturzbetrunken, kam bei einem Unfall ums Leben. Als er bestattet wurde, stand ihre Mutter hochschwanger an seinem Grab und weinte. Mathilde, die ihre Hand hielt, erinnert sich noch genau, wie sie verständnislos zu ihrer Mutter aufsah und sie fragte, warum sie denn weine: »Du brauchst doch jetzt nicht mehr zu weinen, Mama, er kann uns jetzt ja nicht mehr hauen!«
Mathildes Stiefschwester war noch nicht geboren, da heiratete die Mutter schon wieder, zum dritten Mal. Diesmal hatte die Familie mehr Glück: Mathildes zweiter Stiefvater, ebenfalls ein Bauer aus einem Nachbardorf, war gut zu Frau und Kindern. Und er hatte Geld. Anfangs jedenfalls. Bis 1923, als die Inflation explodierte. Mathilde war damals acht Jahre alt. »Da haben auch wir alles verloren. Alles war weg – alles!«
Trotzdem kannte ihre Kindheit auch sorglose Momente. Wenn sie mit den Tieren auf dem Hof spielte, den Hunden und Katzen. Oder mit den anderen Mädels aus der Schule zum Schwimmen an den Bodensee ging. Badeanzüge hatten sie damals nicht, alle zogen sich splitternackt aus, ließen die Kleider am Ufer liegen.
»Einmal haben die Jungs sich im Gebüsch versteckt und uns beobachtet.« Um dann die Kleider zu packen und wegzurennen. »Ich musste nackig nach Hause laufen, da habe ich mich vielleicht geschämt!« Mathilde lächelte verlegen, während sie das sagte. »Hajoh«, schnaubte sie, was im Alemannischen, jenem Dialekt, der zwischen Freiburg und Feldberg gesprochen wird, so viel wie »Jaja« oder »Ach ja« bedeutet. »Hajoh!« – ein Lausbubenstreich sei das eben gewesen.
Gab es mehr Momente in ihrem Leben, in denen sie sich geschämt hat?
Sie schwieg eine Weile und nippte an ihrem Tee. Dann seufzte sie abgrundtief und nickte. Wirklich geschämt, so sehr geschämt wie nie zuvor und auch später nicht in ihrem ganzen Leben, das habe sie sich ein paar Jahre später. Nachdem sie auf dem Schulweg vergewaltigt worden war. Von einem Mitschüler. Da war sie nicht älter als 13 oder 14 Jahre. Mit Händen und Füßen gewehrt habe sie sich, aber er sei viel stärker gewesen als sie. »Zum Glück ist er mit seiner Familie bald darauf weggezogen.«
Ich war erschüttert und gleichzeitig bewegt, dass sie sich mir anvertraute. Hat sie denn gar nichts unternommen, um den Täter zur Rechenschaft zu ziehen?
Die alte Frau schüttelte den Kopf. Mit niemandem, noch nicht einmal ihrer Mutter, habe sie darüber gesprochen. »Ich schämte mich zu sehr.« Noch heute werfe sie sich vor, sich nicht genug gewehrt zu haben, noch heute frage sie sich, was sie damals falsch gemacht habe. »So was vergisst man sein ganzes Leben nicht mehr. Hinterher brauchte ein Mann mich nur anzugucken, und ich hätte ihm eine butzen können.«
Irgendwann hielt sie es nicht mehr aus und beschloss, den Pfarrer ins Vertrauen zu ziehen. Sie wurde streng katholisch erzogen, ging mit ihren Eltern und Geschwistern nicht nur sonntags in die Kirche, sondern auch freitags zum Wallfahrtsgottesdienst. Auch wenn die Familie dann auf dem Heuwagen in den Nachbarort fahren musste. Der Pfarrer hörte sich die Beichte geduldig an. Dann sagte er: »Gott und ich, wir verzeihen dir.« Außerdem ermahnte er das junge Mädchen, in Zukunft dafür zu sorgen, dass es nicht mehr so weit kommen konnte.
Mir verschlug es die Sprache.
»Ich habe dann die Schule abgeschlossen und konnte in Konstanz bei einem Bäcker arbeiten«, fuhr Mathilde fort. »Aber nur bis 1932. Dann mussten alle Landmädchen die Stadt verlassen. Hitler fand, dass sie den Stadtmädchen nicht die Arbeit wegnehmen durften.« So landete sie wieder auf dem elterlichen Hof, pflückte Erbsen und Bohnen für zwei Pfennig pro Pfund. Pflückte sich ihre Aussteuer zusammen.
Auf dem Nachbarhof arbeitete ein Junge aus Gelsenkirchen, den sie gernhatte. Ihm gefiel das schmale junge Mädchen mit dem langen dunkelblonden Zopf auch, und so wurden die beiden ein Paar. »Er hat für mich immer Krisi geklaut.« Kirschen. »Die waren so süß und so gut! Ich hätte mich das nie getraut«, erinnerte sie sich, und ihr Gesichtsausdruck bekam zum ersten Mal etwas Liebliches. Kirschen gab es damals nicht so viele, auch nicht im Laden, die waren teuer. Und deshalb umso begehrter. »Sobald die Krisi reif waren, haben die jungen Burschen sie deshalb gestohlen. Das war damals so. Aber wir sind nie erwischt worden.«
Manchmal streichelte der Junge aus Gelsenkirchen ihren Arm. Dann war sie glücklich. »Das hat schon gereicht. Geküsst haben wir uns nie.« So weit sollte es auch nicht mehr kommen, denn Mathildes Mutter hatte etwas gegen den jungen Mann und verbot ihrer Tochter den Umgang. »Er ist dann nach Gelsenkirchen zurückgekehrt, aber vergessen habe ich ihn nie.«
Sie selbst fing wenig später an, auf dem Gutshof eines Grafen am Bodensee zu arbeiten, als Dienstmädchen. So viel Reichtum hatte sie noch nie zuvor in ihrem Leben gesehen. »Ich hatte zusammen mit zwei anderen Dienstmädchen ein eigenes Zimmer, und wir trugen alle schöne schwarze Kleider mit weißer Schürze«, schwärmte sie.
Ich musste unwillkürlich an die Dienstmädchen aus der englischen Erfolgsfernsehserie Downton Abbey denken und hätte gerne noch mehr aus dieser Zeit in Mathildes Leben erfahren. Aber ich musste mich gedulden, denn Renate wies auf die Uhr: »Zeit fürs Mittagessen!« Und anschließend für den Mittagsschlaf. Für diesen Tag mussten wir das Gespräch beenden.
Das war also unser erstes richtiges Gespräch vor gut drei Monaten. Nun ist es Ende April geworden, ein paar Tage vor dem 1. Mai. Ich stelle mir vor, wie voll es hier auf der Terrasse dann Geld und Besitz, auch das sind Götter – und für viele Leute leider wichtiger als der Glaube und Werte.wohl wieder sein wird, als ein schwarzes Geschoss mit wedelndem Schwanz auf mich zurennt und mich vor Begeisterung fast umwirft. Bruno, Mathildes schwarzer Labrador. Es dauert eine Weile, dann erscheint auch Peter, einer ihrer jüngsten Urenkel. Er hat mit dem Hund gerade eine lange Wanderung gemacht. Peter studiert noch, in Freiburg, aber wie üblich vor solchen Feiertagen, wenn es hoch hergeht, ist auch er angerückt, um hinterm Tresen oder beim Bedienen zu helfen.
»Du kommst sicher wieder wegen der Mathilde«, meint er. »Komm rein, die sitzt wie immer am Kachelofen.«
Peter leert noch schnell den Briefkasten, bevor er für mich die knarzende Eingangstür aufmacht. Auf dem Stammtisch gleich rechts in der Gaststube steht ein großer Strauß frischer Blumen. Die kommen sicher aus dem Gemüsegarten hinter dem Haus, da hat Mathilde auch ein paar Blumenbeete angelegt. Mit Osterglocken, Tulpen, Nelken, Astern, Dahlien oder Gladiolen. Je nach Saison. Was im Laufe eines Jahres halt alles wächst und blüht.
Peter hat recht. Sie sitzt am Kachelofen. Seltsam, welch magische Anziehungskraft Öfen auf alte Menschen auszuüben scheinen – auch dann noch, wenn sie kalt sind. Freudig bellend läuft Bruno auf sie zu. Mathilde zuckt zusammen und richtet sich auf, sie war offensichtlich eingenickt. Lächelnd lässt sie sich von ihrem Urenkel einen Kuss geben und von Bruno den Handrücken ablecken.
»Ich habe immer in meinem Leben Hunde gehabt«, sagt sie dann und bedeutet mir mit einem Blick, mich neben sie zu setzen.
»Schau, Uromi, hier ist eine Karte von der Karin!«
»Ja, ist die denn heuer nicht da, um mitzuhelfen?« Karin ist Peters Schwester.
»Aber nein, die ist doch in Spanien, schau!« Peter hält uns die Ansichtskarte hin und verschwindet dann im Gang. Tossa de Mar. Da war ich auch schon mal.
»Hajoh«, seufzt Mathilde. »Wo die Leut’ heut überall hinkommen!«
Sie selbst hat noch nie in ihrem Leben Urlaub gemacht. Weiter als bis zum Vierwaldstättersee ist Mathilde nie gekommen. Bei einem Schulausflug. Die Schweiz ist hier im Grenzgebiet ja ganz nahe.
»Ich habe auch das Meer noch nie gesehen.« Sie überlegt kurz. »Mein Urlaub war, wenn ich ins Krankenhaus musste«, erzählt sie. »Dort hab ich mich immer erholt.« Zwei ihrer Kinder sind im Krankenhaus geboren, und einmal musste sie wegen eines Bauchwandbruchs auch länger bleiben. Das kam vom vielen Heben. »Ich hab halt immer schwer schaffen müssen. Auch sonntags.« Da wurde morgens in die Kirche gegangen und nachmittags aufs Feld. Um die Ernte einzuholen. Ihr ganzes Leben lang sei das so gewesen. »Früher mussten wir vorher immer erst den Pfarrer fragen, der hat uns das dann erlaubt.« Die Bauernwirtschaft hingegen, die durfte sonntags immer offen sein, ohne ausdrückliche Erlaubnis des Pfarrers: »Das war das tägliche Brot«, erklärt Mathilde. »Wenn es um das tägliche Brot ging, durfte man auch sonntags arbeiten. Dann brauchte man dafür keine Erlaubnis.« Heute sei das ja alles ganz anders: »Heute haben die Leut’ nicht nur den ganzen Sonntag frei, sondern auch den Samstag! Sie können auch andauernd Urlaub machen. Und wenn sie nicht essen und trinken, dann sind sie am Einkaufen …«
Ich schaue sie an. Die alte Bäuerin stellt das einfach nur fest. Erstaunt und nicht etwa missbilligend. Dann aber wird ihr Ton doch eine Spur vorwurfsvoll: »Ich weiß nicht, ob ich eine gute Christin bin«, beginnt sie, »aber ich bin wenigstens keine scheinheilige! Ich tue nicht so, als ob ich glaube. Ich glaube wirklich. Und ich habe nie andere Götter neben dem lieben Gott gehabt, auch das nicht!« Geld und Besitz, das seien solche anderen Götter – und für viele Leute wichtiger als Glaube oder Werte: »Geld, Autos, Kleider … Sie können nicht genug kriegen!«, sagt Mathilde. »Und sie wollen ewig jung bleiben! Wozu soll das denn gut sein?«
Ich denke unwillkürlich an die stattliche Schuhsammlung in meinem Schrank und den neuen Topf Anti-Aging-Creme, den ich mir vor ein paar Tagen geleistet habe. Mathilde hingegen hat, wie so viele ihrer Generation, aufgrund der schweren Zeiten in ihrem Leben erkannt, welche Dinge im Leben wirklich zählen und welche eigentlich bedeutungslos sind. In guten Zeiten vergisst man das schnell.
»Ich war froh, wenn ich eine neue Schürze bekam oder einen schönen Pullover, das war’s«, fährt sie fort. Und natürlich habe sie im Laufe der Jahre Falten gekriegt, natürlich sind ihre Ohren schlechter geworden, dann auch ihre Augen: »Es wird Abend, und es wird Nacht. Dagegen kann man nichts tun.«
Da war er wieder, dieser kurze kräftige Wasserstrahl. Nur ein paar Worte, aber was für welche: »Es wird Abend, und es wird Nacht.« One-liner heißt das auf Neudeutsch: die Fähigkeit, einen komplizierten Sachverhalt mit einem Satz auf den Punkt zu bringen. Viele Politiker absolvieren teure Trainingskurse, um das zu erlernen. Mathilde kann es auch so.
Ich denke an den gräflichen Gutshof, auf dem sie als Dienstmädchen arbeitete – die schwelgten doch auch in Luxus, die hatten doch auch andere Götter neben sich? Mathilde pflichtet mir bei, wenngleich sie anmerkt, dass das damals im Gegensatz zu heute eine Ausnahme gewesen sei: Das hätten sich nur die wenigsten Wenn man von vornherein weiß, dass einem doch nicht geglaubt wird, sollte man besser schweigen.leisten können. Dann gibt sie ehrlich zu: »Gefallen hat es mir schon!« Wunderschön sei er gewesen, dieser Gutshof. Und der Graf und seine Frau steinreich: Sie hatten viele Kühe und Pferde. Und gleich drei Pferdepfleger im Dienst, die für sie sorgten. Alles war geschniegelt und gebügelt. Ihre Stimme ist voller Bewunderung, der Blick nach oben ins Nichts gerichtet. Dann legt sie die Hände in den Schoß und seufzt. »Aber leider konnte ich da nicht lange bleiben, leider musste ich da wieder weg!«
Sie starrt eine Zeitlang vor sich ins Leere. »Der älteste Sohn ist mir damals nachgestiegen«, sagt sie dann. »Der wollte mich auch vergewaltigen.« Mehrmals habe er es versucht, sie probierte zunächst, ihm aus dem Weg zu gehen. »Aber dann habe ich beschlossen, ganz wegzugehen, das war das Beste so.«
Warum hat sie denn nicht den Mund aufgemacht? Warum hat sie auch dieses zweite Mal geschwiegen?
Mathilde guckt mich an und muss bitter auflachen, ganz leise nur, aber es entgeht mir nicht. »Ich wusste, dass mir niemand geglaubt hätte. Es war besser so, wirklich.« Seine Eltern, der Graf und seine Frau, die seien streng katholisch gewesen. »Sie hätten immer zu ihrem Sohn gehalten. Immer. Ich war ja nur ein einfaches Dienstmädchen! Eine Untergebene. Mit der konnte man das tun. Ein Untertan. Mit denen konnte man alles tun.«
Lügen sei schlimm. Aber genauso schlimm sei es, wenn man die Wahrheit sagt und keiner glaubt einem. Deshalb hat sie damals den Mund gehalten und ihn verlassen, diesen wunderschönen Gutshof am Bodensee mit den wunderschönen Pferden und der reichen Grafenfamilie. Deshalb ist sie im Schwarzwald gelandet. »Den Johannes, den hätt’ ich sonst nie geheiratet.«
Wieder einmal weiß ich nicht, was ich entgegnen soll. Mir wird klar, in welchem See, nein, in welchem Meer an »Was wäre geschehen, wenn …?« Streiche diese Worte aus deinem Vokabular, du wirst nie eine Antwort erhalten. Es ist, wie es ist.Freiheiten ich schon mein ganzes Leben lang baden darf. Ich kann und konnte selbst entscheiden, an wen und was ich glauben will. Als Frau muss ich zwar grundsätzlich immer noch fürchten, vergewaltigt zu werden, aber es gilt wenigstens nicht mehr als Kavaliersdelikt, das sich eine Frau selbst zuzuschreiben hat. Und ich bin von den Diskriminierungen und Zwängen der Ränge- und Ständegesellschaft befreit: Vor dem Gesetz immerhin sind wir alle gleich.
Die Sonne scheint durch die kleinen Butzenscheiben des Bauernhofs. Ein Sonnenstrahl reicht, von Staubteilchen umnebelt, über die alten Holzplanken bis zu uns nach hinten an den Kachelofen. Auch Bruno, der friedlich zusammengerollt zu Mathildes Füßen liegt, hat ihn bemerkt und richtet sich auf.
»Im Nachhinein habe ich mich schon ein paarmal gefragt, wie mein Leben verlaufen wäre, wenn ich mich damals irgendjemandem anvertraut hätte. Wenn ich geblieben wäre.« Aber, so erzählt sie, nachdem sie einen tiefen Atemzug getan hat: Die Worte »Was wäre geschehen, wenn …«, die habe sie aus ihrem Vokabular gestrichen. »Du bekommst ja doch nie eine Antwort darauf!« Es ergebe keinen Sinn, im Nachhinein darüber nachzudenken, wie etwas anders hätte laufen können. »Es ist, wie es ist.«
Sie suchte sich damals eine neue Stelle und entdeckte ein Zeitungsinserat, das sie interessierte: Im Schwarzwald auf einem Bauernhof mit Wirtschaft gab es Arbeit. »Sonne« hieß die Wirtschaft. Mathilde fragte ein paar reisende Geschirrhändler, ob sie den Hof und den Ort kannten. Ja, antworteten die, aber da gebe es nur eine Krone, keine Sonne. Sonne oder Krone – Mathilde war das egal, sie wollte weg und beschloss, sich zu bewerben. Es dauerte damals einige Wochen, man war auf die Post angewiesen und das Telegraphenamt. Jeden Tag wartete Mathilde sehnsüchtig auf Nachricht, ob und wann sie das Gut endlich verlassen durfte. Hoffentlich noch rechtzeitig, bevor ein weiteres Unglück geschah. Aber dann bekam sie eine Zusage für die Stelle. »Da habe ich gleich meinen Koffer gepackt, viel hatte ich ja nicht, und bin hierhergefahren, mit dem Zug.«
Ich denke an das Getuschel im Dorf, dass sie damals angeblich mit Kind angereist sei. Nichts davon scheint zu stimmen.
Der Bahnhof lag unten im Tal. Der älteste Sohn, so hatte man ihr geschrieben, würde sie abholen. Doch niemand war da, als die junge Frau mit ihrem Koffer auf dem verlassenen Bahnsteig stand. »Da bin ich in die nächste Gastwirtschaft und hab hier oben bei der Krone angerufen«, erzählt sie. »Es gab ja damals die ersten Telefone.« Dann wartete sie.
Nach einer Stunde kam ein unrasierter Bursche in dreckigen Klamotten in die Gaststätte. Das war der Johannes. Er war mit Pferd und Wagen vorgefahren. Aber als Mathilde das Pferd und den Wagen sah, traute sie ihren Augen nicht, sie war inzwischen anderes gewohnt: »Das war kein richtiger Wagen, das war bloß ein wackliges Wägeli!«, entrüstet sie sich noch im Nachhinein. »Es hatte ja noch nicht einmal einen Sitz, nur ein Brett!« Auf dem habe sie gesessen wie »eine Katze auf dem Schleifstein«. Und das Ross, das habe eine ungekämmte Mähne gehabt und sei völlig verfilzt gewesen.
So kam sie zum ersten Mal hier oben an. Der Vater von Johannes lag krank im Bett, die Mutter war tot. Eine Frau aus dem Dorf sah manchmal nach dem Rechten. Es gab nur ein einziges Handtuch in der Küche, das war völlig schwarz und starrte vor Dreck, denn es wurde für alles gebraucht. Abends wurde es gewaschen und am nächsten Tag wieder benutzt. Mathilde packte als Erstes ihre Aussteuer aus, die Handtücher. Dann stellte sie sich in die Küche. Johannes und seine Brüder wollten zu Abend essen, sie hatten sich schon an den Tisch gesetzt.
»Ich hab ihnen gesagt, sie müssten sich erst die Hände waschen«, erzählt sie. »Da war mein neues weißes Handtuch schwarz.« Ich staune, dass sie auf einmal so viel Autorität ausstrahlen konnte. Aber es waren ja alles noch Burschen, und bis auf den Johannes waren alle jünger als sie. »Ich habe auch sofort versucht, ihnen Tischmanieren beizubringen, und verboten, beim Essen zu fluchen.«
Das war im März 1936. Drei Monate später war sie mit dem Johannes verheiratet. Dafür sorgte ihre Mutter, die kurz darauf anreiste, um nach dem Rechten zu schauen. »Sie fand, das sei das Beste für mich«, sagt Mathilde und schaut zu Boden.
War sie vielleicht doch schwanger? Sollte es dem Grafensohn doch gelungen sein, sie zu vergewaltigen? Ich spreche meine Gedanken nicht aus.
»Meine Mutter hat dann auch sofort mit dem Pfarrer unten im Dorf geredet, und auch der fand, es sei das Beste für mich.«
Das Beste war es jedenfalls für den Johannes und seine Brüder und den Hof, denke ich, aber auch das sage ich nicht laut. Stattdessen rechne ich nach. »Juni 1936 – waren Sie da nicht schon 21 Jahre alt und damit volljährig?«
Mathilde nickt. »Ich bin kurz vor meiner Hochzeit einundzwanzig geworden. Aber hätte ich etwa gegen den Pfarrer und die Mutter aufbegehren sollen? Wie denn?« Unvorstellbar sei das früher gewesen. »Ich hatte zu folgen. Ich musste gehorchen.« Sie weiß noch genau, wie sie in der Kirche vor dem Traualtar stand und der Pfarrer zu reden begann. »Ist es dein freier und ungezwungener Wille, diesen Mann hier zum Ehemann zu nehmen?« Etwas in ihr habe aufgeschrien: »Nein, das stimmt doch gar nicht!« Aber kein Wort kam ihr über die Lippen. »Sagget Sie ja!«, habe ihr der Trauzeuge, der hinter ihr stand, ins Ohr geraunt. »Sagget Sie ja!« Da habe sie ja gesagt. »Nein, gehaucht habe ich es, nur gehaucht!«, verbessert sich Mathilde mit einem tiefen Seufzer.
Sie hat sich gegen ihren Willen verheiraten lassen. Mir die ganze Tragweite zu vergegenwärtigen fällt schwer. Die Autorität von Eltern und Kirche muss damals wirklich noch unermesslich groß gewesen sein. Und Mathilde war eine unsichere junge Frau, die auf eine Kindheit und Jugend ohne viel Liebe, aber mit sehr viel Gewalt zurückblicken konnte.
Wenn der Mensch ein Schiff ist und das Leben ein Meer, so stelle ich es mir vor, dann liegen Menschen, die viel Liebe bekommen haben, viel sicherer auf dem Wasser als die, die ohne viel Liebe groß geworden sind. Sie können ihr Schiff auch viel sicherer durch die Wellen manövrieren, lassen sich nicht so schnell vom Kurs abbringen, sind besser gegen Stürme gewappnet. Mathilde hingegen, so wird mir immer klarer, hatte nur ein kleines Segelschiff, die Wellen und der Wind bestimmten den Kurs. Aber so unsicher es auch auf dem Wasser tanzte – es scheint einen Rumpf aus Stahl zu besitzen. Denn untergegangen ist es trotz allem nicht.
»Nach der Trauung hab ich mich dann in die Küche gestellt, um für die Hochzeitsgäste zu kochen«, erzählt sie weiter. Noch mehr Arbeit erwartete sie ein paar Tage später am Wochenende, da fand auf dem Hof die öffentliche Hochzeitsfeier für das ganze Dorf statt. Ihr Hochzeitskleid war schwarz. »Weiß, das war nur für die Reichen.«
In der Hochzeitsnacht und in den vielen anderen Nächten, die folgten, weinte sie. Und dachte an den Jungen aus Gelsenkirchen. »Es war schrecklich. Mit meinem Mann geschlafen habe ich nur, weil es als Ehefrau meine Pflicht war. Spaß hat es mir nie gemacht.«
Wieder herrscht einen Moment lang Schweigen. Still sitzen wir nebeneinander am Kachelofen.
»Mein freier und ungezwungener Wille … Ooooh!«, bricht es dann auf einmal überraschend heftig aus ihr heraus. Sie richtet sich auf. »Wenn meine Mutter und der Pfarrer nicht gewesen wären, hätte ich den Johannes nie geheiratet. Dann hätte ich mein Leben mit einem anderen verbracht. Oder ich hätte gar nicht geheiratet.«
Hätte, hätte, hätte. Sie scheint vergessen zu haben, dass sie diese Worte aus ihrem Vokabular verbannt hat. Sie will sich doch nicht mehr fragen, was geschehen wäre, wenn … Es muss an mir liegen, an unseren Gesprächen. Und an den Erinnerungen, die dadurch wieder wachwerden. Ich bin nicht nur erschüttert über das, was sie mir erzählt hat, sondern auch sehr erstaunt. Nie hätte ich gedacht, dass sie so offen sein kann. Nie hätte ich vermutet, dass sie so viel durchmachen musste. Mathilde, das war für mich die alte Bäuerin, die gerne einen Schnaps spendiert und immer einen Witz parat hat. Ich kann nicht verhindern, dass ich unsere Leben schon wieder vergleiche. Ich kann und konnte selbst entscheiden, wen ich liebe und mit wem ich zusammen sein will. Ich habe Spaß am Sex. Ich bin vom erstickenden Korsett, zu dem Autoritäten wie Eltern oder Pfarrer werden konnten, befreit.
Aus dem Sonnenstrahl ist ein breiter Kegel geworden, der fast die gesamte Gaststube erfasst. »Lass uns nach draußen gehen«, schlägt Mathilde vor. Ich muss ihr beim Aufstehen helfen und auch beim Rausgehen. »Nein, nicht so hoch!«, korrigiert sie mich, Ohne Liebe kein Eheglück.worauf ich meinen Ellenbogen etwas senke. Barsch und unwirsch hat sie es gesagt, aber das nehme ich ihr nicht übel. Der Umgangston hier oben ist rau, daran musste sie sich selbst vor achtzig Jahren nach ihrem Intermezzo auf dem gräflichen Hof gewöhnen. Und nicht nur daran. Auch die Wirtschaft war völlig neu für sie. »Anfangs fand ich das schrecklich, wegen der vielen Leut’«, erklärt sie. »Man kann es ja nicht allen recht machen. Und man muss trotzdem immer lächeln, immer nur lächeln …« Heute ist sie froh, dass sie die Wirtschaft hat. »Sie würde mir fehlen!« Gerade wegen der Leute. »Das macht mich glücklich.«
Wir sitzen inzwischen unter der großen Kastanie im Hof, die in aller Heftigkeit zu blühen beginnt und wunderbar riecht. Sie ist voller zwitschernder Vögel. Bruno hat sich neben sein Frauchen gelegt und ist schon wieder eingeschlafen.
Mathilde deutet auf das Fenster rechts oben. Da liegt ihr Schlafzimmer, direkt über der Wirtsstube. »Ich höre alles da oben. Wenn die Wirtschaft voll ist, reden alle durcheinander, das ist etwas Herrliches«, sagt sie mit einem versonnenen Lächeln. »Dann kann ich gut einschlafen!«
Hat die Wirtschaft ihr etwa das gegeben, was sie von ihrem Ehemann nicht bekommen konnte? Halt und Zuneigung? Freude? Ein Lächeln und ein paar liebe Worte? Ich will es genauer wissen: Wie war ihre Ehe? Immerhin waren sie mehr als ein halbes Jahrhundert verheiratet. 54 Jahre. Hat sie ihren Mann nicht doch noch lieben gelernt?
Mathilde schüttelt den Kopf. »Ich war keine gute Ehefrau, ich konnte keine gute Ehefrau sein«, sagt sie ganz nüchtern. »Weil ich meinen Mann nicht geliebt habe.« Man könne schon ohne Liebe eine Ehe führen, aber »dann ist es bloß Pflichterfüllung. Auch der Beischlaf. Ich hab mich halt ergeben.« Sie guckt nach oben in die Die Menschen vergessen, dass es im Leben nichts Vollkommenes gibt. Und kein Recht auf Glück.rosaweiße Blütenpracht der Kastanienkerzen. Manchmal hat sie sich schon gefragt, ob sie einem anderen Mann eine gute Ehefrau hätte sein können. Ob sie wirklich glücklich hätte werden können. »Aber ich habe ja schon gesagt, es hat keinen Sinn, sich im Nachhinein zu fragen, wie alles anders hätte laufen können!« Sie guckt mich an und muss auflachen: »Das kommt durch dich. Du bringst mich dazu!« Junge Frauen, so wie ich oder ihre Enkelinnen und Urenkelinnen, die hätten es heute ja viel einfacher: »Ihr könnt viel mehr selbst entscheiden, ihr lernt das, was euch Spaß macht, und habt Berufe, die ihr liebt.« Aber, so gibt sie dann zu bedenken: »Ihr habt auch eure Sorgen. Ihr macht es euch nicht leicht.« Weil heute jeder die große Liebe suche, das große Glück. Mit weniger würden sich die Leute nicht mehr zufriedengeben: »Sie vergessen, dass nichts im Leben vollkommen ist. Es gibt nichts Vollkommenes. Und kein Recht auf Glück.«
Mathilde nimmt einen großen Schluck Wasser. Sie ist es nicht gewohnt, so viel zu sprechen. Renate hat eine ganze Flasche Sprudel vor uns auf den Biertisch gestellt.
Die Ehe mit dem Johannes jedenfalls sei keine gute gewesen, fährt sie dann fort. Auch wenn er sie nie geschlagen habe. Daran hätten auch die Kinder nichts geändert. Renate, das erste, kam elf Monate nach der Hochzeit zur Welt, sie wurde zu Hause, hier auf dem Hof geboren. Mit Hilfe der Dorfhebamme. Es war eine schwere und eine furchtbar lange Geburt. Der Johannes habe draußen auf dem Gang gewartet. Als die Renate dann endlich da war, habe er als Erstes gesagt: »Jetzt ist das auch noch ein Mädchen!«
Ich bin nicht weiter erstaunt oder entsetzt. Der Johannes war ein einfacher Bauer, der noch knietief in heute überkommenen Traditionen steckte. Er wollte einen Stammhalter, Mädchen waren zweitklassig. Das Gerede aus dem Dorf aber, das beschließe ich endgültig zu vergessen. Mathilde ist damals weder mit Kind noch schwanger ins Tal gekommen. Was sich die Leute alles ausdenken!
Klaus, Mathildes zweites Kind, erblickte gut ein Jahr später im Krankenhaus das Licht der Welt. 1939, kurz vor Pfingsten. Die Familie hatte die Maler erwartet, da die Küche geweißelt werden sollte. Mathilde hatte deshalb bereits das ganze Geschirr in die Wirtschaft gestellt. Doch dann musste sie von ihrem Schwager erfahren, dass die Maler es nicht mehr schaffen und erst nach Pfingsten kommen würden. »Oh, was hat mich der Johannes da geschimpft«, seufzt sie. Der Pfingstumsatz stand auf dem Spiel, viele Leute hatten ja schon einen Tisch reserviert.
Hätte sie das Geschirr etwa alles wieder in die Küche räumen sollen? Das kam gar nicht in Frage. »Da bin ich hochschwanger bei meinem Schwager auf dem Motorrad hintendrauf zu den Malern gefahren und hab denen gesagt, dass das so nicht geht!« Die Küche wurde dann tatsächlich wie geplant noch vor Pfingsten geweißelt. Aber ohne Mathilde: Nach dem Ritt auf dem Motorrad setzten die Wehen ein, per Taxi wurde sie ins Krankenhaus gefahren, die Hebamme fuhr gleich mit. Am nächsten Morgen um halb sechs war Klaus dann auf der Welt.
Daraufhin beschloss sie, keine weiteren Kinder mehr zu bekommen. Eine Frau im Dorf schickte sie zu einem Arzt. »Der hat mir dann so eine Paste verschrieben. Zum Verhüten.«
Ich bin etwas verwirrt: Sagte sie nicht, dass sie zwei Kinder im Krankenhaus bekommen habe? Ich beschließe abzuwarten.
Pfingsten 1939. Ein paar Monate später, am 1. September, brach mit dem Überfall auf Polen der Zweite Weltkrieg aus. Mathilde nickt und trinkt noch einen Schluck Wasser. »Da war ich auf einmal alleine auf dem Hof – mit zwei kleinen Kindern. Und die ganze Ernte war zu dem Zeitpunkt auch noch draußen.« Johannes kämpfte wie so viele andere Männer an der Westfront. Einen Führerschein hatte sie zwar nicht, aber sie konnte Trecker fahren. Zum Glück. Mit und ohne Anhänger. Was sie auch tat. Während des Kriegs fuhr sie sogar Langholz und brachte es zum Sägewerk, ganz alleine. Eine schmale junge Frau, 25 Jahre alt, hoch oben auf dem Trecker, hinter ihr zwanzig Meter lange Baumstämme. Ich kann es mir kaum vorstellen.
Kurz vor Kriegsende 1945 musste sie zwanzig Mann für den Arbeitsdienst einquartieren. »Die schliefen oben in Stockbetten. Und die standen jeden Tag in meiner Küche, um zu kochen. Immer einen großen Topf voll, Tag für Tag.« Bis die Franzosen kamen, da wurden die Männer in aller Eile abgezogen. »Ein Bus holte sie ab, ein gelber Postbus, ich weiß es noch genau.« Weiter oben auf dem Berg betrieb der Ortsgruppenleiter damals eine Funkschule und bildete Spione aus, junge Burschen, 18 oder 20 Jahre alt. »Die wollten Deutschland retten, auch 1945 noch! Deshalb blieben sie.« Obwohl die Franzosen anrückten und sogar die hohen Offiziere längst das Weite gesucht hatten. So kam es, dass diese jungen Soldaten auf die eigenen Leute schossen: Sie hielten die Männer vom Arbeitsdienst, die in dem gelben Postbus saßen, versehentlich für den Feind. »Sie haben sie alle erschossen. Alle!«, sagt die alte Frau und hebt die Stimme: »Weil sie Deutschland noch retten wollten!«
Sie deutet runter ins Tal. Dort unten auf dem Friedhof liegen sie jetzt alle, in einem Heldengrab. Von den eigenen Leuten erschossen. Nie wieder in ihrem Leben habe sie so viele Tote gesehen wie in diesem Krieg. Wir schauen zusammen auf die Silhouette der Vogesen in der Ferne, der höchste Berg ganz links, das muss der Grand Ballon sein, der Große Belchen. Über uns, im Kastanienbaum, zwitschern die Vögel.
»Aber das Allerschlimmste in meinem Leben, das war der Tod von Bernhard«, beginnt sie dann auf einmal zu erzählen, »meinem jüngsten Kind.« Sie beugt sich ein bisschen zur Seite, um den Hund zu streicheln, der immer noch neben ihr liegt. Das Weitersprechen fällt ihr ganz offensichtlich schwer. »In der Bibel steht: Du sollst nicht töten«, fährt sie fort. »Auch sich selbst darf man nicht töten. Aber genau das hat mein Junge getan.« Nur 15 Jahre alt sei er geworden: »Wir fanden ihn in der Scheune, er hat sich erhängt. Und weißt du, wann?« Sie sagt es mit gebrochener Stimme, es klingt fast wie ein Wimmern: »Am Heiligen Abend! Ausgerechnet am Heiligen Abend, stell dir das nur vor!«
Das Gezwitscher der Vögel scheint auf einmal leiser geworden zu sein.
»Das habe ich bis heute nicht überwunden. Jedes Jahr kommt es zurück. Jedes andere Datum kannst du überbrücken, aber den Heiligen Abend nicht. Niemals. Nie.«
Auf einmal sorge ich mich, dass sie zusammenbrechen könnte. Wie kann ich sie nur trösten? Ich nehme ihre Hand und halte sie fest.
»Sich selbst das Leben zu nehmen ist eine Todsünde. Ich bin froh, dass der Pfarrer ihn trotzdem begraben hat.« Mathilde wiederholt die Worte, die er am Grab gesagt hat, ganz mechanisch, wie eine Schallplatte, die abgespielt wird: »Wir stehen am Grabe eines Jugendlichen und fragen uns: Warum? Wir werden keine Antwort erhalten. Fragen wir uns doch lieber: Warum schickt Gott uns das?« Fragend guckt sie mich aus ihren klaren hellblauen Augen an: »Was nur habe ich falsch gemacht? Ich muss etwas falsch gemacht haben. Warum hat Gott mir das geschickt? Warum hat der Bernhard sich das angetan?«
Hat er denn keinen Abschiedsbrief hinterlassen?
»Nein, nichts. Er war so ein fröhliches Kind.«
Wir beobachten, wie ein Auto die kurvige Straße durch die Wiesenhänge nach oben kommt. Es ist eine Ente, hellblau und mit offenem Verdeck. Die alte Bäuerin legt die Hand über die Augen, Manchmal muss man halt weiterleben. So wie man einfach weiteratmet. Automatisch.weil die Sonne sie blendet. »Man muss halt weiterleben«, sagt sie. »So wie man einfach weiteratmet. Automatisch. Um zu überleben. Aber vorbei geht der Schmerz nicht, im Gegenteil: Es wird mit jedem Jahr schlimmer. Weil man so viel darüber nachdenkt. Und nach Antworten sucht.« Ein Glück, dass sie in den Jahren nach dem Tod von Bernhard einen neuen Pfarrer gefunden hat. Einen, der ihr Halt geben konnte. »Es hat lange gedauert, aber dann hat er dafür gesorgt, dass ich mich mit Gott versöhnen konnte.«
Ich nicke. Was heute für viele Leute der Psychologe ist, und auch da findet man nicht immer sofort den richtigen, war früher der Geistliche. Wenn Mathilde diesen Lotsen nicht gefunden hätte, da bin ich mir ziemlich sicher, wäre ihr kleines Segelboot gesunken.
Die himmelblaue Ente hat den Hof erreicht und macht neben dem Auto von Urenkel Peter halt. Ein junges Pärchen steigt aus, ausgelassen und sichtlich verliebt. Hand in Hand laufen sie auf uns zu.
»Grüß Gott«, sagt der Mann und schiebt die Sonnenbrille hoch. Wir grüßen zurück. »Wir wollten uns mal erkundigen, ob man auf diesem Hof auch Hochzeit feiern kann«, meint er dann und guckt die junge Frau neben ihm ebenso zärtlich wie vielsagend an. »Wir wollen nämlich heiraten!«, verkünden sie dann beide fast gleichzeitig und müssen prustend auflachen.
»Hajoh«, sagt Mathilde. »Dann gehet Sie am besten rei und fragget Sie die Renate, die ist meine Tochter, die regelt das!«
Schmunzelnd schauen wir dem Pärchen nach, wie es hinter der schweren Eingangstür verschwindet. Ich bin erleichtert. Die beiden haben Mathilde ein bisschen auf andere Gedanken gebracht.
»Hajoh«, sagt die schon wieder und lacht in sich hinein. »Die zwei können auch aus Liebe heiraten. Dann wollen wir mal hoffen, dass es gutgeht.« Denn eine Garantie für Glück sei das ja nicht. »Viele trennen sich trotzdem ganz schnell wieder, das ist heute halt so.« Weil ihnen am anderen auf einmal etwas nicht mehr passe. Oder weil sie einen anderen gefunden haben, von dem sie glauben, dass er besser ist. Ob er es aber auch tatsächlich ist? Jedenfalls gingen »die Leut’« heute viel schneller auseinander und mit mehr als nur einem Partner ins Bett. Vor allem die Frauen, ist Mathildes Eindruck.
Auf diese Stichworte habe ich gewartet. Darauf wollte ich sie schon die ganze Zeit ansprechen, habe mich aber nicht getraut: Wie war das denn bei ihr selbst? Ist sie Johannes immer treu gewesen, obwohl sie ihn gar nicht liebte und unglücklich mit ihm war?
Wieder guckt sie mich kurz aus ihren hellen blauen Augen an. »Bist du etwa der Pfarrer?«, fragt sie dann zu meiner Überraschung zurück. Es gelingt nicht immer, seinen Prinzipien treu zu bleiben. Aber das heißt nicht, dass sie an Gültigkeit verlieren und wir sie über Bord werfen können.»Soll ich jetzt etwa beichten? Es ist halt einfach passiert!«
Mit einer solchen Antwort habe ich nicht gerechnet. Mathilde hatte eine Affäre, einen Lover! Ich merke, dass ich mich für sie freue. Natürlich konnte und kann sie das nur schwer mit ihrem Glauben vereinbaren, mit dem sechsten Gebot: Du sollst nicht ehebrechen. Das ist mir schon klar. Aber trotzdem freue ich mich über alle Maßen für sie: Weil da endlich jemand gewesen sein muss, der Liebe und Zärtlichkeit in ihr schweres Dasein brachte. Jemand, der vielleicht ihr Herz höherschlagen ließ, für den sie sich schön machte. Der sie streichelte und zärtlich zu ihr war, ihr Selbstwertgefühl stärkte.
»Manchmal gelingt es uns nicht, das einzuhalten, woran wir glauben. Manchmal sündigen wir und brechen die Gebote«, sagt Mathilde. »Aber das heißt noch lange nicht, dass sie an Gültigkeit verlieren und dass wir es uns leichter machen könnten.« Man muss weiterhin an sie glauben: Du sollst nicht ehebrechen, das hat schon seine Richtigkeit, findet Mathilde und stellt klar, wie sehr sie es bereut, schwach geworden zu sein.
Ich würde nur allzu gerne Näheres über ihre Affäre erfahren: War es während des Kriegs? Als der Johannes noch an der Front war? War es jemand aus dem Dorf? Oder einer der zwanzig Männer, die während des Arbeitsdienstes bei ihr einquartiert worden waren? Die alte Frau wehrt ab. Sie will nichts über ihn verraten. Nur, dass auch er verheiratet war.
Aber dieser Mann hat doch dafür gesorgt, dass sie ein paar unbeschwerte Momente erlebte und glücklich war? Endlich konnte sie erfahren, was es bedeutete, verliebt zu sein! Dass es auch schön sein konnte, mit einem Mann zu schlafen!
»Das schon«, sagt sie. »Aber ich habe es bitter bereut. Der Preis, den ich dafür bezahlt habe, war hoch.«
Preis? Hat sie eine andere Ehe zerstört? Hat der Johannes ihr eine Szene gemacht, einen fürchterlichen Streit vom Zaun gebrochen, damit gedroht, sie zu verlassen? Musste sie im Dorf Spießruten laufen, als alles herauskam?
Sie schüttelt den Kopf, wiederholt stattdessen die Worte des Pfarrers am Grab ihres Kindes, das sich selbst das Leben nahm: »Wir stehen am Grabe eines Jugendlichen und fragen uns: Warum? Wir werden keine Antwort erhalten. Fragen wir uns doch lieber: Warum schickt Gott uns das?«
Alles sei ans Licht gekommen, alles, seufzt sie: »Ich habe so büßen müssen!«
Ich verstehe immer noch nicht.
»Ja, weil ich dann doch den Bernhard bekommen habe, mein drittes Kind!«, bricht es aus ihr heraus. »Das war ja nicht vom Johannes, das war von dem anderen Mann!«
Es fehlt nicht viel, beinahe schlage ich mir die Hand vor den Mund. Ich begreife ihn sofort, diesen Abgrund an Schuldgefühlen, der sich vor Mathilde aufgetan haben musste. Was muss diese Frau gelitten haben! Sie muss einen Kern aus Stahl haben, die kleine, schmächtige uralte Bäuerin. Jetzt weiß ich auch, wie es zu diesem Getuschel im Dorf kommen konnte. Das uneheliche Kind, das war Bernhard. Ein Kern von Wahrheit, der dann völlig aus seinem Zusammenhang gerissen wurde. Sein Freitod war in dieser streng katholischen Gemeinde ein Tabu und musste schnellstens aus dem kollektiven Gedächtnis gestrichen werden. Es war nicht so, dass Mathilde froh sein musste, dass der Johannes sie damals zur Frau genommen hatte, nein, sie musste froh sein, dass er sie nicht verstoßen hatte.
Mathilde ist ohne meine Hilfe aufgestanden und bückt sich über das Blumenbeet neben der Eingangstür, um ein paar verwelkte Vergissmeinnicht herauszurupfen. Langsam richtet sie sich wieder auf. Das Leben ist wie eine Lotterie, man weiß nie, wie viele Treffer oder Nieten man zieht.Erst Jahre später sei er dahintergekommen, der Johannes. Nicht nur, dass sie diese Affäre gehabt hatte, auch dass der Bernhard nicht von ihm war. Wie und wann genau, das weiß sie nicht mehr. »Er hat mich damals dennoch nicht verlassen, das rechne ich ihm noch heute hoch an«, sagt sie, die verwelkten Blumen in der Hand. »Und ich brauchte endlich nicht mehr zu lügen. Endlich.«
Ein Lieferwagen hält auf dem Hof an, der Kies knirscht. Ein paar Arbeiter steigen aus, Stammgäste, die Mittag essen wollen. Fast gleichzeitig trifft eine Gruppe Wanderer ein, alles Rentner mit Rucksack und Wanderstock.
»Gehet Sie nur rei, gehet Sie nur rei«, sagt Mathilde. »Die Renate ist drinnen, i kom au gliech!«
Die neuen Gäste begeben sich zum Eingang und versperren dem Pärchen, das gerade herauskommen will, den Weg.
»Wir haben einen Termin gemacht!«, sagt die junge Frau strahlend, bevor sie mit ihrem zukünftigen Mann wieder in den himmelblauen 2 CV steigt. Winkend fahren die beiden ab.
Mathilde schaut ihnen nach, lange. »Ich bin oft neidisch und eifersüchtig gewesen«, gibt sie dann zu. »Auf andere Menschen. Und auf das Leben, das sie führen konnten.« Das neunte und das zehnte Gebot, die beiden hätte sie am meisten gebrochen. »Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus«, beginnt sie, ohne zu stocken, aufzusagen. »Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib, Knecht, Magd, Vieh noch alles, was dein Nächster hat.« Das sei ihre Hauptsünde gewesen: »der Neid«.
Weil manche Leute es ihr Leben lang leicht hätten, ohne es zu verdienen, und andersherum manche schwer, obwohl sie das ebenfalls nicht verdienten. Aber, so musste die alte Bäuerin erkennen: »Es gibt keine ausgleichende Gerechtigkeit, das Leben ist nicht gerecht. Es ist wie bei einer Lotterie, man weiß nie, wie viele Treffer oder Nieten man zieht.« Ich denke an den US-Film Forrest Gump, in dem die gleichnamige Hauptperson alias Tom Hanks das Leben mit einer Pralinenschachtel vergleicht, da wisse man nie, in was man beiße. Irgendwie finde ich diese Vorstellung versöhnlicher als die mit der Lotterie.
Mathilde sieht mich lächelnd an. »Die meisten Leute wollen das nicht hören, dass das Leben nicht gerecht ist, ich weiß«, sagt sie. »Aber je schneller man es erkennt, desto besser.«
Sie legt die verblühten Vergissmeinnicht auf die Fensterbank und setzt sich wieder neben mich, gefolgt von Bruno. Liebevoll tätschelt sie ihm den Kopf. Ihr Leben lang hat sie Hunde gehabt, sie kann sich gar nicht vorstellen, ohne zu sein. »Wenn sie alt und krank wurden, habe ich sie aus ihrem Leiden erlöst.« Bei Tieren dürfe man das ja. »Eigentlich müsste man auch Menschen erlösen dürfen«, findet sie. Aber das sei ausgeschlossen: »Du sollst nicht töten. Manchmal hat man als Mensch unerfüllbare Wünsche.« Auch damit müsse man sich abfinden. Zum Glück habe der Johannes einen guten Tod gehabt: Er ist mit Lungenproblemen aus dem Auch wenn einem Schlimmes widerfährt – das Leben bleibt ein Geschenk.Krieg zurückgekommen und daran auch gestorben, »aber erst 1990 und ganz sanft, im Schlaf«. Angst vor ihrem eigenen Tod hat sie nicht: »Wenn er kommt, ist er da. Wenn der liebe Gott mich holen will, holt er mich.« Was dann genau passieren wird, weiß sie nicht: »Es ist ja noch keiner zurückgekommen, um es zu erzählen.« Über ihr Begräbnis hat sie sich noch keine Gedanken gemacht, eigentlich ist ihr das auch egal: »Wenn ich die Augen zugemacht habe, können sie mit mir machen, was sie wollen.«
Wenn es so weit ist, frage ich, wie blickt sie dann auf ihr Leben zurück?
Die Antwort ist kurz und bündig: »Ich hoffe, dass ich das Beste daraus gemacht habe.«
Sie sieht meinen Blick, merkt, dass ich protestieren will. Das Beste daraus machen – das klingt so abschätzig, so abwertend! Wie oft sagt man das ganz beiläufig: Ach ja, wir haben das Beste daraus gemacht. Aus einem verregneten Urlaub, aus einem Missgeschick, einer Fehlanschaffung …
»Ja, ich habe immer versucht, das Beste daraus zu machen«, sagt Mathilde. »Jeden Tag.«
Ich muss die Worte von der Negativkonnotation, die sie bekommen haben, befreien. Erst dann verstehe ich, was sie meint. Erkenne, wie anspruchsvoll das Lebensmotto, das sich dahinter verbirgt, eigentlich ist: das Beste daraus machen. Aus einem jeden Tag. Aus einem ganzen Leben.
Was wäre, wenn wir uns ganz bewusst vornehmen würden, das Beste aus unserem Leben zu machen? Jeden Tag aufs Neue? Anstatt einfach nur zu leben? Es macht einen Unterschied, stelle ich fest, einen gewaltigen Unterschied.
Ihr Leben sei nicht leicht gewesen, viel Schlimmes habe sie mitmachen müssen. »Aber trotzdem«, höre ich sie zu meiner Überraschung sagen, »ist es ein Geschenk, das Leben.« Aber man brauche Mut, es zu leben: »Ich bitte den lieben Gott immer noch jeden Tag um diesen Mut. Und bislang hat er mich erhört, es gibt mich ja noch.«
Aus dem offenen Fenster der Gaststube dringt das Gelächter der Wanderer zu uns nach draußen. Sie amüsieren sich ganz offensichtlich prächtig mit den Arbeitern, wir hören das Klirren von Biergläsern.
»Ich muss jetzt gleich reingehen«, kündigt Mathilde an. Ich nicke.
Sie legt die Hände in den Schoß. Es sei ja nicht so, dass sie nie zufrieden gewesen ist in ihrem Leben, meint sie dann. Manchmal war sie sogar glücklich: »Man darf das Glück nicht nur im Großen suchen«, Pass auf, dass du das Glück nicht übersiehst – es liegt oft im Kleinen, nicht im Großen.





























