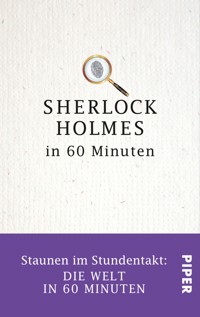9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Berlin in den frühen 1920er Jahren: Eine offenbar verwirrte junge Frau wird vom Exilrussen Tarnawski in einen Unfall verwickelt. Sie trägt ein Medaillon, das einst der Zarentochter Anastasia gehörte, hat keine Papiere bei sich und stammelt nur unzusammenhängende Satzbrocken – auf Russisch. Wer ist diese Frau? Ist sie wirklich die Zarentochter oder nur eine Hochstaplerin? Zwei Jahre zuvor erhält der Luftschiffkapitän Rochus Dorn den Auftrag, die russische Zarenfamilie aus der Gefangenschaft der Roten Armee zu befreien. In geheimer Mission begibt er sich mit dem Luftschiff »Adler« auf ein gefährliches Abenteuer, das zu einem dramatischen Kampf um Leben und Tod wird. Jörg Kastners Trilogie »1918 – Geheimakte Romanow« ist erstmals als Sammelband erhältlich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 591
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Jörg Kastner
1918 – Geheimakte Romanow
Band 1:Das Haus der Verbannten
Roman
Wieder einmal für Corinna, wieder einmal mit Dank, diesmal für besonders viel Geduld.
Ach, lieber Onkel Zeppelin, Ach, lass dich doch erbitten, Komm über unsre Gegend hin Mal durch die Luft geglitten! So recht mit surrendem Gebraus Und mit Propellerkrachen! Du solltest über unserm Haus Mal eine Schleife machen!
Aus einem Kinderlied, abgedruckt im »Berliner Lokalanzeiger« (1909)
Wie man den Krieg führt, das weiß jedermann, wie man den Frieden führt, das weiß kein Mensch. Ihr habt stehende Heere für den Krieg, die jährlich viele Milliarden kosten. Wo habt Ihr Eure stehenden Heere für den Frieden, die keinen einzigen Para kosten, sondern Milliarden erbringen würden? Wo sind Eure Friedensfestungen, Eure Friedensmarschälle, Eure Friedensstrategen, Eure Friedensoffiziere?
Aus Karl May, »Ardistan und Dschinnistan Band 1« (1907)
Prolog
Berlin, im Dezember 1922
Andrej Tarnawski musste gegen die Müdigkeit kämpfen, so gleichmäßig floss der Strom aus Automobilen und Omnibussen über die Leipziger Straße. Kein einziges rotes Haltezeichen weit und breit. Der Verkehr rollte mit einheitlicher Geschwindigkeit dahin und jeder Fahrer hielt brav das vorgegebene Tempo ein. Mit deutscher Gründlichkeit, konnte man sagen. Tarnawskis ermatteter Geist wurde von einem kleinen, privaten Heiterkeitsausbruch belebt. Er musste über die Deutschen lächeln und gleichzeitig konnte er nicht anders, als sie zu bewundern. Warum sonst hätte er seine neue Existenz ausgerechnet in Berlin aufgebaut und nicht in London oder Paris?
Vor vier Jahren erst hatte Deutschland den Großen Krieg verloren, den Weltkrieg. Ein Reich war in die Knie gegangen und der einst so stolze Kaiser Wilhelm II. lebte jetzt zurückgezogen auf einem Schloss in Holland, wo er angeblich privaten wissenschaftlichen Forschungen nachging. Aber Deutschland war nicht tot, es lebte, und sein Herz, Berlin, pochte wie wild. Die Einwohnerzahl der Hauptstadt schritt zügig auf die Vier-Millionen-Marke zu, große Ausstellungen lockten Besucher aus aller Welt an, fast wöchentlich öffneten neue Revuetheater und Vergnügungsparks ihre Tore, und der Automobilverkehr war derart angewachsen, dass der Straßenbau Hochkonjunktur hatte. Manchmal erschienen die Deutschen ihm als ein Volk von Ameisen, emsig bestrebt, ihre Arbeitsmethoden noch effektiver zu gestalten und bessere Straßen zu bauen, um schneller zu Arbeit zu gelangen. Selbst die Theater und Vergnügungsstätten schienen in Deutschland nur dem Zweck zu dienen, die Arbeitskraft der menschlichen Ameisen zu erhalten. Doch eins musste man den Deutschen lassen: Sie hatten sich nach dem verlorenen Krieg und den Revolutionswirren schnell wieder aufgerappelt!
Tarnawski war letztlich auch nur eine dieser Ameisen. Eine reichlich müde Ameise, die am letzten Abend zu lange bei Fürst Nikulin gewesen war, zu viele Trinksprüche ausgebracht und zu viel Champagner getrunken hatte. Er merkte, wie seine Aufmerksamkeit nachließ und dass es ihm im öden Gleichfluss des Straßenverkehrs zunehmend schwerer fiel, das Lenkrad des Citroën C gerade zu halten. Vielleicht lag es an seiner Müdigkeit, dass er die Frau zu spät sah. Wie ein Geist tauchte sie plötzlich vor seiner Motorhaube auf und starrte ihn an. War sie genauso erschrocken wie er, oder warum traf sie keine Anstalten, sich durch einen Sprung von der Fahrbahn in Sicherheit zu bringen? Von einem Augenblick zum anderen war Tarnawski hellwach und bremste, aber er wusste, dass es zu spät war. Als sein Wagen zum Stehen kam, war die Frau so unwirklich schnell verschwunden, wie sie eben aufgetaucht war. Als hätte es sie nie gegeben. Aber der kaum merkliche Aufprall, den er beim Anhalten gespürt hatte, zeigte ihm, dass die Frau kein Trugbild seines übernächtigten Geistes gewesen war.
Tarnawski sprang auf die Straße und achtete nicht auf den wuchtigen Pritschenwagen, der mit wütendem Gehupe nur einen Fingerbreit hinter dem Citroën anhielt. Tarnawski lief nach vorn, wo sich erste Neugierige einfanden. Wie gebannt starrten sie auf die Frau in dem schäbigen Mantel, die vor Tarnawskis Wagen lag. Er war der Einzige, der sich zu ihr niederbeugte, nach ihrem Puls- und Herzschlag fühlte.
»Was ist denn?«, rief eine korpulente Frau neben ihm. »Ist sie tot?«
»Zum Glück nicht«, antwortete Tarnawski. »Ich glaube, der Aufprall war nicht sehr stark. Sie scheint mehr vom Schreck ohnmächtig zu sein.«
»Man muss einen Krankenwagen rufen«, schlug ein Mann in schmutziger Arbeiterkleidung vor.
»Nicht nötig«, erwiderte Tarnawski. »Gleich um die Ecke wohnt ein guter Arzt, ein Freund von mir. Ich wollte gerade zu ihm. Mir müsste nur jemand helfen, die Frau in den Wagen zu setzen.«
»Mach ich doch«, sagte der Mann in der Arbeiterkleidung und stapfte durch den Schneematsch auf die Straße.
Die Frau war ungewöhnlich leicht. Tarnawski, der groß und von kräftiger Statur war, hätte der Hilfe des Fabrikarbeiters vielleicht gar nicht bedurft. Aber so ging es schneller und nach zwei Minuten setzte Tarnawski die unterbrochene Fahrt fort. Mit ihm setzte sich auch die endlose Blechschlange in Bewegung, die sich hinter dem Citroën gebildet hatte.
Tarnawski parkte auf dem Hinterhof des großen dunklen Hauses, in dessen zweitem Stockwerk Iossif Nasarew wohnte und praktizierte. Vielleicht war Nasarew derjenige von all den vielen Exilrussen, die es seit dem Sturz der Romanows nach Berlin verschlagen hatte, für den sich am wenigsten geändert hatte. Nasarew hatte in Petersburg – oder Petrograd, wie es seit dem Krieg hieß – eine florierende Praxis geführt, deren Patientenstamm sich vornehmlich aus Aristokraten und Großkaufleuten zusammengesetzt hatte. Und genauso war es für Nasarew in Berlin weitergegangen. Ein paar seiner Patienten, die er aus Petersburg mitgebracht hatte, waren inzwischen allerdings weit weniger betucht. Aber Nasarew verdiente genug, um ihnen einen »unbegrenzten Kredit« zu gewähren, wie Nasarew es höflich nannte. Natürlich wusste er, dass die verarmten Adligen wohl niemals genügend Geld aufbringen würden, um ihn zu bezahlen. Aber sie waren eine verschworene Gemeinschaft und träumten unverdrossen vom Wiedererstarken der Monarchie, von einem neuen Zaren, der die alte Ordnung wiederherstellte und den entrechteten und enteigneten Exilanten wieder zu Einfluss und Geld verhalf. Andrej Tarnawski hatte beschlossen, sich nicht auf Wunschträume zu verlassen, und seinen alten Beruf als Großmaschinenhändler wieder aufgenommen. Industrie und Technik machten rasende Fortschritte und Tarnawski hatte es innerhalb weniger Jahre dank der starken Nachfrage nach Motoren zu neuem Wohlstand gebracht.
Die Frau hing reglos und mit geschlossenen Augen auf dem Beifahrersitz. Der Kopf war zur Seite gerutscht und ihm fiel ihr bleiches, ausgemergeltes Gesicht auf. Tiefe Ringe hatten sich unter den Augen eingegraben. Eine Strähne des ungepflegten, fettigen Haares fiel in ihr Gesicht und verdeckte, wie ein gescheiterter Gnadenakt, einen Teil davon. Vergebens versuchte Tarnawski ihr Alter zu erraten. Offenbar hatte sie es im Leben nicht gerade leicht gehabt. Sie mochte Anfang zwanzig sein oder gut und gern fünfzehn Jahre älter. Er konnte es einfach nicht sagen.
Sie war wirklich leicht und er trug sie auf den Armen wie ein Kind. Eine ältere Dame mit viel zu großem und viel zu buntem Hut kam ihm im Treppenhaus entgegen und starrte ihn an, als sei er Jack the Ripper. Tarnawski kümmerte sich nicht um sie, sondern steuerte den separaten Zugang zu Nasarews Praxis an. Am Empfang saß die hübsche, blonde Tamara und wollte gerade eine freundliche Begrüßung flöten, da fiel ihr Blick auf die bewusstlose Frau.
»Ein Verkehrsunfall«, erklärte Tarnawski, bevor sie auch nur zu einer Frage ansetzen konnte. »Bitten Sie Dr. Nasarew, dass er sich sofort um die Frau kümmert!«
Tamara sprang auf, eilte in den angrenzenden Raum und drei Minuten später lag die Bewusstlose auf einem Behandlungstisch. Tarnawski ging vor der Tür auf und ab und merkte irgendwann, dass seine Handflächen feucht waren. Er hatte keine äußeren Verletzungen erkennen können. Aber was, wenn die Frau schwere innere Verletzungen hatte, wenn sie starb? Verloren Kinder ihre Mutter, ein Mann seine Frau? Er konnte sich die Unbekannte nicht so recht als Ehefrau und Mutter vorstellen. Er konnte es nicht begründen, aber sie wirkte nicht wie ein Mensch, der sich um andere zu kümmern hatte oder um den andere sich kümmerten. Sie hatte etwas Einsames an sich, etwas Verlorenes.
Nasarew trat unerwartet aus der Tür und schüttelte traurig den Kopf.
»Ist sie …«, fragte Tarnawski zögernd, ohne das fatale Wort auszusprechen.
»Nein.«
»Schwer verletzt?«
»Kann man nicht sagen. Du kannst sie mit dem Wagen nur leicht angeschubst haben, Andrej, sie hat kaum blaue Flecke.«
»Aber dann verstehe ich nicht, dass sie zusammengeklappt ist. Was hat sie?«
»Hunger.«
»Wie?«, fragte Tarnawski ungläubig.
»Die Frau wäre wahrscheinlich auch ohne deine automobilistische Mitwirkung zusammengebrochen. Ich vermute, sie war so schwach, dass sie sich nicht mehr halten konnte und dir vor deinen flotten Citroën gewankt ist. Kein Wunder, sie hat keinen einzigen Pfennig in der Tasche, übrigens auch keine Papiere.«
»Ist sie bei Bewusstsein?«
»Wie man’s nimmt.«
Tarnawski seufzte. »Ich glaube, alle Quacksalber lernen im ersten Semester, sich möglichst unklar auszudrücken. Ist das euer Berufsgeheimnis?«
»Sie spricht, aber sie sagt nichts Vernünftiges. Nur Dinge wie: ‚Nicht schlagen. Tut mir nichts. Ich bin nur ein Bauernmädchen.‘ Und solches Zeug.«
»Wie ein Bauernmädchen wirkt sie nicht gerade.«
»Nein«, pflichtete Nasarew ihm bei. »Schon gar nicht wie eins, das den harten Boden von unserem geliebten, fernen Mütterchen Russland beackert hat.«
»Sprich noch einmal in Rätseln zu mir und ich wechsle den Arzt!«
»Ich wollte damit nur andeuten, dass sie Russisch spricht.«
Tarnawski, das Gesicht ein einziges Fragezeichen, starrte seinen Freund an.
»Tja«, lachte Nasarew. »Wie es aussieht, hast du famoser Automobilist deinen Citroën zielsicher gegen eine von uns gelenkt.«
Tarnawski konnte es nur schwer glauben. Dieser Tag verlief ganz anders als er es geplant hatte. Ursprünglich hatte er Iossif Nasarew zu einem gepflegten Mittagessen in dem ungarischen Restaurant abholen wollen, das vorigen Monat nur ein paar Häuser weiter eröffnet hatte. Jetzt musste Tamara zur Eckkneipe gehen und ein Tablett voller belegter Brote besorgen.
Die fremde Frau blickte den Berg Stullen skeptisch an, als halte sie das Ganze für ein Täuschungsmanöver oder eine Fata Morgana. Sie wirkte auf Tarnawski wie ein Tier, dem man ein unbekanntes Fressen vorgesetzt hatte und das jetzt nicht wusste, ob man ihm etwas Gutes tun oder es vergiften wollte. Nach zwei oder drei Minuten gegenseitigen Anstarrens griff Tarnawski einfach zu und biss herzhaft in ein dick mit Blutwurst belegtes Brot. Nasarew zwinkerte ihm anerkennend zu, langte ebenfalls zu dem Tablett und kaute ein wenig übertrieben glückselig auf einem Mettwurstbrot herum. Die Frau beobachtete das Ganze noch immer vorsichtig, griff dann mit überraschender Schnelligkeit in den Brotstapel und vertilgte ihr Käsebrot mit geradezu maschineller Effizienz. Sie musste wirklich Hunger haben. Die beiden Männer schafften jeweils zwei der großen, überreich belegten Brotscheiben. Die Frau aß so viel wie sie beide zusammen.
»Hat es geschmeckt?«, fragte Tarnawski mit Blick auf die Fremde. Ganz bewusst sprach er Deutsch.
Sie nickte und antwortete auf Russisch: »Otschen choroscho!« Sekunden später fügte sie in ebenso hervorragendem Deutsch hinzu: »Sehr gut. Danke sehr.«
Nasarew lächelte sie an. »Haben Sie Schmerzen?«
»Nein, danke, keine Schmerzen.«
»Gott sei Dank!«, stieß Tarnawski erleichtert hervor. »Dann werde ich Sie nach Hause fahren.«
Sie wirkte plötzlich verwirrt. »Nach Hause?«
»Ja, zu Ihrer Wohnung. Oder wohin Sie möchten. Das bin ich Ihnen wohl schuldig. Und es macht mir keine Mühe. Nennen Sie mir einfach die Adresse!«
»Die Adresse? Welche?«
»Na, dort, wo Sie wohnen.«
Erst nickte sie verständnisvoll, aber plötzlich schüttelte sie den Kopf und blickte die Wand hinter Tarnawski und Nasarew an. Mit leiser, monotoner Stimme erklärte sie: »Ich wohne nirgends.«
Obdachlos also. Das erklärte ihre heruntergekommene Erscheinung, das Fehlen von Geld, ihren Hunger.
Nasarew sah Tarnawski an und sagte leise: »Zwei Querstraßen weiter gibt es ein Obdachlosenheim, ganz in Ordnung. Ich weiß das, weil ich einmal die Woche dort den Samariter spiele und für die Heimbewohner eine kostenlose Sprechstunde abhalte.«
Tarnawski grinste breit. »Bist du katholisch geworden, dass du so auf deine Seligsprechung hinarbeitest?«
Nasarew zuckte mit den Schultern. »Heute Nachmittag muss ich wieder hin. Ich nehme unsere Patientin einfach mit.«
»Kommt nicht infrage!«, beschied ihn Tarnawski. »Sie scheint eine von uns zu sein. Mein Haus ist sehr groß und sehr leer. Ich nehme sie mit zu mir.«
Jetzt grinste Nasarew: »Wer ist hier wohl katholisch?«
Tarnawski ignorierte ihn und wandte sich der Frau zu. »Kommen Sie aus Russland? Wie heißen Sie?«
Er erhielt keine Antwort.
*
Sie aß. Sie wusch sich. Sie zog die neuen Kleider an, die Tarnawski ihr besorgt hatte. Und sie unternahm, wenn er sie dazu aufforderte, mit ihm Spaziergänge im großen Garten seiner Villa in Reinickendorf. Aber sie sprach kaum. Wenn sie den Mund öffnete, waren es meistens nur wenige Silben wie »Guten Morgen«, »Danke« oder »Ich bin satt.«
Tarnawski sprach sie mal auf Deutsch und dann wieder auf Russisch an und immer antwortete sie in der jeweiligen Sprache. Versuchsweise probierte er es mit Französisch und Englisch und auch diese Sprachen beherrschte sie. Sie mochte ohne Obdach sein, regelrecht auf den Hund gekommen, aber sie stammte nicht aus der unteren Schicht, nicht aus ungebildeten Kreisen.
Und sie war schön. Trotz der tiefen Linien, die das Schicksal ihr ins Gesicht geschnitten hatte. Sauber und mit gewaschenen Haaren, in guten Kleidern, wirkte sie ganz anders als in dem schmutzbesudelten alten Mantel, den sie bei ihrer ersten Begegnung getragen hatte. Sie strahlte eine natürliche Schönheit aus und ihr Gesicht hatte etwas Feines, fast Aristokratisches. Auch ihre Haltung und ihre Manieren waren tadellos und eins stand für Tarnawski sehr schnell fest: Sie war kein Bauernmädchen, weder ein russisches noch ein deutsches. Nur etwas wusste er nicht und manchmal glaubte er, es niemals in Erfahrung zu bringen: Wer sie war.
Sie antwortete auf Fragen nach ihrer Identität einfach nicht. Sie äußerte sich noch nicht einmal zu der Frage, ob sie es nicht wusste oder nur nicht sagen wollte. Tarnawski fragte sich immer wieder, ob sie sich nicht erinnern konnte oder ob sie es einfach nicht preisgeben wollte. Er wusste es nicht. Nur eins stand fest: Die Frau war von einem großen Geheimnis umgeben.
Am dritten Abend nach dem Vorfall auf der Leipziger Straße waren turnusmäßig die Freunde Russlands bei ihm zu Gast. So nannte sich der Kreis der Exilrussen um Fürst Nikulin, der sich anfänglich zusammengefunden hatte, um über Möglichkeiten zur Wiederbelebung der russischen Monarchie zu diskutieren. Über die Jahre war daraus mehr eine fröhliche Herrenrunde geworden, die in Erinnerungen an jene Zeit schwelgte, die immer erst im Rückblick zur sogenannten guten alten verklärt wird. Nur Fürst Nikulin, der in seinem früheren Leben Militärberater des Zaren gewesen war, schien das nicht wahrzunehmen. Unverwüstlich hielt er flammende Reden wider den roten Terror und Lobpreisungen auf eine Zarenherrschaft, die niemand sonst unter den Freunden Russlands in so uneingeschränkt guter Erinnerung hatte wie er.
Iossif Nasarew traf eine halbe Stunde vor der Zeit ein, um die namenlose Fremde zu untersuchen. Die Untersuchung fiel zu seiner größten Zufriedenheit aus und er sagte zu Tarnawski, dass sein Logiergast sich rundum wohlfühle.
»Hat sie dir das gesagt, Iossif?«
»Hm, nicht so direkt. Aber meine Untersuchung hat es ergeben. Du sorgst wirklich gut für sie.«
»Was hat sie dir denn gesagt?«, bohrte Tarnawski weiter.
»Eigentlich gar nichts, wenn ich so darüber nachdenke.«
»Dachte ich mir.«
Nasarew warf dem Freund einen misstrauischen Blick zu. »Du scheinst beinah erleichtert, Andrej.«
»Das bin ich auch. Mir gegenüber hält sie sich nämlich sehr bedeckt. Ich wäre schwer erschüttert, wenn du in fünfzehn Minuten mehr aus ihr herausbekommen hättest als ich in drei Tagen.«
»Immerhin bin ich ihr Arzt!«, sagte Nasarew mit übertriebenem, weil nur gespieltem, Ernst.
Ein Mann trat ein und fragte: »Um wen geht es? Um Ihren Hausgast, Andrej Alexandrowitsch?«
Im Eingang des Salons stand die hochgewachsene, hagere Gestalt des Fürsten Nikulin. Sein längliches, asketisches Gesicht, gekrönt von einer hohen Stirn und einem schlohweißen Haarschopf, ließen ihn im Verein mit der leicht vorgebeugten Körperhaltung wie einen Raubvogel auf der Suche nach Beute wirken.
»Sie scheinen bestens informiert zu sein, Fürst«, erwiderte Tarnawski und warf Nasarew einen säuerlichen Blick zu. Da Fürst Nikulin die Neuigkeit nicht von Tarnawski hatte, kam nur der Arzt infrage.
»Ich glaube, meine Sekretärin Tamara geht seit ein paar Wochen mit dem Kammerdiener des Fürsten aus«, sagte Nasarew mit einer entschuldigenden Geste.
Nikulin lächelte vielsagend und trat näher. »Was ist das für eine Geschichte mit dieser halb verhungerten Frau?«
Tarnawski teilte ihm in knappen Worten die Fakten mit.
»Das klingt ja nach einem Hintertreppenroman dieser Courths-Mahler, wie unsere Dienstmädchen sie verschlingen«, kommentierte der Fürst die Geschichte. »Und sie spricht wirklich perfekt Russisch?«
»Ebenso gut wie Deutsch«, antwortete Tarnawski.
»Keine Hinweis auf ihre Identität? Kein Brief oder keine Fotografie in ihren Taschen?«
»Nichts«, bestätigte Tarnawski. »Der einzige persönliche Gegenstand in ihrem Besitz ist ein Medaillon.«
Nikulin sah ihn interessiert an. »Was für ein Medaillon?«
»Ich konnte es mir nicht näher ansehen. Sie trägt es um den Hals und hütet es wie ihren Augapfel.«
»Verstehe«, murmelte der Fürst und dachte einen Moment nach, bevor er sagte: »Andrej Alexandrowitsch, ich möchte Ihren Gast gern sehen.«
»Ich werde sie fragen.«
»Nicht fragen«, sagte Nikulin in einem Tonfall, der seine frühere Autorität am Zarenhof erahnen ließ. »Führen Sie mich einfach zu ihr!«
Widerwillig erfüllte Tarnawski ihm den Wunsch. Begleitet von Nasarew gingen sie hinauf ins Obergeschoss. Die Frau saß in ihrem Zimmer und tat das, was sie häufig tat, wenn sie allein war: Sie starrte aus dem Fenster. Ihr Blick ruhte skeptisch auf Fürst Nikulin, als die drei Männer eintraten.
Der Fürst grüßte sie knapp und höflich und betrachtete sie eine ganze Weile. Schließlich sagte er auf Russisch: »Unser gemeinsamer Freund Andrej hat mir von Ihrem schönen Medaillon erzählt. Dürfte ich es mir einmal ansehen?«
»Warum?«, fragte sie nur, ebenfalls auf Russisch.
»Ich interessiere mich für solche Kostbarkeiten. Falls mir das Medaillon gefällt, würde ich es Ihnen zu seinem sehr guten Preis abkaufen.«
»Es ist nicht zu verkaufen.«
»Weshalb denn nicht?«, erkundigte sich Nikulin.
»Es ist nicht zu verkaufen«, wiederholte die Frau monoton.
»Darf ich es mir trotzdem einmal ansehen?«
»Nein.«
Nikulin wandte sich an seine Begleiter: »Halten Sie die Dame bitte fest!«
Tarnawski zögerte. Es widerstrebte ihm, der Anweisung Folge zu leisten. Ein sehr dünnes Band des Vertrauens begann zwischen ihm und der Unbekannten zu entstehen. Ein Band, das er nicht durch eine unbedachte Handlung zerreißen wollte. Aber Fürst Nikulin war eine Autoritätsperson unter den Exilrussen. Ihm zu widersprechen war fast so, als hätte man sich im Russland der Romanows einem Befehl des Zaren widersetzt. Widerwillig gehorchte Tarnawski und hielt einen Arm der Frau fest, während Nasarew nach dem anderen griff. Als Tarnawski in das Gesicht der Frau sah, bereute er seine Handlung. Dort stand die nackte Angst geschrieben, eine Panik, die in keinem Verhältnis zu dem tatsächlichen Vorgang stand. Ihm wurde klar, dass die Frau Schlimmes erlebt hatte, schreckliche Dinge, die sie für ihr Leben gezeichnet hatten.
Trotz der Panik verhielt sie sich still, als Nikulin vortrat, den Kragen ihrer Bluse öffnete und das Medaillon hervorzog. Vielleicht war es auch gerade wegen dieser Angst, überlegte Tarnawski. Möglicherweise hatte die Frau gelernt, sich ruhig zu verhalten, wenn sie überleben wollte.
Das Medaillon hing an einer Lederschnur, was unpassend wirkte. Vermutlich war die ursprüngliche Kette gerissen. Es bestand aus einem silbernen Oval, in das ein russisches Kreuzzeichen mit zwei Querbalken und einem schräg gestellten Fußbalken eingelassen war. Nikulin betrachtete das Amulett eingehend von beiden Seiten.
Dann trat er zurück, ging vor der Frau auf die Knie, senkte das Haupt und sagte: »Kaiserliche Hoheit, bitte vergeben Sie mir, wenn ich Ihnen zu nahe getreten bin!«
*
»Anastasia?«, stöhnte Graf Selinski. »Nicht schon wieder, bitte!«
Der korpulente Adlige hatte offenbar beschlossen, den ungläubigen Thomas zu geben, als die Freunde Russlands beisammensaßen und über die Frau diskutierten, die ein Stockwerk über ihnen allein in ihrem Zimmer saß und laut Fürst Nikulin niemand anderes war als die Großfürstin Anastasia Nikolajewna, die Tochter des letzten Zaren Nikolaus II. Seit Nikulin das Amulett betrachtet hatte, war eine halbe Stunde vergangen. Eine halbe Stunde, während der sich die Exilrussen die Köpfe heißgeredet hatten.
Nasarew versuchte, die Wogen zu glätten: »Niemand von uns hat in so engem Kontakt zu der kaiserlichen Familie gestanden wie Fürst Nikulin. Wenn er die Frau als Anastasia identifiziert, sollten wir das ernsthaft erwägen.«
Selinski war noch nie ein Freund Nikulins gewesen und die alte Gegnerschaft zwischen ihnen beiden mochte ein Grund für seine beharrliche Ablehnung sein. Kampfeslustig reckte er seinen fast kahlen Quadratschädel vor. »Darf ich daran erinnern, dass Fürst Nikulin schon einmal eine Frau als Großfürstin Anastasia identifiziert hat! Und zwar jenes Fräulein Unbekannt, von dem wir inzwischen alle wissen, dass sie eine mehr dreiste als geschickte Hochstaplerin ist.«
Er spielte auf jene Frau an, die Anfang 1920 versucht hatte, sich durch einen Sprung in den Landwehrkanal das Leben zu nehmen. Ein zufällig anwesender Polizist zog sie aus dem Wasser und man hatte die verwirrte junge Frau als »Fräulein Unbekannt« ins Dalldorfer Irrenhaus eingeliefert. Irgendwann war das Gerücht aufgetaucht, bei ihr handle es sich um Anastasia Romanowa, und sie hatte die wilde Geschichte ihrer Flucht vor den Bolschewiki, die ihre Familie ermordet hatten, verbreitet. Im Nachhinein erschien es Tarnawski schwierig zu sagen, wie die Frau, die sich jetzt Fräulein Tschaikowski nannte, eine so große Anhängerschar unter den Exilrussen hatte finden können. Vielleicht hing es mit dem brennenden Wunsch zusammen, eine Hoffnungsträgerin für ein Wiedererstarken der russischen Monarchie zu finden. Anfangs hatten viele Exilrussen ihr geglaubt und manche, die mit den Romanows bekannt gewesen waren, hatten sie als Anastasia identifiziert. Auch Fürst Nikulin, der seinen Fehler erst vor wenigen Wochen öffentlich zugegeben hatte. Fräulein Tschaikowski mochte einige äußere Ähnlichkeiten zur Tochter des Zaren aufweisen, aber ihr ganzes Benehmen und die Aussagen der glaubwürdigeren Zeugen entlarvten sie als Hochstaplerin. Eine beachtliche Zahl von Gefolgsleuten unterstützte Fräulein Tschaikowski jedoch weiterhin und tat jeden Einwand mit einem – oft hanebüchenen – Gegenargument ab. Zwar gab es Gerüchte, die Frau beherrsche die russische Sprache, aber sie weigerte sich standhaft, dafür einen Beweis anzutreten. Ihre Anhänger fanden das verständlich und verwiesen darauf, ihre schrecklichen Erlebnisse in Russland hätten bei ihr eine starke Abneigung gegen das Land und seine Sprache hervorgerufen.
Fürst Nikulin blickte in die Runde und richtete seinen Blick dann auf Selinski. »Ich habe mich damals geirrt und ich habe diesen Irrtum eingestanden. Diesmal aber bin ich mir meiner Sache sicher.«
»Wieso?«, fragte Selinski nur.
»Drei Gründe«, antwortete Nikulin. »Erstens spricht diese Frau da oben wirklich Russisch.«
Selinski lachte herzhaft. »Es gibt da ein paar Millionen Frauen, auf die das zutrifft, Fürst.«
Nikulin ging nicht auf den Spott ein, sondern sagte ruhig: »Zweitens habe ich mir das Medaillon der Frau, scheinbar ihr einziger persönlicher Besitz, genau angesehen. Ich habe es wiedererkannt. Genau dieses Medaillon hat die Großfürstin Anastasia getragen, als ich im Frühjahr 1914 die Ehre hatte, mit der Zarenfamilie zu speisen.«
»Ein ausgefallenes Medaillon?«, erkundigte sich Selinski.
»Es zeigt ein russisches Kreuz.«
Selinski rollte theatralisch mit den Augen. »Davon gibt es in Russland fast so viele wie russisch sprechende Frauen.«
»Aber nur sehr wenige tragen auf der Rückseite die eingravierte Signatur von Rewas Sergatschow, dem kaiserlichen Hofjuwelier. Ich habe mich damals anerkennend über das Medaillon geäußert und die Großfürstin erzählte, ihr Vater habe es bei Sergatschow für sie anfertigen lassen.«
»Das klingt schon etwas überzeugender«, gestand Selinski zu. »Was ist Grund Nummer drei?«
»Ich habe in ihre Augen gesehen, es sind Romanow-Augen!«
»Fast hätten Sie mich überzeugt, Fürst«, sagte Selinski mit einem Lächeln, das kurz davor stand, in ein abfälliges Grinsen umzuschlagen. »Fast! Aber ein Blick in die Augen ist für mich kein Argument.«
Nikulin nickte. »Ich habe mit dieser Reaktion gerechnet und verstehe sie. Nach der Schlappe mit Fräulein Tschaikowski können wir uns nicht noch einen Missgriff leisten. Sonst würden wir in der Öffentlichkeit jede Glaubwürdigkeit verlieren. Darum ersuche ich Sie, nichts über den Gast unseres Freundes Tarnawski an die Öffentlichkeit dringen zu lassen. Ich bin überzeugt, dass ich vorhin der Großfürstin Anastasia gegenüberstand. Aber das der Öffentlichkeit zu beweisen, wird schwierig sein, solange sie sich in Schweigen hüllt. Das größte Zutrauen scheint sie zu Andrej Alexandrowitsch zu haben. Ihn bitte ich deshalb, sich näher mit seinem Gast zu befassen.« Der Fürst wandte sich direkt an Tarnawski. »Mein Freund, vielleicht gelingt es Ihnen, die Großfürstin zum Sprechen zu bewegen. Sie würden der Sache Russlands damit einen unschätzbaren Dienst erweisen!«
*
Tarnawski bemühte sich, Fürst Nikulin nicht zu enttäuschen, und es fiel ihm nicht einmal schwer. Er unternahm mit der geheimnisvollen Frau Ausflüge durchs winterliche Berlin. Anfangs wirkte sie unbeteiligt, aber Schritt für Schritt taute sie auf. Sie half ihm, als er im großen Garten einen Schneemann baute, und als sie bei einem Spaziergang über die Jannowitzbrücke in eine Schneeballschlacht zwischen zwei Gruppen Kindern verwickelt wurden, machte sie mit Begeisterung mit. Er hatte das Gefühl, dass sie jeden Tag ein bisschen mehr ins normale Leben zurückfand, Vertrauen zu ihm gewann und zu sich selbst. Nicht ein einziges Mal sprach er sie auf ihren Namen oder ihr Schicksal an. Er wollte das mühsam aufgebaute Vertrauen nicht leichtsinnig zerstören, sondern erreichen, dass sie sich ihm aus freien Stücken mitteilte.
Als er sie an einem Sonntag zum Eislaufen auf dem Tegeler See einlud, sagte sie sofort zu. Aber auf der Fahrt zu dem zugefrorenen Teil des Sees, der von den Behörden freigegeben worden war, wurde sie plötzlich sehr ernst. Sie bat Tarnawski, bis zur letzten Abbiegung zurückzusetzen. Dort stand ein alter, verwitterter Wegweiser mit der Aufschrift Zu den Wichart-Werken.
»Können wir da lang fahren?«, fragte sie.
»Aber zum See geht es geradeaus.«
»Ich möchte gern zu den Wichart-Werken«, beharrte sie. Dann fiel ihr etwas ein und sie fügte hinzu: »Aber die haben sonntags wahrscheinlich geschlossen, nicht?«
»Nicht nur sonntags«, erwiderte Tarnawski. »Die Werke sind schon seit 1920 dicht. Dort wurden Luftschiffe und Flugzeuge hergestellt. Nach dem Krieg wurde Deutschland von den Siegermächten nicht nur die militärische, sondern auch die zivile Luftfahrt verboten. Das war das Aus für die Wichart-Werke.« Er seufzte. »Schade auch. Ich hatte gehofft, gute Geschäfte mit dem alten Wichart machen zu können.«
»Wohnt er noch in der Nähe?«
»Er wohnt gar nicht mehr. Wichart hat die Schließung seiner Betriebe nur wenige Wochen überlebt.«
»Oh!«
Sie war von einem Augenblick auf den anderen blass geworden.
»Warum erschreckt Sie das?«, fragte er. »Was interessiert Sie so an den Wichart-Werken?«
Statt zu antworten, sagte sie nur: »Ich will zurück. Bitte kehren Sie um!«
Das war alles, was sie an diesem Tag noch zu ihm sagte. Er brachte sie nach Hause, wo sie sofort auf ihr Zimmer ging.
Für ihn war die Sache unerklärlich. Es war längst dunkel geworden, da saß er noch immer im Salon und grübelte über den Vorfall nach. Bis Pjotr, sein Diener, ihm einen unangemeldeten Besucher ankündigte.
»Wer ist es?«, fragte Tarnawski.
»Ein Herr. Ich kenne ihn nicht.«
»Hat er dir seine Karte gegeben?«
»Nein«, sagte Pjotr kopfschüttelnd. »Er nannte nur seinen Namen: Dorn.«
Der Name kam ihm bekannt vor, aber Tarnawski konnte ihn beim besten Willen nicht einordnen. Er konnte etwas Ablenkung gut vertragen und sagte darum: »Also gut, Pjotr, führen Sie Herrn Dorn herein!«
In dem Augenblick, als der Besucher über die Türschwelle trat, wusste Tarnawski, wen er vor sich hatte. Der schlanke Mann mit dem ernsten Gesicht war, obwohl Deutscher, eine Zeit lang häufig in den Kreisen der Exilrussen zu Gast gewesen. Er hatte im Krieg an einer Geheimmission in Russland teilgenommen und dabei angeblich die Großfürstin Anastasia getroffen. Deshalb galt er als ein Experte in Fragen der Identifizierung von Romanow-Prätendentinnen. Als er aber die Frau aus dem Landwehrkanal rundweg zur Betrügerin erklärte, fühlte sich ihre damals noch im Glauben unerschütterliche Anhängerschar von Dorn enttäuscht und wandte ihm den Rücken zu. Er war so plötzlich aus den russischen Kreisen verschwunden, wie er aufgetaucht war.
»Ich will Sie nicht weiter stören, Herr Tarnawski«, sagte Dorn. »Aber wie ich höre, haben Sie wieder einmal eine Anastasia aufgetan.«
»Die Erste, die mir persönlich zugelaufen ist. Aber eigentlich sollte niemand davon wissen. Wir wollten uns erst vergewissern, Herr Dorn.«
Dorn lächelte verlegen. »Einer der Freunde Russlands ist auch mein Freund.«
»Wer?«
»Ich bin kein Schwätzer. Das Geheimnis unseres gemeinsamen Freundes ist bei mir ebenso sicher wie das Ihres Gastes, Herr Tarnawski. Vielleicht kann ich Ihnen bei der Identifizierung behilflich sein.«
»Ich glaube nicht, dass mein Gast Sie sprechen möchte. Die Dame hat sich schon vor Stunden zurückgezogen.«
»Fragen wir sie doch einfach«, schlug Dorn vor.
»Meinetwegen«, sagte Tarnawski und beauftragte Pjotr, den Besucher bei der Dame anzumelden.
»Und sagen Sie ihr, mein Name ist Dorn!«, rief der Besucher dem Diener nach.
Pjotr kehrte nach zwei Minuten zurück und sagte: »Die Dame sagt, sie möchte Herrn Dorn sehr gern sprechen, aber unter vier Augen.«
Wieder brachte Dorn sein verlegenes Lächeln an, ließ es wie eine Entschuldigung wirken und sagte: »Wenn Sie gestatten, Herr Tarnawski?«
Tarnawski breitete die Hände mit den Handflächen nach oben auseinander. »Nur zu! Ich freue mich, dass sie überhaupt mit jemandem spricht.«
Für Tarnawski wurde es ein langes Warten. Erst kurz vor Mitternacht kehrte Dorn in den Salon zurück. Er wirkte auf Tarnawski seltsam erregt und erschöpft zugleich, auf jeden Fall innerlich aufgewühlt.
»Und?«, fragte Tarnawski gespannt.
»Dürfte ich vorher um etwas zu trinken bitten?«
»Entschuldigung, ich bin ein miserabler Gastgeber.«
Tarnawski bot Dorn einen Platz und einen guten Cognac an.
Dorn trank genussvoll, leckte über seine Lippen und begann zögernd: »Die Sache ist nicht ganz so einfach, wie Sie vielleicht hoffen, Herr Tarnawski. Damit Sie es richtig verstehen, müsste ich Ihnen eine längere Geschichte erzählen.«
»Es ist zwar spät, aber schlafen kann ich jetzt doch nicht.«
»Also gut«, sagte Dorn, lehnte sich im Sessel zurück und schlug die Beine übereinander. »Die Geschichte beginnt im Sommer 1914 am Tegeler See …«
Kapitel 1
Am Himmel über Berlin (1914)
Die Sonne hing wie ein leuchtender Lampion im wolkenlosen blauen Firmament und ihre wärmenden Strahlen erschienen Rochus Dorn wie ausgestreckte Arme, die das aufsteigende Schiff willkommen hießen. Die Meteorologen hatten recht behalten. Die Jungfernfahrt von WL 7 schien ein voller Erfolg zu werden. Dorn jedenfalls wollte dazu alles in seiner Macht Stehende tun. Petrus spielte mit und der Start war reibungslos verlaufen, eigentlich hätte er vollauf zufrieden sein können. Aber das ungute Gefühl, das ihn beim Betreten der Führergondel befallen hatte, ließ ihn nicht los. Es war eine Vorahnung, die er nicht näher in Worte fassen konnte. Das unbestimmte Gefühl, dass dieser 28. Juni des Jahres 1914 sein strahlendes Antlitz ausnutzte, um dahinter eine böse Überraschung zu verbergen. Eine tödliche Überraschung vielleicht – so wie vor drei Jahren.
»Was hast du, Junge?«, riss ihn Pitt Lütters Bassstimme aus den Gedanken. »Du ziehst ein Gesicht, als hättest du gleich ein halbes Dutzend Schlechtwetterfronten vor uns gesehen. Dabei haben wir reinstes Kaiserwetter!«
»Es ist nicht das Wetter«, sagte Dorn zu seinem Höhensteuermann. »Ich musste nur gerade an etwas denken.«
»Ich weiß schon, an was.« Lütters buschige Brauen zogen sich zusammen und der robuste Mann sah aus wie ein griesgrämiger alter Bär. »Jetzt ist der denkbar ungünstigste Augenblick dafür. Denk lieber daran, dass dein Vater heute stolz auf dich wäre. Und die feinen Herrschaften da unten sollten wir auch nicht enttäuschen. Fräulein Lisette drückt dir ganz fest die Daumen und nachher, wenn wir wieder unten sind, sicher einen dicken Kuss auf die Wange, du Glückspilz!«
Pitt nahm eine seiner Bärenpranken vom Höhensteuerrad und deutete nach unten, wo die zusammengeströmte Menge kleiner und kleiner wurde und eher einem Ameisenhaufen ähnelte als fein herausgeputzten Offizieren, Industriellen, Grafen, Baronen und ihren Damen. Unter WL 7 blinkte der Tegeler See silbrig blau und das Weiß der zahlreichen Segelboote tanzte, wie von freudiger Erregung erfüllt, auf dem Wasser. Bestimmt waren sämtliche Köpfe in diesem Augenblick nach oben gerichtet, um sich die Sensation des Tages nicht entgehen zu lassen.
Dorn gab sich einen Ruck und beschloss, das Heer der Schaulustigen nicht zu enttäuschen. Er rief Pitt und dessen Kollegen am Seitensteuer, dem blassgesichtigen Ferchmann, seine Anweisungen zu und griff gleichzeitig nach rechts, um den Maschinentelegrafen auf Volle Fahrt zu stellen. Das Luftschiff stieg höher und ging, während es an Fahrt gewann, auf Südostkurs, hielt auf die große Metropole Berlin zu. Ganz so, wie Dorn es mit Gottfried Wichart zur Linden, dem Gründer und Leiter der Wichart-zur-Linden-Luftfahrtreederei, abgesprochen hatte. Für die Menschen am Boden musste es ein prächtiges Bild sein, wie der riesenhafte, silbrig glänzende Zylinder schneller wurde und, das leuchtende Blau des Himmels durchschneidend, mit einem eleganten Schwenk Kurs auf Berlin nahm.
WL 7 war der Prototyp eines neuen Luftschiffs, das Wichart zur Linden in Serie gehen lassen wollte, um dem alten Grafen Zeppelin endlich den Rang als führender Luftschiffhersteller Deutschlands und damit der ganzen Welt abzulaufen. Wicharts neue Konstruktion, an der die Ingenieure mehr als drei Jahre gearbeitet hatten, war beeindruckende 164 Meter lang, durchmaß neunzehn Meter und hatte ein Volumen von 32.000 Kubikmetern. Ein wahres Ungeheuer aus Aluminium, Sperrholz, Leinen und vor allem Wasserstoff, mit dem die achtzehn Gaszellen prall gefüllt waren. Eins der größten Luftschiffe, die es auf der Welt gab, und – wenn es nach Wichart zur Linden ging – bald das berühmteste von allen.
Ein Fensterblick nach unten zeigte Dorn, dass der Tegeler See längst hinter ihnen lag, zu einem Tümpel geschrumpft, die Havel nicht mehr als ein schimmernder Strich. Und noch immer stieg WL 7, schoben die mächtigen Propeller der vier Maybach-Motoren den Prototyp auf das Häusermeer Berlins zu. Das weite Grün mit dem blauen Tupfer da unten war die Jungfernheide mit dem Plötzensee.
Dorn erinnerte sich an Sommertage, die er nicht in der Führergondel eines Luftschiffs verbracht hatte, sondern mit Lisette. Beim Picknick im Grünen oder in der Badeanstalt. Bilder von einem plötzlichen Sommergewitter tauchten vor seinem geistigen Auge auf. Lisette und er packten eilig ihren Picknickkorb zusammen und liefen zu der Stelle am Waldrand, wo Dorn seinen Mercedes-Simplex geparkt hatte. Das Gewitter war schneller. Als Dorn und Lisette den Wagen erreichten, war alles nass, der Picknickkorb, der Simplex und sie selbst. Dorn klappte das Verdeck über den Wagen und Lisette, aber es war nicht mehr als eine ritterliche Geste. Eher ein trotziger als ein tauglicher Versuch, die Nässe abzuhalten. Er kam sich dabei fast komisch vor und als er in den Wagen stieg, sah er, dass auch Lisette erheitert war und von einem Ohr zum anderen grinste. Ihre Blicke trafen sich, tauchten tief ineinander ein – und dann lachten sie beide so laut, dass der Donner des schweren Gewitters vergessen war. Noch bevor Dorn Lisette in die Arme nahm und ihr den ersten Kuss gab, wusste er, dass er die Frau fürs Leben gefunden hatte.
»Da unten steht ja ’ne ganze Kompanie von weißen Gestalten und winkt, sieht aus wie Schneemänner auf Urlaub.«
Wieder war es Lütter, der seinen Kommandanten in die Realität zurückholte. Dorn erkannte ein großes, weitverzweigtes Gebäude inmitten einer Parkanlage.
»Die Ärzte und Schwestern vom Virchow-Krankenhaus«, sagte er. »Von hier oben sehe ich sie lieber als aus der Nähe.«
Lütter wieherte wie ein Brauereigaul. »Da haste recht.«
WL 7 folgte dem Kanal zum Nordhafen und fuhr dann über den Exerzierplatz Richtung Stadtzentrum. Dorn gab Lütter den Befehl, tiefer zu gehen.
»Desto besser sieht man uns, schließlich soll unsere Jungfernfahrt Aufsehen erregen.«
Der Prototyp verlor langsam an Höhe und Berlin wuchs unter ihm zu einem steinernen Labyrinth. Je tiefer WL 7 sank, desto mehr schwand die Übersichtlichkeit der Straßenzüge, die aus großer Höhe wie die Boulevards einer Spielzeugstadt gewirkt hatten. Aus Ameisen wurden – wenn auch winzig kleine – Menschen. Immer mehr von ihnen bemerkten den über ihnen schwebenden Giganten, blieben mit in den Nacken gelegten Köpfen stehen, winkten, riefen vielleicht auch etwas. Pferdedroschken und Automobile hielten an, weil die Insassen sich das Schauspiel nicht entgehen lassen wollten. Unter den Linden kam es zu einem regelrechten Volksauflauf. Omnibusse und Straßenbahnen mussten anhalten, weil es kein Durchkommen gab. Die Passagiere drängten auf die Straße und schlossen sich der winkenden Menge an.
Der Jubel ließ Dorns Herz leicht werden. Mit Leib und Seele hatte er sich der Luftfahrt verschrieben. Es gab für ihn kaum ein schöneres Gefühl, als sich in die Lüfte zu erheben. Hier oben fühlte er sich frei und zugleich stark, mächtig, ein bisschen vielleicht wie Gott. Er sah die Welt aus einer Perspektive, die den meisten Menschen verwehrt blieb; ähnlich musste sie sich dem Schöpfer darbieten. Und Dorn konnte sich wenden, wohin er wollte, nach Norden, Süden, Osten, Westen. Er musste keinem Straßenverlauf folgen, musste vor keiner Grenze haltmachen. Dorn glaubte fest daran, dass in der Luft die Zukunft der Menschheit lag. Irgendwann, wenn es ihr auf der Erde zu eng geworden war, würde die menschliche Rasse sich in die Lüfte erheben, als hätte jeder Einzelne von ihnen die Schwingen eines Vogels. Noch war es nur ein Traum, aber ein schöner. Dorn sah Städte auf riesigen Masten, wie gewaltige Vogelnester. Luftschiffe jeder Größe verkehrten zwischen ihnen, große Frachter und kleine Postschiffe. Die Menschen lebten in Frieden. Worum hätten sie sich auch streiten sollen? Der Himmel gehörte allen und bot so unendlich viel Platz.
WL 7 folgte der Prachtstraße Berlins in östlicher Richtung und überquerte die Museumsinsel mit ihren verschnörkelten Bauten, alle noch überragt von der Kuppel des Kaiser-Wilhelm-Doms. Dorn ließ das Schiff nach Süden einschwenken und dem Spreeverlauf bis zum Großen Müggelsee folgen. Von dort ging es in einer Linksschleife über Friedrichshagen, Münchehofe, Mahlsdorf und Biesdorf zurück zur Stadtmitte. Das Schiff verhielt sich einwandfrei und gehorchte jedem Befehl wie ein gut ausgebildeter Rekrut. Der Landsberger Chaussee folgend, kehrte WL 7 ins Herz Berlins zurück, erregte noch einmal die Aufmerksamkeit der Bevölkerung und nahm dann Kurs auf das Werksgelände der Wichart-zur-Linden-Luftfahrtreederei. Das Schiff befand sich bereits kurz vor dem Tegeler Schießplatz, als ein großer Schatten sich vor die rotgelbe Scheibe der Nachmittagssonne schob. Dorn wusste augenblicklich, dass etwas nicht stimmte. An einen großen Vogel, einen Habicht oder Bussard, konnte er nicht glauben. Der Schatten bewegte sich zu schnell und hielt zielstrebig auf das Luftschiff zu. Dorns unheilvolle Ahnung, als er vor wenigen Stunden die Führergondel betrat, war also doch keine fixe Idee gewesen.
»Was ist das?«, rief Ferchmann mit nervöser Stimme. »Warum hält dieser Vogel auf uns zu?«
Pitt Lütter gab die Antwort: »Weil der Vogel kein Vogel ist, sondern ein Flugzeug. Aber welcher Idiot kann so blind sein, uns zu übersehen?«
»Frag lieber, welche Idiotin!«, knurrte Dorn. »Wenn dir die Antwort einfällt, dann weißt du auch, dass die Maschine mit voller Absicht auf uns zuhält.«
Lütters Gesicht verwandelte sich in ein Fragezeigen. »Du meinst …«
»Ich meine, das da vorn ist ein Eindecker, sieht mir sehr nach einer Fokker-Spinne aus. Und im Moment fällt mir nur eine Person ein, die in dieser Gegend so einen Vogel fliegt.«
Es war tatsächlich ein Flugzeug und als es den Blendkreis der Sonne verließ, fand Dorn auch seine übrige Identifizierung bestätigt. Ein Fokker-Eindecker, und auch noch mit blauem Anstrich. Nein, er hatte sich nicht getäuscht.
»Der Pilot ist verrückt!«, stieß Ferchmann erregt hervor. »Er hält direkt auf uns zu, will uns rammen!«
»Verrückt vielleicht, aber kein Pilot, sondern eine Pilotin«, erwiderte Lütter und wirkte im Vergleich zum Seitensteuermann geradezu gelassen. »Sie wird uns nicht rammen, sondern im letzten Augenblick abdrehen.«
»Wird sie nicht«, sagte Dorn leise, aber mit Nachdruck. »Ich kenne sie!«
Er gab Pitt das Kommando zum Steigen und stellte den Maschinentelegrafen auf Volle Fahrt.
»Wir kneifen vor dieser Irren?«, rief Lütter ungläubig aus.
»Lieber vor ihr kneifen als mit ihr zusammenstoßen. Wichart wäre bestimmt nicht sehr erfreut, wenn ich seinen Prototyp auf der Jungfernfahrt in Einzelteile zerlege. Also los, Pitt, hoch mit dem Kahn!«
Murrend gehorchte Pitt Lütter. WL 7 nahm Fahrt auf und verließ seine bisherige Fahrthöhe von fünfhundert Metern, während die Fokker unbeirrbar auf das Luftschiff zuhielt. Hätte Dorn nicht den Steigbefehl gegeben, wäre es zu einem Zusammenstoß gekommen. So aber schoss das Flugzeug unter WL 7 hinweg.
Irritiert stellte Dorn fest, dass auch der vordere Beobachtersitz des Zweisitzers besetzt war. Sollte er sich getäuscht haben? Aber nein, die marineblaue Fokker-Spinne und das tollkühne Flugmanöver ließen nur einen Schluss zu. Er starrte dem kleiner werdenden Flugzeug hinterher, wütend, ja zornig.
*
Auch als WL 7 eine halbe Stunde später sicher vertäut am Landemast hing, war Dorns Zorn noch nicht verraucht. Jenseits eines Gitterzauns erstreckten sich die Start- und Landebahnen der Flugzeuge, flankiert von mehreren Hangars. Vor einem offenen Hangar blitzte die blaue Fokker-Spinne im Sonnenlicht, während zwei Mechaniker sich an der Maschine zu schaffen machten. Natürlich war die Fokker längst wieder am Boden; ein Flugzeug war in jeder Hinsicht flinker als ein großes Luftschiff. Am liebsten wäre Dorn sofort hinübergelaufen und hätte sich die Pilotin vorgeknöpft. Aber da war die mehrhundertköpfige Menschenmenge vor, die eine eigens für den heutigen Tag aufgebaute Tribüne füllte. Sogar eine Blaskapelle hatte Wichart zur Linden engagiert.
Während Dorn zur Tribüne schritt, spielten die Musiker in den goldbetressten Fantasieuniformen den Fehrbelliner Reitermarsch. Händeklatschen und Hochrufe. Wenn Dorn gekonnt hätte, so hätte er die Menge mit einer Handbewegung zum Schweigen gebracht, hätte sich mit ein paar knappen Worten bedankt und wäre dann schnurstracks hinüber zu den Flugzeughangars gegangen.
Oder war die Pilotin der Spinne hier? Seine Augen suchten den Randbereich der Tribüne ab, wo Wichart zur Linden und seine engsten Mitarbeiter standen.
Und Lisette. Wicharts Tochter trug ein hellblaues Sommerkleid mit einem dezenten Blumenmuster, das ihr ausgezeichnet stand. So wie alles, was sie trug. Die meisten Frauen verstanden es, sich auszustaffieren, mit Kleidern und Make-up auch einer durchschnittlichen Erscheinung eine hübsche Fassade zu geben. Lisette hatte das nicht nötig. Ein einfaches Kleid und ein Minimum an Kosmetik genügten ihr, um alle anderen Frauen in den Schatten zu stellen.
Ihr fein geschnittenes Gesicht wollte so gar nicht zu dem pausbäckigen ihres Vaters passen. Dorn kannte Fotografien von Wicharts verstorbener Frau und wusste daher, dass Lisette ganz nach ihrer Mutter kam. Zum Glück! Er musste innerlich schmunzeln, als er feststellte, dass ihr Anblick ausreichte, um ihn seinen Zorn vergessen zu lassen. Zumindest für einen langen Augenblick.
Die Pilotin der Spinne war nicht auf der Tribüne, soweit er das feststellen konnte. Wichart zur Linden versperrte ihm jetzt die Sicht. Der schwergewichtige Reeder trat auf Dorn zu und zog ihn mit sich auf das hölzerne Podest, das vor der Tribünenfront errichtet war. Die Kapelle spielte einen Tusch, der sich verdächtig nach Zirkus anhörte.
Mit einer gebieterischen Handbewegung verschaffte sich Wichart Gehör und begann: »Meine Damen und Herren, hochverehrte Gäste, lassen Sie mich meinen Dank an Sie alle aussprechen, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, diesem großartigen Ereignis beizuwohnen. Mein ganz besonderer Dank aber gilt dem Mann, der WL 7 auf seiner Jungfernfahrt geführt hat, Rochus Leberecht Dorn!«
Applaus brandete auf und Wichart legte seine rechte Hand auf Dorns linke Schulter. Dorn wäre am liebsten im Boden versunken, nicht weil der Druck von Wicharts Hand so schwer war. Es war der Name. Er hasste seinen zweiten Vornamen wie die Pest. Leberecht! Dorns Vater war ein glühender Verehrer des Feldmarschalls Blücher gewesen, Gerhard Leberecht von Blücher. Und Dorn musste ein Leben lang darunter leiden.
Wichart setzte seine Rede fort, lobte die Vorzüge seines neuen Luftschiffs, das nach seinen Worten aufgrund der Kombination von Sperrholz und Aluminium Leichtigkeit und Schnelligkeit mit Festigkeit verband und sprach dann noch einmal Dorn seinen Dank aus.
»Diesem prächtigen Luftschiffer steht eine große Zukunft bevor, so wie der ganzen Luftschifffahrt. Und ich kann mich glücklich schätzen, dass Rochus Leberecht Dorn sein zukünftiges Leben und Wirken ganz der Wichart-zur-Linden-Luftfahrtreederei widmen wird. Weshalb ich dessen so gewiss bin, meine Damen und Herren? Nun, nächsten Monat, genauer gesagt, am zwanzigsten Juli, wird die Verlobung zwischen Herrn Dorn und meiner Tochter Lisette gefeiert!«
Wieder ein Tusch, Jubelrufe und kleine weiße Blumensträuße, die aus der vorderen Reihe der Tribüne aufs Podest geworfen wurden. Jetzt erst bemerkte Dorn die Mädchen in den weißen Rüschenkleidern, jedes mit einem halben Dutzend dieser Sträuße bewehrt. Wichart hatte einen Sinn für effektvolle Inszenierungen. Jetzt holte er Lisette aufs Podest und legte ihre Hand in die von Dorn. Fast so, als wolle er vor aller Augen die Trauung vollziehen. Die Fotografen ließen sich das Bild nicht entgehen. Morgen würde sich Dorn in jeder Berliner Zeitung wiederfinden.
Während die Menge noch applaudierte und die Kapelle, die nicht nachstehen wollte, einen Tusch nach dem anderen spielte, beugte sich Dorn zu Wichart und fragte: »Was ist mit Dunja?«
»Was soll mit ihr sein?«
»Sie war das doch vorhin, die mir fast ins Schiff geflogen wäre, oder?«
»Das nehme ich an.«
»Sie haben Dunja also nicht mit diesem Kunststück beauftragt?«
Wichart lächelte. »Ich habe eine Menge übrig für dramatische Effekte, aber ich bringe deshalb doch nicht den Prototyp meines neuen Luftschiffs in Gefahr!«
»Danke, das wollte ich nur wissen.« Dorn wandte sich zum Gehen.
Erneut legte Wichart eine Hand auf seine Schulter. »Wohin willst du?«
»Etwas klären!«
Dorn drückte Lisette einen Kuss auf die Wange, dann lief er quer über den Platz in Richtung Landemast und Luftschiffhalle. Im Schatten der gewaltigen Halle, die man eigens für WL 7 errichtet hatte, stand sein Mercedes-Simplex. Dorn war klar, dass die Gäste auf der Tribüne über seinen schnellen Abgang verwundert waren. Vermutlich hatten sie ein paar festliche Worte von ihm erwartet, aber er konnte nicht länger an sich halten. Im Augenblick gab es nur einen Menschen, dem er etwas zu sagen hatte: Dunja von Brauneck. Dorn kurbelte den Motor an und jagte den Simplex zum Ausgang des Luftschiffgeländes, das durch den Gitterzaun vom Flugplatz getrennt war.
Dunjas amerikanisches Automobil, ein Baby Grand Tourer von Chevrolet, war augenfällig im selben Blau lackiert wie ihre Fokker-Spinne. Der Chevrolet parkte hinter dem Fliegernest, wie die Pilotenunterkunft scherzhaft genannt wurde. Kaum stand der Simplex, sprang Dorn schon aus dem Wagen und stürmte in das lang gestreckte Gebäude. Wie auf Bestellung ertönte ein kehliges Lachen, das er unter tausend Stimmen herausgehört hätte. Dorn folgte dem Lachen und wandte sich nach links. Sein Weg endete vor einer dunklen Tür, hinter der ein großer Aufenthaltsraum lag. Wicharts Piloten bezeichneten ihn als Kasino. Dorn stieß die Tür auf.
An dem lang gestreckten Tisch saßen Dunja und ein Fremder. Dunja trug noch ihre lederne Pilotenkluft, die ihre üppigen Formen zur Geltung brachte. Entspannt hatte sie sich in ihrem Stuhl zurückgelehnt und ihre Füße, die in schwarzledernen Stiefeln steckten, auf die Tischplatte gelegt. Ihr Gegenüber hatte vor sich einen Block und einen Bleistift liegen. Dorn war sofort klar, dass es ein Reporter war. Der untersetzte, noch junge Mann trug einen etwas zu auffälligen Anzug, der vom Kragen bis zu den Hosenaufschlägen mit fingernagelgroßen Punkten gemustert war. Selbst der Hut, den er neben sich auf den Tisch gelegt hatte, war mit dem augenfeindlichen Muster verunziert.
Nur für eine Sekunde wirkte Dunja über Dorns Auftauchen erschrocken, dann öffnete sie ihre sinnlichen Lippen zu einem Raubtierlächeln. »Rochus, schön, dass du zu uns stößt. Herr Gräser ist überaus interessiert an deinen fliegerischen Heldentaten.«
»Und ich bin überaus interessiert an deinen fliegerischen Heldentaten, Dunja«, erwiderte Dorn, ohne den Reporter zu beachten. »Was sollte das vorhin? Hattest du Sehnsucht nach dem Friedhof?«
Betont lässig strich Dunja eine ihrer dunklen, fast schwarzen Locken aus dem Gesicht und behielt ihr aufgesetztes Lächeln bei. »Nur Sehnsucht nach dir, mein Lieber. Ich eile sogar durch die Lüfte, um bei dir zu sein.«
Das Funkeln ihrer braunen Augen verriet Dorn, was sie wirklich dachte. Er kannte diesen Blick, seit er mit Dunja Schluss gemacht hatte. Dunja wollte das nicht akzeptieren, tat so, als habe sie ein Anrecht auf Dorn. Für ihn war Dunja eine Leidenschaft gewesen, aber keine richtige Liebe. Für Dunja hatte er auch nicht einen Moment lang so tiefe Gefühle empfunden wie für Lisette. Noch am Abend jenes Sommertages, als er Lisette zum ersten Mal geküsst hatte, war er zu Dunjas Wohnung am Gendarmenmarkt gefahren und hatte ihr gesagt, dass es vorbei war. Seitdem verfolgte Dunja ihn mit ihren giftigen Blicken und Bemerkungen. Dass sie als Testpilotin für Wichart arbeitete, machte die Sache für Dorn nicht gerade leichter.
Der Reporter räusperte sich zweimal und sah Dorn an. »Ich habe Fräulein von Brauneck um diesen Flug gebeten, Herr Dorn. Ich wollte den Jungfernflug des WL 7 aus nächster Nähe miterleben. War es für Sie nicht ein berauschendes Gefühl, das Schiff heil wieder zu Boden gebracht zu haben?«
Dorn spürte, wie sich in ihm etwas verhärtete; eine unsichtbare Faust ballte sich in seinem Innern zusammen.
»Wie meinen Sie das, Herr Gläser?«, fragte er mit belegter Stimme.
»Gräser mit R«, berichtigte ihn der Reporter. »Vor drei Jahren hatten sie nicht so viel Glück. Als sie damals den Prototyp eines neuen Luftschiffs auf dem Jungfernflug befehligten …«
»Ich weiß, was damals geschehen ist!«, unterbrach Dorn mit schneidender Stimme.
Schlagartig stand jener 13. August des Jahres 1911 wieder vor ihm. Damals hatte Dorn D 3 befehligt, die neueste Konstruktion der Dorn-Luftschiffwerke. Sein Vater war ein begnadeter Konstrukteur gewesen und hatte sein ganzes Vermögen zur Gründung der eigenen Firma eingesetzt. Zusammen mit einigem Fremdkapital hatte es ausgereicht und auf D 3 hatten Ferdinand Dorn und seine Teilhaber alle Hoffnungen gesetzt. Dorns Vater und seine Mutter waren an Bord gegangen, um bei der Jungfernfahrt dabei zu sein. Es war ein strahlender Sommertag gewesen, so wie heute. Aber damals hatte sich die Voraussage der Meteorologen als nicht so zuverlässig erwiesen. Unvermittelt zog eine Sturmfront auf und schüttelte D 3 mit harter Faust wie ein zürnender Gott, der seine ungehorsamen Kinder straft. Dorn hatte alles versucht, um das Schiff sicher zu landen, vergebens. Als D 3 sich schon dem Landemast näherte, riss der Sturm das Schiff regelrecht auseinander. Wer überlebte und wer starb, lag allein in Gottes Hand. Mehr als die Hälfte der Besatzung schaffte es nicht. Vierzehn Tote, darunter Dorns Eltern. Dorn selbst aber trug kaum mehr als eine Schramme davon.
Seitdem hatte es keinen Tag gegeben, an dem er sein Schicksal nicht verflucht, an dem er nicht gewünscht hätte, er läge anstelle seiner Eltern auf dem Friedhof von St. Peter. Das Unglück bedeutete das Ende für die Dorn-Luftschiffwerke und wäre um ein Haar auch sein persönlicher Ruin gewesen. Die gerichtlichen Untersuchungen zogen sich fast ein Jahr hin, dann erst wurde seine Unschuld festgestellt. Aber dafür interessierten sich die Zeitungsschreiber, die erst in Sonderblättern von der Katastrophe berichtet hatten, kaum noch. Hätte Gottfried Wichart zur Linden ihm nicht eine Chance gegeben, hätte Dorn vielleicht nie mehr die Führergondel eines Luftschiffs betreten.
»Ich wollte Sie nicht beleidigen, Herr Dorn«, sagte der Reporter heiser. »Ich wollte nur wissen, ob Ihnen der heutige Flug besser gefallen hat als der …« Der Reporter biss auf seine Unterlippe, als er selbst bemerkte, wie dumm seine Worte waren.
»Fahrt, nicht Flug«, sagte Dorn und trat auf den Mann zu.
»Wie?«
»Luftschiffe fahren, sie fliegen nicht. Es sind ja Schiffe«, erklärte Dorn im Tonfall eines Lehrers, der mit einem an besonders niedriger Auffassungsgabe leidenden Kind spricht. Er setzte sich auf die Tischkante, genau an der Stelle, wo der Reporter seinen Hut abgelegt hatte. »Sonst noch Fragen?«
»M-mein Hut!«
»Ja?«, fragte Dorn, ohne sich von der Kopfbedeckung zu erheben. »Was ist damit?«
»N-Nichts, schon gut«, stammelte der Reporter und steckte mit fliegenden Fingern Block und Bleistift ein. »Ich muss jetzt in die Redaktion, damit der Artikel rechtzeitig fertig wird.«
Dorn schenkte ihm ein falsches Lächeln, wie es sonst nur Dunja zustande brachte, und blieb noch immer auf dem Hut sitzen. »Lassen Sie sich nicht aufhalten. Ich bin schon sehr gespannt auf Ihren Artikel.«
Der Reporter schluckte und warf einen letzten, verzweifelten Blick auf die Stelle, wo sein Hut – oder das, was davon übrig war – lag. Hastig verabschiedete er sich und eilte nach draußen, ohne weiter auf Gottfried Wichart zur Linden zu achten, mit dem er fast zusammengestoßen wäre.
Dorn wandte sich schulterzuckend an seinen zukünftigen Schwiegervater. »Ich glaube, in irgendeinem Käseblatt haben wir morgen eine verdammt schlechte Presse.«
»Käseblatt ist gut«, sagte Dunja mit einem harten, metallischen Lachen. »Gräser schreibt für die BZ am Mittag!«
Dorn stand auf und nahm den zerknautschten Filz in die Hand, der eben noch ein gepunkteter Hut gewesen war. »BZ am Mittag, und da kann er sich nichts Besseres leisten?«
»Unwichtig«, sagte Wichart und jetzt erst fiel Dorn auf, wie blass er wirkte. »Wir können froh sein, wenn morgen überhaupt eine Zeitung die Jungfernfahrt von WL 7 erwähnt.«
»Wie bitte?«, fragte Dorn. »Da draußen ist eine ganze Kompanie Schreiberlinge versammelt.«
»War versammelt, war.« Wichart seufzte schwer und ließ sich auf einen Stuhl sinken. »Die Nachricht, die eben durchgekommen ist, hat sie zurück in ihre Redaktionsstuben getrieben wie eine Herde aufgescheuchter Schafe. Und auch die übrige Festversammlung hat sich so gut wie aufgelöst. Lisette bemüht sich, die wenigen Übriggebliebenen bei Laune zu halten. Aber wer kann noch gute Laune haben nach dieser Nachricht?«
Dorn begriff, wie ernst es Wichart war, und fragte ruhig: »Was ist geschehen?«
Wichart ließ seinen Blick von Dunja zu Dorn wandern, bevor er sagte: »Heute gegen Mittag wurde in Sarajevo ein Attentat auf den österreichischen Thronfolger verübt. Was genau vorgefallen ist, weiß ich nicht. Die Rede ist sowohl von Schüssen als auch von einer Bombe. Ist auch nicht weiter wichtig. Wichtig ist nur das Resultat: Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin, Herzogin Sophie, sind tot. Bei den Attentätern soll es sich um Serben handeln.«
»Und?«, fragte Dunja.
»Begreifst du denn nicht?«, ereiferte sich Wichart. »Kaiser Franz Joseph sucht schon lange einen Vorwand, um gegen Serbien vorzugehen. Einen besseren Grund, um hart gegen die Serben durchzugreifen, wird er kaum finden. Wenn nicht ein Wunder geschieht, dann gibt es Krieg!«
Dorn starrte stumm nach draußen, auf den wolkenlosen Sommernachmittag. Er war trügerisch wie jener verhängnisvolle 13. August 1911, als er seine Eltern verloren hatte. Aber jener Sturm vor drei Jahren war unbedeutend gewesen im Vergleich zu dem Sturm, der in diesem Augenblick über ganz Europa heraufzog.
Kapitel 2
Es sah aus wie Weihnachten im Juli. Das große Anwesen der Familie Wichart zur Linden war festlich geschmückt und mit Hunderten von Lampions erleuchtet, die ihre volle Wirkung erst nach Sonnenuntergang entfalten würden. Viele Gäste waren bereits erschienen und Dorn musste den Mercedes-Simplex vorsichtig zwischen Dutzenden von parkenden Automobilen, große Limousinen zumeist, hindurchmanövrieren.
Chauffeure in ihren Dienstuniformen standen in Gruppen zusammen und unterhielten sich, vielleicht über die angespannte politische Lage in Europa, vielleicht auch nur über das Tennisfinale in Wimbledon, wo Otto Froitzheim nach fünf Sätzen mit 8:6 im letzten Satz dem Australier Norman Brookes unterlegen war. Der Anblick der Uniformen erzeugte in Dorn eine düstere Vision von anderen Uniformierten, die sich, mit Gewehren bewaffnet, auf dem Schlachtfeld gegenüberstanden. Er hörte Kanonendonner und sah Pulverrauch. Kein Wunder, war seit dem Attentat in Sarajevo das Wort »Krieg« doch in aller Munde.
Nach der Ermordung Franz Ferdinands und seiner Frau hatte Kaiser Wilhelm die Kieler Woche abbrechen lassen und war nach Berlin zurückgeeilt. Dorn hatte nicht den Eindruck, dass die diplomatischen Bemühungen, die der Kaiser und sein Reichskanzler von Bethmann Hollweg anstrengten, darauf abzielten, den Frieden zu sichern. Auf den Straßen, in den Salons, in den Zeitungen – überall hörte man vom Krieg, aber kaum jemand sprach vom Frieden. In diesem Zusammenhang erschien ihm wie ein böses Omen, was in Rom geschehen war. Dort hatte der Papst einen Ohnmachtsanfall erlitten, als er im Petersdom für die Seelenruhe der in Sarajevo Ermordeten beten wollte. In einer englischen Zeitung, es war wohl der Daily Chronicle gewesen, hatte Dorn einen Satz gelesen, der die Lage treffend beschrieb. Dort hieß es, die Ermordung des österreichisch-ungarischen Thronfolgers falle wie ein Donnerschlag auf Europa. Dorn schüttelte die trüben Gedanken ab, wollte sich nicht den heutigen Abend vermiesen lassen. Schließlich war es ein ganz besonderer Tag in seinem Leben, das erste und wohl auch einzige Mal, dass er sich verlobte.
Keiner der Chauffeure hatte die versteckte Stelle unter den alten Kastanienbäumen entdeckt und Dorn stellte hier den Mercedes ab. Die meisten Dienstboten kannten ihn und grüßten ihn ehrerbietig, als er die breite Treppe zum Haupteingang hinaufstieg und in der Eingangshalle seinen Staubmantel abstreifte.
Kaum hatte eins der in Reih und Glied wartenden Dienstmädchen ihm den Mantel abgenommen, hörte er eine vertraute Stimme: »Rochus, endlich! Ich dachte schon, du wolltest mich sitzen lassen, bevor wir überhaupt verlobt sind. Wäre doch schade um den ganzen Aufwand, den Papa für den heutigen Abend betrieben hat.«
Lisette sah wunderschön aus in dem cremefarbenen Kleid, das ihr Vater eigens für diesen Anlass in Paris hatte anfertigen lassen. Wenn es etwas auf der Welt gab, das dem alten Wichart noch wichtiger war als seine Luftschiffe und Flugzeuge, dann war es Lisette. Vielleicht war der frühe Tod von Wicharts Frau ursächlich dafür, dass er seine ganze Liebe auf sein einziges Kind bündelte. Dorn eilte ihr entgegen und schloss sie fest in die Arme, wollte sie küssen.
»Nicht so fest, Rochus!« Sie streckte einen Arm mit einem Stück Papier von sich weg. »Du zerdrückst sonst den Brief!«
Dorn lockerte seine Umarmung, hielt Lisette aber weiterhin fest, küsste sie zärtlich und fragte: »Eine besonders gelungene Gratulation zur Verlobung?«
»Nein, die stapeln sich alle nebenan. Der Brief stammt von Tante Rieke. Es handelt sich sozusagen um ein offizielles Schreiben. Hier, sieh mal, das Siegel!«
Er betrachtete das erbrochene Siegel, das einen Doppeladler zeigte. »Sieht aus wie vom Zarenhof.«
»Ist es ja auch!«
Als Lisette die Worte fast triumphierend ausrief, erinnerte er sich. Eine Tante von Lisette, Friederike Schondorf zur Linden, stand als Gesellschafterin in Diensten der Zarenfamilie. Lisette hatte immer mit Bewunderung von ihrer Tante gesprochen.
Lisette löste sich aus der Umarmung und schwenkte den Brief wie eine Trophäe. »Weißt du, was Tante Rieke schreibt?«
»In ein paar Sekunden bestimmt.«
Lisette schnitt ihm eine Grimasse. »Ich kann sofort nach St. Petersburg fahren, wenn ich will.«
»Wieso solltest du das wollen?«, fragte Dorn.
»Na, wenn ich die Stelle annehme, die Tante Rieke mir besorgt hat. Die Zarin ist nämlich sehr angetan von meiner Tante und ist geneigt, auch mich in ihre Dienste zu nehmen.«
»Als was?«, fragte Dorn irritiert.
»Na, als Gesellschafterin.«
»Aha. Und wem sollst du Gesellschaft leisten?«
»Den Töchtern des Zaren und der Zarin, den Großfürstinnen Olga, Tatjana, Maria und Anastasia. Tante Rieke schreibt, vielleicht könnte ich ihnen auch Deutschunterricht geben.«
Als Dorn sie nur schweigend ansah, fragte sie empört: »Freust du dich gar nicht für mich?«
»Für dich mehr als für mich. Ich muss mich erst an den Gedanken gewöhnen, dass meine Frau bereits am Verlobungstag mit dem Gedanken spielt, mich zu verlassen.«
»So?«, fragte sie mit einem Aufblitzen in den Augen. »Also würdest du mich vermissen?«
»Nein, gar nicht«, erwiderte er betont gleichgültig. »Du weißt doch, ich bin nur auf das Geld deines Vaters aus.«
»Gut zu wissen, bevor es zu spät ist«, ertönte die dröhnende Stimme von Gottfried Wichart zur Linden in Dorns Rücken. Lisettes Vater kam durch eine Tür, die zum Westflügel führte, trat auf Dorn zu und schüttelte ihm freundschaftlich die Hand. »Herzlich willkommen, alter Erbschleicher! Aber wer will das einem Mann verdenken, dessen Zukünftige lieber mit den Grazien vom Zarenhof Blindekuh spielt als bei ihrem Angetrauten zu sein?«
Er lachte so laut und herzlich, dass Dorn nicht anders konnte, als in das Lachen einzufallen.
Lisette setzte ein ernstes Gesicht auf und sagte streng: »Papa! Rochus! Ihr könnt doch nicht über die Großfürstinnen lachen, nicht hier! Wir haben viele hochrangige Persönlichkeiten zu Gast. Wenn das jemand weitererzählt …«
»Wir lachen doch gar nicht über die Großfürstinnen«, erwiderte Wichart, noch immer nicht ganz ernst.
»Sondern?«, fragte Lisette.
»Über dich.« Voller Freude über seinen eigenen Scherz begann Wichart erneut, lauthals zu lachen.
Lisette spielte die Erboste. »Macht nur so weiter, dann steige ich wirklich in den nächsten Zug nach Russland!«
Als er das hörte, fühlte Dorn sich erleichtert. »Dann willst du das Angebot nicht annehmen?«
»Wärst du nicht, Rochus, hätte ich schon nach St. Petersburg gekabelt, dass ich unterwegs bin.« Lisette faltete den Brief sorgfältig zusammen und steckte ihn in die kleine Handtasche, die farblich auf ihr Kleid abgestimmt war. »Aber so habe ich etwas Besseres vor. Fast schade.«
Jetzt war Lisette es, die beim Anblick von Dorns empörtem Gesicht aus vollem Halse lachte.
*
Gottfried Wichart zur Linden hatte eine Verlobungsfeier organisiert, die seinem Namen und den hochrangigen Gästen würdig war. Dorn traf auf Grafen und Barone, Generäle und Obristen, Botschafter und Konsuln. Der Champagner floss in Strömen. Das Orchester gönnte sich kaum eine Pause und die Gäste tanzten einen Walzer nach dem anderen. Hin und wieder gab zur Abwechslung eine üppige Sängerin in einem rosafarbenen Kleid ein Lied zum Besten, meistens ein Stück aus einer populären Operette. Als die Frau in Rosa gerade Das Lied vom Rosenkavalier anstimmte, trat eine Person auf Dorn zu, die er den ganzen Abend über nur von fern gesehen hatte. Fast glaubte er, Dunja von Brauneck ging ihm absichtlich aus dem Weg. Grund genug hätte sie gehabt. Nur war es eigentlich nicht ihre Art, vor Konfrontationen Reißaus zu nehmen.
Sie trug ein atemberaubend enges Kleid aus dunkelblauer Seide. Selbst splitterfasernackt hätte sie nicht verführerischer wirken können. Ihr kunstvoll onduliertes Haar wurde von einem breiten Seidenband gleicher Farbe zusammengehalten. Und auch ihre Tasche war aus demselben Stoff gefertigt. Ein Traum in Blau, der Dorn mit einem ungewohnt unsicheren, fast schüchternen Lächeln bedachte.