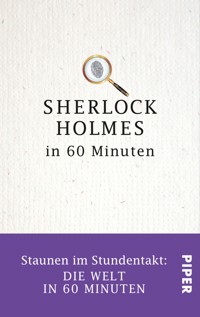1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Amerika – Abenteuer in der Neuen Welt
- Sprache: Deutsch
Folge 10 der spannenden »Amerika«-Saga von Jörg Kastner: Unendlich scheinende 2000 Meilen voller Gefahren, und Jacob Adler und seine Freunde mittendrin. Als der Oregon-Treck unter der Führung von Abner Zachary Kansas City verlässt, ist der Wintereinbruch nicht mehr weit. Sind die Siedler zu spät aufgebrochen? Wenn sie in den wilden Rocky Mountains eingeschneit werden, erwartet sie der sichere Tod. Die Siedler treiben ihre Zugtiere zu Höchstleistungen an, aber Verfolger haben sich auf ihre Spur gesetzt, die zu allem entschlossen sind: Der Marshal von Kansas City sucht unter den Leuten vom Treck dreiste Diebe – aber da ist noch jemand: ein zäher, einsamer Reiter, der dem Treck beharrlich folgt … Jörg Kastners große »Amerika«-Saga begleitet die beiden Auswanderer Jacob Adler und Irene Sommer in die Neue Welt. Mit ihnen suchen zahllose Menschen – Verarmte, Verbitterte, Verfemte – eine neue Heimat jenseits des Atlantiks. Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten warten auf die Auswanderer viele unbekannte Gefahren: Naturkatastrophen, wilde Tiere, Banditen und Indianer. Zudem tobt in Amerika ein erbarmungslos geführter Bürgerkrieg. Doch trotz aller Bedrohungen durchqueren Jacob und Irene den riesigen Kontinent und begegnen dabei so manch berühmter Persönlichkeit. Jede Mühsal und jedes Abenteuer nehmen die beiden auf sich für ihre neue Heimat – Amerika.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 154
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Jörg Kastner
2000 Meilen westwärts
Folge 10 der großen SagaAmerika – Abenteuer in der Neuen Welt
Roman
Was davor geschah
Als der junge Zimmermann Jacob Adler nach dreijähriger Wanderschaft in seinen Heimatort Elbstedt zurückkehrt, ist dort nichts mehr wie vorher. Seine Mutter ist tot, der Vater und die Geschwister sind angeblich nach Amerika ausgewandert, und seine Verlobte ist mit dem Bierbrauersohn Bertram Arning verheiratet. Von Arning fälschlicherweise des Mordversuchs beschuldigt, verlässt Jacob seine Heimat und schifft sich nach Amerika ein, um nach seiner Familie zu suchen. Aber auch in der Neuen Welt lauern Gefahren auf Jacob und seine Reisegefährten Martin Bauer und Irene Sommer. Sie werden in den Bürgerkrieg hineingezogen, der zwischen den amerikanischen Nord- und den Südstaaten ausgebrochen ist, und haben zahlreiche Abenteuer zu bestehen. In Kansas City schließen sie sich dem letzten Siedlertreck an, der sich vor Einbruch des Winters auf den Weg nach Oregon macht.
Kapitel 1Der Marshal von Kansas City
Träge zog die scheinbar endlos lange Wagenkolonne durch die öde, wenig abwechslungsreiche Prärie von Kansas. Der Elan, der die Siedler noch beim Aufbruch am Morgen beherrscht hatte, war verflogen. Die heiße Julisonne hatte ihn ausgedörrt, und der von weit mehr als tausend Hufen aufgewirbelte Staub hatte eine dicke Kruste über ihn gelegt.
Der Traum in den Köpfen der Menschen aber blieb davon unbeeindruckt. Männer wie Frauen dachten an ihre neue Heimat, an Oregon, weit im Westen hinter den mächtigen Gebirgszügen der Rocky Mountains, noch mehr als 2000 Meilen entfernt. Der Traum war so stark, dass er die Menschen eine Tatsache vergessen ließ: Der beschwerliche Trail würde seinen Tribut fordern, von Tieren wie von Menschen. Nicht alle Wagen würden das Gelobte Land erreichen. Und auch nicht alle Siedler.
Jacob Adler trieb seinen Grauschimmel an und lenkte ihn auf einen kleinen Hügel, etwa fünfhundert Yards von der Route des Trecks entfernt. Hier hielt der junge Zimmermann aus Deutschland sein Pferd an, stützte sich mit einem Arm aufs Sattelhorn, wischte sich mit dem anderen Arm die dicke Staubschicht aus dem Gesicht und atmete tief durch. Es tat richtig gut, Luft holen zu können, ohne mit jedem Zug die feinen Staubpartikel einzuatmen, die Pferde, Mulis, Ochsen und Wagenräder ununterbrochen in den blauweißen Himmel schleuderten. Wenn er bedachte, wie ausgetrocknet der Boden schon wieder war, erschien es Jacob wie ein ferner Traum, dass das Land am Missouri vor wenigen Tagen noch von heftigen, ununterbrochenen Regengüssen geplagt worden war.
Jacob genoss es, auf seinem Grauen hin und wieder in die offene Prärie hinauszureiten, weg von dem Staub und dem Lärm des Trecks. Nach der Mittagspause würde er für den Rest des Tages auf dem Bock sitzen, um den Planwagen zu lenken. Sein Freund Martin Bauer würde dann Gelegenheit haben, das Gelände auf dem Pferd zu erkunden.
Daheim in Deutschland hatte Jacob so gut wie keine Erfahrung mit Pferden gehabt, aber in den amerikanischen Weiten kam ein Mann nicht darum herum, in den Sattel zu steigen. Jacob hatte sich schnell daran gewöhnt, einen kräftigen Vierbeiner allein durch einen kurzen Zuruf oder den Druck seiner Schenkel zu lenken. So wie er sich an vieles Neue schnell gewöhnt hatte.
An den Umgang mit Schusswaffen, wenn er sie auch nur im Notfall benutzte. An seiner Hüfte hing ein schwerer 44er Army Colt, und in seinem Scabbard steckte ein Sharps-Karabiner. Beides Beutewaffen von Quantrills Freischärlern. An die englische Sprache, deren Grundbegriffe Jacob und seinen Freunden der alte Seebär Piet Hansen auf dem Auswandererschiff ALBANY beigebracht hatte. Sein Englisch wurde immer besser, je länger er gezwungen war, in dieser Sprache zu reden. Allmählich verschwanden auch die vielen Seemannsausdrücke, die er Hansens Lehrgang verdankte. Manchmal träumte er schon auf Englisch.
Trotz der vielen Abenteuer und Gefahren, die im großen Amerika lauerten, spürte er, dass dies sein Land war. Vielleicht sogar wegen all dieser Herausforderungen. Hier konnte ein Mann beweisen, was in ihm steckte. Hier war er frei, seine Träume zu verwirklichen. Wie es die Siedler vorhatten, die mit dem Treck westwärts zogen.
Unter Jacob rollten dreißig Wagen über den von vielen anderen Trecks so stark ausgetretenen Pfad, dass auf ihm kaum noch ein karges Büschel Präriegras wuchs. Noch brauchten sie ihren Führer nicht, den in Wildleder gekleideten Mann namens Oregon Tom, der in Kansas City als Scout angeheuert worden war; eigentlich hieß er Thomas Bidwell, aber wegen der zahlreichen Trecks, die er schon über die Rocky Mountains nach Oregon gebracht hatte, war ihm sein Spitzname verliehen worden. Noch war die Spur mehr als deutlich, die die vorangegangenen Trecks dieses Jahres hinterlassen hatten.
Mehr Trecks würden nicht folgen, jedenfalls nicht von Kansas City aus. Nicht in diesem Jahr. Die Zeit war schon zu weit fortgeschritten. Im günstigsten Fall würde man den langen Trail in vier Monaten bewältigen, wahrscheinlich waren aber eher in fünf, da immer mit unvorhergesehenen Zwischenfällen gerechnet werden musste. Wenn man in den Bergen vom Schnee überrascht wurde, konnte dies schnell das Ende bedeuten. Eingeschneit und verhungert. So war es schon vielen Siedlern ergangen.
Man hatte Jacob die – wahre – Schreckensgeschichte des Donner-Trecks erzählt, der im Jahr 1846 den bei Fort Hall vom Oregon Trail abzweigenden California Trail genommen hatte, aber in die unerbittlichen Fänge des Winters geriet. Dutzende von Menschen starben, und ihre Gefährten überlebten nur, weil sie das Fleisch der Toten verzehrten.
Jacob schüttelte sich bei dem Gedanken daran und konnte sich zugleich nicht so recht vorstellen, ein ähnliches Schicksal zu erleiden. Die gnadenlos auf den Treck brennende Sonne ließ den Winter so fern erscheinen, wie es Jacobs Heimatstadt an der Elbe war.
Er nahm den breitrandigen Filzhut ab, um sich mit dem grünen Halstuch den Schweiß von der Stirn zu wischen. Er und Martin hatten auf den guten Rat Mitreisender gehört, und ihre Mützen gegen Schatten spendende Hüte vertauscht. Auch das Halstuch war Jacob sehr nützlich. Wenn die Staubwolke des Trecks zu unangenehm wurde, zog er es vor Mund und Nase.
Der Kauf eines Hutes war für Martin von doppeltem Vorteil gewesen. Er hätte seine Mütze wohl kaum wieder aufgesetzt, nachdem sie in Kansas City neben der Leiche von Adam Zachary gefunden worden war und ihn in den Verdacht gebracht hatte, Zacharys Mörder zu sein.
Der Verlust seines Sohns hatte Adams Vater, den alten Abner Zachary, schwer getroffen. So schwer, dass er fast selbst zum Mörder geworden wäre, als er Martin lynchen wollte. Seitdem wirkte der vormals so kräftige Mittfünfziger gebrochen und um zehn, fünfzehn Jahre gealtert. Er war noch immer Treck-Captain, Führer des Wagenzugs, aber Jacob fragte sich, ob er es wirklich schaffen würde, dreißig Wagen und fast zweihundert Menschen ins Gelobte Land zu bringen, wie der alte Prediger Oregon häufig nannte.
Jacob wünschte es ihm. Abner Zacharys Plan, eine neue Stadt zu errichten, in der Menschen aller Hautfarben und Religionen in friedlicher Eintracht miteinander lebten, gefiel ihm. Der Prediger hatte seine Leute, darunter viele Schwarze, aus dem Sklavenstaat Missouri geführt, um ihn zu verwirklichen. Jacob hatte versprochen, seine Fähigkeiten als Zimmermann beim Bau der neuen Stadt einzusetzen. Dafür wurden er, Martin, Irene Sommer und ihr kleiner Sohn Jamie in den Treck aufgenommen.
Abner Zachary selbst saß auf dem Bock seines schweren Conestoga-Wagens und trieb seine acht Maultiere gehörig an, um den Treck weiterzubringen. Denn die Geschwindigkeit aller Wagen richtete sich nach dem vorausfahrenden Conestoga des Treck-Captains. Eine von Abners Töchtern saß neben ihm; die beiden anderen hockten vermutlich im Wagen und genossen den Schatten, den ihnen die Segeltuchplane spendete. Aaron und Andrew, die beiden Abner verbliebenen Söhne, hatten sich wie Jacob in die Sättel geschwungen und ritten dem Treck ein Stück voraus. Vielleicht hielten sie Ausschau nach Oregon Tom, der schon vor zwei Stunden zu einem Erkundungsritt aufgebrochen und seitdem nicht mehr gesehen war.
Weitere Wagen unterschiedlicher Größe und Bauart zogen an Jacob vorbei. Je länger der Morgen dauerte, desto mehr zog sich der Treck auseinander. Wurde ein Wagen langsamer, traf es zugleich auch alle nachfolgenden. Auf einigen Böcken hockten nur Frauen oder Kinder. Die Männer saßen auf ihren Pferden oder waren abgestiegen, um neben den Zugtieren herzugehen und sie mit der Peitsche anzutreiben. Die meisten der Gesichter kannte Jacob schon, die Namen aber nur von einigen.
Da war der schwarze Schmied Sam Kelley mit seiner Familie und seinem Schwager, dem erst vor zwei Tagen freigekauften Sklaven Jackson Harris. Zehn kräftige Ochsen waren nötig, um den Prärieschoner mit Kelleys fahrbarer Schmiede zu ziehen. Sams Frau Aretha saß mit ihrem Bruder auf dem Bock und lenkte den Wagen. Auf der einen Seite der Ochsen ritt Sam, auf der anderen sein dreizehnjähriger Sohn George auf dem feurigen Rappen Black Thunder. Mit lauten Schreien feuerten sie die Ochsen an, ihren müden Trott nicht noch weiter zu verlangsamen. Wenn George so weitermachte, konnte er in wenigen Tagen fluchen wie ein Erwachsener.
Da waren die Millers, zu denen Jacob – wie auch zu den Kelleys – ein fast freundschaftliches Verhältnis hatte. Sie hatten ihre Farm an der blutigen Grenze zwischen Kansas und Missouri aufgegeben, weil der ewige Kampf zwischen Befürwortern und Gegnern der Sklaverei, die in Kansas verboten und in Missouri erlaubt war, sie zermürbt hatte.
Und der Wagen mit Custis Hunter, Virginia Cordwainer, ihrem gemeinsamen kleinen Sohn Bobby, dem frei gelassenen Sklaven Melvin und Virginias ehemaligem Hausmädchen Beth. Jetzt, auf dem Treck, hätte die korrekte Berufsbezeichnung für die Schwarze ›Wagenmädchen‹ lauten müssen. Oder besser ›Kinderfrau‹, da es ihre Hauptaufgabe war, auf den kleinen Bobby aufzupassen. Das Kind hatte den Namen Robert von Custis Hunters ermordetem Vater übernommen.
Die Taufe sollte erst noch erfolgen, durch Abner Zachary. Genauso die Hochzeit von Custis und Virginia und wohl auch die von Melvin und Beth, die dann das Ehepaar Freeman sein würden. Freeman, freier Mann, diesen Namen hatte sich Melvin erst gegeben, als er kein Sklave mehr war.
Aber Jacob hatte nicht nur Freunde im Treck. Fast feindschaftlich gegenüber stand ihm die irische Familie O’Rourke. Die Brüder Patrick und Liam O’Rourke hatten sich bei dem versuchten Lynchmord an Martin hervorgetan, und Jacob hatte ihnen zusammen mit Bowden Webb, dem City Marshal von Kansas City, den tödlichen Spaß verdorben.
Als der letzte Wagen an Jacob vorübergerumpelt war, folgte die Viehherde. Weit auseinander zogen Pferde, Mulis, Ochsen und Milchkühe über die Prärie und sättigten ihren Hunger an Hundsgras und Klee, verabscheuten aber auch die bunten Blumenfelder nicht, die immer wieder aus dem grünbraunen Einerlei herausragten. Ein paar Männer gaben acht, dass die Herde nicht zu weit zurückblieb und nicht zu sehr auseinanderdriftete. Der Dienst bei der Herde erfolgte nach einem Plan, der alle männlichen Siedler der Reihe nach dazu einteilte.
Die letzten Kühe passierten Jacobs Hügel im müden Trott und widerstanden beharrlich den anfeuernden Rufen zweier hinterherlaufender Halbwüchsiger und dem lauten Kläffen einiger ungewöhnlich vergnügter Hunde. Als der Deutsche dem langen, schwerfälligen Treck nachsah, stiegen Zweifel in ihm auf, ob er sein Ziel am anderen Ende des riesigen amerikanischen Kontinents jemals erreichen würde.
Gerade wollte er den Grauen antreiben, um zum Wagenzug aufzuschließen, als er eine Staubwolke in der Richtung bemerkte, aus der die Siedler gekommen waren. Erst dachte er an ein paar Nachzügler der Viehherde. Aber dafür bewegte sich die Wolke mit zu großer Geschwindigkeit auf den Treck zu. Das konnten keine müde vor sich hintrottenden Rinder sein. Bald erkannte er, dass es Reiter waren, eine große Anzahl, etwa zwanzig.
Er verlängerte die Schatten spendende Hutkrempe durch die davorgelegte flache Hand, kniff die Augen zusammen und spähte in die Sonne hinein, aus der die Reiter kamen. Ihren Anführer, der einen kräftigen Apfelschimmel ritt, glaubte Jacob zu erkennen. Ein großer, robuster Mann im dunklen Anzug, dessen Gesicht von einem dunklen Schnurrbart beherrscht wurde. Ja, Jacob war sich jetzt sicher, Marshal Bowden Webb vor sich zu sehen.
Als der scharf galoppierende Reitertrupp näherkam, erkannte Jacob auch zwei der Deputys an Webbs Seite, Grant Begley und Bill Stoner. Das sah ganz nach einer Posse aus. Der Deutsche fragte sich, ob sie zufällig den Spuren des Trecks folgte.
Er blieb mit dem Grauen auf dem Hügel und wartete, bis ihn die Reiter erreichten. Marshal Webb hob die Hand, und die Männer zügelten ihre Tiere, dabei eine noch größere Staubwolke aufwerfend.
»Freut mich, Sie zu sehen, Marshal«, grüßte Jacob mit ehrlich empfundener Sympathie den Mann, der nicht nur geholfen hatte, Martin vor dem Hängen zu bewahren, sondern der auch eine Posse zusammengestellt hatte, um Jackson Harris aus den Händen skrupelloser Sklavenjäger zu befreien.
»Mich auch«, sagte Webb in seiner ruhigen Art und sah zum riesigen Bandwurm des Trecks hinüber. »Ihr Wagenzug kommt nicht besonders schnell voran, scheint mir.«
»Nein. Die Tiere müssen sich erst an den Trott gewöhnen.«
»Dabei sollten Sie und Ihre Freunde es eilig haben, möglichst rasch die Rockies zu erreichen, um noch vor dem Winter über die Berge zu kommen. Unter anderem.«
Die letzten Worte hatte der Polizeichef von Kansas City mit einer seltsamen Betonung ausgesprochen. Seltsam war auch sein Blick und der seiner Begleiter. Düster schauten sie dem langsam gen Westen rollenden Treck nach. Auch Jacob erntete kaum einen freundlichen Blick oder ein freundliches Wort, Webb ausgenommen.
»Was soll das heißen, Marshal, unter anderem?«, fragte Jacob deshalb.
»Ich könnte mir vorstellen, dass jemand von Ihren Leuten einen guten Grund hat, die Entfernung zwischen sich und Kansas City schnell zu vergrößern.«
»Sie sprechen in Rätseln.«
»Ich werde Ihnen alles erklären, wenn wir beim Treck sind, Mr. Adler. Dann muss ich es nicht zweimal sagen.«
Webb trieb seinen Apfelschimmel an, und die Posse folgte ihm. Jacob schloss sich den Bürgern von Kansas City mit gemischten Gefühlen an. Etwas war nicht in Ordnung, so viel war sicher.
Die Siedler warfen den an den Wagen vorbeigaloppierenden Reitern verwunderte Blicke zu. Als sie den vordersten Wagen, Abner Zacharys Conestoga, erreichten, rief Webb dem Prediger auf dem Bock zu, er solle den Treck anhalten lassen.
Der schwarz gekleidete Graubart zügelte seine Mulis und zog, als sie standen, die Wagenbremse an. Hinter ihm wiederholte sich das von Wagen zu Wagen. Das Rumpeln und Knarren der Prärieschoner erstarb allmählich.
Überraschte Siedler sammelten sich um den Conestoga. Auch Zacharys Söhne hatten den nicht geplanten Halt der Kolonne mitbekommen und lenkten ihre Pferde zurück zum Treck.
»Was ist denn los, Marshal?«, wollte Abner Zachary wissen.
»Wir müssen den Treck durchsuchen, Mr. Zachary.«
»Durchsuchen?«, wiederholte dieser, als glaube er, nicht recht gehört zu haben. »Etwa jeden Wagen?«
Jacob fühlte sich bei Webbs Erklärung an die Sklavenjäger erinnert, die Jackson Harris vor seinem Freikauf beim Treck gesucht und auch, versteckt im Wagen seines Schwagers, gefunden hatten.
»Das ist leider nötig«, sagte Bowden Webb. »Es sei denn, jemand rückt freiwillig die achtzigtausend Dollar heraus.«
»Achtzigtausend Dollar?«, fragte Liam O’Rourke, verzog sein breites, abstoßendes Gesicht und brach in ein raues Lachen aus. »Wenn Sie so viel Geld bei uns finden, Marshal, lege ich noch mal dieselbe Summe drauf.«
Der Ire schüttelte sich vor Lachen und genoss es, Webb zu verspotten. Es war seine Rache dafür, dass der Marshal Liam und seinem Bruder Patrick den Spaß am Lynchen verdorben hatte. Dass sich Martins Unschuld kurz danach herausstellte, kümmerte die rohen Iren nicht.
»Sie sollten nichts versprechen, was Sie nicht halten können, Mann«, sagte Webb scharf.
»Was hat es mit diesen achtzigtausend Dollar auf sich, Marshal?«, erkundigte sich Abner Zachary.
»Sie wurden in der Nacht aus dem Tresor der Asquith Trading Bank gestohlen.«
»Ein Bankraub also«, brummte der alte Prediger und fuhr mit der Hand durch seinen grauen Bart.
»Nein, kein Bankraub, sondern ein Diebstahl«, widersprach der Marshal. »Es wurde keine Gewalt gegen Menschen angewendet. Der Dieb hat sich in der letzten Nacht Zugang zum Bankgebäude verschafft, den Tresor geöffnet und den gesamten Inhalt, Kleingeld ausgenommen, mitgehen lassen.«
»Wieso konnte er den Tresor einfach so öffnen?«, fragte der Prediger erstaunt. »Hat er ihn gesprengt?«
Webb schüttelte seinen Kopf. »Er ist still und leise vorgegangen, sodass der Diebstahl erst heute Morgen bemerkt wurde. Irgendwie hat er es geschafft, die Kombination des Tresors zu knacken.«
»Oder er kannte sie«, warf Jacob ein.
»Daran haben wir auch schon gedacht«, erwiderte der Marshal. »Wir haben sofort die Häuser der Bankangestellten durchsucht, ohne Erfolg.«
»Weshalb glauben Sie, das Geld bei uns finden zu können?«, fragte Aaron Zachary, nach dem Tod seines Bruders der älteste Sohn des Predigers.
»Bis jetzt ist es in der Stadt nicht aufgetaucht. Vielleicht deshalb nicht, weil es gar nicht mehr in der Stadt ist.«
»Das ist aber sehr weit hergeholt«, fand Aaron.
»Gar nicht«, belehrte ihn Webb. »Es ist im Gegenteil sehr auffällig, dass die Bank just in der Nacht vor Ihrem Aufbruch ausgeräumt wurde.«
»Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemand von unseren Leuten getan hat«, meinte Abner Zachary kopfschüttelnd, wandte sich zur Seite und blickte an der langen Wagenreihe entlang. »Nein, wirklich nicht!«
»Das lässt sich leicht feststellen, Mr. Zachary«, sagte der Marshal. »Lassen Sie uns die Wagen durchsuchen, und wir wissen es genau.«
»Nein!«, sagte da hart Aaron Zachary. »Wir haben es eilig, und die Durchsuchung sämtlicher Wagen dauert zu lange.« Er blickte den Anführer der Posse abweisend an. »Außerdem liegen die Stadtgrenzen viele Meilen hinter uns. Sie befinden sich außerhalb Ihres Zuständigkeitsbereichs, Marshal!«
Webb blieb ruhig, als er entgegnete: »Das sehen Mr. Asquith und alle Bürger, die ihm ihr mühsam verdientes Geld anvertraut hatten, anders. Sie meinen nämlich, der Marshal von Kansas City sei überall dort zuständig, wo sich die Dollars der Bürger von Kansas City befinden.«
Aaron blieb unversöhnlich. »Sie haben kein Recht zur Durchsuchung der Wagen, Webb. Und Sie können uns nicht zwingen, diese Aktion zu dulden.«
»Da wäre ich mir an Ihrer Stelle nicht sicher«, meinte der Marshal und legte wie beiläufig die Rechte auf den Kolben des sechsschüssigen 44ers, der im Lederholster an seiner rechten Hüfte steckte.
Seine Deputys und die anderen Mitglieder der Posse folgten seinem Beispiel. Revolver wurden in den Holstern gelockert und Karabiner aus den Scabbards gezogen.
Die sich bedroht fühlenden Siedler wollten nicht nachstehen. Wer von den Männern um Zacharys Conestoga eine Waffe bei sich trug, machte sich bereit, sie zu gebrauchen.
Jacob allerdings zögerte, weil er keinen Anlass für eine bewaffnete Auseinandersetzung sah. Vielmehr schienen sich die Antipathien, die sich während des versuchten Lynchmords aufgestaut hatten, ein Ventil zu suchen.
Abner Zachary entschärfte die Situation, als er erklärte: »Wir haben nichts zu verbergen, Marshal. Um Ihnen das zu beweisen, sind wir bereit, Ihre Männer in unsere Wagen zu lassen. Fangen Sie gleich mit meinem an.«
Aaron Zachary nahm das höchst unwillig auf, wagte aber nicht, gegen seinen Vater aufzubegehren.
Während die Deputys Begley und Stoner von ihren Pferden stiegen und auf den Conestoga kletterten, verteilten sich die anderen Posse-Mitglieder über den Treck, um die übrigen Wagen zu durchsuchen. Die Nachricht von dem gestohlenen Geld verbreitete sich rasch über alle Wagen und sorgte für erregte Debatten über den Diebstahl.