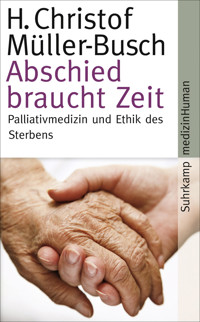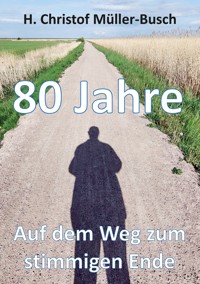
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch lädt Sie ein, die Summe der Erfahrungen, Gefühle und Geschichten eines besonderen Lebens zu erkunden, das 1943 beginnt und nach 80 Jahren autobiographisches Erinnern mit tiefgreifendem Assoziieren verwebt. Es ist nicht nur ein Rückblick, sondern eine Reise der Selbstreflexion und des Neuerfindens des eigenen Lebenswegs. Der Autor, ein Pionier der Palliativmedizin in Deutschland, öffnet die Türen zu seiner Lebensgeschichte und verbindet seinen Weg zur Medizin mit persönlichen und intimen Einblicken. Tauchen Sie ein in die Zeiten des Wandels, des Zeitgeschehens und der eigenen Entwicklung. Spüren Sie die Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart und erfahren Sie, wie das Leben uns formt und prägt. »80 Jahre: Auf dem Weg zum stimmigen Ende« erinnert uns daran, dass jeder Moment eine wertvolle Chance ist, das eigene Leben zu verstehen und zu erfahren. Erforschen Sie die Vergänglichkeit und die Bedeutung unseres Daseins inmitten der großen Geschichte der Menschheit. Entdecken Sie den Weg zum stimmigen Ende. Dieses Buch lädt Sie ein, Ihr eigenes Leben zu betrachten, die Essenz des Lebens zu begreifen und den persönlichen Weg zu einem erfüllenden Ende zu finden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 574
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
H. Christof Müller-Busch
80 Jahre Auf dem Weg zum stimmigen Ende
© 2023 H. Christof Müller-Busch
Umschlag & Satz: Erik Kinting, buchlektorat.net
Verlag und Druck:
tredition GmbH
An der Strusbek 10
22926 Ahrensburg
Softcover
978-3-347-94260-8
Hardcover
978-3-347-94261-5
E-Book
978-3-347-94262-2
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Einleitung
70 bis 80 Jahre
0 bis 7 Jahre
7 bis 14 Jahre
14 bis 21 Jahre
21 bis 28 Jahre
28 bis 35 Jahre
35 bis 42 Jahre
42 bis 49 Jahre
49 bis 56 Jahre
56 bis 63 Jahre
63 bis 70 Jahre
Ausblicke im Juni 2023
80 Jahre
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
70 bis 80 Jahre
Ausblicke im Juni 2023
80 Jahre
Cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
46
45
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
Einleitung
Was ich euch noch erzählen wollte, sind einige Erinnerungen an mein Leben in den letzten 80 Jahren. Ehe ich sie vergesse, sollen sie wenigstens aufgeschrieben sein. Erinnern und Vergessen gehören zum Altern – was im Vordergrund steht und was besser ist, ist nicht immer klar. Aber vergessen ist ja in meinem Alter durchaus möglich. Ich habe versucht, diesem Erinnern eine Systematik zu geben, und ich hoffe, dass mein – bisweilen mit einiger Überwindung zur (schonungslosen) Offenheit – zusammengetragenes Gedachtes, Gefühltes und Gelebtes euer Interesse daran vertiefen möge, was mein Leben und unser Leben geprägt haben. Vor allem aber möchte ich euch unterhalten, bestärken und bestätigen in eurem Sein, Wirken und Werden: Vertraut auf euch und das Leben!
Verzeiht mir, wenn meine Aufzeichnungen nicht so heiter geworden sind, wie es in der gelassenen Distanz des Alters bei einem Rückblick vielleicht möglich gewesen wäre. Aber in der Selbstreflexion bin ich doch sehr nachdenklich geworden. So geht es einerseits darum, euch und denjenigen, die es interessiert, einige Informationen über mich aus der Innenperspektive zu geben, andererseits aber für mich auch darum, das – trotz aller Widrigkeiten und Schwierigkeiten – einmalige Wunder meines Lebens nochmals in meinem inneren Auge an mir vorbeiziehen zu lassen, mit Wehmut, mit Abstand, mit Erstaunen und sicherlich mit vielen Fragen. Ich möchte es nicht missen.
Die ursprüngliche Idee war gewesen, die letzten 50 Jahre der von Ricki und mir geteilten Lebenszeit, aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu beleuchten – eine reizvolle Herausforderung, sieht doch ein anderer niemals das gleiche wie das Ich. Und bei zwei Menschen, die so unterschiedlich »geerdet« sind wie Ricki und ich, vielleicht auch ganz spannend. Wir haben das gemeinsame Zusammentragen unserer Wirklichkeiten leider nicht geschafft – insofern sind diese Aufzeichnungen auch mehr Anregungen als die »wahre Geschichte unseres Lebens«. Und das vor dem Hintergrund, dass wir in diesem Jahr zusammen schon auf insgesamt 150 Jahre Lebenszeit zurückblicken dürfen – wahrlich ein Privileg, das wir feiern wollen. Ricki hat in ihrem Buch »1000 Schlucke täglich« schon viele der gemeinsamen Erfahrungen beschrieben – aus ihrer Perspektive! Ich folge also nach: mit meiner Sicht, die bei manchen Leserinnen und Lesern, und besonders vielleicht bei »meiner Frau« zu anderen Assoziationen, Erinnerungen und Interpretationen führen, weil sich nicht nur die Sichtweisen, sondern auch das autobiografische Gedächtnis zu gemeinsamen Erfahrungen unterscheiden. Faktenscheck und Korrektur sind für die objektive Bewertung der Geschichte wichtig, hier geht es um die Innenperspektive auf der Suche nach Sinn.
Die Epoche meines Lebens stellt zwar nur einen Wimpernschlag in der Geschichte der Menschheit dar. Stefan Zweig hat in seinen »Sternstunden der Menschheit« mit dem Wimpernschlag eigentlich nur eine Epoche von zehn Jahren gemeint – aber selbst, wenn meine Erinnerung vielleicht acht oder sogar noch mehr Jahrzehnte umfasst – sie waren die einzigen Jahre, in denen ich das Glück und die Chance hatte, das Leben, mich und die Erde ein wenig kennenzulernen. In der Erinnerung ist dieser Wimpernschlag meines Lebens einzigartig – ein sehr persönliches Dokument aus großväterlicher Perspektive zum Erleben einer sicherlich wichtigen Phase der Menschheitsgeschichte. Wie nie zuvor bekamen die Beziehungen der Menschen zueinander und das Schicksal der Erde eine globale Dimension. Wie nie zuvor erlebten wir Veränderungen dieser Welt in einer Weise, die in uns das Bewusstsein wachsen ließ, dass ein einzelnes kleines Leben immer auch ein Teil im Getriebe des Ganzen ist. Meine Großväter sind vor meiner Geburt gestorben – sie konnten mir von ihrem Leben nichts erzählen. Aber auch sie lebten in einer historischen Epoche, die mich noch heute bewegt und beschäftigt. Ihr Erbe begleitet mich ebenso wie manche Fragen, die ich ihnen nie stellen konnte. Deswegen ist es mir ein Anliegen, mit meinem Lebensbericht und vielleicht auch mit diesen Erinnerungen einige Spuren zu legen.
Ich will versuchen, das, was mir zu diesem Wimpernschlag in der Geschichte einfällt, zu gliedern. Das erfolgt in der Einsicht, dass man – grob gesagt – ein Menschenleben recht gut in Lebensabschnitte von sieben Jahren, die Heptomaden, einteilen kann. Ursprünglich stammt diese Idee von dem vorsokratischen Philosophen, Lyriker und Reformpolitiker Solon, einem der sieben Weisen des antiken Griechenlands. Sie endet mit der 10. Heptomade, das bedeutet schlicht: Mit siebzig Jahren ist die Zeit des Sterbens angebrochen. Solon lebte in der klassischen Blütezeit des antiken Griechenlands, wurde ca. 640 v. Chr. in Athen geboren und starb vermutlich dort im Alter von ca. 80 Jahren. In seiner berühmten Elegie endet das Leben eines Mannes, das beim »unreifen Knaben« beginnt, mit der zehnten Heptomade: »Wer in die zehnte gelangte, die zehnte nach Maßen vollendend, träfe ihn die Neige des Todes kaum zur Unzeit wär’s«. Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Systematik der Heptomaden von Rudolf Steiner aufgegriffen, dessen anthroposophische Menschenkunde ich in einer wichtigen Phase meines Lebens kennenlernen durfte.
Einstimmen auf diese gemeinsame Reise durch meine Lebensjahrsiebte möchte ich mich und euch allerdings gleich mit einem Rückblick auf meine letzten zehn Jahre: die Dekade seit meinem 70. Geburtstag, Diesen ersten Blick auf das in dieser Zeitspanne gelebte, gedachte und Geleistete riskiere ich gerne, ist er doch verbunden mit Freude und einer großen Dankbarkeit, dass ich diese Jahre mit vielen von euch teilen durfte. Dem weniger mit meiner Geschichte Vertrauten werden einige Namen, die in diesem Abschnitt auftauchen, fremd sein. Sie weisen auf frühere Zeiten hin … Gemeinsam Erlebtes und Beziehungen haben diese Jahre »unvergesslich« für mich gemacht. »Erinnerungen gegen das Vergessen« – diese Rubrik passt hier nicht. Mein erster Rückblick beschreibt lebendiges gelebtes Leben – auf dem Weg zur Zugabe der nächsten Dekade. Gerne stelle ich ihn den Erinnerungen gegen das Vergessen der Heptomaden voran! Voici – mein jetziges Leben.
Und jetzt kommt mit! Ich lade euch ein auf meine Reise durch die vergangenen acht Jahrzehnte.
70 bis 80 Jahre
Unvollendetes Leben (2013–2023)
Auch wenn ich die letzten Jahre als Zugabe empfunden habe (und jeden Tag weiter als Geschenk empfinde), spüre ich doch, dass der Blick auf die zurückliegende Zeit für mich immer bedeutsamer wird als die, die vor mir liegt. Die Intensität des Lebens und Erlebens in den letzten zehn Jahren hat gerade diese Phase besonders wertvoll und glücklich gemacht. Einen großen Anteil daran haben sicherlich die sieben Frauen, die mein Leben in der »sinkenden Phase« inzwischen untrennbar begleiten und bestimmen. Auch wenn ich nicht der engagierteste Großvater bin, sondern eher ein »Unruhestifter« im Ruhestand und mit vielen anderen Dingen beschäftigt, war es schon sehr berührend, dass meine Enkeltochter Matilda vor elf Jahren als eines der ersten Worte »Opa« sagte. Durch Matilda, Mira und zuletzt Martha – gerade noch rechtzeitig im Coronajahr 2020 geboren – sind es mit Ella inzwischen vier Enkeltöchter geworden, deren Entwicklung ich noch möglichst lange mit Freuden beobachten möchte. Ihre Lebenswege in eine ungewisse und – wie es derzeit scheint – keineswegs bessere Zukunft als die, auf die ich zurückblicken darf, beschäftigen mich bisweilen auch mit Sorgen und Ängsten.
Viele Großeltern meiner Generation treibt in der Zeit des fortschreitenden Alters die Sehnsucht nach vergangenen Zeiten, der alten Heimat, nach Kindheit und Jugendzeit um. Kein Wunder, dass »zum Stift gegriffen« wird, um die Erinnerungen aufschreiben, nicht zuletzt auch, um die Zeit der Jugend wieder aufleben zu lassen, zumindest aber, um sie nicht zu vergessen. Wenn ich mir die Erinnerung ermögliche, erlaube und sie (mit-)teile, begebe ich mich auf eine spezielle kommunikative Reise in mir und mit euch, denn Erinnern bedeutet immer auch eine Spurensuche nach Tradition.
Die Dichtigkeit von zehn Jahren Lebenszeit auf rund 30 Seiten zusammenzufassen, macht Kompromisse und Mut zur Lücke notwendig, erfordert Zeitsprünge und benötigt Assoziationsvermögen. Insofern sollen diese Erinnerungen auch eher Blitzlichter sein als detaillierte und vollständige Schilderungen von Erlebnissen. Persönliches, Privates, vielleicht auch Intimes, vermischen sich mit Information. Die Utopie vom berühmten Schriftsteller habe ich inzwischen ausgeträumt. Aber ich wünsche mir doch, dass meine Erinnerungen und biografischen Reflexionen etwas zum Verstehen des Lebens in seinen verschiedenen Phasen beitragen können.
Nach der Auflösung des elterlichen Hauses in Neustadt habe ich mich nun endgültig von der pfälzischen Heimat getrennt. Geblieben sind über 100 Jahre sorgsam dokumentierte Familiengeschichte in vielen Kisten, die von den tradierten Werten der Eltern bestimmt wurde. Vor diesem Hintergrund habe ich die Pfalz, zu der ich eine eher ambivalente, vielleicht sogar herablassende Beziehung pflegte, immer seltener besucht, dafür umso häufiger das Wendland, aber auch den Thunersee und das Berner-Oberland. Herz, Geist, Seele und Körper finden in diesen Regionen immer wieder Inspiration – auch wenn meine sportlichen Leidenschaften, z. B. das Skifahren, und Ambitionen zur Selbstpflege in einer ernüchternden Bilanz relativiert werden müssen. Aber mittelmäßiges Golfspielen und Wandern geht ja noch.
Geblieben sind mir aus der Pfalz neben den eher ungeliebten Kisten voller Familiengeschichte die Liebe zum Pfälzer Wein und einige Freundschaften in Berlin mit Mitschülern aus der Neustädter Schulzeit. Aller Distanz zum Trotz. Dazu gehören Christian, Gerhard und ganz besonders Richard. Vielleicht werden sie zu wenig gepflegt, weil mich der bilanzierende Blick und eigentlich auch die Sehnsucht zurück viel weniger beschäftigen als das Programm der Zugabe. Mit Richard organisierte ich eine spannende Ringvorlesung an der Humboldt Universität zum Thema »Krankheit, Sterben und Tod im Leben und Schreiben europäischer Schriftsteller«, deren Beiträge in zwei interessanten Bänden erschienen sind. In diesem Zusammenhang setzte ich mich noch einmal intensiver mit dem Leben und Sterben von Federico Angst auseinander, dessen unter dem Alias Fritz Zorn erschienener Bestseller »Mars« mich wie viele andere in den 70er Jahren fasziniert hatte. Immerhin haben meine Recherchen dazu geführt, dass das verschollene schriftstellerische Werk von Federico Angst wiedergefunden wurde und aktuell aufgearbeitet wird. Eine Dissertation dazu soll zu seinem 80. Geburtstag im Jahr 2024 erscheinen.
Richard ist im Gegensatz zu mir ein erfahrener Autor, der über 60 Bücher publiziert bzw. auch selbst geschrieben hat – ein umfassendes publizistische Œuvre und Vermächtnis, von dem ich nur träumen kann. Er ist mir in den letzten 10 Jahren ein wichtiger intellektueller Inspirator geworden.
Ein Beispiel für die Veränderungen des unvollendeten Lebens sind auch die Art wie Feste gefeiert wurden. Weihnachtsfeste waren lange Zeit meines Lebens ein Alptraum für mich gewesen und gerne übernahm ich dankbar als junger Arzt Dienste im Krankenhaus, die andere loswerden wollten. Mit Familie, Kindern, Richard, Christine und manchmal auch anderen Gästen wurden sie zum intellektuellen Event mit kulinarischer Herausforderung. Alte Geschichten wurden erzählt und wir philosophierten über Literatur, Kunst und Politik, doch mit Beginn meines Großvaterseins veränderten sich natürlich auch Rituale. Erst als Großvater bekamen sie eine freudige Bedeutung. Ich versuchte die Enkeltöchter mit familienbewusster Selbstverständlichkeit und sogar mit fantasieverliebter Begeisterung vom Christkind und vom Weihnachtsmann zu überzeugen, Verhaltensweisen, die ich mir früher nie vorgestellt hatte. Immerhin konnte ich in den letzten zehn Jahren das kleine rote Fähnchen als Besonderheit unseres – im Übrigen fantasievoll und meist von den Enkeltöchtern geschmückten – Baumes bewahren. Ich hatte es als Alternative zur glitzernden Christbaumspitze bei Rickis erstem Weihnachtsfest 1975 in der Schlüterstraße als symbolhaftes Zeichen des Protests eingeführt und seitdem als notwendigen Schmuck unseres Tannenbaums verteidigt. Wie anspruchslos dankbar sind Ricki und ich inzwischen geworden, wenn wir ganz selbstverständlich mit unseren Kindern, ihren Männern und den Enkeltöchtern im Wendland die Weihnachstage verbringen, auch wenn ich meistens am Computer sitze und mit irgendeinem Problem beschäftigt bin. Dazu gehört inzwischen auch das Weihnachtsrätsel aus dem Tagesspiegel, das regelmäßig für einige Stunden (manchmal aber auch einige Tage) den routinierten TagNacht-Rhythmus unterbricht, je nachdem, welche Schwierigkeiten des Rätsels mich herausfordern. Je schwerer, umso besser – unlösbar gibt es nicht!
Mit dem Wendland verbinde ich die – sicherlich aus unterschiedlicher Perspektive durchaus wechselhaft erlebte – Geschichte des gemeinsamen Lebens mit Ricki ganz besonders. Das Haus ist Zuflucht und Ausgleich zugleich. In schwierigen Zeiten, die wir in Berlin und Herdecke durchlebt haben, konnten wir im wendländischen Splietau immer wieder zueinander und zu einem Miteinander finden. Inzwischen gehören die regelmäßigen Weihnachts-, Osterund Pfingstzusammenkünfte in Splietau zu den unverzichtbaren Ritualen einer familiären Verbundenheit, auf die wir uns nicht nur freuen, sondern auf die wir auch stolz sind. Bei aller Verschiedenheit unserer Charaktere bestätigen sie uns. In den letzten Jahren – besonders auch durch die Pandemie bedingten Beschränkungen – haben unsere Töchter mit Familie, besonders aber die Enkeltöchter, die Landluft des Wendlands für sich und viele ihrer Freunde entdeckt, sodass das Haus gut genutzt wird und – trotz seiner vielen Räume – für die Alten schon fast kein Platz mehr ist. Die Ausbauaktivitäten eines Abstellraums zu einer »Covid-Lounge«, die Maries Mann Mathis während des Corona Lockdowns in Splietau entwickelte, waren ein erster zaghafter Versuch, die Raumprobleme des Splietau-Projekts anzupacken. Mehr als 200 m2 Wohnfläche genügen nicht mehr, wenn alle da sein wollen und auf unterschiedliche Art ihre Ruhe suchen. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass mir das Wendland für die »freie« Zeit des Alters einmal Heimat werden würde. Schließlich verbinden mich und uns mit dem Wendland tatsächlich auch genealogische Beziehungen, die mein Bruder Klaus schon vor sechzig Jahren herausgefunden hatte. Auch diese Zusammenhänge habe ich erst in den letzten zehn Jahren in den von meiner Mutter nach dem Tod von Klaus sorgsam gehüteten und archivierten Dokumenten entdeckt:
Vorfahren meiner Großmutter mütterlicherseits, die Eggelings bzw. Ribocks, lebten vor rund 300 Jahren in Dannenberg, Quickborn und Gorleben, bis ein Postmeister im 18. Jahrhundert über die Zwischenstation Celle ins Rheinland umzog, um dort die BuschLinie meines Stammbaums mitzugründen. Einige Kisten des Nachlasses meiner Eltern werden in der Tenne in Splietau aufbewahrt und warten immer noch darauf, durchgesehen zu werden. Und auch die nach dem Tod von Klaus angefertigte Bronzebüste befindet sich in Splietau: Sie hat unter der großen Eiche im Garten einen angemessenen Platz gefunden, wo sie hoffentlich noch einige Jahre überdauern darf bis sie verwittert – Verlusterinnerung, die mich begleitet.
Ich empfinde mein Dasein als Geschenk und Privileg. Versöhnung und Nachsicht, ganz besonders auch mit mir selbst, beschäftigten mich und werden immer mehr zu vorherrschenden Themen. Niemals habe ich die schwindende Zeit gleichzeitig so sehr als Gewinn und gleichzeitig als Verlust empfunden wie die der vergangenen zehn Jahre. Die Vorstellung, irgendwann als Großvater in eine Lebensphase zu gelangen, in der ich so intensiv Lebenslust und Lebensfreude empfinden würde wie jetzt, war mir zu Beginn meines Erwachsenenlebens ziemlich fremd. Nicht alt zu werden, war meine unerschütterliche Überzeugung, ja vielleicht sogar so etwas wie ein Lebensplan. Das glückliche Schicksal, im Laufe der Jahre zu einem von Weiblichkeit dominierten großelterlichen Leben mit zwei Töchtern und inzwischen vier Enkelinnen gelangt zu sein und seit fünfzig Jahren ein geteiltes Leben mit derselben Frau zu führen, gab mir Bestätigung, Sicherheit und Sinn. Andererseits beunruhigte mich die Normalität der Zufriedenheit. »War’s das jetzt?«, fragte ich mich immer häufiger in den letzten Jahren und auf verschiedenen Ebenen. Nicht Zweifel begleiteten mich, sondern der Drang nach Abenteuern. Gab es in der Gegenwärtigkeit der befristeten und unsicheren Zukunft noch etwas zu entdecken, auf das ich im Rückblick nicht geachtet hatte, oder etwas, das ich versäumt oder verdrängt hatte? Welche Höhepunkte wollte und konnte ich in diesem Leben noch finden? Meine letzten zehn Jahre sind zu einer Erfahrung geworden, in der meine Lust am Leben täglich weiter zuzunehmen scheint. Sie sind mit einer Geschwindigkeit zur Vergangenheit geworden, dass ich sie zu gerne nochmals leben würde! Ich weiß: Geht nicht. Sie waren, sind und bleiben mein unvollendetes Leben, Phase der Erkenntnis, Ernüchterung und Demut, aber auch der Neugier und Lust.
Nicht nur meine sieben Frauen aus drei Generationen trieben und treiben mich voran. Gelassenheit und Begehren führten zu einem permanenten Spannungszustand. So empfinde ich die letzten Jahre trotz aller Einsichten, Erkenntnisse und Weisheiten, die sich mit dem Altsein eingestellt haben, tatsächlich eher als unvollendete Zeit. Mein Leben hat Fülle, Bedeutung und Sinn erlangt, die ich nicht verlieren, nicht missen möchte. Tod ist kein Thema, aber das Damoklesschwert befindet sich im Raum. Auch wenn ich keine Angst vor dem Tod habe: Zur »Unzeit« wär’s schon.
Manchmal ergreift mich verständnisloses Bedauern über die Versäumnisse des Lebens, über ausgelassene Gelegenheiten. Wie viel, was könnte ich noch nachholen? Ja, könnte ich? Wirklich? Ob es eine typisch männliche Eigenschaft ist, wenn sich trotz nachlassender Kräfte gerade im fortschreitenden Alter gegen alle Vernunft (und wider alle Möglichkeiten …) sinnliche Gefühle regen? Die Träume, die mich als junger Mensch beschäftigten und fesselten, wichen im Laufe der letzten Jahre einer Ernüchterung, in der die Herausforderungen der Gegenwart mehr im Spiegel des bilanzierenden Rückblicks als, in dem der Spekulation auf die Zukunft betrachtet werden. Die Schritte wurden wichtiger als die Spuren, die sie hinterlassen.
Ein weiteres Beispiel wie die letzten Jahre auch Erfahrungen des offenen Herzens aber auch des offenen Geistes wurden, waren die Herausforderungen in China. Im ersten Jahr meiner Einsätze für den »Senior Experten Service« (SES) in Shandong verzauberte die 19-jährige Chinesin Xue, eine attraktive Hostess, die morgens die Gäste des Hotels zum Frühstück begrüßte, mein einsames Herz. Natürlich war es eine unerfüllbare Romanze, wenn sich unsere Blicke in kaum überwindbarer Distanz mit einem schweigsamen Lächeln begegneten, vielleicht auch deshalb so romantisch, weil ein Rendezvous, ein Fehltritt oder gar ein Seitensprung sehr fern jeglicher Vorstellung oder gar Verwirklichung war. Blicke genügten vollkommen. Aber ich spürte, wie sinnliche Gefühle mich einerseits über 50 Jahre zurück in unerfüllte und unerfüllbare Sehnsüchte vergangener Jahre zurückschickten. Ich trug das Geheimnis der Blicke in mir. Als Ricki und ich im nächsten Jahr erstmals gemeinsam nach China fuhren und im selben Hotel untergebracht wurden, begrüßte Xue immer noch die Frühstücksgäste. Oder schon wieder? Und lächelte vertraut. Mit einem schamhaften Erröten und erleichtert bat ich Ricki um ein Erinnerungsfoto von Xue und mir. Die Schwärmerei eines alternden Mannes wurde dokumentiert. Im darauffolgenden Jahr war Xue nicht mehr da. Ich hörte nie wieder etwas von ihr.
Die letzten zehn Jahre gehörten trotz nachlassender Manneskräfte und schwindender Fähigkeiten zur wertvollsten und intensivsten Zeit meines Lebens. Sie vergingen wie im Flug und ich frage mich oft, ob es das Bewusstwerden der Frist oder der Reichtum der Erinnerungen und damit verbundener Sehnsüchte ist, die mich immer noch neugierig sein lassen und sinnlich beschäftigen. Sind es die romantischen Altersutopien oder die alterskluge Vernunft, die das alternde Leben so lebenswert machen?
Die Relativität der Zeit in den verschiedenen Abschnitten meines Lebens – sie beschäftigte mich immer wieder. Und inzwischen befeuert sie das Alter. Ob es Ambitionen nach Leistungsbeweisen sind oder die Suche nach neuen Abenteuern: Alles verfolge ich mit einer gewissen Ungeduld – warum soll es mir anders ergehen als anderen alternden Männern? Ich versuche, mich den Zeichen der Vergänglichkeit zu widersetzen, aber muss auch erkennen, dass Utopien und Träume im Alter eher Grenzen verdeutlichen, als dass sie verwirklicht werden möchten. Was kann ich noch hinterlassen? Zum Nobelpreis hat es nicht gereicht … Aber ich will doch noch einiges aus diesem letzten Lebensabschnitt herausholen. Ihm noch möglichst viele sinnliche Momente entlocken. Auch wenn ich ernüchternd feststelle, dass die belebenden Kräfte der Vergangenheit nachlassen, nicht mehr dieselben sind und abwägendes Entsagen sich mit Ansprüchen und Sehnsüchten vertragen muss, spüre ich in mir noch – durchaus erstaunt und nicht ohne Selbstgefälligkeit – das unruhige Herz eines Kindes, das sinnliche Begehren der Jugend und die Romantik des jungen Mannes, der ich nicht mehr bin.
Ein Resultat dieses unruhigen Neubeginns waren zunächst die SES-Aktivitäten in China. Die sechs Reisen nach Shandong und Henan haben mich (und nach meinem ersten Einsatz als Palliativ- und Schmerzexperte in Rizhao) auch Ricki mit ihrer logopädischen und neurorehabilitativen Erfahrung in den letzten Jahren sehr begeistert. Zwar haben mir die Versuche, Chinesisch (oder besser: Mandarin) zu lernen, gezeigt, dass Lernwille und Lernfähigkeit im Alter durchaus in Konflikt geraten. Natürlich: Es gibt inzwischen diese wunderbaren Übersetzungs-Apps, die eine Verständigung mit Menschen aus anderen Kultur- und Sprachregionen erleichtern, zur Kommunikation allerdings sind sie nur bedingt bis gar nicht geeignet. Bei meinen Anstrengungen, die Grundlagen der chinesischen Sprache zu erlangen, machte sich mein Seniorenmalus doch schon deutlich bemerkbar. Ich mühte mich ab, ohne belohnt zu werden. Das System der chinesischen Grammatik ist eigentlich bestechend einfach und einleuchtend. Mit wenigen Wörtern kann man sich verständlich machen, wenn es nur gelingt, diese irgendwo im Gedächtnis gespeicherten Wörter abzurufen und richtig auszusprechen. Aber genau daran scheiterte es bei mir. Noch mühsamer wird es, wenn man auch die Schriftzeichen entziffern bzw. erinnern will, und so schaffte ich es bei aller Anstrengung leider nicht, auch über die landeseigene Sprache mit den Menschen in China zu kommunizieren. Trotzdem eine großartige Herausforderung und eine mich weiterhin beschäftigende Erfahrung.
Während der meist drei- bis vierwöchigen Einsätze als SES-Experte konnte ich mich eindrucksvoll davon überzeugen, mit welch atemberaubender Geschwindigkeit die politische, technologisch-ökonomische und zivilisatorische Entwicklung in China in den letzten Jahren erfolgt ist. Keiner kann sich ihr entziehen. Die Aufenthalte in China haben meinen »westlichen« Blick auf die Welt relativiert. Ich war erstaunt, wie gut die Menschen, denen wir in China begegnet sind, über Deutschland Bescheid wussten. Auch wenn Europa und besonders Merkel-Deutschland von den Chinesen sehr geschätzt wurde, habe ich in China erstmals und zunehmend den Eindruck gewonnen, dass die Jahre der europäischen Dominanz in der Welt zu Ende gehen und sich die Machtkonstellationen auf unserer Erde wieder einmal verändern.
In China bestehen zu grundlegenden Begriffen unseres Wertesystems andere Vorstellungen und auch andere Umgangsweisen. Beispielhaft anführen lassen sich hier das unterschiedliche Verstehen zu den in unserer Kultur mit Recht hoch bewerteten Begriffen wie individuelle Freiheit und Demokratie, Selbstverwirklichung, Rechte und Menschenrechte sowie geistiges Eigentum. Dafür haben Freundschaft, Harmonie, Achtung im Miteinander, Erziehung und Höflichkeit einen vielleicht höheren Stellenwert als bei uns. Zu den grundlegenden ethischen Prinzipien der konfuzianischen Philosophie bzw. Ethik gehören die Mitmenschlichkeit und die Sittlichkeit. Sie bestimmen auch heute noch das Leben und umfassen die Formen, Regeln und Pflichten der Etikette und der Konventionen. Und so stellt sich – trotz aller Kritik an den Totalitaristen – für mich die Frage, ob wir nicht auch vom heutigen China – besonders unter Berücksichtigung der Rehabilitierung früher geächteter chinesischer Traditionen, in denen zwar eine hierarchische Ordnung durchaus betont wird, – für unsere vielleicht zu sehr an den Entfaltungspotenzialen des Individuums orientierten Wertvorstellungen etwas lernen können.
Leider haben die Corona-Pandemie, vielleicht aber auch die für europäische »Langnasen« immer schwieriger zu akzeptierenden politischen Entwicklungen mit einem machtvollen Nationalismus und schwer nachvollziehbaren Restriktionen von Informationen und individuellen Freiheitsrechten, zu einer ergebnisoffenen Zwangspause geführt, sodass ungewiss ist, ob es nochmals zu einer Fortsetzung dieser SES-Einsätze kommt. Diese wurden von den an Palliative Care in China sehr interessierten Kollegen vor Ort sicherlich geschätzt und haben zu eindrucksvollen Begegnungen und inzwischen auch zu friendships mit vielen Menschen geführt, die von uns achtsam mit WeChat gehütet und gepflegt werden. Als Geste der Anerkennung wurde mir vor einigen Jahren sogar die Ehrenbürgerschaft in der Provinz Shandong verliehen.
Zum Neubeginn der letzten unvollendeten Jahre gehörte auch, dass Ricki und ich immer mehr Zeit am Thunersee verbrachten. Zunächst waren es nur drei bis vier Wochen jährlich, in den letzten Jahren sind die Fluchten ins »Haus Bärli« mit dem faszinierenden Panoramablick auf den See und die Oberländer Berge immer länger geworden, zumal sich die WLAN-Konnektivität in dem früheren »Funkloch« merklich verbessert hat. Im ersten Corona-Jahr 2020 wurden wegen der Lockdown-Maßnahmen aus den geplanten drei Wochen sogar fünfeinhalb Monate …
In der Schweiz entdeckte ich das Wandern als Leidenschaft – oder genauer: das wandernde Lesen, das mich in den letzten Jahren mehrere Stunden täglich beschäftigt und gleichzeitig als Test für die Belastbarkeit meiner etwas insuffizienten Herzklappe auch einen gesundheitlichen Zweck erfüllt. Nach einem Skiunfall im Berner Oberland, den ich mit einer intensiven »außerkörperlichen Erfahrung« (out-of-body experience – OBE) verbinde, hatte ich es zwar wieder auf die geliebten Bretter zurückgeschafft. Doch die Skitage sind in den letzten Jahren – selbst an Sonnentagen und auf blauen Pisten – immer seltener geworden, zumal auch Rickis Lust am Schifoahrn merklich abgenommen hat.
Auch wenn Berge und Schnee schön sind: Ich habe mich mit dem lesenden Wandern unabhängig von den immer seltener mit gutem Schnee bedeckten Pisten gemacht und wandere nicht nur in der Schweiz, sondern überall und wie ich es einrichten kann. 20 km oder 25 000 Schritte als tägliches Ziel werden zwar nicht immer erreicht, aber immerhin habe ich in den letzten dreieinhalb Jahren mehr als eine halbe Weltumwanderung hingelegt – natürlich mit erheblichem Verbrauch an Schuhen und nicht ohne Blasenpflaster. Der Strandweg zwischen Spiez und Faulensee, auf dem schon Sepp Herberger die deutschen – und vor allem Pfälzer – Fußballer 1954 zur Weltmeisterschaft fit machte, der Panoramaweg sowie der Spiezberg gehören zu meinen Lieblingsrouten in der Schweiz. Nach sicherlich weit über 1 000 Wanderungen kenne ich inzwischen fast jeden Stein und jeden Baum und doch entdecke ich immer wieder neue Blicke auf den See und die Oberländer Berge, die mich erstaunen, berühren, zum Innehalten zwingen. Die Bilder vermitteln ein Gefühl der Erfüllung, das mit Wehmut verbunden ist, aber auch mit Dankbarkeit und Demut. So ist mir der ererbte Flecken Erde am Thunersee nicht nur wegen seiner unbestreitbaren Schönheit ein kostbarer Rückzugs-, Kraftspende- und Ruheort geworden. Hier verbindet sich die Geschichte meines Lebens mit Gegenwartsfreuden und Sorgen, aber auch Zukunftsaussichten wie nirgendwo sonst.
Wenn ich auf den See, die Wolken und die Berge, blicke, ergreift mich oft ein Gefühl vom Stillstand der Zeit, das die Ungeduld des Alterns beruhigt und das ich gerne noch eine Weile erleben möchte. In Berlin wandere ich auf den Straßen des Westends, häufig über den Olympiapark in die Murellenschlucht oder durch die Stadt, in den Tiergarten, durch den Grunewald, am Wannsee und an der Spree entlang. Und immer wieder treibt es mich auf Friedhöfe. Wenn ich einige Tage nicht auf dem Waldfriedhof Heerstraße – mein Favorit, auch weil er so gut erreichbar ist und so viele Geschichten erzählt – gewesen bin, fehlt mir etwas. Es gibt kaum einen Ort in Berlin, den ich in den letzten Jahren nicht auch zu Fuß erreichen wollte, erreichen konnte und auch immer noch zu Fuß erreichen kann! Ich spare mir die U-Bahn, wenn ich zum Bahnhof Spandau laufe oder in die Philharmonie …
Allerdings wird das regelmäßige Wandern allmählich nicht nur mühsamer, sondern auch zum »Zeitdieb«, sodass ich nach weniger zeitaufwendigen Alternativen suche. Aber Stillstand – auch wenn ich ihn sehr genieße – kann ich mir als sinnvollen Lebensinhalt nicht vorstellen. So wurde und bleibt das Altern eine Auseinandersetzung mit bedrängender Zeit. Auch beim Golfspielen, das ich eigentlich nur im Wendland unregelmäßig praktiziere, bemerke ich inzwischen, dass die Steigerungsfähigkeit nachgelassen hat – eine durchaus ernüchternde und schmerzliche Einsicht. Ich bewundere die langen Abschläge von Marco, dessen Handicap inzwischen deutlich besser ist als meins. Ja, was soll ich schreiben? Die besten Jahre liegen hinter mir. Überrascht das?
Natürlich gab es neben den erlebnisreichen SES-Reisen mit Einsätzen in China und einmal in Marokko auch weitere eindrucksvolle Reisen – es ist ja ein Privileg des gesunden Alters und der finanziellen Möglichkeiten, relativ spontan unterwegs sein zu können, um diesen Planeten kennenzulernen. Wir konzentrierten uns auf Europas Geschichte und Kultur. Die Erfahrungen der Reisen mit Achim und Renate nach Spanien, Italien und Griechenland, nach Wien, Salzburg, Krakau, Barcelona und Rom, teilweise zusammen mit unseren Berliner Freunden Sofie und Helmut gehören zu den schönsten Erinnerungen der letzten Jahre. Die Planungen der Reisen machten in der Phase der zunehmend verrinnenden Frist die Zukunft – nicht zuletzt durch Achims anregende, kulturgeschichtliche Vorbereitungen und Beiträge – immer wieder zum herausfordernden Planungsprojekt. In unserem System der unterschiedlichen Perspektiven und des Vielbeschäftigtseins waren gemeinsame Terminfindungen manchmal schwierig. Die große Kreuzfahrt über verschiedene Ozeane oder nur in die Fjorde Norwegens blieb auf der Strecke, allerdings nicht aus terminlichen, sondern vor allem aus ideologischen Gründen. Die gmeinsamen Reisen bleiben mit Bildern der Dankbarkeit im Gedächtnis. Mit Freunden geteilte Lebensfreude und gemeinsames Erleben sind ein Geschenk und soziale Erfahrungen, die dem Alter – trotz aller Einschränkungen – auch neue Dimensionen bringen. Während man unterwegs immer häufiger als älterer oder sogar alter Mensch erkannt wird, fühlt man sich selbst meist jünger. Für das Jahr 2026 haben wir uns in Barcelona zur geplanten Fertigstellung der Sagrada Família verabredet, deren Baubeginn immerhin ins Jahr 1882 zurückreicht. Allerdings hat die Corona-Pandemie zu einer weiteren Verzögerung der Fertigstellung geführt, sodass die Reisepläne der »greisen Alten« ins Wanken geraten. Aber auch das Unvollendete hat seinen Reiz. Ich verbinde allerdings mit diesen von sehr viel freundschaftlicher Verbundenheit geprägten Reisen nicht nur Dankbarkeit, sondern auch persönliche Flashbacks, die mich überrascht und beschäftigt haben: klerikale Kneipen der katholischen Priester in Rom 1963 und 1964, in denen es die besten und billigsten Spaghetti und kostenlosen Wein gab: »Sacro e profano«; ein Sonnenaufgang in Barcelona 1965 nach einer verliebten, kurzen Nacht mit Frühstück auf den noch schlafenden Ramblas; auf den Spuren Kafkas im Prager Frühling 1966, Laterna magica und eine weitere amour fou; bewegende Begegnungen mit Überlebenden des Warschauer Ghettos und DDR Oppositionellen 1989 in Auschwitz beim Erklingen des abgebrochenen Trompetensignals Hejnał in Krakau; die mich immer noch begleitenden Stigmata meiner klassisch humanistisch geprägten Schulzeit in den 50er Jahren beim Rezitieren der noch präsenten Eingangsverse der Odyssee im antiken Theater von Epidauros. Die meisten Flashbacks gab es allerdings bei Reisen nach Österreich, nach Salzburg und natürlich Wien – und es gibt sie noch, auch wenn sie in den letzten Jahren seltener geworden sind. Wen wundert es?
Zum unverzichtbaren Element meines unvollendeten Lebens in den letzten Jahren gehörte auch das regelmäßige Arbeiten. Ich empfinde es, trotz mancher Anstrengungen z. B. der zunehmenden Schwerhörigkeit, auch als Privileg, weiterhin in der Fort- und Weiterbildung bzw. der Lehre aktiv sein zu können. Die Möglichkeit, meine Altenzeit selbstbestimmt mit Arbeit zu füllen, beschäftigt zu sein und auch Geld zu verdienen, ist eine für mich wichtige Form von Sinnfindung und Self Care geworden, nicht zuletzt wegen der Bestätigung und Anerkennung, die mir dabei entgegengebracht wird. Meine Vorträge und Seminare behandeln vorwiegend palliativmedizinische, algesiologische und ethische Themen, und ich freue mich, wenn ich einen vollen Terminkalender und Jahrespläne habe und als »alter, weiser Mann« eingeladen werde. Noch habe ich das Gefühl, dass ich etwas zu sagen habe, aber vielleicht ist es manchmal auch schon so, dass man mich NOCH etwas sagen lässt. Die Grenzen der eigenen Bedeutsamkeit zu erkennen und auch anzuerkennen, benötigt kritische Selbstreflexion, aber auch aufmerksame Berücksichtigung der Rückmeldungen anderer. Das Reisen mit der, immer wieder zu neuen Überraschungen aufgelegten, Deutschen Bahn, war lange eine willkommene Abwechslung des persönlichen, aber auch beruflichen Alltags. Inzwischen ist es eine eher lästige Angelegenheit geworden, ebenso wie der wechselnde Komfort der Hotelbetten, die keineswegs einheitliche Funktionsweise von Lampen, Fernsehern, Internet, Duschen und Wasserhähnen oder die unterschiedlichen Anordnungen und Regeln der Frühstücksbuffets. Die Lehrtätigkeit in Fallseminaren zur Erlangung der Zusatzbezeichnung »Palliativmedizin für Ärztinnen und Ärzte« oder im Curriculum »Psychoonkologie« brachte mich mehrfach im Jahr mit engem Zeitplan und wenig Zeit an die gleichen Orte, so nach Westerland, Bad Segeberg, Lübeck, München, Worpswede, Kassel, Hamburg, Hannover und natürlich auch Berlin, was die Akzeptanz der verschiedenen Übernachtungsbesonderheiten immerhin erleichterte. All das fördert Altersflexibilität, oder etwa nicht? Unterrichten ist trotz aller Routine immer wieder – und bleibt immer noch – eine spannende Selbsterfahrung, weil die Gruppen sehr unterschiedlich zusammengesetzt sind und sich Spezialisten aus verschiedenen Fachdisziplinen, mit unterschiedlichen Charakteren sowie Lernstilen begegnen. Nicht immer geht das reibungslos. Ich habe allerdings in den letzten Jahren gelernt, so auf interaktiven Austausch, kommunikatives Miteinander und – wenn es geht – kritische Selbstreflexion zu achten, dass meine Herzensbotschaften meistens auch angenommen und verinnerlicht werden. Gruppenarbeit an konkreten »Fällen«, Problem orientiertes Lernen und kollegialer Erfahrungsaustausch sind wesentliche Elemente meiner Didaktik geworden. Palliativmedizinische Fallseminare gehören inzwischen zu den Geheimempfehlungen der ärztlichen Weiterbildung, deren »Erfolg« sich häufig erst viel später zeigt, nämlich in der veränderten Herangehensweise an palliative Probleme: Es geht darum, den sterbenskranken Menschen im Blick zu haben und nicht nur die Symptome und Befunde seiner Diagnosen. Die Frage nach dem Verstehen berührt immer auch die Bereitschaft, etwas aus der Perspektive des anderen zu sehen. Diesen Hinweis habe ich von Hans-Georg Gadamer schon vor fast 60 Jahren in Heidelberg bekommen. Und seine Bedeutung gewinnt auch noch im Alter an Tiefe. Zu dieser Einsicht gehört wohl auch, dass der andere recht haben könnte. Auch diese Weisheit stammt von Gadamer.
Besonders beschäftigt hat mich in den letzten zehn Jahren das Projekt eines Fernlehrgangs zur Palliativbegleitung, dessen inhaltliches Konzept ich zusammen mit einer kleinen Autorengruppe der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP) für das Hamburger Institut für Lernsysteme (ILS) entwickelte. Grundlage dieses Lehrgangs war die Erkenntnis, dass das Thema »Palliativ« in alle gesellschaftlichen Bereiche hineinreicht und eigentlich niemand für sich allein stirbt. Die Idee dieses Fernlehrgangs war es, im Rahmen der von mir 2008 initiierten »Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutschland« das gesamtgesellschaftliche Bewusstsein zum Thema »Palliativ« zu fördern. Mithilfe von Lehrheften im Rahmen eines Fernlehrgangs sollen Wissen und Verständnis über die schwierigen und uns alle angehenden wichtigen Problemen am Lebensende verbreitet werden, Umgangsmöglichkeiten mit diesen Problemen aufgezeigt und die Angst vor der Konfrontation mit Sterbesituationen gemindert werden. Palliativversorgung und Palliativbegleitung sind nicht nur Herausforderungen für kompetente multiprofessionelle Teams, sondern gehen uns irgendwann im Leben alle an. Auch wenn die Startbedingungen für den Fernkurs nicht ganz einfach waren, hat sich dieses Projekt recht erfolgreich entwickelt, sodass mich die Kommentierung und Korrektur der Einsendeaufgaben der Studierenden inzwischen wirklich tagtäglich eine gewisse Zeit als »Fernlehrer« beschäftigt. Für fast vier Jahre von Frühjahr 2019 bis Winter 2022 fand ich in einer ehemaligen Teilnehmerin dieses Lehrgangs inspirierende Unterstützung bei den Vertiefungsseminaren in Hamburg sowie in den gemeinsam entwickelten Webinaren. Im »Team-Teaching« wurden die Seminare zu einem Highlight von prägender Begegnung und interprofessionellem Austausch, was uns die fast durchweg sehr positiven Rückmeldungen immer wieder bestätigten. Für 2023 wurden die Karten neu gemischt und ich stecke in Anpassungsprozessen, um gemeinsam mit ILS den Kurs für die weitere Zukunft neu zu strukturieren.
Die Teilnehmenden des Fernlehrgangs stammen aus ganz unterschiedlichen sozialen Schichten und gesellschaftlichen Bereichen: von der Professorin bis zum Bauarbeiter, von der gerade examinierten Altenpflegerin bis zum berenteten Lehrer, was sich auch in der Bearbeitung der Einsendeaufgaben zu den sicherlich anspruchsvollen Lehrheften niederschlägt. Neben Beschäftigten in Gesundheitsund Sozialberufen sind es u. a, auch Gärtnerinnen, Sekretärinnen, Stewardessen, Polizisten, Banker, Busfahrer und Ehrenamtliche, die an diesem Kurs teilzunehmen. Viele kommen aus mir unbekannten Orten Deutschlands und des deutschsprachigen Europas, es gab sogar Teilnehmerinnen, die in Indien, Afrika und den USA lebten und sich mit diesem Fernkurs palliativ weiterbildeten. Es sind häufig sehr persönliche Erfahrungen mit Sterben, Tod und Trauer, die eine nähere Beschäftigung mit dem Thema »palliativ« anregen und begründen. Leider sind es oft besonders tragische Todesfälle, die für die Ausrichtung des eigenen Lebens bedeutsam werden. Und es ist trotz aller Zurückhaltung sicherlich eine gute und wichtige Aufgabe, sich in der Vorbereitung auf die Hilfebedürftigkeit und evtl. auch das Sterben im persönlichen Umfeld mit palliativen Möglichkeiten und Prinzipien zu beschäftigen. Häufig habe ich in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, dass Gespräche, wenn ich mich als »Palliativexperte« geoutet habe, sehr rasch in eine persönliche Richtung und vertrauensvolle Intimität gelaufen sind.
Palliativ geht uns alle an. Der Tod lauert immer und ist ein Lebensbegleiter, der uns immer wieder überrascht. Deswegen ist es gut, sich frühzeitig mit manchen Fragen zu beschäftigen, die wir gerne von uns schieben. Auch das Thema Demenz ist inzwischen ein Erfahrungsbereich, dem sich kaum noch jemand entziehen kann und für den palliative Aspekte wichtig sind.
Mein gelebtes Leben der unvollendeten letzten 10 Jahre hat einen Rhythmus gefunden, mit dem sich die rasch verfließende Restzeit gut ertragen lässt: ohne Notwendigkeit nicht zu spät aufstehen, zwei Stunden Tagesspiegel, gelegentlich auch die TAZ lesen und aktuelles erledigen, Rickis Bedürfnis nach einem rechtzeitigen, biogerechten und schmackhaften Essen gerecht werden, mit der Wetter-App zwei bis drei möglichst regenfreie Stunden zum auditiven Wandern finden, die Zeit (die mir immer häufiger fehlt) für Arbeiten am Computer, für Kommentare, Korrekturen, Steuererklärung, Korrespondenzen optimal nutzen, soziale Kontakte, Austausch und Freundschaften pflegen, die meist viel zu kurzen, aber manchmal auch sehr langen Abende mit Konzerten, Kultur, Kino oder TV (zumeist reicht‘s nur für Markus Lanz) füllen, bis ein oder zwei Gläser Rotwein (im Sommer auch Rosé) das Einschlafen erleichtern. Auch wenn die Tage mit Aktivitäten rasch verfliegen, erscheinen sie – nicht zuletzt durch die pandemiebedingten Veränderungen der sozialen Kommunikation – leerer, aber auch flüchtiger als früher. Nichts wird wirklich versäumt. Mit Videokonferenzen, Online-Vorträgen und Webinaren vergeht die Zeit oft schneller als früher, und doch bleibt immer etwas, was man vermisst.
So richtige Höhepunkte bringen die Tage nicht mehr und die Nächte haben ihre lustvolle Faszination verloren – eher Zwischenstationen mit Unterbrechungen. Die Attraktivität des tiefen traumlosen Schlafes wechselt mit Phasen halbwachen Wartens, fantasievollen Erinnerns und bilanzierenden Grübelns. Auch wenn ich mir noch nicht vorstellen kann, die Zeit des unvollendeten Lebens mit weniger Aktivitäten zu füllen, kann ich nicht leugnen, dass der Anteil der rezeptiven Aktivität in Relation zur produktiven Aktivität allmählich zunimmt. Im bescheidenen Mikrokosmos eines eher auf eine längere Frist hin orientierten alternden Menschen sind die 24 Stunden eines Tages auch zu einer Herausforderung geworden. Die Routine der Bewältigung schafft Zufriedenheit – auch wenn die Produkte weniger wertgeschätzt und anerkannt werden als die Anstrengungen, die mir die Aktivitäten bereiten. Der Traum vom Ruhm und der geschichtlichen Bedeutsamkeit meines Lebens ist einer realistischen Einsicht und gesunden Bescheidenheit gewichen. Ich lebe, also bin ich! Während es in den ersten Aktivitätsjahren der 70er eher versäumte Gelegenheiten, nicht wahrgenommene Chancen oder vielleicht schon verlorene Fähigkeiten waren, die mich beim Zurückblicken wehmütig machten, konzentriert sich mein Blick heute viel mehr auf die Gegenwart, auf Augenblicke. Es sind weniger persönliche Erwartungen, Sorgen und Ängste, die mich beschäftigen, als die Hilflosigkeit, mit der sich die Gegenwart der Kontrolle entzieht: Die Aussichten in die Zukunft sind eigentlich nie so ungewiss und trübe gewesen wie gerade jetzt. Klimaund Corona-Krise, der Niedergang demokratischer Errungenschaften und der die Welt erschütternde Krieg Putins gegen die Ukraine haben zu einer Wende geführt, in der ich im Rückblick auf mein bescheidenes Leben nur feststellen kann: Die besten Jahre liegen hinter uns. Die Selbstverständlichkeit der Gewöhnung und die Zweifel, dass es statt nationalistischer Machtinteressen doch noch gemeinsame Anstrengungen zur Gestaltung einer lebenswerten Zukunft geben wird, bedrücken mich. Wenn ich bei unseren Enkeltöchtern Ella, Matilda, Mira und Martha ihre Art der Entdeckung und Aneignung der Welt beobachte, erfüllt mich eine sehnsüchtige Wehmut und manchmal der Wunsch, für die frühe Lebensphase meines Lebens eine erneute Chance zu bekommen. Die Zeit der Kindheit, in der das bedingungslose Wollen im Vordergrund steht, vergeht zu rasch. Und wenn ich sehe, wie mit der Entwicklung des Fühlens und Denkens die Herausforderungen, sich in dieser Welt auch zurechtzufinden, nicht einfacher werden, wird mir der durch großväterliche Erfahrungen auch geprägte Blick auf mein letztes Lebensjahrzehnt besonders bewusst. Wie stolz und fast verlegen macht es mich, wenn ich als Großvater von meinen Enkelmädchen geliebt und respektiert werde, auch wenn ich es selten geschafft habe, ausdauernd mit ihnen zu spielen, zu basteln oder zu musizieren. Leider kann ich ihnen – was ich mir noch mehr unter einem guten Großvater vorstelle – auf ihre vielen Fragen keine guten oder zumindest befriedigenden Antworten geben und die Welt so erklären, dass meine Einsichten ihren Lebensweg sicherer machen. Die Lebensfreude, die mir in den letzten Jahren Ella, Matilda, Mira und Martha geschenkt haben, ist für mein großväterliches Leben eine größere Bereicherung geworden als die, die ich meinen Enkeltöchtern geben konnte. Es sind wirkliche Highlights des Glücks, mit ihnen im Wendland oder in Berlin in die Eisdiele zu gehen, und ihre Freude zu sehen, wenn es mir gelingt, ihnen mit einer kleinen Überraschung Wünsche zu erfüllen. Ihr Leben in die Zukunft auch materiell ein wenig zu unterstützen, ist mir wichtig und macht mir auch Mut in dunkleren Stunden. Wie anders waren die Bedingungen meiner Kindheit und meine Art, mich in dieser Welt zurecht zu finden. Wie schon erwähnt, sind meine beiden Großväter vor meiner Geburt gestorben, ich habe sie also nie bewusst erlebt. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass sie erwähnt wurden. Und in der Wirklichkeit meiner Kindheit und Jugend spielten sie allenfalls als Fiktion eine Rolle. Insofern sind meine Enkelinnen ein besonderes Geschenk, durch das mir in den letzten zehn Jahren die Erfahrungen meiner großvaterlosen Kindheit und Jugend ins Bewusstsein gekommen sind. Die fehlenden Vorbilder erklären aber auch, warum aus mir kein übermäßig talentierter Großvater geworden ist. In meiner Kindheit gab es zwar Großmütter, aber wenn es um Vorbilder ging, dann konnte und sollte dies nur mein Vater sein. Ich war stolz und später auch etwas bedrückt, dass ich Hans-Christof genannt wurde. Und die Betonung lag auf HANS, denn es war der Wunsch meines Vaters gewesen, in seine Fußstapfen zu treten.
Auch wenn mein eigenes Leben an Glanz und Schwung verliert, wird es durch die Aktivitäten der Enkelgeneration immer wieder auf seine Bedeutsamkeit verwiesen. Immerhin fühle ich mich trotz meines bisweilen altersstarrsinnigen Wartestands noch von fridays for future und Greta angesprochen. Wenn ich meist ohne sichtbare Empörung, sondern eher von einer gewissen Form der »Altersskepsis« bzw. »Altersbetrübtheit« motiviert, immerhin an den großen Demonstrationen in Berlin in den letzten Jahren teilgenommen habe (auch, um dort dem Rest der Familie zu begegnen …), dann erfüllte mich diese Aktivität doch mit sinnlicher Freude: Es ist ja auch eine Form des Wanderns! Das unbefangene Engagement vieler junger Menschen zu erleben, ihre Bereitschaft, für eine lebenswerte Zukunft auch Opfer bringen zu wollen, zu verzichten, sich biologisch korrekter zu ernähren und dafür auf die Straße zu gehen, ist beeindruckend und gleichzeitig überkommen mich Zweifel und ungute Gefühle, ob das alles genügt. Zuversicht ist aus meiner Perspektive nicht angesagt. »How dare you?« wurde den politisch Verantwortlichen von Greta Thunberg entgegengeschleudert, um Scham- und Schuldgefühle angesichts der klimatischen Bedrohungen zu provozieren. »Schämt Euch!« war die übliche Floskel, mit der die Großelterngeneration unsere Eltern erzog. Meine Generation hat sich gegen das Schämen gewehrt: Die 68er-Generation ist angetreten für eine Welt, in der wir uns nicht schämen wollten und sollten! Und entsprechend gelingt es mir heute als alternder Mensch vielleicht nicht ausreichend und konsequent genug, mich zu schämen, wenn die Versäumnisse meiner Generation angeprangert werden. Schuldgefühle und Selbstzweifel haben mich mein Leben lang begleitet und sind vielleicht ein eigentümliches Charakteristikum meines Lebens. Sie sind im Verlaufe der letzten Jahre einem der eigenen Grenzen bewussten Selbstgefühl gewichen, mit dem ich mich weniger hinterfrage, sondern mein Leben mit Blick auf die Ablaufuhr und sicherlich mit eingeschränkten Kräften im wahrsten Sinne des Wortes »auf Schritt und Tritt« auskoste: Mein Fußabdruck soll Spuren hinterlassen! Gut, den CO2-Ausstoß behalte ich dabei im Blick. Versprochen!
Auch wenn die besten Jahre vorbei zu sein scheinen – zumindest aus meiner Sicht – zu einer nüchternen Lebensbilanz bin ich noch nicht bereit. Sicherlich bin ich in den letzten Jahren gelassener und demütiger, vielleicht sogar glücklicher geworden. In der zufriedenen Genügsamkeit des unvollendeten Lebens verschiebe ich die Danksagung für das im Rückblick gelungene Leben noch vor mir her. Die Faszination, mit der ich mein Leben und seine Entwicklungsstufen bis zum heutigen Tage betrachte, wird begleitet von dem Wunsch, noch eine Weile den Zukunftsweg meiner Enkeltöchter begleiten zu dürfen – auch wenn das Alter, dass spüre ich schon, nicht mehr so unvorstellbar viel Zukunft zulässt. Altern wird beschwerlicher und das ist durchaus eine bittere Erkenntnis. Während ich mich mit mir versöhne, entdecke ich – wohl nicht nur ich – bei kritischer Altersreflexion und mit nicht geringem Erstaunen äußere und innere Ähnlichkeiten mit meinen Eltern, denen ich zu verdanken habe, dass ICH geworden bin, aber auch Ähnlichkeiten und Bestätigungen, dass man seinen Wurzeln letztlich nicht entrinnen kann.
Was Du ererbt von Deinen Vätern hast … Hinweise zur Ähnlichkeit mit meinem Vater begegnen mir häufiger und eindrücklicher das Gesicht, die Mimik, die Statur meines Vaters, der forsche Schritt ist nicht zu leugnen. Sie sind sicherlich eine Bestätigung, wo ich herkomme. Wenn ich in den Spiegel schaue oder Fotos des 80-Jährigen herauskrame, erkenne ich ihn in mir, auch wenn ich keine Krawatte trage und sicherlich weniger korrekt und modisch gekleidet bin als er. Mit anderen Gemeinsamkeiten gibt es Akzeptanz- und Identitätsprobleme. Ein Beispiel soll auch hier genügen: Zu Vaters penibler Art und seiner buchhalterischen Sparsamkeit, die auch einen Hang zum Geiz offenbarte, gehörte seine Neigung »Schnäppchen« zu finden: billige Angebote, Gelegenheiten, die deshalb wahrgenommen wurden, weil sie »günstig« waren, nicht unbedingt, weil sie benötigt wurden. Er hat diese – wohl in Indien gelernte – Neigung gepflegt und sie hat mich bei ihm schon als Kind gestört. Wie peinlich! Inzwischen bin ich selbst der Faszination für Schnäppchen erlegen. Während Vater ein geschickter Kaufmann und Verhandler war, suche ich bei Ebay oder im Netz und erstehe nicht selten Dinge, die ich eigentlich nicht brauche. Und auch meine Mutter entdecke ich in mir. Aber das ist eine andere Geschichte …
Vielleicht werden Ella, Matilda, Mira und Martha auch irgendwann bei sich Eigenheiten finden, die auf mich verweisen, zumindest aber auf ihre Eltern. Dennoch: Die virtuellen Erfahrungen und weniger das real Erlebte werden die Lebenswelten der Zukunft sehr viel mehr bestimmen als meine Jugend, die meiner Eltern und natürlich besonders auch die der Großeltern, die zumindest eines gemeinsam hatten: die erkennbare Welt. Die Zeiten haben sich verändert und der Boden der Vergangenheit hat für die Nachgeborenen schon eine ganz andere Bedeutung als für meine Generation oder für meine Töchter.
Auf meinem eingangs genannten Lieblingsweg, dem Strandweg am Thunersee, lief ich in den letzten Jahren regelmäßig an einer Bank vorbei, auf der ein Satz eingraviert ist, der mich nachdenklich macht: »Auch eure Großkinder sollen in Zukunft die Natur genießen können …« Ja, darum geht es im Alter doch immer wieder: Die Sorge um die Nachgeborenen macht das vergehende Leben wichtig und sinnvoll, zumindest möchte ich das von mir behaupten. Es geht nicht mehr nur um mich, sondern eigentlich um das, was ich für die Zukunft noch hinterlassen kann. Das sorgt und kümmert mich, meine Erinnerungen sollen auch dazu gehören. In Erinnerung an die Fußballweltmeisterschaft 1954 sind auf dem sogenannten Herberger-Pfad. drei grob in Holz gehauene Statuen für die drei deutschen »Helden von Bern« zu finden: neben Sepp Herberger, dem legendären Trainer, Fritz Walter aus der Pfalz und Helmut Rahn, der das Tor zum Sieg geschossen hat. Sie waren meine großen Idole in der Lebensphase, die meine Enkelkinder gerade durchleben. Deswegen wandern beim Wandern meine Gedanken wehmütig 70 Jahre zurück. Manchmal versuche ich mir vorzustellen, wie es für sie dort in 70 Jahren aussehen mag. Die derzeitige Wirklichkeit wird unseren Planeten so verändern, sodass sich die wenigsten die heutige oder gar die Welt vor 70 Jahren noch vorstellen können – auch wenn sie in der Erinnerung lebendig ist.
Mit 80 habe ich – statistisch gesehen – die durchschnittliche Lebenserwartung eines Mannes gerade erreicht. Nun geht es weiter, das unvollendete Leben soll mit den Zugaben, die mir geschenkt werden, in ein vollendetes Leben überleiten. Diese Chancen der Restlaufzeit wahrzunehmen, wird mich hoffentlich noch eine Weile beschäftigen.
Körper und Geist werden müde. Die Zeit des Zweifelns, Kämpfens und des Drängens geht zu Ende. Wie lange werde ich, werden wir, diese Selbstverständlichkeiten noch erleben dürfen? Und so geht mit der prognostischen Ungewissheit für die Zukunft der Blick in der Gegenwart immer mehr in die Vergangenheit zurück …
0 bis 7 Jahre
Leben wollen (1942/1943–1950)
Für die ersten sieben Jahre meines Lebens gibt es schon sehr bald keine Zeitzeugen mehr, die diese für mich als Kleinkind heute noch unvorstellbare Zeit aus eigenem Erleben darstellen könnten. Auch für mich ist das meiste mehr durch Erzählungen sichtbar geworden als durch bewusstes Erleben. Und doch begleiten mich einige Szenen – wenn auch verschwommen – wie Schatten durch mein ganzes Leben. Das Ende des tausendjährigen nationalsozialistischen Reiches, in dessen Wahn die für mich immer noch unvorstellbarsten und grausamsten Verbrechen an Menschen begangen wurden, zeichnete sich schon in meinem Geburtsjahr ab: Es wurde von den einen als Kriegswende eines brutalen von Deutschland begonnenen Weltkrieges bezeichnet, von anderen galt es als Beginn der Befreiung, in dem der Zusammenbruch oder die Kapitulation der nationalsozialistischen Diktatur nicht mehr aufzuhalten war.
Die Wirklichkeit des verbrecherischen Krieges, in dem ich geboren wurde, war ein Tabu, das meine ersten Jahre begleitete. Die Jahre meiner frühen Kindheit sind vielfach beschrieben worden. Sie stehen im Zeichen der schlimmsten globalen Erschütterung, die die Menschheit bisher erlebt hatte, aber auch für den Neubeginn in eine Epoche der Menschheit, in der das Schicksal dieses Planeten wie niemals zuvor von den Menschen selbst bestimmt wird. Diese Zeit hat mich geprägt und dazu geführt, darauf achten zu müssen und zu wollen, dass die Fehler und Gefahren, die mein privilegiertes, modernes Leben begleiteten, unsere Nachfolgegenerationen nicht, zumindest aber weniger gefährden. Und in diesem Bewusstsein stecken ebenso Zweifel, ob allein das Wissen darüber ausreicht, dass wir auch für die Zukunft der Erde und nicht nur für die Gestaltung der Gegenwart Verantwortung tragen. Wissen wir denn immer noch zu wenig, um ins notwendige und nachhaltige Handeln zu wechseln? Welcher Impulse bedarf es? Der Beginn meines Lebens liegt in einer Zeit, in der es in Deutschland im wahrsten Sinne des Wortes ums Überleben ging. Ich bin dankbar, dass ich diese Zeit erleben konnte. Erinnerung und Vorstellung verschwimmen. Die wichtigsten Bilder sind zunächst die Fahrzeuge, mit denen mein Vater unterwegs war, um lebenswichtige Sachen zu besorgen, zu hamstern oder etwas zu organisieren: ein klappriger Leiterwagen aus Holz, ein altes Fahrrad und später ein knatterndes Moped. Er war eigentlich immer auf Reisen. Die verschwommenen Bilder erinnern an eine Zeit, die heute unvorstellbar ist, von Nöten und Trümmern geprägt, die der Krieg hinterlassen hatte, und von denen ich als Kind zwar berührt, aber doch wenig geschädigt wurde. Im Vergleich zu vielen anderen ging es uns in der Idylle Neustadts wahrscheinlich sogar gut, wir waren ja trotz allem eine erhaltene kleine Kriegsfamilie: Vater und Mutter lebten, wir hatten ein Dach über dem Kopf und einen Keller voll mit Kohlen – trotzdem war es manchmal kalt, das weiß ich noch … Vater hatte durch seine Verbindungen zu französischen Besatzern auch viele nützliche Beziehungen, die uns merklich geholfen haben. Wie er das schaffte, erzählte er uns nicht, und ich war zu klein, um mich für seine Geschicklichkeit im Organisieren und Hamstern zu interessieren. Ich kann mich nicht erinnern, irgendwann als Kind gehungert oder gefroren zu haben, wie das von vielen anderen meines Jahrgangs berichtet wird. Genauso wenig erinnere ich, dass mir etwas »geschmeckt« hat: Essen war Nahrung. Es gibt ein Foto von mir, dass mich als pausbäckigen, heulenden kleinen Knirps zeigt. Zunächst scheint es, dass dies ein von Hungerödemen gezeichnetes Kind darstellt, aber es war »nur« mein geschwollenes Gesicht, das nach der Verschickung in ein Kinderheim durch eine dort erworbene Mumpsinfektion entstellt wurde: »Fast hätte ich dich nicht mehr erkannt«, erzählte mir meine Mutter, als sie mich im Kinderheim endlich abholte. Sie war entsetzt und wütend, dass man mich in der Verschickung so krank werden ließ, ohne sie zu benachrichtigen. Während Vater sich um das Überleben kümmerte, richtete Mutter ihren Blick darauf, dass wir nicht zu Schaden kamen. Sie achtete auf Moral und Wahrheit, er auf die Sicherheit.
Geboren wurde ich 1943, im Jahr der Schlacht um Stalingrad, der Judendeportationen aus dem Warschauer Ghetto und der Ermordung von Zehntausenden in den Konzentrationslagern. Die meiste Zeit meines vorgeburtlichen Lebens verbrachte ich in Berlin, in der sicheren Gebärmutterhütte. Ursprünglich bin ich also ein Berliner. Zumindest habe ich die ersten sechs oder sieben Monate meiner Existenz in dieser Stadt verbracht. Voller mütterlichem Stolz und mit meinem Strampeln im Bauch hatte Mutter sich von der Brandrede Joseph Goebbels im Sportpalast zum »totalen Krieg« hinreißen lassen, wenige Wochen bevor sie im März 1943 Berlin verließ – sicherlich ein hormoneller Irrtum. Ich habe mich immer – wie viele meiner Generation – geschämt, in der Nazizeit geboren zu sein. Auch wenn die vor aller Öffentlichkeit begangenen grausamen und unvorstellbaren Verbrechen uns Nachgeborenen nicht angelastet werden können, waren und blieben sie prägend für mich. Vater und Mutter waren stille Dulder gewesen. Nein, Nazis waren die Eltern nicht und doch …
Ich wurde an einem Donnerstag, dem 17. Juni 1943 geboren, ein historisch nicht erwähnenswerter Tag, aber derselbe Tag, an dem auch Fritz Teufel zur Welt kam, ein in den 70er Jahren bekannter linker Kommunarde, mit dem ich tatsächlich gelegentlich verwechselt wurde. Da er unter besonderer Beobachtung des Staats- und Verfassungsschutzes stand, führte das an der »innerdeutschen« Grenze einige Male zu längeren Ausweiskontrollen und Wartezeiten. Damals wurden noch Geburtsdaten verglichen. Natürlich kann ich mich an die Geburt im Neustädter Krankenhaus Hetzelstift nicht erinnern, aber meine Mutter erzählte gerne, dass sie beim Anblick ihres ersten Kindes ziemlich erschrak – um nicht zu sagen bestürzt war: Ich war kein süßes, hübsches, wunderschönes Baby, wie von ihr erwartet, kein Kind, das sie spontan als Mutter begeisterte. Das Monstrum mit dem breiten Mund, einer wulstig heraushängenden Zunge, einer riesigen Kopfgeschwulst, welches ihr in den Arm gelegt wurde, trug alle Zeichen einer unerwarteten Geburtsdramatik, die den Geburtshelfer energisch zu Geburtslöffeln greifen ließ, um mich mit Gewalt aus der dunklen Gebärmutter zu befreien. Aber letztlich war Mutter doch glücklich. Schließlich hatte sie mit mir im Bauch – wie so viele Frauen damals – schon einiges erlebt. Pränatale Stressprogrammierung war damals noch kein Thema, aber ich habe den Krieg und die Berliner Bombennächte in ihr ja miterlebt (wenngleich unbewusst und ahnungslos) und auf die mir mögliche Art und Weise verarbeitet. Meine Eltern hatten am 10. September 1942 auf dem Standesamt in Ludwigshafen geheiratet. Wie alle Hochzeitspaare damals bekamen sie Hitlers »Mein Kampf« als Hochzeitsgeschenk, mit einer Widmung von Erich Stolleis, dem damaligen Oberbürgermeister, einem ambivalenten Nazi, mit dem die Eltern im späteren Leben gut befreundet waren. Nach dem Krieg pflegten sie Freundschaften eher mit Menschen, die nicht im Herzen überzeugt auf Parteilinie waren, allerdings auch nicht im Widerstand.
Mein Geburtstermin am 17. Juni 1943 lässt sich ziemlich genau auf die Zeugung in der Hochzeitsnacht im Hotel Europäischer Hof in Heidelberg am 11. September oder im Bayerischen Hof in München am nächsten Tag – 40 Wochen oder 10 Mondmonate oder 280 Tage danach – zurückverfolgen. Die Frage, ob ich ein Produkt der Hochzeitsnacht bzw. der wenigen Flittertage nach der Hochzeit geworden bin, hat mich schon als aufgeklärter Schüler Jahre später beschäftigt. War es Zufall oder Absicht? Heiratsurlaub von der