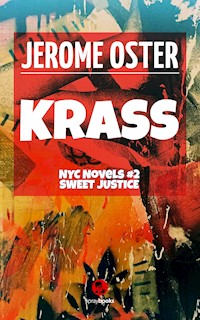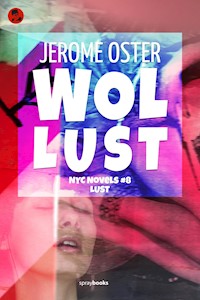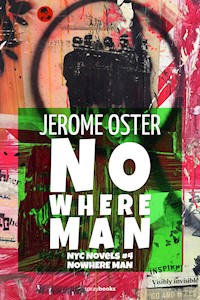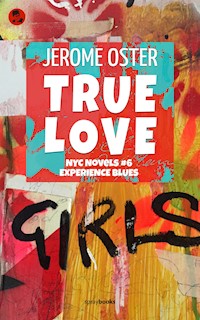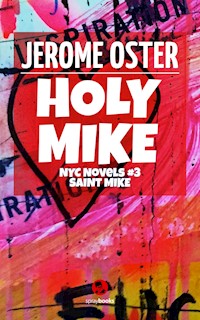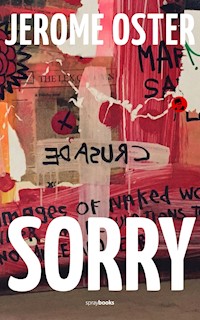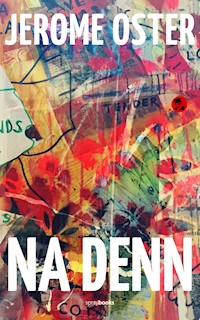0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: spraybooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
»Er versuchte, an alles Mögliche zu denken, um sich von der Kälte abzulenken, und kam schließlich auf eine Erkenntnis, die ihm intuitiv schon immer klar gewesen war: Du kannst deine Höhenangst besiegen, wenn du von einer schönen Frau nach oben gelockt wirst.« Roy Reid, Journalist aus New York, wird von einer alten Freundin nach Hamburg gerufen, weil ihr Mann vom Fernsehturm in den Tod gesprungen ist. Ob es Selbstmord war? Die Witwe und auch Reid haben da so ihre Zweifel, denn der Tote litt unter … Höhenangst. Ob also mehr dahintersteckt? Und so macht sich der New Yorker auf Spurensuche in einer ihm fremden Stadt, und während er lernt, dass die Lektüre von Proust tatsächlich ein Leben verändern kann, kommt er dem Rätsel eines Todes auf die Spur.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 116
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
ACROPHOBIA
Höhenangst
Jerome Oster
Übersetzt vonRobert Brack
Inhalt
Höhenangst
Über Jerome Oster
Guckkästen mit schmutzigen Bildern
Weiter Bücher von Jerome Oster
Saint Mike
Eins
Zwei
Drei
Das Leben tobt!
Der dritte Roman
1.Glücksraben
Erste eBook–Ausgabe 2016, v1.0
Titel des amerikanischen Originalmanuskripts »Acrophobia«
Copyright © 2000, 2016 by Jerome Oster
Als »Höhenangst« zuerst auf Deutsch erschienen 2001 in der Reihe »Schwarze Hefte«, Nr. 36, des Hamburger Abendblatts, Hamburg
Copyright © 2001, 2016 der deutschen Übersetzung by Robert Brack
Überarbeitete und neu lektorierte deutsche Ausgabe
Redaktion Doris Engelke
Cover-Foto Almut Schaude
Copyright © dieser Ausgabe 2016 bei
spraybooks Verlag Bielfeldt und Bürger GbR, November 2016
2016 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werks darf in irgendeiner Form ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
spraybooks Verlag Bielfeldt und Bürger GbR
Remigiusstr. 20, 50999 Köln
www.spraybooks.com
ISBN: 978-3-945684-27-6
Beinahe hätte Roy Reid die E-Mail gelöscht, denn sie hatte keine Betreffzeile und kam von einem unbekannten Absender. Er hatte sowieso keine Lust mehr auf E-Mails und sah nur ab und zu in sein Postfach. Es machte ihm Spaß, Leute einfach anzurufen und die Überraschung in ihrer Stimme zu hören, wenn ihnen klar wurde, dass es da draußen tatsächlich lebendige, sprechende menschliche Wesen gab. Oder er schrieb ihnen klassische Briefe. Was allerdings häufig dazu führte, dass er eine E-Mail erhielt, in der dann stand: Dein Brief ist angekommen.
Die E-Mail war kurz und knapp, wie ein Telegramm aus fast vergessenen Zeiten.
Larry ist tot. Vom Hamburger Fernsehturm gestürzt. 132 Meter tief. Bitte komm. Brauche dich als Dolmetscher. Maria.
Und nun irrte Reid über den Flughafen Paris–Charles–de–Gaulle und suchte seinen Anschlussflug nach Hamburg, der inzwischen längst gestartet sein sollte. In Europa bekommt man nie ein schlichtes Ich weiß es nicht zur Antwort, wenn man nach dem Weg fragt. Stattdessen wird wild gestikulierend irgendwohin gezeigt. Da drüben. Please go there. Là-bas. Sempre diretto. Immer geradeaus. Selbst dann, wenn der Gefragte selbst keine Ahnung hat. Was durchaus oft der Fall ist. Sie wollen einen bloß loswerden, und das möglichst schnell.
Kurz vor der Landung war in der vom New Yorker John F. Kennedy International Airport gestarteten Maschine durchgegeben worden, man solle nach rot uniformiertem Servicepersonal Ausschau halten, das einem den Weg zum Anschlussflug zeigen würden, den Weg quer durch den Flughafen – einem völlig unübersichtlichen Flughafen, übrigens, was man allerdings nicht erwähnt hatte. Der Rotuniformierte, den Reid schließlich ansprach, hielt ein Klemmbrett mit irgendeiner Liste in der Hand. Er schien alles fest im Griff zu haben.
»Deux D, à Hambourg?«, fragte Reid. Er wusste bereits, dass sein Anschluss von Terminal 2D abging, weil er auf die Ansage während des Landeanflugs auf den Charles-de-Gaulle geachtet hatte. Der Rotuniformierte sah ihn an, als hätte er nach der Anschlussmaschine zum Mond gefragt.
»’Ambourg?«
»’Ambourg, oui«, bestätigte Reid. Er hatte -burg in -bourg verwandelt, aber vergessen, Ham- in ‘Am- zu ändern. Damit kriegen sie einen immer wieder, diese Franzosen. Tja, Pech gehabt. Zurück auf Los. Oder gehe direkt ins Gefängnis.
»Please go there. Là-bas«, sagte der Rotuniformierte. Er deutete in irgendeine Richtung, aus der Reid nie mehr zurückgefunden hätte. »Consultez les écrans.«
Auf les écrans waren Flüge in alle Himmelsrichtungen verzeichnet, nur eben nicht nach Hamburg. Beziehungsweise ‘Ambourg. Reid machte kehrt, um den Rotuniformierten erneut zu fragen. Der Mann sprach jetzt mit einem anderen Passagier, einer Amerikanerin, die in Reids Maschine gesessen hatte. Reid wollte sich schon einmischen, um den Rotuniformierten als pathologischen Lügner bloßzustellen, als er auf einem Monitor keine zwei Meter neben dem Mann den Hinweis auf den Anschlussflug nach ’Ambourg las:
Hambourg – AF 1710 – 0955 – À l’heure
À l’heure … na ja, wenn man mal davon absah, dass der Flug eigentlich für 9:15 Uhr angesagt war. In diesem Fall allerdings hätte Reid ihn verpasst, denn seine Maschine war erst um neun Uhr gelandet, und inzwischen war es bereits zwanzig nach neun, weil Reid so lange gebraucht hatte, um sich im gefühlt unendlichen Labyrinth der Tunnel und Terminals des Charles–de–Gaulle zu orientieren. Von rotuniformiertem Servicepersonal war weit und breit nichts zu sehen gewesen, bis Reid endlich auf den pathologischen Lügner stieß. Die Passagiere nach ’Ambourg wurden mit einem Shuttlebus übers Rollfeld zu ihrer Maschine gebracht. Das Flugzeug stand mit einem halben Dutzend anderer Jets in der Nähe einiger Treibstofftanks. »Mesdames et messieurs«, hörte man die Durchsage des Stewards, »die Maschine wird derzeit noch betankt. Aus Sicherheitsgründen möchten wir Sie bitten, sich nicht anzuschnallen.«
Wie wär’s denn, dachte Reid, wenn man aus Sicherheitsgründen darauf verzichten würde, die Maschine zu betanken, wenn bereits Passagiere an Bord sind?
Sie rollten fast bis nach Reims, bevor sie endlich starteten, immer hinter einem Flugzeug der Euralair hinterher, das eine Entenkarikatur auf dem Leitwerk trug. Euralair? Wo – oder was – war Eural? Und wieso eine Ente? Immerhin war das Frühstück gut. »German«, wie jemand hinter Reid feststellte, und das stimmte: Brot und Käse und dünn geschnittenes Fleisch, reichlich Proteine, die er jetzt auch nötig hatte. Das Frühstück auf dem Flug vom JFK zum Charles–de–Gaulle hatte aus ein paar Keksen bestanden. Französisch eben. Proteine eingewickelt in Zucker und Fett.
Der Flughafen Hamburg-Fuhlsbüttel war leer und angenehm. Es gab mehr teure Läden, als so ein leerer und angenehmer Flughafen verdient hatte. Reid gefiel es hier, obwohl Maria gekommen war, um ihn abzuholen. Das hatte er eigentlich ausdrücklich abgelehnt, weil er den Weg in eine neue Stadt lieber allein fand.
»Herrje, Roy«, sagte Maria und drückte ihm ganz europäisch zwei Küsschen auf die Wangen. Wie üblich war er nicht auf das zweite eingestellt und musste den Kopf noch mal vorstrecken, um ihre Wange zu berühren.
»Ja«, erwiderte er, ohne zu wissen, was er damit meinte.
»Gott sei Dank«, sagte Maria. »Du und dein Deutsch. Die Leute hier und ich – ich verstehe einfach nichts.«
Kein Wunder, wenn die meisten ihrer Sätze ohne Verben blieben.
»Vergiss nicht, dass mein Deutsch mein Deutsch ist. Ich kann mir in einem Restaurant etwas zu essen bestellen und mich nach dem Weg erkundigen. Aber ich verstehe durchaus nicht alles, was die Leute mir erzählen.«
Reid bemerkte, dass Maria ziemlich europäisiert war. Sie rauchte wieder und drehte sich ihre Zigaretten sogar selbst. Drum. Die Art, wie sie das Papier ableckte und dann an der fertig gedrehten Zigarette sog, bevor sie sie anzündete, erinnerte Reid an Dinge, an die er sich nicht erinnern wollte, jedenfalls nicht jetzt, nachdem seine Exfreundin seinen ehemals besten Freund geheiratet hatte, der nun tot war, weil er 132 Meter in die Tiefe gestürzt war, wie viele Fuß das auch sein mochten, vom Fernsehturm, dem höchsten Gebäude der Stadt, 279,2 Meter hoch, wie viele Fuß auch immer das sein mochten.
»Heinrich–Hertz–Turm«, sagte Maria. »Das ist sein offizieller Name.« Sie deutete auf einen Stapel schrecklich offiziell wirkender Papiere, die sie aus ihrer Umhängetasche gekramt und auf den Tisch gelegt hatte. Maria und Reid saßen im Limerick, einem pseudo-irischen Pub im Univiertel, das auch Pizza servierte. Es lag nicht weit entfernt von Marias Pension in der Moorweidenstraße. Im Limerick fühlte sie sich wohl. Sie war Stammgast hier. Reid bestellte eine irische Pizza mit Wurst und Sardellen. Oder war es eine italienische Pizza mit Wurst und Sardellen? Jedenfalls, der Teller war warm und die Pizza sah gut aus. Draußen liefen die Leute in Lederjacken und Wollpullovern herum, obwohl es schon Frühsommer war.
Maria tippte immer wieder auf bestimmte Stellen auf den Papieren, aber Reid konnte sich auf die endlos langen Worte keinen Reim machen. »Was denn?«
»Der Turm. Dieser verdammte Fern–Seh–Turm. Weißt du, was das bedeutet? See–far–tower.«
War er hier nicht der Deutsch-Experte? War er nicht genaudeshalb hergekommen? Weil er mit endlos langen Worten umgehen konnte? Worte wie Lebensabschnittsgefährtin. Oder Spargelzeit. Oder Hauptbahnhofsviertel. Oder Fingerspitzengefühl. Oder sein absoluter Favorit: Sogeradeebenknappaneinandervorbeischießen.
»Das ist die deutsche Übersetzung von TV. Und TV ist kurz für Tele–vision und bedeutet wörtlich übersetzt Fern-sehen. Tele–fon bedeutet Fern–Stimme oder Fern-Sprecher. Tele–graf bedeutet Fern–Schreiber.« Maria starrte ihn an. Sie war mal seine Lebensabschnittsgefährtin gewesen, sein slice–of–life–girl–friend. Das hatten beide längst hinter sich gelassen, schon seit vielen Jahren. Es war ihnen sogar gelungen, Freunde zu bleiben, nachdem Maria seinen besten Freund geheiratet hatte. Und jetzt? Jetzt war sein bester Freund Larry tot, und sie saßen hier zusammen. Zusammen. Zusammenarbeiten. Zusammen–suchen.
»Was wollte er bloß da oben, Roy? Er hatte doch solche Höhenangst.«
»Darf ich dich mal was fragen? Aber reg dich bitte nicht gleich wieder auf.«
»Mein Mann ist tot. Was soll mich da noch groß aufregen? … Ach so, du willst wissen, ob’s eine andere Frau gab?«
»Und? Gab es eine?«
In einem Singsang, der klang, als würde ein Kind einem begriffsstutzigen Erwachsenen eine Selbstverständlichkeit auseinanderklamüsern, erklärte Maria: »Er war für drei Monate hier in Hamburg, um an einem Buch zu arbeiten. Er hat von der Stadt ein Förderstipendium bekommen, man hat ihm eine Wohnung zur Verfügung gestellt. Ich sollte die letzten beiden Wochen seines Aufenthalts mit ihm verbringen. Anschließend wollten wir nach Dänemark und Schweden. Selbst wenn es eine andere Frau gegeben hätte, wäre er ihr zuliebe niemals auf diesen Turm gestiegen. Nicht mal Nicole Kidman hätte ihn dort hinauf locken können.« Reid gab dem Kellner ein Zeichen, bestellte die Rechnung. »Ich geh mich mal ein bisschen umsehen.«
»Umsehen? Himmel, Roy! Du bist nicht zum Vergnügen hier!«
»Was immer ich hier tue – ich mach’s auf meine Art.«
Das brachte sie zum Schweigen. Damals, als sie noch seine Lebensabschnittsgefährtin gewesen war und er ihr Lebensabschnittsgefährte, hatte er nie so mit ihr gesprochen. Wenn er es doch mal getan hatte, war sie sofort in den Schmoll-Modus gegangen, und er hatte Tage gebraucht, um sie wieder einigermaßen aufzutauen. »Ich melde mich, sobald ich was herausgefunden habe«, sagte Reid.
»Und was mache ich solange? Im Hotel rumsitzen und auf dich warten?«
Er hatte sie gebeten, ihm kein Zimmer in ihrer Pension zu reservieren. Er wollte sich seine Unterkunft selbst suchen. Aber sie hatte trotzdem ein Zimmer für ihn gebucht, zwar nicht direkt neben ihrem, aber doch auf dem gleichen Flur, nur ein paar Türen weiter. Es war genau wie damals, als sie nur wenige Meter voneinander entfernt auf der Horatio Street gewohnt hatten. Damals waren sie zuerst Nachbarn gewesen und später für eine Weile Lebensabschnittsgefährten. »Ich geb dir Bescheid.«
»Du willst zu Fuß los.«
»Ja.«
»Als du gesagt hast, dass du dich umsehen gehst, da hab ich gedacht, das wär nur so eine Redensart, so was wie ein Witz.«
»Nein, kein Witz.«
* * *
Der Witz war er selber. So wie er angezogen war, hätte er vielleicht in ein Museum gehen können, in ein schön warmes Museum. Er stellte seinen Jackenkragen hoch, vergrub die Hände in den Taschen und ging über die Moorweidenstraße zum Mittelweg und von dort über die Alte Rabenstraße zum Park Alstervorland.
Eine Weile hielt er sich Richtung Norden, machte schließlich kehrt, verließ den Park, hielt sich am Alsterufer, ging über die Alsterterrasse zum Dammtor und weiter zum Stephansplatz. Von dort aus machte er sich quer durch Planten un Blomen auf den Weg zum Heinrich–Hertz–Turm. (Wieso hieß es eigentlich nicht Planten und Blomen? Ob irgendwelche Spaßvögel vielleicht das d vom Schild am Eingang des Parks gestohlen hatten?) Der Turm schien zum Greifen nah, gleich da drüben hinter den Bäumen.
Eine Stunde später kam er tatsächlich dort an. Er hatte eine kleine Ewigkeit gebraucht, um aus dem Park herauszufinden. Die Wege wirkten zwar sehr übersichtlich, führten allerdings nirgendwohin, sondern einfach nur weiter und weiter und weiter. Immer geradeaus. Oh, es war durchaus schön hier … überall Blumen. Reid stammte aus Brooklyn und wusste, eine Rose ist eine Rose ist eine Rose, aber sonst nichts. Sieh nur diese purpurroten Blüten! Oder dort drüben die rosafarbenen! Waren die aus Plastik? Er fasste eine an. Echt! Wie konnte das angehen? Wie konnte dieses kalte Klima solche herrlichen Farben hervorbringen? Und wo war überhaupt der Turm abgeblieben? Er war nirgends zu sehen – einfach verschwunden. Vielleicht hatte er sich zu Tode gefroren, war umgekippt und einfach zerborsten.
Vielleicht sollte Reid jemanden fragen.
Die Senioren in den Liegestühlen dort drüben. Diese verrückten alten Menschen nahmen doch tatsächlich ein Sonnenbad! Sie waren gekleidet wie für eine Arktisexpedition, und dennoch saßen sie da und hielten die Gesichter hoffnungsvoll in die Richtung gereckt, wo sie offenbar die Sonne vermuteten, irgendwo hinter den absolut undurchdringlichen Wolken. (Am Stephansplatz hatte er ein Werbeplakat für was auch immer gesehen: Unser Wetter könnte durchaus besser sein, aber das Investitionsklima nicht. Er hatte keine Ahnung vom Investitionsklima, aber die Feststellung, das Wetter könnte besser sein, war eine ziemlich kesse Untertreibung. Herrgott, es war immerhin Juni.Mitte Juni!)
Er könnte natürlich auch dieses junge Pärchen fragen, das gerade vorbeiging, er ein Boris–Becker–Klon, sie eine Steffi Graf. (Was war eigentlich aus dem deutschen Tennis geworden? Wohin nur waren alle diese Blumen entschwunden?)
Aber sie würden es ihm sowieso nicht verraten, weder die Senioren noch die Tennisspielerdubletten. Sie würden einfach nur irgendwohin deuten. Geradeaus. Gehen Sie immer geradeaus.
Also streifte Reid mal hierhin, mal dorthin, machte kehrt, bog gelegentlich links und bisweilen rechts ab, und schließlich, nach etwa einer Stunde, war er endlich raus aus Planten un Blomen und stand auf der Karolinenstraße. Da war er also, der Heinrich–Hertz–Turm, der gottverdammte Fern–Seh–Turm. Direkt hinter ihm. (Als er später im Stadtplan nachschaute, fiel ihm auf, dass er streng genommen schon längere Zeit nicht mehr in Planten un Blomen herumgeirrt war, sondern sich in den Kleinen Wallanlagen befunden hatte. Wahrscheinlich war er sogar an einem Schild vorbeigekommen, auf dem stand, dass er soeben diese Anlage betrat, aber hätte er es auch verstanden, wenn er es gelesen hätte? Waren Anlagen nicht etwas, das man in Schuhe steckte oder einem Brief beifügte? Oder waren das Einlagen? Im Deutschen gab es zu viele Worte mit zu vielen völlig verschiedenen Bedeutungen. Zum Beispiel Betrieb. Alles war Betrieb. Wenn er in seinem Zimmer den Telefonhörer hob, war der Apparat in Betrieb.