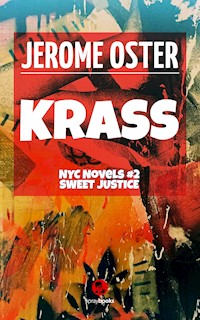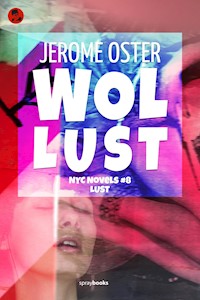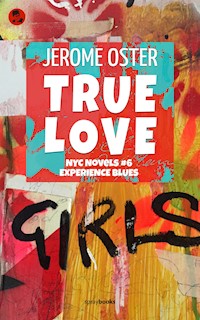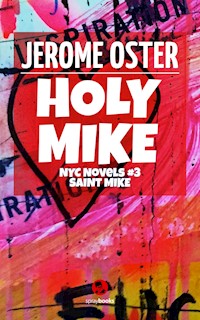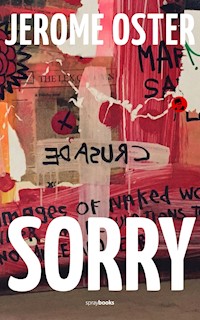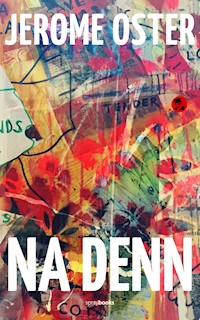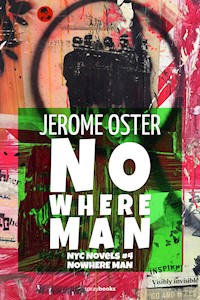
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: spraybooks
- Kategorie: Krimi
- Serie: NYC Novels
- Sprache: Deutsch
Dimanche hat das Gesicht einer exotischen Priesterin und spielt in der Broadway-Produktion »Sterben ist leicht« eine Punk-Göttin. Wie leicht sterben in Wirklichkeit ist, erlebt Dimanche, als man sie mit einer .38er Special von der Bühne pustet. Die New Yorker an sich lässt dieser Abgang völlig kalt. Der Lotto-Virus grassiert. Aber der Megastadt steht noch ein ganz anderes Spektakel bevor: der Stadtmarathon. Da passt die Ermordung eines nicht zu identifizierenden Joggers vorzüglich ins Konzept der Boulevardpresse. Wer kennt den »Nowhere Man«, dem bei seinen Trainingsrunden ein Loch in die Stirn geschossen wurde?
»Mich interessiert nicht, wie Menschen abgeschlachtet werden. Aber ich finde interessant, was mit Menschen passiert, die an einem Mord beteiligt sind: den Tätern, Opfern und Ermittlern«, sagt Jerry Oster, den die New York Times zum besten Krimiautor der 1990er Jahre ernannte. Für seinen Kriminalroman NIGHTFALL wurde ihm 1999 der Deutsche Krimipreis verliehen.
»In Jerry Osters Multi-Kulti-Babylon New York stimmt alles.« — Der Tagesspiegel
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 452
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Nowhere Man
NYC Novels #4
Jerome Oster
Übersetzt vonMartin Hielscher
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Erste eBook-Ausgabe 2021
Titel der amerikanischen Originalausgabe NOWHERE MAN, 1987
Copyright © 1987, 2021 by Jerome Oster
Copyright der deutschen Übersetzung © 1989, 2021 by Martin Hielscher
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werks darf in irgendeiner Form ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
ISBN: 978-3-945684-21-4
eBook v1.0, September 2021
Copyright © dieser Ausgabe 2021 bei spraybooks Verlag, Köln
Redaktion: Doris Engelke
Korrektorat: Ute Lüers
spraybooks Verlag Bielfeldt und Bürger GbR, Remigiusstr. 20, 50999 Köln
www.spraybooks.com
Für Diane Cleaver
Kapitel 1
In einen der Jahreszeit nicht entsprechenden dicken grauen Mantel gehüllt, hätte die Gestalt ein Mann, aber auch eine Frau sein können.
Er oder sie – oder es – kam zwischen zwei der Lieferwagen hervor, die hintereinander an der Westseite der Crosby, zwischen Prince und Houston, parkten – Lieferwagen, die tagsüber die Waren schicker Delikatessenläden, Boutiquen und Kunstgalerien transportierten.
Der Jogger stolperte, weil er nicht gewohnt war, bei seinem frühmorgendlichen Lauf irgendjemand zu sehen. Vor allem nicht jemand, der sich ihm mit ausgestreckter Hand näherte, wie diese Gestalt es tat.
An diesem Morgen war der Jogger zufällig früher als sonst aufgebrochen. Es dauerte eine Weile, bis er begriff, um wieviel früher. Als er am Washington Square Park vorbeikam, bemerkte er, dass keine anderen Jogger unterwegs waren, komisch, denn um diese Jahreszeit steigerten die ernsthaften Jogger ihr Laufpensum, in Vorbereitung für den Marathonlauf im nächsten Monat, und manche von ihnen liefen zweimal am Tag, zu jeder Tages- und Nachtzeit und bei jedem Wetter. Komisch auch, dass so viele Leute im Park waren. Natürlich, es war Spätsommer, und im Park war immer noch rund um die Uhr was los. Aber wirklich komisch fand er, dass die Leute, die dort nachts immer herumhingen, wach waren, noch unter Strom von letzter Nacht, und nicht ausgebrannt und verkatert in den Klauen des Morgens danach. Einer von ihnen, ein schwarzer Teenager, lief an der Washington Square West ein paar Schritte neben ihm her, drehte seinen Ghettoblaster etwas leiser, und sagte: »Hey, Brother. Haste mal ’nen Streichholz?« Er blieb stehen, lachte über seinen Witz und drehte die Commodores wieder lauter: Night Shift.
Auf der McDougal Street, zwischen Third und Bleecker, bemerkte er, dass die Rollläden des Falafel-Imbisses, der sonst immer gerade öffnete, wenn er kurz nach sechs vorbeilief, noch nicht hochgezogen waren. (Jeden Morgen überlegte er, warum der Imbiss eigentlich so früh öffnete: Wer aß so etwas um diese Zeit? Oder diente der Laden bloß als Fassade für etwas Verbotenes?) Auf der anderen Seite der Houston Street, ein kurzes Stück nördlich der Prince, sah er auf der Uhr im Fenster der Kindertagesstätte, dass es erst kurz nach vier war.
Er schloss daraus, dass er von allein aufgewacht war, obwohl er gemeint hatte, dass der Wecker geklingelt und er daran herumgefummelt hätte, um ihn auszustellen. Ohne auf die Uhr zu sehen, war er aus dem Bett gestiegen, ins Badezimmer gegangen, und hatte seine Joggingklamotten angezogen, die noch von gestern zum Trocknen an der Duschstange hingen. Um sie nicht zu wecken, hatte er kein Wasser auf kleiner Flamme aufgesetzt, damit es kochte, wenn er zurückkam, und er sich Kaffee machen konnte. Er hatte auch nicht das Radio eingeschaltet, um die Temperaturen zu erfahren. Das Wasser konnte er auch später aufsetzen. Er duschte und musste bloß eine Hand aus dem Badezimmerfenster halten, um festzustellen, dass er kein Sweatshirt und keine lange Trainingshose brauchte, so wie eine Woche zuvor, als der Herbst einen Vortrupp geschickt hatte. Er war wohl gegen vor vier aufgewacht: Kein Wunder, dass sie sich nicht gerührt hatte; kein Wunder, dass der Portier auf seinem Hocker geschlafen hatte.
Die MacDougal endet an der Prince, und er wandte sich nach Osten zur Sullivan und lief sie dann in südlicher Richtung entlang bis zur Broome, dann die Sixth Avenue bis Grand hinunter, dann wieder gen Osten, über Thompson, West Broadway, Wooster, Greene, Mercer, Broadway. Auf der Crosby lief er nach Norden und an der Spring und der Prince vorbei.
Sie würde nicht wach werden, wenn er zurückkam. Er könnte duschen, sich rasieren, sich anziehen und verschwinden, ohne sie zu wecken. Das wäre in Ordnung: Er könnte später anrufen und sagen, dass es ihm leidtäte. Und weil sie ihn vermisst und sich Gedanken und vielleicht sogar Sorgen über ihn gemacht hätte, hätte sie schon vergessen, wie wütend sie auf ihn gewesen war. Obwohl, so wütend war sie auch wieder nicht gewesen: Sie war nicht nach Hause gegangen, hatte nicht gesagt, dass es so einfach nicht klappen könnte und dass sie aufhören würde, es noch weiter zu versuchen, weil er sich einfach nicht genügend Mühe gäbe.
Der Jogger stolperte, weil er normalerweise nur wenige andere Jogger sah (alle drehten ihre Runden um den Washington Square Park, eine Strecke, die er ermüdend fand, daher seine Ausflüge nach SoHo); Körper, ausgestreckt auf den Bänken im Park, von ausgebrannten und verkaterten Leuten in den Klauen des Morgens danach; den Verkäufer im Falafel-Imbiss; manchmal einen Mann mittleren Alters – jedes Mal einen anderen Mann, der seinen Hund ausführte – jedes Mal einen anderen Hund –, auf der McDougal oder Sullivan; den Verkäufer eines Delikatessengeschäftes an der Ecke von Sixth und Broome, das früh aufmachte (obwohl nicht so früh, dass es an diesem Morgen schon offen gewesen wäre); die Angestellten der Werkstatt, die die ganze Nacht geöffnet hatte; einige Penner, die auf einer hellerleuchteten Laderampe an der Crosby nördlich der Houston schliefen; vielleicht einen Wächter der New York University, der aus seiner Loge am Washington Place herauskam, um ein bisschen Luft zu schnappen; wieder die Jogger, die um den Park liefen, denn für eine Viertelrunde tauchte er dort noch mal auf, bevor er seinen Lauf unter dem Triumphbogen an der Fifth Avenue beendete; und natürlich seinen Portier, Teddy, und an den Wochenenden Pat. Jedenfalls niemanden, der sich ihm mit ausgestreckter Hand näherte, wie die Gestalt es tat.
Er stolperte und hatte drei Gedanken.
Erstens: dass er oder sie – oder es – ihm etwas anbot, einen Talisman oder einen Schatz, den er verstecken sollte. Eine romantische, lächerliche Vorstellung.
Zweitens: eine Überlegung, die der ersten auf dem Fuß folgte: dass er zur Rede gestellt wurde, dass die Gestalt der Hüter der Straße war, sein … wie hieß er noch? Zerberus? Nein, Zerberus war ein Hund, ein Hund mit drei Köpfen. Charon – so hieß er; Charon, der Fährmann. Passender, weil düsterer, wenn auch nicht weniger albern. Denn: ließ Charon je einen aus der Hölle zurückkommen?
Drittens: ein Gedanke, der sein erster hätte sein sollen (denn dies war schließlich New York City, die Hauptstadt der Welt, die Heimat von Tausenden – oft schien es: von Millionen – Obdachlosen): dass er um eine kleine Spende gebeten wurde. Das schien plausibel, auch wenn es überhaupt nicht plausibel war, dass ein Bettler denken könnte, jemand in Unterhemd, Shorts und Turnschuhen hätte Kleingeld bei sich. Der dritte Gedanke des Joggers war sein letzter, denn das, was die Gestalt ihm entgegenhielt, war kein wertloses Schmuckstück, auch keine Hand, die ihn stoppen wollte, sondern eine Pistole. Die Kugel schlug ein Loch in seine Stirn und beendete das Denken.
»Haste das gehört?«
»Was?«
»Den Knall. Wie ’ne Fehlzündung.«
»Alles, was ich höre, Jer, ist die Brandung am Strand von Waikiki. Da sind wir nämlich bald, wir verschwinden aus dieser miesen Garage mit ihren miesen Autos, sobald wir rausgekriegt haben, wie wir das Lotto knacken.«
»Da gibt’s überhaupt nichts zu knacken, Artie.«
»Da is Geld drin, dann gibt’s auch ’n Weg, das Ding zu knacken.«
»Erzähl das mal Jackie Sharps.«
»Was meinste?«
»Der sitzt im Knast, das mein ich. Erzähl dem mal: ›Jackie, da is Geld drin, dann gibt’s ’n Weg, das Ding zu knacken. Und dass du jetzt im Knast sitzt, Jackie, tja, Pech gehabt.‹«
»Er hat den Weg gefunden, Jerry. Er war in der Bank, als sie ihn schnappten.«
»Und jetzt sitzt er im Knast und wird von so ’nem Shwartzer gevögelt. Holst du den blauen Marquis?«
Wie alle guten Komikerduos waren sie sehr verschieden gebaut – Jerry kurz und gedrungen, Artie groß und dünn. Wie alle guten Komikerduos redeten sie immer aneinander vorbei. »Was ist mit den Tischtennisbällen?«, fragte Artie.
»Der blaue Marquis is für um sechs. Du hättest ihn längst holen solln. Was für Tischtennisbälle?«
»Wenn der Kerl die Karre um sechs haben will, hol ich sie um fünf vor sechs. Die pumpen doch Luft in diese Riesentrommeln voller Tischtennisbälle, oder? Die Bälle fliegen rum, sie öffnen die kleine Falltür, einer der Bälle fliegt hoch, und die Zahl drauf is eine der Zahlen, die gewinnen, stimmt‘s?«
»Was ist mit dem grauen Fleetwood?«
»Der graue Fleetwood ist für um sieben, zum Teufel. Wenn du den jetzt holst, wo willst du den dann hinstellen, auf die Straße? Die Straße is voll mit Lastern. Wir könnten die Bälle präparieren, Jerry, das mein ich. Ich mein, jemand muss die doch machen, oder? Und jemand packt sie in die Riesentrommeln. Vielleicht gibt’s da ’ne Möglichkeit, die Dinger zu präparieren, damit sie zu schwer sind, um zu fliegen, wenn die kleine Falltür aufgemacht wird, oder zu groß, um durchzupassen, kapiert? Nur die Nummern nicht, auf die wir setzen. Wir müssen bloß den Typen, der die macht, oder den, der sie in die Riesentrommeln packt, dazu kriegen, dass er dafür sorgt, dass die nicht wie die anderen Bälle sind.«
»Hey, wer is das denn?«
»Hörste mir eigentlich zu, Jer?«
»Da. Auf der anderen Straßenseite. Sieht aus wie eine von diesen Pennerinnen.«
»Sieht aus wie ’n Mann.«
»Sieht aus wie ’ne Pennerin, die ’n Haufen Mäntel anhat.«
»Warum zum Teufel solln die denn mitten im Sommer ’n Haufen Mäntel anhaben?«
»Letzte Woche war es kalt. Ich hab lange Unterhosen angehabt.«
»Weil du ein Dreckarsch bist, Jerry … Was is mit der Nutte, die die Bälle aus den Trommeln holt? Meinst du, dass sie für ’n Abschlag von den zweiundfünfzig Millionen die herausholt, die wir angekreuzt haben?«
Jerry lachte. »Klar, Artie. Ruf sie einfach an, machst du’s mal eben?«
»Und wenn ich dir sage, ich hab ’ne Verabredung mit ihr?«
»Quatsch.«
»Ich wusste, dass du das sagst, wenn ich’s dir erzähle. Gib’s zu, du bist eifersüchtig.«
»Ha!«
»Keine Frage. Du bist eifersüchtig, Babe. Du bist eifersüchtig, weil du weißt, dass sie tolle Titten hat – das hast du selbst gesagt, letztes Mal, als wir Lotto im Fernsehen gesehen haben.«
»Wie heißt sie?«
»Glaubst du, das erzähl ich dir?«
»Wie heißt sie, Artie?«
»Angela.«
»Angela was?«
»Muldoon.«
»Quatsch.«
»Was soll ich dir sagen? Sie ist halb Italienerin, halb Irin.«
»Welche Hälfte gehört ihrer Möse?«
»Hey, pass auf, was du sagst.«
»Wann gehst du mit ihr aus, Artie?«
Artie bückte sich, um seinen Schuh zuzubinden.
»Na? Na?«
»Ich geh nicht mit ihr aus, aber vielleicht treff ich sie, vielleicht. Ihre Schwester ist ’ne Krankenschwester, wie meine Schwester. Ich könnte auf jeden Fall ’ne Verabredung mit ihr hinkriegen, wenn ich’s drauf anlege. Aber erst mal mach ich ’nen Plan.«
»Weißt du, was mir mal jemand gesagt hat, Artie?«
»Dass du ein Dreckarsch bist?«
»Mir hat mal jemand gesagt, Frauen und Geschäfte passen nicht zusammen. Und weißt du, wer mir das gesagt hat?«
»Deine Mutter?«
»Lass meine Mutter da raus. Wenn du nicht willst, dass ich mal nachforsche, wie Angelas Möse ist, dann lass meine Mutter da raus. Wer mir gesagt hat, dass man Frauen und Geschäfte auseinanderhalten soll, war Jackie Sharps.«
»Jackie Sharps, Jackie Sharps, Jackie Sharps.«
»Der im Knast sitzt, weil er Frauen und Geschäfte nicht getrennt hat. Bevor er die Bank geknackt hat, ist er mit ’ner Kassiererin ausgegangen, die da arbeitete. Sie hat ihm den Lageplan erklärt und gesagt, an welchen Tagen die Purpleator-Kuriere kamen. Jackie glaubt, dass sie ihn verpfiffen hat.«
»Hey, schau mal.«
»Was?«
»Schau mal, Jer. Ein Mann. Das gucken wir uns mal an.«
»Ich sollte wohl besser den blauen Marquis holen.«
»Los, komm.«
Sie bewegten sich seitwärts, auf den Fußballen, mit ausgestreckten Armen. Krabben in der Stadt.
»Heilige Scheiße.«
»Mein Gott.«
»Fass ihn nicht an, Artie.«
»Ich muss ihn doch anfassen, wenn ich wissen will, ob er tot ist, oder?«
»Ob er tot ist?«
»Oh, Scheiße. Guck mal. Genau zwischen die Augen.«
»Ich kotze gleich, Mann.«
»Was is das denn?«
»Los komm, Mann. Wir müssen die Cops rufen, oder so.«
»Guck mal. Jerry, guck mal.«
»Ich will nicht gucken.«
»Jerry, guck mal. Was da aus seinen Shorts raushängt.«
»Ich will’s nicht sehen.«
»Ein Lottoschein.«
»Wen zum Teufel interessiert das denn jetzt, Mann?«
»Und was is, wenn’s das Gewinnlos ist, Jer?«
»Wen zum Teufel interessiert das denn jetzt, Mann?«
»Ich behalte es.«
»Artie!«
»Du sagst überhaupt nichts, Jer. Wenn die Cops kommen. Okay?«
»Okay.«
»Du sagst überhaupt nichts, Jer. Schwörst du das?«
»Ja.«
»Schwörst du bei Gott?«
»Ich sagte: ja.«
»Dann tu’s.«
»Ich … ich schwöre bei Gott.«
Kapitel 2
Charly Johnstone zwängte sich auf einen Sitz in der Mitte der dritten Reihe im Parkett des Kean Theaters, da ging der Vorhang hoch. »Eine neue Premiere, eine neue Show«, summte Charly.
Der Vorhang ging gleich wieder herunter, denn es war eine Probe, keine Aufführung, nur eine technische Probe für die Bühnencrew. Der Regisseur, Jay Dillen, wollte, dass der Vorhang so aufgezogen wird, dass es – wie er dem Bühnenmanager erklärte – »eine gewisse Spannung in sich hat.«
»Spannung«, flüsterte Charly ihrem Begleiter zu, dem Reporter einer lokalen Zeitung aus New Jersey (die East Underpass Gazette hatte Charly sie im Mayfair-Public-Relations-Büro immer genannt), »hat diese Produktion im Übermaß. Schreiben Sie das bitte nicht, Love. Schreiben Sie, dass die Proben und Previews ein Soufflé von unerhörter Geschliffenheit waren. Das schreibt man S-o-u-«
»Charly!« sagte Dillen, denn mit Charlys Flüstern hätte man ein Taxi, das einen Block weit entfernt parkte, bestellen können. Sanft fügte er hinzu, »Vielen Dank, Darling.«
Sie sahen zu, wie der Vorhang einige Male hoch- und wieder runtergezogen wurde. »Bei diesem letzten Mal habe ich intensive Spannung empfunden.« Charly lehnte sich zurück, um den Reporter zu mustern. »Bestimmt bin ich nicht die erste, die Ihre unheimliche Ähnlichkeit mit Woody Allen bemerkt. Ist die, äh, Schmiere normalerweise Ihr Ressort? Ich glaube nicht, denn Charly kennt jeden Schreiber und Schnorrer am Broadway, um nicht zu sagen, jede Hure und Taschendiebin.«
»Ich schreibe hauptsächlich über Lokalpolitik«, sagte der Reporter. »Stadtrat, Schulausschuss. Aber in meiner freien Zeit kümmere ich mich auch um Theater und Oper in der Nachbarschaft.«
»Schön.« Charly sank in ihren Sitz zurück. Es gibt keine schlechte Publicity, sagte man in der PR-Branche, und keine Zeitung, die zu unwichtig wäre, um dort eine Meldung zu platzieren; aber es gab auch Gelegenheiten für ein Nickerchen, die man nicht auslassen durfte.
Der Reporter holte ein winziges Ringbuch mit gelbem Einband heraus. »Öh, worum geht’s denn in dem Stück?«
»Gute Frage. Eine Frage, die zu meiner Zeit – wir reden hier von Äonen, nicht bloß ein paar Dekaden – viele Kritiker in den Pausen vieler Stücke an ihre Frauen gerichtet haben, damit ihre Kritiken nicht verrieten, dass sie geschnarcht hatten, statt der Poesie, die über ihren stecknadelkopfgroßen Gehirnen verkündet wurde, Beachtung zu schenken. Dieses Stück ist ein Stück in einem Stück in einem Stück in einem Stück in einem Stück und so weiter, zurück – oder ist es vorwärts? – bis in die Unendlichkeit. Es ist ein Stück – und das ist so schrecklich geistreich daran – über eine Schauspielerin, die ermordet wird am Abend vor ihrem Broadway-Debüt in einem Stück über eine Schauspielerin, die ermordet wird, et cetera, et cetera, et cetera. Ein Stück, das Noises Off wie Godot erscheinen lässt, ein Stück wie eine chinesische Dose, was mich an einen herrlich schmutzigen Witz erinnert, den ich gerade gehört habe. Zwei, äh, orientalische Gentlemen gingen gerade die -«
»Charly!«
Charly faltete die Hände wie ein aufmerksames Schulmädchen. Als nichts passierte, drehte sie sich in ihrem Sitz um. »Also, wo klemmt’s, bitteschön? Ah. Ich sehe. Heute ist Beflaggung angesagt, ein Tag für Golddruck. So ist das bei einer Aufführung vor hohen Herrschaften, Love. Der Herr im grauen Anzug – im grauen Anzug für achthundert Dollar? Martin Klein, der letzte der großen Broadway-Mogule, ein Mann, der David Merrick zum Mittagessen verspeist, mit Jimmy Nederlander als Vorspeise und Joe Papp als Nachtisch. Die alte Schleuder – machen Sie daraus vornehme Witwe – an seinem Arm? Vivian Thibault Wyndham, Erbin, Wohltäterin, und jede sonstige -erin, die Sie sich nur ausdenken können. Eine reiche alte Schachtel, mit einem Wort, die unser Vorhaben hier unterstützt mit einer Summe von – Ach, lassen wir das. Ich fürchte, das ist nicht für Ihre Ohren bestimmt, Love. Wer dort am Ende der Reihe sitzt und wie eine schlechte Kopie von Keith Richards aussieht – nur damit Sie all die Namen und Rollen der Schauspieler haben –, ist Kevin Last, Dimanches Hauptlover und, im Stück, ihr Gegner, der, wie Dimanche, seinen ersten Auftritt auf einer richtigen Theaterbühne hat, obwohl er, wie sie, schon in vielen Rock’n’Roll-Läden die Leute mit seinen ’eavy-Met’l-Possen zu Beifallsstürmen hingerissen hat. Kevin tritt erst in der 2. Szene auf. Der Knabe in den Lederlumpen ist, müssen Sie wissen, ist Jay Dillen, der Regisseur, der Mann, ohne den das Stück bloß Worte auf einem Blatt Papier wären, die Schauspieler bloß ein Haufen –«
»Ruhe bitte, meine Damen und Herren. Und Charly auch. Vorhang bitte.«
»Komisch. Sehr komisch … Ah, da ist sie, die legendäre Dimanche. Schauen Sie sie bitte mal an. Ist sie nicht entzückend? Gott, was für ein Gesicht! Ein Modigliani-Gesicht nannte es People einmal … Ein Gesicht wie von Giacometti, schrieb die Newsweek. Das Gesicht einer exotischen Priesterin, riskierte Rolling Stone und landete fast einen Treffer, meine ich, aber dann besudelte er das Ganze dadurch, dass er sie eine weiße Grace Jones nannte. Grace Jones, ich bitte Sie!
Sie werden sicher schreiben wollen, was sie anhat. Ihre Leserinnen lieben das, und Ihre Redakteure, also, die werden ordentlich beeindruckt sein. Wie Sie sehen, spielt diese Szene in einer Garderobe hinter der Bühne eines Theaters, nicht unähnlich diesem Theater, einem Theater, an dem ein Stück aufgeführt werden soll über eine Schauspielerin, die am Vorabend ihres Debüts in einem Stück ermordet wird über eine Schauspielerin, und so weiter. Sie trägt die Art von Sachen, von denen der Autor annimmt, dass Schauspielerinnen sie tragen, wenn sie sich ausruhen, und offensichtlich ist der Kostümbildner gleicher Meinung – ein weißes, gestepptes Polyesterhauskleid mit schwarzen Samtrevers von Fernando Sanchez von Bergdorf Goodman. Darunter - Sie werden einen Blick darauf werfen können, wenn Gott Ihr Kopilot ist, trägt sie nur schwarze Seiden-French-Knickers von Argenti, dessen Name sich auf den Hüften aller erfahrenen Frauen findet. Ihr Haar … Sie werden sicher über ihr Haar schreiben wollen … naturblond – glauben Sie mir –, kurz- und stumpfgeschnitten, und zwar nicht in einem Salon, wo man nur die Frisuren kennt, die in irgendwelchen Zeitschriften abgedruckt sind, sondern bei den Astor-Place-Coiffeuren, wo sich die Kunden und Friseure täglich – stündlich – zusammentun, um neue Stile auszuhecken. Ist sie nicht ein Traum? Ein gehender, redender, lebender, atmender –«
»Einen Moment mal, bitte.« Von seinem provisorischen Arbeitstisch hinten im Parkett, kam jetzt Jay Dillen den Gang hinunter. Eine Hornbrille hing an einem Band um seinen Hals. Er fuhr sich mit einer Hand durch das wellige, graumelierte Haar. »Dimanche, Honey, die Stelle lautet –«
»Ich weiß, wie die Stelle lautet«, sagte Dimanche und zog den Gürtel um ihren Hausmantel fest, den sie während der Szene unverschämt weit offengelassen hatte, obwohl sie mit dem Rücken zum Rampenlicht saß, einer Szene, in der sie allein auf der Bühne war und einen Monolog an ihr Abbild im Spiegel richtete. Dillen breitete die Arme aus. »Also, bitte?«
»Sehen Sie, Love«, wisperte Charly, »wir werden nun Zeugen einer weiteren Episode, dessen was die Leute im Showbusiness kreative Differenzen nennen. Dimanche kennt die Stelle, behauptet sie jedenfalls, und ich glaube ihr, findet aber, dass der Text hier irgendwie mangelhaft ist … wie auch immer. Sie findet, er klingt falsch, nicht nur im Zusammenhang des Stückes, sondern auch im Verhältnis zu dem, was die Schauspieler den Subtext nennen, was, wenn ich es definieren müsste, und ich sehe an den Furchen auf Ihrer Stirn, dass ich es wohl muss -«
»Verdammt nochmal, Charly!« Dillen stand am Ende ihrer Reihe und starrte finster hinüber.
»Jay?« Dimanche war an die Rampe gekommen und saß da, die Beine gekreuzt. Ihr einzigartiges Gesicht – schmal, eckig, streng, exotisch – konnte, wenn sie wollte, das einer Ausgestoßenen werden, eine Rolle, zu der ihre Haltung beitrug. »Ich stelle mich nicht an. Du verstehst das so, ich sehe es anders. Ich habe jetzt eine ganze Weile so gespielt, wie du die Rolle interpretierst. Ich will nur, dass du mir die Chance gibst, sie mal so zu spielen, wie ich sie verstehe. Bloß um zu sehen, wie es geht. Cass siegt bei jedem Wortwechsel, den sie hat. Wenn sie sympathisch wirken soll, muss sie auch ein paar verlieren; ihr müssen ab und zu mal die Worte fehlen. Mir gefällt der Gedanke, dass ihr gerade dann die Worte ausgehen, wenn sie mit sich selbst redet, und deshalb habe ich eben versucht, ein bisschen zu stottern, was du so verstanden hast, als hätte ich meinen Text nicht gelernt. Ich kenne meinen Text. Ich kannte meinen Text schon wenige Tage, nachdem ich die Rolle bekommen hatte. Du bist ein Profi. Für mich ist das alles neu. Aber ich kenne das Leben. Wenn Cass nicht real wirkt, wenn sie nicht lebendig wirkt, dann wird es niemanden berühren, wenn sie ermordet wird.«
»Hört, hört«, flüsterte Charly. »Sie werden bemerken, dass jemand, der bei einer solchen Auseinandersetzung eigentlich zu entscheiden hätte – nämlich die Autorin B. G. Harris –, fehlt. Der Grund für ihre Abwesenheit ist, dass sie just in diesem Augenblick in einem Zimmer hinter der Bühne auf ihrer Schreibmaschine tipp, tipp, tippt und versucht, eine andere Szene umzuschreiben, deren, äh, Glaubwürdigkeit Dimanche in Zweifel gezogen hat.«
Dillen spitzte wiederholt die Lippen und sah aus wie ein Fisch auf dem Trockenen. Zu seiner Vorstellung von Zusammenarbeit passte es offenbar nicht, Widerspruch zu hören – und noch dazu so sanft –, und er suchte nach einer Antwort. Dann sah er die Pistole, die aus einer Tasche von Dimanches Hausmantel hervorlugte. »Was zum Teufel ist das denn?«
Ohne hinzusehen, wusste Dimanche, wovon er sprach.
»Jay-«
»Verdammt nochmal Dimanche, erst hast du sie in Szene vier aus der Hosentasche rausschauen lassen, und jetzt willst du, dass sich die Zuschauer von dem Augenblick an, wo der Vorhang aufgeht, darüber den Kopf zerbrechen?«
»Darüber nachdenken, ja.« Dimanche erhob einen Finger wie ein altkluges Kind. »Aber das ist alles. Sie sollen nicht wissen, was sie bedeutet, nicht wissen, dass sie eine Requisite aus dem Stück im Stück ist. Sich bloß Gedanken machen.«
Dillen hob die Arme und ließ sie wieder sinken. »Worüber ich mir Gedanken mache, ist, wo ist eigentlich die Motivation?«
Dimanche lächelte. »Wenn die Leute in Szene vier sehen, Jay, dass die Pistole in der Hüfttasche ihrer Jeans steckt, werden sie verstehen, was von Anfang an die Motivation gewesen ist. Ganz einfach: Cass will sterben. Sie bringt sich um, wenn nötig; sie tötet jemand anderen und akzeptiert den eigenen Tod als Konsequenz; sie würde mit jemandem kämpfen – ihrer Mutter, Buddy, Todd, Diana, egal – in der Hoffnung, dass sich ein Schuss löst und sie tötet. Du bist ein Profi. Ich bin hier neu. Aber man muss kein Profi sein, um die Motivation zu verstehen. Man muss nur ein bisschen erlebt haben.«
Dillen stand da wie jemand, der sehr viel erlebt hat. »Da fällt mir etwas ein, über das ich eigentlich gar nicht reden wollte, aber wenn wir schon einmal dabei sind: Freddy hat mir erzählt, dass du die Waffe mit nach Hause genommen hast. Das ist verrückt, Baby. Du wirst unterwegs festgenommen. Du wirst umgebracht. Was ist, wenn sie dir aus der Tasche fällt? Was ist, wenn du unter einen Bus kommst?«
»Freddy«, flüsterte Charly, »ist der Bühnenmanager. Passt auf die Requisiten auf, solche Sachen.«
Dimanches Lächeln war jetzt trauriger. »Jay, ich muss doch wissen, was für ein Gefühl das ist, mit einer Waffe herumzulaufen. Wenn ich unter einen Bus komme, werden die Leuten endlich begreifen, worüber sie sich die ganze Zeit gewundert haben–« sie hob den Aufschlag ihres Morgenmantels, nicht provozierend, sondern so, wie ein Kind ein neues Kleidungsstück vorführt–, »nämlich, dass ich schwarze Stepphöschen trage. Cass braucht die Waffe, Jay, wie sie Sauerstoff braucht – mehr als Sauerstoff. Ohne Sauerstoff wäre sie bloß tot; ohne die Waffe wäre sie nichts.«
»Gott, was für Einsichten«, sagte Charly. »Zu dumm, dass sie keine Artikel über diese Inszenierung schreibt, sondern darin mitwirkt. Sie werden nichts darüber schreiben, Love. Wenn auch nur ein Komma dieser Auseinandersetzung in Ihrer drolligen kleinen Zeitung erscheint, schlage ich Sie mit Playbill tot und lasse Ihren Leichnam von der Kasse für verbilligte Karten am Times Square herunterbaumeln.«
Eine unnötige Drohung; der Reporter war immer noch gelähmt von dem flüchtigen Blick auf Dimanches Unterwäsche, einem Geheimnis, von dem er nie geträumt hätte, dass er es teilen würde, da Gott nicht sein Kopilot war, ja noch nicht einmal zum selben Geschwader gehörte.
Dillen, ein Mann um die einsachtzig, schien zu schrumpfen. »Also gut, vielleicht. Aber eine echte Waffe? Ich meine, nimm doch eine aus der Requisite. Wir besorgen dir eine aus der Requisite, Dimanche, mit Schulterhalfter und allem Drum und Dran.«
»Jay, das haben wir doch alles schon mal durchgekaut. Ich stand vor der Bühne, während Freddy durch Szene vier latschte mit einer Waffe aus der Requisite, und die sah genauso aus wie eine Requisite, eine billige Waffe aus der Requisite. Er sagte, das wäre die beste, die er hätte, und wenn das die beste war, will ich sie nicht.« Sie holte die Waffe aus der Tasche und hielt sie mit beiden Händen hoch. »Weißt du, wie schwer eine richtige Waffe ist? Fühl mal. Sie ist erstaunlich schwer.«
»Also gut, Dimanche. Auf der Bühne – vielleicht. Aber auf der Straße?«
Dimanche winkte gereizt ab. »Es ist doch nicht so, als ob ich -« fing sie an, wurde aber unterbrochen – oder ließ sich unterbrechen – von einem leichten Tohuwabohu im Zuschauerraum.
Auch Dillen drehte sich um, wie Charly, um zu sehen, was da los war.
»Oh, mein Gott. Exeunt omnes – oder jedenfalls die Dame, die die Schecks unterschreibt. Nun, Sie werden auf keinen Fall schreiben, Love, dass Mrs. Wyndham die Proben voller Zorn vorzeitig verlassen hat. Wenn ich so darüber nachdenke: Warum kommen Sie nicht ein anderes Mal wieder, näher am Premierentermin, wenn all die Falten ausgebügelt worden sind, all die Haken abgehakt, all die …«
»Charly, kommen Sie bitte in mein Büro.« Dillen hastete den Gang hoch. »Wir machen eine halbe Stunde Pause. Seid pünktlich um halb vier wieder da.«
Charly tippte mit einem Fingernagel auf das Notizbuch des Reporters. »Soufflé. S-o-u-f-f-l-e, Accent aigu.«
Die Hände auf den Hüften, ihren Fernando-Sanchez-Morgenmantel leicht geöffnet, der verspiegelten Garderobenwand zugekehrt, betrachtete Dimanche mit größtmöglichem Desinteresse die Frau, der sie gegenüberstand: blondes Haar, kurz- und stumpfgeschnitten; gelb-grüne Augen in einem einzigartigen Gesicht; ihr Schlüsselbein; kleine Brüste mit überraschend dunklen Brustwarzen, wenn man bedachte, dass sie naturblond war; eine schmale Taille, die noch schmaler wirkte durch die schwarzen Seidenstepphöschen; die Beine und Füße einer Tänzerin. Mit dem größten Desinteresse, das sie aufbringen konnte, weil Dimanche sich selten einem Spiegel begegnete, in dem sie sich nicht gefiel. Dieser war großzügig genug, die blauen Flecken zu mildern. Es klopfte, sie schreckte hoch und schloss ihren Morgenmantel. »Was?«
»Ich bin’s.«
»Verschwinde.«
Kevin Last öffnete die Tür und kam herein. »Bist du okay?«
»Nein, ich bin nicht okay. Und nein, ich will keine Gesellschaft.«
Er setzte sich auf ihre Couch. »Willst du, dass ich dir beim Text helfe?«
Dimanche nahm das Skript von ihrem Umkleidetisch und warf es in eine Ecke – neben ihn, nicht nach ihm. »Du bist so mies wie die anderen. Ich kenne meinen Text. Der Text ergibt keinen Sinn.«
Kevin atmete tief durch die Nase. »Vielleicht sollten wir uns ein paar Lines reinziehen.« Er schob eine Hand in die Tasche seines Kenzo-Jacketts.
»Ich hab’s dir schon mal gesagt – keine Drogen. Das ist hier nicht Rock and Roll, Kevin; das ist Broadway.«
»Scheiße, Baby. Du bist die Nummer eins. Du brauchst diesen Gig nicht.«
Sie verschränkte die Arme. »Weißt du, was unser Problem ist, Kevin? Ich spreche Englisch, du sprichst wie ein Musiker.« Sie hob nachdenklich den Kopf. Und ihr Problem war das des Stückes: Sie war einfach schneller und besser als Kevin.
»Die Bad Brains spielen im CB«, sagte Kevin. Seine Antwort passte zu dem, was sie gesagt hatte, aber nicht zu dem, was sie gemeint hatte. »Kommst du mit?«
Sie wandte sich ihrem Schminktisch zu. »Ich muss telefonieren, Kevin. Würdest du mich jetzt bitte entschuldigen?«
Er war schneller aufgestanden und an der Tür, als erwartet. »Unser Problem ist, dass du Fotze vergessen hast, wo du herkommst.« Er knallte die Tür hinter sich zu.
Dimanche saß für einen Moment da, die Hand auf dem Hörer. Als sie die Beine kreuzte, spürte sie das Gewicht in der Tasche ihres Morgenmantels. Sie nahm den .38er Revolver heraus und legte ihn auf den Tisch.
Auf die Straße. Es ist nicht so, als wäre ich auf die Straße, wie andere Leute. Das war der Satz, den sie im Theater angefangen hatte. Sie ging überhaupt nicht auf die Straße, nur von der Bühnentür zu ihrer Limousine und von ihrer Limousine zu ihrer Haustür. Sie ging nicht mehr einkaufen; die Designer kamen zu ihr, arrangierten private Modenschauen in ihrem Wohnzimmer und führten endlose Variationen von schwarzen Leder-Miniröcken, schwarze Jäckchen, blauen Jeansjacken, fingerlosen lila Spitzenhandschuhen, lila Pumps mit Pfennigabsätzen vor (während sie dasaß und sich über die .38er Special im Bund ihres schwarzen Lederminirockes freute). Sie ging nie in Restaurants (außer zu privaten Partys), in Museen und Galerien (außer zu Vernissagen), in Filme (außer zu Premieren), in Konzerte oder Clubs (außer wenn die Öffentlichkeit ausgeschlossen war). Sie unternahm niemals, ausnahmslos niemals, Spaziergänge, Busfahrten, U-Bahn-Fahrten, ging nie in einen Park, an den Strand, Radfahren, Rollschuhlaufen, Schlittschuhlaufen, in eine Pizzeria, Frisbee spielen – alles Dinge, die sie getan hatte, bis sie so berühmt wurde, dass es einen Verkehrsstau gegeben hätte, wenn sie dergleichen tat, einen Verkehrsstau, der in ihrer Vorstellung damit endete, dass die Straßen mit den Leichen von Hunderten von Teenagern übersät waren, die alle blonde Haare hatten, kurz- und stumpfgeschnitten, und schwarze Lederminiröcke, schwarze Jäckchen, blaue Jeansjacken, fingerlose lila Spitzenhandschuhe, lila Pumps mit Pfennigabsätzen ein Armband aus Elefantenhaar und eins aus Kupfer und Halsketten aus Rheinkiesel trugen. Nachdem sie so berühmt geworden war, hatte sie noch eine Weile versucht, ein paar dieser Dinge zu tun, und zwar inkognito. Nicht weiter schwierig - weg mit den Armbändern und der Halskette, ein buntes Kopftuch auf, eine unmoderne dunkle Brille, ein ausgebeultes Sweatshirt, alte Jeans, Turnschuhe. Solche Sachen besaß sie noch, irgendwo in Regalen und Schränken. Und es hatte funktioniert: Einmal war sie von der Fifty-ninth und Fifth zur Thirty-fourth und Seventh gelaufen und hatte dann die U-Bahn ins Village genommen, ohne ein zweites Mal von irgendjemand angeschaut zu werden; ein anderes Mal war sie zum Washington Square Park gegangen, hatte auf dem Brunnenrand gesessen, den Rolling Stone gelesen, einen Hotdog in der Hand, hatte zugesehen, wie Tony the Fireman seine Show abzog, war nach Hause gegangen, ohne dass jemand versucht hätte, sie abzuschleppen, ohne von den Home Boys, die Drogen verkauften, angequatscht zu werden. Aber beide Male hatte sie sich die Verkleidung herunterreißen, das Kopftuch losbinden, die Brille wegschleudern und das Sweatshirt ausziehen wollen, um das Jäckchen zu zeigen, das sie darunter trug – um die zu bleiben, die sie wirklich war oder geworden war – und dazustehen in ihrer zum Markenzeichen gewordenen Pose, die Beine gespreizt, die Hände in die Hüften gestemmt, und zu flüstern, wie sie ins Mikrophon flüsterte, wenn sie die Bühne betrat, wobei sie glaubte, dass sie auch ohne Verstärker gehört wurde wie damals, als sie immer schrie: »Who wants to party?« Denn nur ihr Ruhm hielt sie aufrecht; sie brauchte ihn wie Sauerstoff, wie Cass ihre Waffe brauchte.
Also hatte Kevin recht, jedenfalls zum Teil. Sie hatte nicht vergessen, wo sie herkam; sie konnte es bloß nicht riskieren, sich daran zu erinnern.
Sie wählte und strahlte, als jemand abnahm.
»Hallo. Kannst du kurz rüberkommen? Ich brauche einen Freund.«
Kapitel 3
»Er weiß es.«
»Wer?«
»Der Cop. McIvan.«
»Woher zum Teufel soll er’s denn wissen, Jerry?«
»Schau dir doch bloß ma an, wie er uns beobachtet.«
»Nein, Jerry, schau dir nicht an, wie er uns beobachtet. Wenn du weiter rüberglotzt, fängt er an, drüber nachzudenken, was dich so nervös macht.«
»Was is, wenn er uns deswegen in die Zange nimmt?«
»Reg dich ab, Jerry.«
»Wegen dem Los, mein ich.«
»Hey, Jerry. Wenn du das nochmal sagst, dann hört er dich vielleicht, und nimmt dich genau deswegen in die Zange. Im Moment hat er keine Ahnung von irgendeinem Los, also hör auf, Los zu sagen.«
»Gerade hast du’s gesagt.«
»Weil ich’s leise sagen kann, verstehst du, ohne mein Maul allzu sehr aufzureißen.«
»Er weiß es. Schau ihn dir doch an.«
»Also gut, Jerry. Schau du ihn dir an. Er weiß einen Scheiß. Sieht er so aus, als ob er was wüsste? Schau ihn doch an, wie er in seinen Taschen rumkramt, als ob er was vergessen hätte, als ob er vergessen hätte, wer er ist.«
Detective Lieutenant Timothy McIver machte bloß Inventur: In der einen Hüfttasche hatte er ein Taschentuch mit seinen Initialen und in der anderen einen Kamm mit dem Namen einer Apotheke darauf, ein Werbegeschenk.
In seiner linken Hosentasche befand sich, neben einer Einkaufsliste (Thunfisch, Brot, Nudelsuppe mit Huhn, Hühnerbrust, Stove Top Stuffing, Pepsi, Budweiser Light), ein Coupon von einer chinesischen Wäscherei und eine Eintrittskarte vom RKO Proctor’s Sevenplex in New Rochelle, wo er und seine Frau gestern Abend Hollywood Vice Squad II gesehen hatten. Aus seiner rechten Hosentasche fingerte er), neben zwei Dimes, einem Nickel, zwei Pennies und zwei U-Bahn-Münzen, zwei Zehner, einen Fünfer und zwei 1-Dollarscheine in einer versilberten Geldklammer mit seinen Initialen darauf (ein Geschenk seiner Tochter zu seinem fünfzigsten Geburtstag).
Aus der linken Tasche seiner Sportjacke kramte er ein Flugblatt, das zu einem Treffen der Detectives Endowment Association einlud, aus der rechten eine Packung Merits und ein vergoldetes Feuerzeug mit der Inschrift Für Tim, In Liebe, Margaret, ein Geschenk von seiner Frau zum zwanzigsten Hochzeitstag. In der linken Innentasche hatte er eine Brieftasche mit seinem Führerschein, Mitgliedskarten der DEA, des Automobile Club of New York, des Silver Screen Video Club und des New Rochelle Y, eine A&P-Scheckkarte, eine Sozialversicherungskarte, einen Blue-Cross-Blue-Shield-Ausweis, einen Westchester-County-Board-of-Elections-Ausweis, eine Blutspenderkarte und eine Karte, die zur Brieftasche gehörte, auf der sein Name, seine Adresse und Telefonnummer eingetragen waren – von Margaret, die gewusst hatte, dass er es nicht tun würde.
In seiner rechten Innentasche befand sich seine Marke und sein Ausweis vom Police Department. Sein Schulterhalfter hatte seinen Namen auf den Gurt geprägt; sein Dienstrevolver trug eine Registriernummer. An seinem linken Ringfinger steckte ein Ring der St. John’s University, Jahrgang ’58er, mit seinem Namen auf der Innenseite. Sein Hemd trug ein Wäschereizeichen, an seiner Sportjacke heftete immer noch ein Etikett von der Reinigung im Futter. Die Schlüssel, die von einem Ring an seinem Gürtel hingen, trugen den Namen der Schlosser. Warum hatten die beiden Wächter vom E-Z-Parkhaus nicht seine Leiche mitten auf der Crosby Street gefunden? Er hätte nach ein paar Sekunden gewusst, wer der DOA wäre, und hätte bloß noch den finden müssen, der ihn umgebracht hatte.
Die Leiche mitten auf der Crosby Street war nicht so zuvorkommend. Außer dass der Tote eins fünfundachtzig oder eins neunzig groß war, 160 oder 170 Pfund wog, welliges braunes Haar und keine besonderen Kennzeichen hatte, wusste McIver nichts über ihn.
Zum einen war das Gesicht des Toten nicht mehr das, was man ein Gesicht nennen konnte, nachdem es als Ziel für eine .45er gedient hatte, und zwar aus ziemlich geringer Entfernung. Zum anderen trug der Mann ein rotes Hind-Unterhemd, blau-weiß gestreifte Joggingshorts von Brooks mit einem eingenähten Genitalschutz, weiße Socken, grau-rote New-Balance-Joggingschuhe – und weiter nichts. Keine Uhr, kein Armband, keine Ringe, keine Kette um den Hals; er hatte kein Portemonnaie, keine Schlüssel, kein Geld, kein Garnichts bei sich. Die Tasche seiner Shorts – wenn man das eine Tasche nennen konnte, 3 Zentimeter breit und 6 Zentimeter tief – war leer.
McIver trat über den Kreideumriss des toten Mannes mitten auf der Crosby Street und ging die dreißig Meter zum E-Z-Parkhaus, wo die Wächter, die 911 angerufen hatten, jetzt auf Klappstühlen saßen und ihre Geschichte zum hundertsten Mal anderen Angestellten der Garage, Kunden, Passanten und Leuten erzählten, die in den anderen Loft-Häusern an der Straße arbeiteten und Jobs hatten, von denen McIver, selbst wenn er den ganzen Nachmittag, die ganze Nacht und den ganzen nächsten Tag daransetzen würde, kein bisschen mehr verstehen würde als jetzt..
Er ging an den Wächtern vorbei – er hatte ihre Geschichte schon drei- oder viermal gehört und wusste, dass sie den Toten nicht kannten, dass sie nichts und niemand gesehen oder gehört hatten, dass sie keine Zeugen, sondern nur zufällig in der Nähe gewesen waren – dorthin, wo sein Partner, Detective Sergeant Nate Bloomfield, an einer Wand lehnte und etwas in sein Notizbuch schrieb.
»Ich habe die Schuhfirma erreicht, Tim«, sagte Bloomfield. »Die sitzt in Massachusetts. Der Mann, mit dem ich gesprochen habe, meinte, wenn sie sich die Schuhe ansehen, könnten sie sagen, wann die gemacht worden sind, vielleicht auch, wann sie versandt worden sind und wohin. Er hat mir die Nummer ihres New-York-Ladens gegeben, um uns den Trip nach Mass zu ersparen. Er guckt sich die Schuhe an, wenn wir wollen.«
McIver grunzte.
»Er war sich nicht ganz sicher, der Mann von der Firma, aber er sagte, das gilt vielleicht auch für das Hemd und die Shorts und die Socken – wenn der Hersteller sich die ansieht, könnte er vielleicht sagen, wann sie gemacht worden sind, vielleicht sogar, wann sie versandt worden sind und wohin.«
McIver nickte.
»Hast du irgendeine Idee, Tim?«
McIver schüttelte den Kopf.
»Das ist scheißschwer zu knacken.«
McIver stopfte sein Hemd rein.
»Erinnerst du dich an die splitternackte Leiche beim Roosevelt Krankenhaus? Oder war es St. Luke’s? Der Kerl lag jedenfalls über den ganzen Bürgersteig verteilt. Stellte sich raus, dass es ein leichter Fall war, oder etwa nicht? Der Typ hatte ein Krankenhausschildchen ums Handgelenk, und das Fenster war kaputt, aus dem er sich heruntergestürzt hatte. Es war St. Luke’s.«
McIver schniefte.
»Oder die Leiche – ’ne Tussi – nur mit BH und Strumpfhose, und die halben Eingeweide hingen raus in der Halle vom Chrysler-Hochhaus? Wieder so ’n leichter Fall – außer dass wir ungefähr zwanzig Stockwerke hochsteigen und bloß den Blutflecken bis dahin folgen mussten, wo sie gearbeitet hatte – was war das noch gleich, ein Reisebüro?) Nein, eine, äh, du weißt schon, Stelle, wo sie ausländisches Geld wechseln –und da lag ihr Boss, sein Gehirn über den ganzen Schreibtisch verteilt.«)
McIver kratzte sich am Ohr.
»Das hier wird schwierig.«
»Mhm«, sagte McIver.
Bloomfield lachte. »Weißt du, Tim, ich dachte gerade an all den Kram, den ich in meinen Taschen habe – ein Portemonnaie, eine Marke, alle möglichen Ausweise, Führerschein, Scheckkarten, Karten, einen Coupon von der Reinigung, so Zeug … Warum konnten sie nicht meine Leiche finden? Wir wüssten, wer der DOA ist und müssten bloß noch den finden, der ihn erschossen hat. Wo wir gerade vom Schießen reden, Tim, das Mädchen ist hier, die Frau, die Filmemacherin, die Regisseurin, die diesen Film über uns macht, über Cops, Nell Ward. Sie hat einen Kameramann dabei, sie will wissen, ob sie den DOA schießen kann –« Bloomfield lachte. »Sagte ich schießen? Hat doch schon jemand gemacht. Sie sagte, sie meint, ihn filmen, weißt du, mit einer Kamera.«
»Ihn filmen, wie er da liegt?«
»Ich glaube schon, ja.«
McIver zuckte mit den Schultern. »Meinetwegen.«
»Danke, Lieutenant.« Nell Ward berührte McIvers Ellbogen. Er sah sie an und sah dann weg, weil er sie nicht bloß ansehen konnte – er musste sie einfach anstarren. Eine schöne und ungewöhnliche Frau, nicht wie andere, die ihm begegnet waren, die, auch wenn sie schön waren, nie ungewöhnlich aussahen –außer Nutten oder Junkies oder Verliererinnen), und in dem Fall war das Ungewöhnliche an ihnen nur das Traurige gewesen. Nell Ward war ungewöhnlich, weil sie Männerkleidung trug – nicht bloß lange Hosen und Hemden und flache Schuhe, sondern Männerkleidung: heute einen zweireihigen Navy-Blazer über einem weißen Tennispullover mit Zopfmuster, ausgebeulte weiße lange Hosen, schwarzweiße Schuhe, ein Nadelstreifenhemd, einen Schlips; sie trug heute keinen Hut, sondern hatte ihr langes blondes Haar hochgesteckt, und von vorne sah ihre Frisur wie die eines Mannes aus – und ungewöhnlich, weil er, als er ihr in die Augen blickte, ein Schild mit der Aufschrift Betreten verboten entdeckte. »Es ist, äh, nicht schön, Miss Ward. Sie sollten das Tuch drauflassen.«
»Natürlich. Ich will die Leute nicht schockieren. Ich will versuchen zu zeigen, wie sie wirklich ist.«
»›Sie‹?«
»Die Arbeit der Polizei. Wer, glauben Sie, hat ihn umgebracht, Lieutenant? Nicht welches Individuum – ich weiß, dafür ist es zu früh –, sondern was für eine Art Mensch?«
McIver zuckte mit den Schultern. »Eine Art Killer.«
Nell Ward lächelte. »Okay, es war eine dumme Frage. Ich habe nur gefragt, weil ich gerade Cop gespielt habe und dachte, ich hätte die Antwort schon gefunden.«
»Ach ja? Und was ist die Antwort?«
»Ich habe bloß Cop gespielt.«
»Spielen Sie. Das kostet nichts.«
»Werden Leute nicht oft von Leuten umgebracht, die sie kennen?«
»Manchmal ja.«
»Oft.«
»Okay, oft.«
»Ich glaube, er wurde umgebracht von jemandem, den er kannte, nicht unbedingt persönlich, aber der ihn schon mal gesehen hat und den er vorher gesehen hat, jemand, der seine Strecke kannte, der wusste, wie verletzbar er wäre, mit so wenig Klamotten an. Kleidung verbirgt nicht nur, sie schützt auch.«
»Mhm.«
»Jemand, den er erkannte, wegen dem er vielleicht langsamer laufen würde. Sein Tempo – man denkt ja schon, dass er schnell lief – war seine einzige Verteidigung.«
»Aha. Interessant. Umgebracht weshalb? Um an sein Portemonnaie, seine Uhr, seinen Schmuck ranzukommen? Er hat nichts dergleichen dabei. Ich weiß nichts über Joggen, und ich habe noch nie jemanden überfallen, aber wenn ich’s täte, würde ich, glaube ich, keinen Jogger überfallen … wo die so wenig anhaben.«
Nell Ward berührte ihn am Ellbogen. »Hab bloß Cop gespielt, Lieutenant. Und jetzt muss ich Regisseur spielen. Danke, dass ich schießen – äh, filmen durfte.«
»Ja«, sagte McIver. Er ging zu Bloomfield hinüber. »Nimm dir noch mal die Wächter vor, Nate. Sie benehmen sich komisch; sie haben zu mir rübergeglotzt, als ob sie denken, ich weiß was, von dem sie nicht wollen, dass ich’s weiß.«
Auch der Mörder sah Tim McIver an und überlegte, ob der wohl ahnte, dass der Mörder gerade zuschaute.
Irgendwo und irgendwann hatte der Mörder etwas über Pyromane gelesen, und zwar darüber, wie oft sie dem Feuer zusehen, das sie angezündet haben, und dass ein Brandstiftungsexperte manchmal bloß die Menge zu mustern braucht, die sich um einen Brand versammelt, um den Täter zu erkennen. Könnte ein Cop die Menge mustern, die sich bei einem Mord versammelt und wissen, wer der Mörder ist?
Erstaunlich, wie cool sich der Mörder fühlte, wie entspannt. Ein gerötetes Gesicht, Achselschweiß – das wäre normal, aber er hatte kein Fieber, schwitzte nicht, ein Beweis, dass alles perfekt abgelaufen war.
Perfekt, wenn auch nicht nach Plan. Er war früher aufgestanden als sonst, aber das hatte perfekt zum Plan des Mörders gepasst, größere Dunkelheit und die Straßen viel leerer. Perfekt dunkel, perfekt leer.
Seine Regelmäßigkeit war sein Verderben gewesen, die gleichbleibende Routine, mit der er lebte – das Arschloch. Er hatte darüber gefaselt, als wäre es eine Tugend – dass er von A nach B nach C und wieder nach A lief, soundso viel Kilometer die Stunde, soundso viel Meter die Minute, soundso viel Zentimeter die Sekunde: Er hatte es alles geplant, kalkuliert, ausgemessen, vorausbedacht – das Arschloch.
Was für ein Hochgefühl war es gewesen, ihn stolpern und dann fallen zu sehen, sein kalkuliertes, ausgemessenes, regelmäßiges Leben zusammenbrechen zu sehen, zu sehen, wie sich sein Mund bewegte, als wollte er in Worte fassen, was ihm gerade passierte, den Schmerz in seinen Augen zu sehen, der nicht bloß körperlicher Schmerz war, sondern Ungehaltenheit darüber, dass er nicht das damit machen konnte, was er mit allem anderem in seinem Leben tat – es auf überschaubare, handhabbare Zahlen zu reduzieren. Das Arschloch.
Kapitel 4
Martin Klein weinte echte Tränen. »Sie werden mich zum Gespött machen.«
»Wer?« Charly Johnstone klemmte den Hörer in eine der Falten unter ihrem Kinn und zündete sich eine Sherman’s-Zigarette mit einem Ohio-Blue-Tip-Streichholz an aus der Schachtel, die sie in ihrer Handtasche trug – eine gelbe Netztasche aus Vorhangschnur mit der Aufschrift URGENT NEWSFILM. »Es interessiert mich nicht, ob am selben Abend eine O’Neill-Premiere ist. Ich will die Tavern on the Green … Ja, O’Neill ist tot, Mickey, und ja, ich will nicht das Sardi’s, das ist zu klein.«
»Vergiss die Premierenparty«, sagte Klein. »Ich werde mich umbringen – morgen, ganz bestimmt.«
Charlys Stimme wurde zu einem Kreischen. »Mickey? Wir brauchen unbedingt das Tavern on the Green. Martin will sich umbringen. Ruf Liz Smith an, ja? Ich rufe Suzy an.« Sie legte auf.
Jay Dillen lachte.
»Was zum Teufel ist so komisch, du Hohlkopf?« Klein suchte in seinen Taschen herum, fand eine Serviette aus dem Carnegie Deli und schnäuzte sich hinein.
»Das Leben.« Dillen goss sich einen Kaffeebecher voll aus einer Flasche Peters-Val-Mineralwasser. »Jede wache Minute.«
»Sag das Vivian Thibault Wyndham. Ruf Vivian Thibault Wyndham an – wann hast du das letzte Mal einen sicheren Sponsor aus einer Probe abhauen sehen? –, und erzähl ihr, wie komisch doch das Leben ist. Was für Wasser ist das? Das ist doch kein Perrier.« Klein sprach es so aus, dass es sich auf derriere reimte.
»Es kommt aus Deutschland«, sagte Dillen.
»Du trinkst deutsches Wasser? In meinem Büro? Wasser, das von dem absoluten Abschaum der Erde stammt? Was verlangen die dafür?«
»Das hier ist mein Büro, Marty. Zwei kosten 99 bei Gristede’s.«
Klein schnaubte. »Du fängst besser mal an, nach Sonderangeboten Ausschau zu halten, und die Zahnklammern für deine Kinder vergisst du auch am besten und gehst vielleicht mal beim Pfandleiher vorbei und lässt diese Uhr schätzen – was ist das, eine Rolex? – weil du, wenn dieses Stück nicht bald wie ’n Broadway-Stück aussieht statt wie ein Benefizstück für die Hadassah, da bist, wo der Pfeffer wächst, und nicht mal nen Pisspott dabeihast.«
Dillen trank einen Schluck Wasser. »Ich habe keine Kinder, Marty. Und wir haben immer noch drei Wochen für Previews.«
»Dies Stück sollte schon gestern wie ’n Broadway-Stück aussehen, nicht in drei Wochen, drei Tagen oder drei Stunden.«
Dillen sah auf seine Uhr – eine Omega. »In drei Stunden hat B. G. Harris die neue Szene fertig.«
Klein nahm den Becher und schnüffelte an dem Wasser. »Das war mein erster Fehler, ein Stück von einer Dramatikerin zu machen.«
Charly drohte mit einem Finger. »Vorsicht, Martin. Leise auftreten, mein Schatz.«
»Eine Frau, die nicht mal ihren eigenen Namen benutzt –«
»Die Geschichte, Martin, ist voll von herzlosen Müttern, die ihren Töchtern Namen gaben, die ihnen wie Albatrosse – Albatri? – ihr ganzes Leben lang am Hals hängen.«
»B. G. Was ist sie eigentlich, eine Rock-Gruppe? Und was bedeutet er, dieser Albatros von einem Namen? Und Dimanche« – er sprach es so aus, dass es sich auf Ranch reimte – »was für ein Name ist das überhaupt? Sie ist doch keine Französin, oder? Das war mein zweiter Fehler: eine Schauspielerin zu engagieren, die keine ist. Sie ist ein Popstar, wenn ich glaube, was ich heute in einem kleinen Artikel über die Schwierigkeiten gelesen habe, in denen unser Stück steckt. Was ist schon ein Popstar? Kommt ›Pop‹ von populär? Wie viele Leute braucht man, um populär zu sein oder das Schmiergeld bezahlen zu können?«
Dillen, dessen richtiger Name Davidovich war, sagte: »Dem Stück fehlt nur noch der letzte Schliff, Marty.«
»Kein Stück ist in Stein gemeißelt, Martin«, sagte Charly. »Ein Stück ist ein Lebewesen – ein lebender, atmender Organismus.«
»Verdammt, ich sollte mir einen Handwerker besorgen und keinen Schriftsteller. Ich sollte mir einen Handwerker besorgen und keinen Pressereferenten – Charlene. Ich versteh nicht, warum ich jeden Tag in der Zeitung lesen muss, dass dieser lebende, atmende Organismus Schwierigkeiten macht. Ich weiß, dass er’s tut, warum muss ich’s dann in der Zeitung lesen? Es ist dein Job, Dinge aus der Zeitung rauszuhalten und reinzubringen. Ich sollte mir einen Handwerker holen statt Dimanche, einen Handwerker statt einem Regisseur, denn weißt du, was ich so gedacht habe, Jay, während du da rumstandest und dir anhören musstest, wie sie sagte, sie kennt ihren Text, aber er gefällt ihr einfach nicht? Du hättest vielleicht mal sagen können, dass es nicht ihr Job ist, ihren Text zu mögen, sondern ihn zu sprechen. Hatte ich vielleicht unrecht? Bin ich altmodisch? Es ist doch nicht so, dass ich die ganze Zeit bloß rumsitze und über die Lunts rede, wie manche anderen Leute. Helen Hayes, die Barrymores. Ich bin ziemlich hip. Ich habe mir einmal das Living Theatre angesehen. Ich habe einen Popstar für die Hauptrolle in einem verdammten Broadway-Stück engagiert, ich sollte mich mal untersuchen lassen. Eigentlich sollte ich hier rumheulen.«
»Du bist ein Goldstück, Martin«, sagte Charly. »Ein Traditionalist, aber nicht so von Nostalgie erfüllt, dass du über die Straße gingst, ohne auf den Verkehr zu achten, und von Hansoms träumst, offenen Schlitten, die von einem Pferd gezogen werden; ein Perfektionist, aber offen für die Möglichkeiten der Improvisation. Ein Goldstück, kurz gesagt. Eine Legende, ein -«
»Hör auf, mich vollzusülzen, und sag mir einen guten Grund, warum ich nicht einen neuen PR-Mensch, einen neuen Regisseur und eine neue Hauptdarstellerin engagieren und die Bee Gees nach Australien zurückschicken soll.«
»Nach Indiana«, sagte Dillen.
»Es ist très simpel, Martin«, sagte Charly. »Wie heißt doch das alte Sprichwort? ›Erst die Seite, dann die Bühne‹. Um nicht zu sagen, erst die Besetzung, die Hauptdarsteller, die Proben, die PR-«
»Erzähl das mal Vivian Thibault Wyndham«, sagte Klein. »Ruf Vivian Thibault an – wo gehst du hin?«
»Auf die Toilette.« Mit ihrem schwarzen breitrandigen Hut, dem lila Kaftan, dem grauen Schal und den rot-weiß-blauen Etonic-Joggingschuhen sah Charly aus wie ein Schiff unter vollen Segeln, aber ohne jegliche Takelage.
»Deshalb wird nie eine Frau Präsidentin werden«, sagte Klein. »Die Russen würden vor Coney Island landen, und sie wäre gerade auf dem Klo. Was wollen Sie?«
Dillens Assistentin, die ihren Kopf ungefähr drei Zentimeter in den Türrahmen geschoben hatte, zog sich um die Hälfte zurück. »Mr. Dillen, ich hab Probleme, zur Westküste durchzukommen. Sie haben mich gebeten, es in einer halben Stunde noch mal zu versuchen.«
»Danke, Mindy«, sagte Dillen.
Klein griff wieder nach dem Becher und nahm einen Schluck. »Also Mindy ist ein schöner Name. Die Westküste? Warum zur Westküste durchkommen? Hey, Jay – was hast du vor? Bereitest du etwa ’nen Film vor, damit du im Trockenen sitzt, wenn das Stück hier den Bach runtergeht?«
»Amanda ist in L. A.«
»Du bist doch nicht immer noch sauer, oder? Weil Dimanche die Rolle gekriegt hat und nicht Amanda?«
Dillen schüttelte den Kopf.
»Lüg mich nicht an, Jay. Du bist es immer noch.«
Dillen zuckte die Achseln. »Ich war enttäuscht, ja. Ich habe mich auf die Gelegenheit gefreut, mit Amanda zusammenzuarbeiten. Jetzt sieht es aber so aus, dass sie den Roeg-Film kriegt, also ist alles bestens gelaufen.«
»Amanda Becker. Ein guter Name. Ein richtiger Name – wie Meryl Streep, nicht wie Dimanche. Ich hätte auf dich hören sollen, Jay.«
»Ich glaube, ich war derjenige, Marty, der Amanda gesagt hat, dass sie nicht die Richtige ist – dass die Rolle nicht zu ihrem Typ passt.«
»Typ, was soll’s. Ich will einen Schlager, keine Bombe. Wenn du einen Schlager willst, musst du dir Leute holen, die richtig einschlagen, keine Popstars. War es, äh, schwierig, Amanda zu erklären, dass sie nicht die Richtige ist, wo ihr doch, äh, was miteinander hattet?«
»Ein bisschen schwierig. Aber es ist gutgegangen.«
»Für sie vielleicht. Ein Roeg-Film. Aber nicht für mich.« Er nahm noch einen Schluck. »Das Wasser ist gar nicht so schlecht, dafür, dass es vom Abschaum der Erde stammt. Du solltest weiter so frugal sein, weil du bald am Arsch der Welt sitzen und nicht mal ’nen Pisspott haben wirst.«
»Vielleicht gewinne ich ja im Lotto«, sagte Dillen.
»Hast du dir ein Los gekauft?«
»Natürlich. Es ist wunderbar, ein Teil dieser kollektiven Erregung zu sein. Die ganze Stadt bebt vor Erwartung. Es ist wie die Yankees gegen die Mets, oder die Jets und die Giants beim Superbowl.«
»Weißt du, wie die Chancen stehen? Sechs Millionen zu eins.«
»Einer muss schließlich gewinnen.«
»Stimmt nicht. Ist nicht wahr. Absolut nicht. Es ist kein Pferderennen, wo auf jeden Fall ein Pferd gewinnt, und wenn es rückwärts über die Zielgerade läuft oder rübergejagt wird. Es ist reines Rätselraten, nur, dass du eine Zahl erraten musst, die es noch gar nicht gibt, wenn du sie geraten hast. Wenn die Zahlen feststehen und keiner richtig geraten hat, gewinnt auch keiner, und das Geld geht zurück in den Jackpot. Warum, glaubst du, sind im Jackpot zweiundfünfzig Millionen? Weil keiner in all den Wochen die richtigen Zahlen geraten hat.«
Dillen blieb fest. »Es kostet einen Dollar, Marty. So viel wie diese zwei Flaschen Mineralwasser. Es haut mich um, wenn ich mir vorstelle, dass ein Dollar zweiundfünfzig Millionen Dollar einbringen kann.«
»Erzähl das einem armen Schlucker in der South Bronx mit sechs Kindern und seiner Schwiegermutter in einer Zweizimmerwohnung und Raten für das Auto, den Fernseher, die Waschmaschine. Er denkt nicht, dass es ihn umhaut; er denkt, er hat eine Chance. Er hat keine Chance, Jay. Und das Einzige, was ihn umhaut, ist ein Tritt in den Arsch. Die Lotterie ist ein Komplott – ein Komplott, damit die armen Schlucker aus der South Bronx nicht ihre Besen anspitzen und ihre Eisenketten schwingen und zum Rathaus, zum Weißen Haus, dem Kongress oder was immer marschieren und ihren Anteil vom Großen Amerikanischen Traum fordern … Auf welche Zahlen hast du gesetzt?«