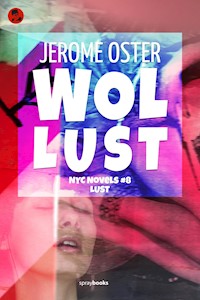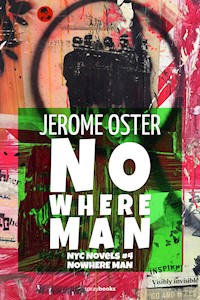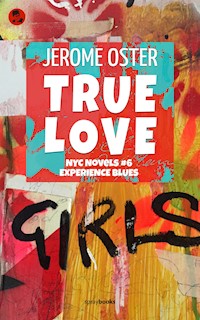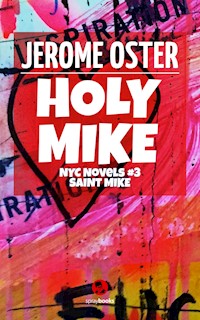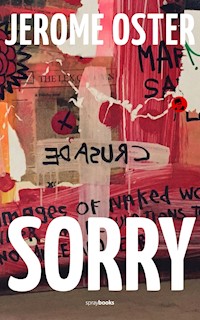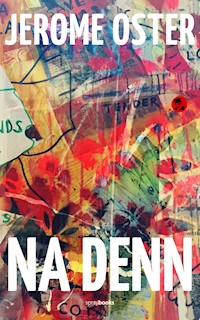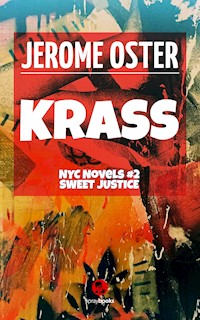
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: spraybooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: NYC Novels
- Sprache: Deutsch
Die Begegnung von Carlos Pabon und einer Smith & Wesson endet für Carlos mit einem Loch in der Stirn. Weil Pabon ein mieser kleiner Dreckskerl war, der seine Freude an der Angst anderer hatte, schreiben die Zeitungen von der Tat eines »Samariter-Killers«. Und es bleibt nicht das letzte Opfer dieses Täters. Gleichzeitig erschüttert eine zweite Mordserie die Megastadt – diesmal jedoch sind die Opfer ausnahmslos selbstbewusste, starke Frauen. Gibt es Zusammenhänge? Die Detectives Redfield und Neuman – unter Kollegen besser bekannt als Redford und Newman (nach den berühmten Schauspielern aus Filmen wie »Butch Cassidy und Sundance Kid« oder »Der Clou«) – machen sich an die Arbeit …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 394
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Krass
NYC Krimis #2: Sweet Justice
Jerome Oster
Übersetzt vonJürgen Bürger
Erste eBook–Ausgabe 2018, v1.1
Die amerikanische Originalausgabe erschien 1985 unter dem Titel »Sweet Justice« Copyright © 1985, 2018 by Jerome Oster
Unter dem Titel »Dschungelkampf« zuerst auf Deutsch erschienen 1987 im Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg.
Copyright © 1987, 2018 der deutschen Übersetzung by Jürgen Bürger
Durchgesehene und überarbeitete deutsche Ausgabe
Redaktion Doris Engelke
Korrektorat Christoph Steinrücken
Copyright © dieser Ausgabe 2018 bei
spraybooks Verlag, Oktober 2018
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werks darf in irgendeiner Form ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
spraybooks Verlag Bielfeldt und Bürger GbR
Remigiusstr. 20, 50999 Köln
www.spraybooks.com
ISBN: 978-3-945684-19-1
Dieser Roman spielt ganz offensichtlich in NYC. Dennoch sind die Personen und Ereignisse frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit lebenden oder toten Personen oder Ereignissen wäre reiner Zufall.
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Werbung
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Über den Autor
Weitere Bücher von Jerome Oster
Mehr spraybooks …
Kapitel 1
Carlos ließ sein Messer am Oberschenkel der Frau entlanggleiten, der durch den Schlitz in ihrem langen schwarzen Kleid bis zur Hüfte nackt hervorschaute.
Der Prince tanzte mit zusammengekniffenen Augen verzückt zu den Salsaklängen, die aus dem Panasonic in seiner Armbeuge dröhnten. Er hielt das Radio wie ein Baby.
Zero lungerte auf der Bank, zog an einem Joint.
Mit der Spitze des Stiletts berührte Carlos die Stelle zwischen den Brüsten der Frau, ihre nackten Schultern, das Grübchen an ihrem Hals. Ihre grünen Augen musterten ihn verächtlich.
Zero lachte. »Yo, Carlos. Willste die Braut ficken?« Wie mit all seinen Versuchen, bei Carlos auf die Kumpeltour zu landen, fiel er auch mit dieser Bemerkung auf die Nase.
Mit der Messerspitze fuhr Carlos über den Unterarm der Frau und die kurze weiße Pelzjacke, die sie lässig über ihre Schulter geworfen hatte.
Die Gleise klirrten. Ein Luftzug durchfuhr den Tunnel.
»Ey, die Bahn«, rief Zero, rutschte von der Bank, versuchte seine Schlappe wieder wettzumachen. Er beugte sich weit über die Bahnsteigkante, nickte seine Diagnose ab und richtete sich wieder auf, am Kragen seiner Nylon-Windjacke zupfend. »Sag ich doch, ne Bahn. Scheiß, wurde ja auch mal Zeit.«
Der Prince wechselte den Sender, wirbelte über Werbung, Nachrichten, Gerede, Mozart, Mantovani, suchte nach noch einem Song wie der Nummer eben. Ein Hai, der immer in Bewegung bleiben muss, sich das Leben aus der Musik holt.
Carlos trat einen Schritt zurück, um die Frau von oben bis unten zu betrachten. Sie hatte die linke Hüfte abgewinkelt, die linke Hand lag auf ihrem Hintern – ganz leicht, schien ihn sanft zu streicheln. Ihre Haut war weiß: weiß neben dem schwarzen Kleid, weiß neben dem rotbraunen Haar, weiß neben den dunkelrot geschminkten Lippen, weiß neben der kurzen weißen Pelzjacke. Am linken Handgelenk trug sie ein goldenes Armband, am rechten Ringfinger einen silbernen Ring. An den Füßen hochhackige silberne Sandalen. Sie war schon überall gewesen, hatte alles erlebt und würde wieder losziehen, sobald sich etwas Neues ergab; mit ihr zu sein, würde ein teures Vergnügen.
Der Luftzug aus dem Tunnel wurde stärker; es stank nach der abgestandenen Hitze des Sommers.
Das Plakat war größer als alle anderen an den Wänden der U-Bahnstation; die Frau war beinahe lebensgroß. Sie posierte vor etwas, das die Skyline von Manhattan sein sollte – erleuchtete Fenster in Gebäuden, die sich gegen einen mit einem Sichelmond geschmückten Nachthimmel abzeichneten. Die Fenster bildeten Worte: KANAL 3 – IMMER DABEI. Über dem Fenster, in einer Schrift in genau demselben Rot wie der Lippenstift der Frau, stand: Bleib lange auf mit Chris Kaiser. Unter den Füßen der Frau, in großer Blockschrift im Silber ihrer Sandalen, die eindringliche Aufforderung: SEHEN SIE NEW YORKS SPÄTNACHRICHTEN. NACHTS UM 12 AUF KANAL 3 MIT CHRIS KAISER … EINFACH SENSATIONELL!
Das dumpfe Grollen des einlaufenden Zugs wurde zu einem Donnern.
Carlos wollte in ihrem Mund, ihrem Arsch, ihrer Fotze sein. Er wollte leergesaugt, ausgelutscht und wieder leergesaugt werden. Er legte die Messerspitze zwischen ihre Beine und drückte fest zu, zerriss dabei das Papier. Er zog die Hand zurück und stach in ihren Unterleib.
Zero lachte, schlug sich auf die Schenkel. »Gib’s ihr, Mann, gib’s … ihr. Yo, Prince. Yo! Guck dir das an. Carlos fickt die Nutte.«
Sorgfältig schlitzte Carlos ihr die Kehle auf.
Mit einem Höllenlärm fuhr der Zug in die Station ein, übertönte die Musik, überflutete den Bahnsteig mit Hitze und Lärm. Carlos trat zurück, ließ das Messer zuschnappen, schob es in die Tasche seiner Tarnjacke und drehte sich um.
Mit lautem Kreischen hielt der Zug. Dann war Prince’s Musik wieder besser zu hören.
»Yo, Carlos. Komm jetzt, Mann.« Zero stand in der mittleren Tür des letzten Waggons und hielt die automatische Schiebetür mit einem Fuß offen.
»Weg von den Türen da hinten!« Die müde Stimme des Zugführers dröhnte durch das statische Rauschen der Lautsprecheranlage.
Zero beugte sich aus dem Wagen und zeigte dem Zugführer den gereckten Mittelfinger. Er warf Carlos einen Blick zu, wollte Beifall.
Carlos legte eine Hand auf Zeros Brustkorb – er war weich, scheinbar knochenlos – und schob ihn in den Wagen. »Mach schon, Arschloch! Du hast doch den Mann gehört!« Carlos blieb in der Tür stehen, als der Zug sich langsam wieder in Bewegung setzte, sah zu der Frau zurück, die ihn nicht länger quälen würde. Dann ging er zu der Haltestange in der Mitte des Wagens und lehnte sich dagegen. Er sah in Fahrtrichtung, die Hände in den Gesäßtaschen seiner Jeans, die Knie entspannt, um die Stöße des Zuges abzufedern, die Augen auf die Beine einer winzigen Asiatin in der Uniform einer Krankenschwester geheftet.
Von seiner Endstation in der Zweihundertsechsundvierzigsten Straße in der Bronx bis zu dieser Haltestelle in der Einhundertachtundsechzigsten Straße in Manhattan hatte der in südlicher Richtung fahrende Broadway-Nahverkehrszug nur wenige Passagiere eingesammelt. Sie lebten in einem anderen Rhythmus als der Großteil der übrigen Welt: Arbeiter auf dem Heimweg oder auf dem Weg zur Schicht; Nachtmenschen, die schon früh unterwegs waren; Frühaufsteher, die sich spät nach Hause schleppten. Und Spezialisten: ein Penner, der den Zug für diese Nacht zu seiner Absteige umfunktioniert hatte und gerade seine zweite Tour von der Bronx zur Battery und zurück machte; ein Graffiti-Künstler, der am Times Square in die Flushing-Linie umsteigen und zu den U-Bahndepots nach Queens fahren würde – seinem Atelier –; dort würde er die Nacht damit verbringen, Züge im wild style zu bemalen. Die Fahrgäste saßen weit voneinander entfernt, jeder eingehüllt in seine eigenen Ängste, denn jeder von ihnen könnte ein Krimineller sein – außer der Krankenschwester, die nur Opfer sein konnte.
Der Prince drehte die Lautstärke seines Panasonic hoch, damit er die Musik trotz des Zuglärms hören konnte.
Zero inhalierte den letzten Zug seines Joints und schnippte die Kippe auf ein geöffnetes Fenster zu. Er traf nicht und so landete sie auf dem freien Platz neben einem Mann in Jeans und Cordjacke, der ein Taschenbuch las. Der Mann wischte die Kippe mit seinem Buch vom Sitz.
»Yo, Arschloch. Is doch keine Müllkippe hier.« Zero lachte und fixierte Carlos’ Rücken. Seine Augen bettelten, dass Carlos sich umdrehen und ihn loben möge. Als sein Blick zurückwanderte, sah der Mann ihn an, erkannte sofort seine Situation. Zero studierte eine Werbung über dem Kopf des Mannes – oder versuchte es wenigstens; in der fünften Klasse hatte er aufgehört, zur Schule zu gehen.
Carlos zog unterdessen in Gedanken langsam die Krankenschwester aus, warf ihr Häubchen zur Seite, dann ihr Cape, zog eine Lage der gestärkten sterilen Kleidung nach der anderen fort, bis ihr winziger Körper vor ihm lag. Er zischte durch zusammengepresste Zähne und lächelte, als sie ihn nicht ansah, denn er wusste, dass sie ihn gehört hatte. Er setzte sich ihr gegenüber auf eine Bank, streckte die Beine aus. Seine Converse All Stars berührten beinahe ihre winzigen weißen Schuhe.
Sie zog die Füße weg.
In der Hundertsiebenundfünfzigsten Straße stieg niemand aus und niemand ein.
Carlos setzte sich neben die Krankenschwester. Sie roch sauber. Mit winzigen Händen drückte sie ihre Handtasche fest an ihren Bauch. Ihr müdes Gesicht war voller Angst. Ihre Augen waren weit aufgerissen.
Carlos schob einen Finger hinter ihr Ohr und hob eine Haarsträhne an. »He, Baby, willste ein bisschen Spaß?«
Sie schloss die Augen und hielt die Luft an.
Carlos ließ einen Fingernagel unter ihr Ohrläppchen gleiten. »Ich hab ein echt großen Schwanz.«
Die Krankenschwester stand auf und ging mit steifen Schritten zum vorderen Ausgang.
Carlos holte sie ein, packte ihr Handgelenk und drehte sie herum, zog sie an sich und beugte sich herab, um sie zu küssen. Sie drehte den Kopf blitzschnell zur Seite, und er bekam nur einen Mund voller Haare.
Zero konnte nicht anders, er prustete laut los. Dann stand er auch schon neben Carlos, zielte mit einem Finger genau zwischen die Augen der Krankenschwester. »Yo, Fotze. Stehst du nicht auf meinen Freund, oder was?«
Carlos packte Zero am Kragen und stieß ihn zu der Verbindungstür zum nächsten Wagen. »Lass keinen rein oder raus!«
Zero, der arme Zero – sein richtiger Name war Roberto, nach einem Baseball-Star, aber er war immer nur Zero, nicht mal eine richtige Zahl –, hob die Hände und ließ sie sofort wieder sinken. »Wie soll ichn das machen?« Er spürte die Blicke des Mannes in Jeans und Cordjacke und sah ganz bewusst nicht zu ihm rüber.
Carlos stöhnte und ließ genervt die Schultern sinken. »Du hast dochn Scheißmesser, oder?«
Froh, daran erinnert zu werden, holte Zero das Messer raus, klappte es auf und filetierte die Luft, während er langsam rückwärts Richtung Tür ging. »Keiner rührt sich, kapiert?« Er spürte, wie der Mann in Jeans und Cordjacke nervös auf seinem Platz rumrutschte.
Der Prince hatte sich bereits unaufgefordert vor der hinteren Tür des Wagens aufgebaut, die Panasonic auf dem Boden zwischen seinen Füßen. Er sagte nichts, hielt sein Messer in beiden Händen. Ein echter Fighter.
Carlos hob sein Messer vors Gesicht der Krankenschwester und ließ die Klinge herausspringen. Obwohl sie die Augen geschlossen hatte, zuckte die Frau zusammen. Er lachte. »He, Baby. Du musst echt keine Angst haben. Wir zwei machen gleich was total Schönes …«
Die anderen Fahrgäste saßen wie benommen und stumm da. Kopien menschlicher Wesen, die beteten, dass es bald vorbei sein möge. Alle außer dem Mann in Jeans und Cordjacke, der sich vorbeugte, die Ellenbogen auf den Oberschenkeln, das Taschenbuch immer noch aufgeschlagen in den Händen, wie ein Gebetbuch. Doch er studierte nicht den Text, er verfolgte alles aufmerksam.
Der Zug wurde immer langsamer, schließlich kroch er nur noch, aufgehalten von irgendeinem unerklärbaren Signal kurz vor der Haltestelle in der Hundertsiebenundvierzigsten Straße.
Zero war sich ganz sicher, dass jemand die Notbremse gezogen haben musste, dass gleich die Cops den Zug umringen und sie mit ihren Taschenlampen blenden würden, während ihre Megaphone mit Rückkopplungen kreischten. »Yo, Carlos.« Er zuckte zusammen, als Carlos ihm einen bösen Blick zuwarf, weil er seinen Namen ausgesprochen hatte. »Ich … ich will doch nur wissen, ob wir hier aussteigen?«
Carlos stieß seine Knie gegen ihre Beine, sie setzte sich in Bewegung, er schob die Krankenschwester vor sich her den Gang hinunter. Vor jedem Fahrgast blieb er stehen, grinste spöttisch, als alle schnell wegsahen. »Marciónes. Ihr beschissenen Feiglinge. Wollt ihr der Kleinen nicht helfen? Huevones. Hijos de puta. He, oder wollt ihr vielleicht auch ein Stück vom Kuchen? Wollt ihr die Kleine ficken? Fickt euch selbst! Ich und meine Freunde hier, wir machen ne kleine Party. Und ihr, ihr bleibt schön, wo ihr seid. Verstanden? Ihr folgt uns nicht. Und ihr zieht auch nicht die Notbremse. Und ihr ruft auch keine verdammten Cops. Ihr fahrt einfach schön weiter und vergesst, dass ihr was gesehen habt. Ihr werdet euch an nichts, an überhaupt nichts erinnern. Nada. Verstanden, ihr Saftsäcke? Und um die Kleine hier macht euch mal keine Sorgen. Wir werden ihr schon nichts tun. Wir feiern nur ein bisschen, ich und meine Freunde.« Carlos schob sich den Messergriff zwischen die Zähne und streichelte die Brüste der Krankenschwester, ihren Venushügel, ihren Hintern.
Zero lachte, aber er wusste genau, dass er keinen hoch kriegen würde. Er würde wieder der letzte sein, so wie damals, als Miguels Cousine aus Santo Domingo sie alle rangelassen hatte. Bei dem Gedanken an sie, glitschig vom Sperma seiner Freunde, wurde ihm immer noch kotzübel.
Der Zug ruckte und rollte langsam in die Station.
»Carlos.« Der Mann in Jeans und Cordjacke stand im Gang. Er klappte das Taschenbuch zu und schob es in seine Gesäßtasche.
Carlos nahm den Messergriff wieder aus dem Mund und hielt der Krankenschwester die Klinge an die Kehle. »Setz dich wieder hin, Mann.«
»Lass sie los«, sagte der Mann, laut genug, um den Zug zu übertönen. »Steigt einfach hier aus, genau wie du gesagt hast. Aber ohne sie. Steigt aus, und alles ist gut. Keine Cops. Nichts. Und jetzt lass sie los.«
Er war schlank, wie ein Läufer. Er trug Mokassins und einen marineblauen Pullover. Er mochte Student sein, vielleicht schon ein bisschen zu alt, oder ein junger Professor – für Englisch oder Mathematik. Oder ein Dichter oder ein Banker, der sich mal unters gemeine Volk mischt.
»Lass sie los«, sagte er wieder. Das war ein Befehl – kein Vorschlag, keine Bitte.
Carlos hörte die Autorität in der Stimme des Mannes und spürte die Schnelligkeit und Kraft, doch er genoss die Gefahr. Er war schon zu weit gegangen, um jetzt noch zurückzustecken. »Coño de tu madre.«
»Carlos.« Zero stand an der Tür, bereit, sofort abzuhauen. »Wir halten.«
Der Mann machte einen Schritt. »Lass sie los … Carlos.« Er lächelte über den Vorteil – wie klein auch immer –, den der Name ihm gab.
Carlos drückte die Messerspitze fester gegen den Hals der Krankenschwester. »Bleib stehen, motherfucker.«
Der Mann kam näher, langsam, geschmeidig.
Die Krankenschwester öffnete die Augen. »Nein. Bitte. Er wird mich umbringen.«
Der Mann blieb stehen. Mit einer Hand strich er sich durch sein braunes Haar, das aus der Stirn gekämmt war. Plötzlich drehte er sich um und bremste den Prince, der sich herangeschlichen hatte, mit ausgestreckter Hand aus. »Bleib stehen.«
Der Prince lächelte und ließ sein Messer von der rechten in die linke Hand wandern.
Der Mann zog eine Pistole aus einer Innentasche seiner Jacke und richtete sie auf Prince, duckte sich leicht, die Füße gespreizt, zielte mit beiden Händen. Prince erstarrte und wich zurück.
Der Zug hielt. Die Türen öffneten sich.
»Zero! Halt die verdammten Türen auf.« Carlos bewegte sich Richtung Tür, zog die Krankenschwester mit sich.
Zero stöhnte über den Verlust seiner Anonymität.
»Carlos!«
Verrückt – Carlos warf einen Blick hinter seinem menschlichen Schild hervor, vom Ruf des Mannes aufgestört. Sie waren mehr als Gegner; sie waren Tänzer in demselben Tanz, und er musste einfach reagieren. Die Kugel traf ihn zwischen die Augen.
Das Gewicht von Carlos’ Körper warf die Krankenschwester über die Metalllehne einer Sitzbank, ihr blieb die Luft weg. Als sie wieder atmen konnte, schrie sie.
Fahrgäste ließen sich fallen und schrien ebenfalls.
Zero stürzte los. Der Prince rannte, ließ seinen Panasonic im Stich.
Die Türen schlossen sich. Der Zug setzte sich langsam wieder in Bewegung.
Der Mann zog Carlos’ Körper von der Krankenschwester herunter und schleuderte ihn zu Boden, als wöge er gar nichts. Er berührte die Schulter der Krankenschwester, schließlich schaute sie zu ihm hoch. Er lächelte, legte eine Hand auf ihren Kopf, dann ging er zum vorderen Teil des Waggons, öffnete die Schiebetür und trat auf die Metallplattform hinaus. Er löste die Kette, stellte sich auf die Fußstützen, schob die Ziehharmonikaverbindung zurück und sprang, die Hände ausgestreckt, auf den Bahnsteig, er fiel, rollte sich ab, kam wieder auf die Füße, die Pistole – während des Sprunges weggesteckt – wieder gezogen, die Beine breit, mit beiden Händen die Waffe haltend.
Der Bahnsteig war leer.
Der Mann steckte die Pistole ein, wischte sich den Schmutz des Bahnsteiges von Jeans und Jacke, feuchtete mit den Lippen eine Fingerspitze an und rieb an einer Schramme an seiner linken Hand. Dann strich er sich mit beiden Händen durch die Haare und ging auf den Ausgang zu.
Der Fahrkartenverkäufer in seiner kugelsicheren Festung blickte nur kurz von einer Zeitung auf, als der Mann durch das Drehkreuz ging. Die Schlagzeile der Zeitung lautete:
Kriminalität in der U-Bahn endlich besiegt?
Kapitel 2
DeWitt Strawberry öffnete den Reißverschluss seiner Hose. Er hatte schon seit einer Stunde einen Steifen und sein Ding sprang wie ein Schachtelteufel heraus. Er streichelte ihn, während er in die Schwärze starrte und versuchte, das ebenholzschwarze Paradies zu erkennen, das Ivory Snow Richardson ihm versprochen hatte.
»Ivory? Ivory, bist du da? Komm schon, Mädchen, du kannst einen Mann doch nicht so quälen. Ich platz gleich!«
Aus der Wohnung auf der obersten Etage der heruntergekommenen Mietskaserne, wo Ivory Snow auf DeWitt warten und ihm geben würde, was er schon seit Wochen wollte, drang kein Laut.
»Ivory Snow?«
DeWitt lächelte, als er ein leises Stöhnen aus der Wohnung hörte. Bei dem Gedanken daran, dass Ivory Snow hinter dieser Tür auf der Matratze lag, auf der sie es, wie sie selbst gesagt hatte, früher schon getrieben hatte – sie sagte nicht, mit wem –, und gerade an sich selbst spielte, während sie auf ihn wartete, wurde sein Schwanz noch härter.
»Ivory? Was machstn da drinnen, Mädchen? Sags DeWitt. Hast du vielleicht die Hand im Höschen und machst dich schön feucht? Komm schon, sags DeWitt … Du sagst mir, was du machst, und ich sag dir, was ich mache. Wie ich meine Hand um mein Riesending lege, das ist so groß, dass meine Finger fast zu kurz sind. Meine Rute wird schon ganz glitschig. Die wartet nur darauf, wie geölt in dich reinzurutschen, wie ein verdammter, dicker Ast … Oh, komm schon, Ivory, erzähl DeWitt, was du machst.«
Wieder ein Stöhnen.
»Ivory? Hast du eine Hand auf deiner Titte?«
Und wieder Stöhnen, was für DeWitt ganz klar ja, ja bedeutete. Er machte einen Schritt in die Finsternis, die nicht weniger undurchdringlich geworden war. Auf dem Weg hierher war er noch kurz in den Süßwarenladen gegangen und hatte sich für neunundfünfzig Cents eine Mini-Taschenlampe gekauft. Nur für alle Fälle. Er tastete in der Gesäßtasche danach, nahm sie aber nicht heraus. Damit würde er warten, bis er neben Ivory Snow lag. Und im Licht der Lampe würde er dann ihren prächtigen Körper erforschen.
DeWitt machte einen weiteren Schritt und dann noch einen.
»Ivory. Ich komme, Mädchen. Dein wunderbarer DeWitt kommt jetzt, und er bringt seinen besten Freund mit, und, Mädchen, du wirst seinen Freund lieben.«
Nach einem weiteren Schritt stieß er mit seinem Fuß gegen die Matratze.
Das Stöhnen schien von irgendwo hinter seinem Rücken zu kommen, aus einer Ecke, und für einen Augenblick war DeWitt erschrocken. Aber er wusste ja, welche Streiche einem die Akustik in diesen leeren alten Gebäuden spielen konnte. Er streckte die Hand aus und fand ein Bein. »Ivory? Ivory, was ist denn mit dir? Wieso hast du eine Hose an? Ich hab dir doch gesagt, dass du ein Kleid anziehen sollst. Das rote, in dem du so toll aussiehst. Ivory?«
Na ja, trotzdem, vielleicht war es ja diese knallenge weiße Hose, unter der sich Ivorys Slip abzeichnete. Er würde sie einfach auf den Bauch drehen und sein Ding zwischen ihre Arschbacken drücken, die in dieser Hose, ooh, so toll, zusammengepresst wurden.
DeWitt kniete sich auf die Matratze und wollte Ivory, eine Hand auf jedem Bein, dazu bringen, sich umzudrehen. »Komm schon, Mädchen. He, ich hab ne Idee. Ich glaub, das wird dir gefallen.«
Die Beine ließen sich nicht bewegen. Und nicht nur das, die Füße steckten in Stiefeln – in großen, schweren Stiefeln.
»He, Ivory, was machst du, Mädchen? Willste DeWitt vielleicht einen Streich spielen, oder was? Ivory?«
Er rief ihren Namen in Richtung Ecke, denn von dort war das Stöhnen gekommen. Keine Antwort.
Stiefel? Na schön, Stiefel können auch ganz interessant sein. DeWitt dachte an die Frauen in den Zeitschriften, die es im Hinterzimmer des Süßwarenladens gab. Frauen, die manchmal in Stiefeln fotografiert wurden – hohe Lederstiefel, Cowboy-Stiefel, Bauarbeiterstiefel, Motorradstiefel – und mit sonst nichts. Sie sahen schon okay aus, und genauso würde auch Ivory Snow Richardson aussehen. Klarer Fall. Seine Ohren spielten ihm einfach einen Streich.
DeWitt streckte sich auf der Matratze aus, sehnte sich danach, dass sie ihn endlich berührte. Er suchte in seiner Tasche nach der kleinen Lampe und legte sie so, dass sie das Kopfende der Matratze beleuchten würde. »Ivory? Ich muss dir was zeigen. Mein Freund, du weißt schon, der, von dem ich dir erzählt habe? Er ist da. Komm schon, Mädchen, sag ihm guten Tag. Gib ihm die Hand. Sag ihm, wie sehr du dich freust, ihn kennenzulernen. Hier, ich knips die Taschenlampe an, damit du dir sein hübsches schwarzes Gesicht mal ansehen kannst.«
Mit der Rechten nahm DeWitt ihre Hand – ihre unglaublich schwere Hand – am Handgelenk und führte sie zu seinem Schwanz. Mit der Linken schaltete er die Taschenlampe ein.
Das Licht war überraschend hell. Die Lampe warf einen Lichtkegel über die Matratze und machte unmissverständlich klar, dass das Wesen auf der Matratze, das Wesen mit einer Hand auf DeWitts Schwanz, keineswegs Ivory Snow Richardson war, sondern vielmehr ein Mann. Ein großer Mann, ein Mann mit blauer Trainingsjacke und weißen Streifen auf den Ärmeln, ein Mann mit langer schwarzer Baumwollhose, ein Mann mit Springerstiefeln an den Füßen, ein Mann mit kahl geschorenem Kopf und einem buschigen Schnurrbart, ein Mann mit einem Loch auf der Stirn, ein toter Mann.
In dem Licht war jetzt auch Ivory Snow Richardson zu erkennen, die in der Ecke in der Lache ihres eigenen Erbrochenen kauerte und stöhnte.
Auch DeWitt Strawberry musste kotzen. Auf die Brust des toten Mannes.
Kapitel 3
Die Männer an der Theke starrten zum Fernseher hoch wie Gläubige vor einem Altar.
Die Frau auf dem Bildschirm hatte rotbraunes Haar, weiße Haut und rote, rote Lippen. Ihre Augen waren grün. Sie trug eine limonengrüne Seidenbluse, über deren oberstem Knopf ein Stück dunkelgrüne Spitze herausschaute. »Hi. Ich bin Chris Kaiser. Herzlich willkommen zu New Yorks spätesten Spätnachrichten auf Kanal Drei – nur hier ist man immer dabei … Unser erster Beitrag: Bürgermeister Berger und der Chef der U-Bahnpolizei Nolan gaben heute Nachmittag eine Pressekonferenz, auf der sie erklärten, dass der Krieg gegen die Kriminalität in unseren U-Bahnen gewonnen sei. Gleich kommt der Bericht unseres Reporter Jim Giles, doch vorher …«
Eine Bier-Werbung füllte den Bildschirm.
»Ja?« Der Barkeeper war eine Frau mit verwuschelten roten Haaren und einem Gesicht, dem es an Symmetrie fehlte.
»Ein Bier«, sagte der Mann mit der Cordjacke.
»Ein Miller?« Sie deutete mit ihrem Kopf kurz auf den Fernseher. »Es ist Zeit für ein Miller.«
»Ba Mi Ba«, sagte der Mann. Er rieb sich seine Handfläche, wo er eine rote Schürfwunde hatte.
Sie stützte die Hände in die Hüften. »Miller, Bud, Rheingold, Schafer, Schlitz, Hite, Heineken, Michelob, Coors, Bass Ale, Löwenbräu, Watney’s, Rolling Rock … Soll ich weitermachen? Meine Schicht endet um vier.«
»Bud.«
»Ein Bud. Wieso wollen die Leute immer ein Bud, wenn ich aufzähle, welche Biersorten wir haben? Wenn sie schon nicht mehr Fantasie haben, warum fragen sie nicht gleich danach?«
Der Mann schaute zu dem Fernseher hoch. Chris Kaiser saß auf einem weißen Ledersessel, hatte die langen Beine übereinandergeschlagen. Der Schlitz in ihrem grauen Rock zeigte einen weißen Streifen Oberschenkel. Ihr Manuskript hielt sie auf dem Schoß. Der rechte Arm lag lässig auf der Rückenlehne des Sessels; eine Pose, durch die die Bluse ihre Brüste umspielte.
»Gefällt sie Ihnen?«, fragte die Frau hinter der Theke. »Viele Kerle mögen sie.« Sie stellte ein Glas auf einen Untersetzer, füllte es und stellte dann die Flasche auf die Theke. »Hab noch keinen Kerl getroffen, dem sie nicht gefiel. Einsfünfzig.«
Der Mann bezahlte mit einem Fünfer, nahm einen Schluck und stellte sich vor, dass es ein Ba Mi Ba wäre. Als er das letzte Mal ein Ba Mi Ba getrunken hatte, hatte er kurz vorher einen Mann getötet. Um eine Frau zu beschützen. Eine Asiatin. Seine Hand hatte damals gezittert, weil er sie, eigentlich, gar nicht beschützt hatte. Er war zu spät gekommen. Er hatte nur noch ihren Angreifer töten und so vielleicht andere Unschuldige beschützen können.
Die Frau kam zu ihm, wischte mit einem Handtuch über den Tresen. »Verletzt?« Sie nahm seine Hand und berührte behutsam das weiche Fleisch. »Eine üble Schramme. Das sollten sie besser mal auswaschen. Ich hole heißes Wasser aus der Küche.«
Als sie mit einer Schüssel heißem Wasser, einem Handtuch und Seife zurückkam, war der Mann fort, das Bier nicht ausgetrunken, das Wechselgeld von dem Fünfer lag immer noch auf der Theke.
»Ach, Linda. Du hast wirklich ein glückliches Händchen. Und ein großzügiges Trinkgeld dazu.«
Kapitel 4
Chris Kaiser schleuderte die Schuhe von sich. Diese Geste war so etwas wie ihr Markenzeichen, ein Signal, dass die Sendung zu Ende war, eine Einladung an ihre Kollegen, von den Podesten, oberhalb der Bühne herunterzukommen und sich um ihren weißen Ledersessel zu versammeln, während der Nachspann über den Bildschirm lief. Für die Zuschauer zu Hause waren die anderen nichts als Silhouetten; ein einziger Scheinwerfer war auf Chris Kaiser gerichtet.
Sie streckte sich und legte die Hände in den weißen Nacken, warf ihr rotbraunes Haar zurück und lächelte. Ihre Stimme jedoch war eiskalt. »Ich will nicht noch einmal so lächerlich gemacht werden wie eben.« Für die Zuschauer zu Hause schien sie mit ihren Kollegen zu fachsimpeln und die Erinnerung an einen gut erledigten Job zu genießen.
Ihre Kollegen senkten die Köpfe, wussten nicht, wer von ihnen sie durch Unvollkommenheit beleidigt hatte.
David Dempsey, der Wetterfrosch, riskierte seinen Kopf. »Eine andere Vorhersage konnte ich nicht bringen, Chris.« Chris Kaiser war überzeugt, dass die Zuschauer glaubten, die Meteorologen würden das Wetter machen – woher sollten sie denn sonst wissen, wie es werden würde? – und dass solche trostlosen Prophezeiungen wie die von Dempsey – er hatte für das Wochenende Regen vorausgesagt – sie dazu bringen würden, auf einen anderen Kanal umzuschalten.
Chris streckte die Hand aus und lud Dempsey mit einem Lächeln ein, sie zu berühren. »David, Schätzchen. Sei doch nicht dumm. Der Sommer ist vorbei. Die Leute sind doch froh um jede Entschuldigung für ein ruhiges Wochenende daheim.«
Zu Hause vor dem Bildschirm fragten sich die Leute, ob die beiden wohl ein Liebespaar waren. Sie berührten sich ständig, lächelten einander unentwegt an.
Randy Peck, der Sportredakteur, räusperte sich. »Ich, äh, hoffe, du hattest nichts gegen meinen kleinen Witz.« Als er von Ermittlungen der Bezirksstaatsanwaltschaft Bronx berichtet hatte, weil einige ortsansässige Baseball-Spieler angeblich Kokain schnupften, hatte er, ad libitum, ihren Club die »New York Junkies« genannt. Chris machte selbst gern solche Witze – oder wollte zumindest vorher informiert sein, wann sie aus einer anderen Ecke kamen, um mit ihrem extravaganten Lachen zu unterstreichen, wie komisch sie waren.
Chris zog ihre Hand zurück und gewährte Peck einen freundlichen Händedruck. »Aber Randy … das war komisch.«
Ruby Tuckers Unterlippe zitterte. Sie hatte ihren Exklusivbericht verdorben – dass in einem wilden Streik von Lehrern der staatlichen Schulen eine Einigung kurz bevorstand – und gesagt, dass der Unterricht »hoffentlich« am Montag wieder aufgenommen werde. Als Chris den Job des Koordinators übernommen hatte, hatte sie unmissverständlich klargemacht, dass in ihrer Sendung keine Nachricht durch irgendwelche Adverbien an Durchschlagskraft verlieren dürfte.
Doch Chris Kaiser sah weder Ruby noch Kristen Richards, den Unterhaltungsredakteur, noch Tess Delany an, die New Jersey-Korrespondentin, die im Studio war, um einen Bericht über die Sanierung von Weehawken anzukündigen. Sie sah Jim Giles an, mit einem Lächeln, das die Zuschauer zu Hause als Bewunderung interpretieren konnten. Jim Giles war der Nestor der New Yorker Fernsehjournalisten, ein Mann, der sein Handwerk bei Edward R. Murrow gelernt hatte und den viele für den einzigen Hüter von Vernunft und Anstand in diesem Sender hielten. Nach fünfzehn Jahren als Koordinator und Moderator der Sechs- und Zehn-Uhr-Nachrichten von Kanal 3 war er schließlich in die zweite Reihe verdrängt worden, als das Management des Senders, gierig auf höhere Einschaltquoten, die Sechs-Uhr-Nachrichten durch eine Stunde Klatsch und Unterhaltung ersetzt hatte. Die Spätnachrichten hatte man auf Mitternacht verlegt und als Star Chris Kaiser aus Los Angeles engagiert.
»Sie haben es vermasselt, Jim«, sagte Chris Kaiser, verzichtete auf ein eindeutigeres Wort, das die Zuschauer zu Hause womöglich von ihren Lippen hätte ablesen können. »Die U-Bahn-Story war nichts als ein Haufen Scheiße.« Sie lächelte besonders strahlend, überspielte so das Schimpfwort. »So was gibt es in meiner Sendung nicht! Die Zuschauer wissen, dass das eine Lüge ist, und ich will nicht, dass sie in mir qua Assoziation ebenfalls eine Lügnerin sehen.«
Giles schob eine Hand in die Tasche seines blauen Blazers und betastete die winzige Flasche Dewars, die er kurz vor der Sendung getrunken hatte, während Chris und die anderen noch ihre Manuskripte studierten. »Hab nur die Fakten gebracht, Ma’am.«
Die Kamera verlosch und die Studio-Beleuchtung ging an. Der Nachspann war vorbei; sie waren jetzt nicht mehr auf Sendung. Die Leute zu Hause sahen jetzt einen Werbespot.
»Fakten?«, kreischte Chris Kaiser. »Was für Fakten? Da hat der beschissene Bürgermeister also eine beschissene Pressekonferenz gegeben. Na und? Meine Güte, wir haben ein Wahljahr. Was soll er denn sagen – dass er den Krieg gegen das Verbrechen in unserer Stadt verliert? Scheiße.«
Die Crew, normalerweise verschwand sie immer so schnell wie möglich, drückte sich noch im Studio herum, genoss, was zu einem regelmäßigen Epilog der Sendung wurde.
Giles zog die Hand aus der Jackentasche und berührte seinen Krawattenknoten. »Vergessen Sie da nicht etwas? Das alles ist doch erst durch unseren Exklusivbericht ins Rollen gekommen. Durch meinen Exklusivbericht. Die Daily News hat gemeldet, dass die Anzahl der Verhaftungen durch die U-Bahn-Cops zurückgegangen wäre. Berger ist bei einer Pressekonferenz mit einer Frage danach überrascht worden und musste einräumen, dass dies der Wahrheit entspräche. Alle haben es ganz genau so gebracht – Cops hilflos gegenüber Kriminalität in der U-Bahn –, alle außer uns. Ich habe den ganzen Bericht in die Hände bekommen, von dem die News nur einen Teil hatte, und habe festgestellt, dass die Festnahmen rückläufig sind, weil die Straftaten rückläufig sind – weil inzwischen mehr Cops patrouillieren, weil die elektronische Überwachung verbessert und ausgebaut worden ist, weil es mehr Patrouillen von Bürgern gibt, mehr Hunde …«
»Hunde«, sagte Chris Kaiser verächtlich.
»Die heutige Pressekonferenz hat unseren Exklusivbericht in allen Punkten bestätigt«, fuhr Giles fort. »Das ist rundherum eine gute Story: Die Presse kommt mit unausgegorenen Geschichten, und in der U-Bahn entwickelt sich alles zum Besseren. Aber das wissen Sie ja alles selbst.«
Chris Kaiser spreizte eine Hand über ihrem Brustkorb, spielte die Unschuld. »Wollen Sie damit sagen, dass heute niemand in der U-Bahn überfallen worden ist, Jim?«
Giles griff wieder in seine Jackentasche und streichelte die kleine Flasche.
Chris Kaiser lachte. »Können Sie dem Opfer eines Überfalls in die Augen sehen und ihm oder ihr sagen, dass der Krieg gegen die Kriminalität in der U-Bahn gewonnen ist?«
Chris Kaiser lachte wieder. »Was wir hätten tun sollen – was wir auch tun werden, wenn Berger das nächste Mal versucht, uns mit Statistiken zu blenden –, wir schicken ein Kamerateam runter in die U-Bahn, während er seine Pressekonferenz abhält. Wir werden Leute auftreiben, die gerade überfallen worden sind, denen die Handtasche geklaut oder die Taschen ausgeleert wurden. Das dürfte nicht sonderlich schwer sein. Kann schon sein, dass die Verbrechensrate gefallen ist, aber Überfälle gibt es immer. Und wir werden diese Opfer fragen, wer den Krieg gegen die U-Bahn-Kriminalität gewinnt. Wir werden Berger ins Studio holen und mit den Opfern konfrontieren. Das hätten wir schon längst machen sollen.« Sie wirbelte zu einem Produktionsassistenten herum. »Holen Sie Cavanaugh.«
»Er ist schon nach Hause«, antwortete der P. A.
Sie stemmte die Hände in die Hüften. »Nach Hause? Wie zum Teufel kann der Produzent während der gottverdammten Sendung nach Hause gehen? Holen Sie mir den Mann ans Telefon!«
»Er wird noch nicht zu Hause sein«, sagte der P. A. »Er ist eben erst gegangen. Er wohnt in Yonkers.«
Chris Kaiser verdrehte die Augen. »Yonkers.« Langsam und so laut, dass es jeder hören konnte, sagte sie dann: »In Zukunft geht keiner nach Hause, bevor ich es sage. Niemand von der Produktion, kein Autor, kein Techniker, keiner aus dem Senderaum, keiner!« Ganz bewusst fixierte sie ihre Kollegen; alle sollten begreifen, dass sie gemeint waren. »Der richtige Zeitpunkt, über das zu sprechen, was an der Show nicht in Ordnung war, ist unmittelbar danach und nicht erst am nächsten Nachmittag. Wenn wir oft genug und lange genug hierbleiben, geht vielleicht irgendwann nicht mehr so viel daneben. Vielleicht ist es dann irgendwann nicht mehr nötig, dass wir so lange und so oft noch hierbleiben müssen. Aber bis dahin bleibt jeder… Verstanden?« Und dann ging sie Richtung Studiotür.
Jim Giles wusste, dass es sinnlos war, aber er musste einfach fragen. Er rief ihr nach: »Was, wenn wir keine Opfer finden?«
Chris Kaiser blieb stehen und drehte sich langsam zu ihm um. »Was haben Sie da gesagt?«
»Was, wenn wir niemanden finden, der genau in dem Moment, in dem der Bürgermeister sagt, dass die U-Bahn-Kriminalität zurückgegangen ist, überfallen wurde?«
Chris Kaiser legte den Kopf zurück und lachte. »Oh, mein Gott, Jim! Sie sind wirklich ein Langweiler. So ein … ein Gentleman. Kein Wunder, dass Sie so lausige Einschaltquoten hatten – ein paar tausend Leute, die unter Schlaflosigkeit leiden und hoffen, dass Sie sie mit einem Bericht über Zinssätze in den Schlaf wiegen.«
Sie kehrte zu ihrem Sessel zurück, umkreiste ihn, während sie sprach. »Es hat noch nie zuvor eine lokale Nachrichtensendung zu irgendeiner Sendezeit auf irgendeinem Kanal mit so hohen Einschaltquoten wie dieser hier gegeben. Aber das wissen Sie ja selbst. Allerdings bin ich nicht ganz so sicher, ob Sie auch den Grund dafür kennen. Das liegt nicht nur daran, dass ich so sexy bin. Oh, ich bin sexy, keine Frage. Aber es steckt mehr dahinter. Diese Show hat die höchsten Einschaltquoten von allen Nachrichtensendungen zu jeder Sendezeit auf jedem Kanal, weil ich den Leuten nichts erzähle, was sie nicht hören wollen. Ich sage ihnen nicht, die Stadt wäre ein Garten Eden; ich sage ihnen, dass sie ein Dschungel ist. Ich erzähle ihnen nicht, dass die Stadt sauber ist und gut riecht; ich sage ihnen, dass sie eine Jauchegrube ist. Ich erzähle ihnen nicht, dass es ein Vergnügen ist, hier durch die Straßen zu schlendern; ich sage ihnen, dass die U-Bahn voller verrückter Killer ist und die Straßen voller Betrunkener und dass die Brücken und die Straßen vergammeln. Mit einem Wort, ich sage ihnen die Wahrheit. Nennen Sie das ruhig ›schlechte‹ Nachrichten. Nennen Sie solche Berichte ruhig ›Panikmache‹. Ich nenne es einfach die Wahrheit. Die einzigen positiven Nachrichten, die ich in meiner Sendung dulde, sind die Wettervorhersagen. Deshalb gefällt es mir auch nicht, wenn David für den 4. Juli Regen vorhersagt. Das Wetter ist die einzige Sache, auf die die Leute noch Hoffnung setzen. Ich hasse es, ihnen die zu nehmen … Sie geben den Leuten die Fakten, Jim. Sie sagen ihnen, dass die Zinsen steigen und die Verbrechensquoten sinken. Aber Sie sagen ihnen nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist das, was trotz der Fakten existiert. Fakt ist, dass die Arbeitslosenzahlen runtergehen; die Wahrheit ist, dass die Leute keine Jobs haben. Fakt ist, dass die Verbrechen in der U-Bahn weniger werden; die Wahrheit ist, dass Leute in der U-Bahn überfallen werden.
Sex und Gewalt: Das ist doch die Formel, oder? Die Rezeptur, mit der man eine Unterhaltungssendung, einen Spielfilm, zur besten Sendezeit verkauft. Aber nicht nur die reine körperliche Gewalt hilft verkaufen, auch die seelische, die wirtschaftliche Gewalt, Gewalt durch die Umweltbedingungen. Sie wollen den Leuten da draußen sowas nicht sagen, Jim … deswegen schauen die Ihnen auch nicht zu. Oh, Sie glauben, nur weil Sie Zinssätze thematisieren, würden Sie schon etwas über wirtschaftliche Gewalt sagen. Aber Zinssätze sind keine wirtschaftliche Gewalt; wirtschaftliche Gewalt, das ist irgendein armer Schlucker, dem die Hypothek gekündigt und ein Vorhängeschloss an seine Haustür gehängt wird. So eine Geschichte meine ich. Finden Sie mir diesen Mann, Jim, und Sie haben eine gute Story.
Sie haben mir eine Frage gestellt. Sie haben gefragt, was ich mache, wenn ich niemanden finde, der in der U-Bahn überfallen worden ist, während der Bürgermeister auf seiner Pressekonferenz verkündet, wir hätten die Kriminalität in unseren U-Bahnen besiegt. Ich erfinde ein Opfer. Ich suche mir einen Burschen und stelle ihn vor die Kamera und lasse ihn erzählen, wie er in der U-Bahn überfallen worden ist, während der Bürgermeister seine Pressekonferenz abgezogen hat. Und er wird es tun. Und er wird dabei nicht einmal das Gefühl haben, zu lügen. Und ich hätte ebenfalls nicht das Gefühl, dass ich ihn eine Lüge erzählen lasse. Er wird die Wahrheit sagen – die Wahrheit, so wie er sie empfindet. Denn wahr ist doch, dass die Leute schreckliche Angst haben, mit der U-Bahn zu fahren, ganz gleich, was die Fakten sagen. Und ängstliche Menschen sind Opfer.«
Chris Kaiser hörte auf, ihren Sessel zu umkreisen und ging auf Jim Giles zu. Als sie schließlich stehenblieb, war ihr Gesicht nur noch wenige Zentimeter von seinem entfernt. »Sie trinken wieder, Jim? Sie wissen, wie ich darüber denke.«
Giles umklammerte die Flasche in seiner Tasche so fest, dass er sie fast zerdrückte – und er befürchtete, dass er, sollte sie zerbrechen, die Scherben aus der Tasche holen und Chris Kaisers Gesicht aufschlitzen würde.
»Was ein weiterer Grund ist, Jim«, sagte Chris Kaiser und ging wieder Richtung Ausgang, »das und alles, was ich gerade sagte, warum ich Cavanaugh bitten werde, Sie ganz aus der Sendung zu nehmen. Meine Zuschauer wollen die Wahrheit, und ich lasse keinen Narren aus mir machen, nur weil es unter meinen Mitarbeitern Leute gibt, die sie ihnen nicht sagen wollen.«
Sie drückte die schallisolierte Tür mit der Schulter auf und verschwand.
Eine Stunde später hörte der Produktionsassistent, sein Name war Michael Magazine, das Telefon in Jim Giles Büro läuten und ging hinein, um den Anruf zu beantworten. Fünf winzige Scotch-Fläschchen standen in einer Reihe am Rand des Schreibtisches.
Es war Giles Frau, und Michael Magazine sagte, ihr Mann hätte gerade das Haus verlassen, es hätte noch eine Mitarbeiterbesprechung gegeben. Sie rief häufig noch so spät an, und er sagte jedes Mal, dass Giles gerade gegangen wäre, obwohl Giles schneller als die meisten von der Crew verschwand.
Michael Magazine warf die Scotch-Fläschchen in den Papierkorb unter Giles’ Schreibtisch, überlegte es sich dann anders und holte sie wieder heraus. Dabei entdeckte er eine kleine Pappschachtel, die ein Dutzend .38er-Kugeln enthalten hatte. Die Schachtel war leer.
Er nahm die Fläschchen und die Schachtel und warf sie in eine Mülltonne draußen auf dem Flur, bedeckte alles mit alten Zeitungen. Er ging den Flur hinunter, drehte sich dann um und holte die Schachtel wieder aus der Mülltonne, drückte sie zusammen und steckte sie in seine Tasche. Er betrat das Nachrichtenstudio.
Alle außer der neuen süßen P.A., die gerade ihre Dauerwelle mit einem Kamm bearbeitete, waren bereits fort. Sie sagte, sie wohne in Park Slope und hoffe, dass sie nicht zu lange auf eine U-Bahn warten müsse. Er sagte, er wohne in Bay Ridge und habe ein Auto. »Wie wär’s? Soll ich dich mitnehmen?«
»Ja. Das wäre toll.«
Michael Magazine warf die Schachtel in eine Mülltonne vor der Tiefgarage.
Kapitel 5
Jake Neuman musterte intensiv das Poster von Chris Kaiser, dann steckte er sein Hemd wieder in die Hose. Obwohl sie auf dem Poster verunstaltet war, fühlte er sich in ihrer Gegenwart unordentlich und ungepflegt.
Bobby Redfield stand neben ihm. »Jesus.«
»Irgendwer mag wohl ihre Sendung nicht«, meinte Neuman.
»Ich war auch einmal dabei, erinnerst du dich? Nicht in ihrer Show, sondern bei einer Diskussionsrunde, die sie moderiert hat … Killer, Cops und Gerichte.«
»Hab ich verpasst«, sagte Neuman. »Werde mir wohl ein Baseball-Spiel angesehen haben. Die Schnitte sind noch ziemlich frisch.«
Federici glitt vor ihn und ließ seine Finger über das Plakat gleiten. Ein Connaisseur. »Keine Rasiermesser, aber ganz sicher eine dünne Klinge. Vielleicht ein Stilett.«
McGovern lachte. »Vielleicht, Sherlock?«
»Ein Stilett wie das von unserem Exitus«, sagte Federici.
McGovern setzte sich auf eine Bank und steckte sich eine Lucky an. »Steve Federici, der Spaghetti.« Er lachte. »Kapiert, Loo? Ich meine, hast du jemals so einen dünnen Typen gesehen?«
Lieutenant Neuman reckte sich, versuchte die letzten Reste Schläfrigkeit aus seinem Körper zu vertreiben. »Ich habe genug gesehen. Verschwinden wir von hier.«
Hier war die U-Bahnstation an der Einhundertachtundsechzigsten Straße, wo, das hatte der Zugführer den ersten Cops, die auftauchten, erzählt, Carlos Pabon und zwei andere junge Hispanics den Richtung Süden fahrenden Broadway Local vergangene Nacht um elf Uhr sechsundzwanzig bestiegen hatten – falls der Zug pünktlich war. Die Detectives hatten sich von der Sechsundneunzigsten Straße aus nach Norden vorgearbeitet, hatten sich den Zug angesehen, der nördlich der Station auf ein Abstellgleis gefahren worden war; von der Hundertsiebenunddreißigsten Straße aus, von wo der Zugführer, nachdem Passagiere ihn auf die Schießerei aufmerksam gemacht hatten, die Polizei gerufen hatte; von der Hundertfünfundvierzigsten Straße aus, die für kurze Zeit der Tatort gewesen war – der Stelle, wo der Täter und Pabons Kumpel die Bahn verließen.
Sie hatten ziemlich wenig handfeste Beweise – nicht so wenig wie bei manchen anderen Morden, aber weniger als bei den meisten. Die Spurensicherung hatte in dem U-Bahn-Waggon nicht sonderlich viel gefunden: Pabons Leiche mit einer Kugel im Gehirn; Pabons Blut; ein Schnappmesser mit Pabons Fingerabdrücken, die bereits im Computer des Zentralen Strafregisters wie auch in Dutzenden von Akten des New York City Police Departments und der städtischen und bundesstaatlichen Besserungsanstalten registriert waren; der letzte Rest einer Marihuana-Zigarette mit einem partiellen Fingerabdruck auf dem »E-Z Wider»-Zigarettenpapier; ein Panasonic-Radio mit einem ordentlichen Satz Abdrücken, aber keiner von ihnen brachte in ihrem Computer ein Glöckchen zum Klingeln – kurz, ein paar Spuren des Opfers und seines Gefolges, aber keinerlei Anhaltspunkte auf den Killer – außer vielleicht ein paar fragmentarische Fingerabdrücke auf dem Ziehharmonikagitter zwischen den letzten beiden U-Bahn-Waggons, wo dieser aus dem Zug gesprungen war.
Und dass der Mörder gesprungen war, wussten sie von Cecil Briggs, dem Graffiti-Künstler, bislang ihr bester Zeuge. Nachtarbeiter, der er war – »Sechs, sieben Nächte die Woche gehe ich in die Depots. Du findest ja kaum noch eine leere Stelle auf den Zügen. Heutzutage arbeiten ja so viele Typen, und ich hab ne ganze Menge zu sagen, und ich muss es sagen, ehe auch noch der letzte Zug endgültig vollgeschmiert ist«. Briggs hatte es nichts ausgemacht zu warten, um mit den Cops zu reden. Und lange nachdem die übrigen Passagiere, diejenigen, die nicht gleich abgehauen waren, als der Zug in der Hundertsiebenunddreißigsten Straße gehalten hatte – vor Erschöpfung und Müdigkeit nach Hause gefahren waren, nachdem sie ihre Telefonnummern hinterlegt hatten. Er verzichtete gerne für eine Nacht auf seine Kunst, um es mal mit einem neuen Medium zu probieren. Als die Beamten der Mordkommission seine Zuhörer wurden, hatte er bereits eine beeindruckende Ballade fertig.
»Also, ich sitz da und denke so vor mich hin, Mann, plane schon mal, was ich in dieser Nacht alles mache, und dann, also urplötzlich, na ja, da ist dieser Spic mit einem Messer, Mann, hat also diese Krankenschwester am Hals gepackt und sagt, er will aussteigen, also aus der Bahn, und dass er sie, also, nehmen will, Mann, also er und seine Freunde, und dann steht da dieser weiße Typ auf und sagt: ›Sag das noch mal, motherfucker! Was willste machen? Du machst hier gar nichts, einen Scheißdreck machst du, außer dass du jetzt aus diesem Scheißzug verschwindest, du und deine beschissenen Freunde, aber ganz klar ohne irgendeine Krankenschwester, kapiert?‹ …«
»Hat er das genauso gesagt, Cecil«, hatte Neuman ihn unterbrochen, »oder ist das deine künstlerische Version des Sachverhaltes?«
»Häh? Ach, Scheiße, nein, das hat er nicht so gesagt, ich weiß nicht mehr, was er genau gesagt hat, also nicht ganz genau. Er hat gesagt, also … Ach, Scheiße, habs vergessen. Aber, ja, klar doch, ich meine, ja, echt klar, also, so was Ähnliches hat er schon gesagt.«
»Bitte, fahr fort«, sagte Neuman.
»Tja, also, wo war ich gerade? … Okay. Also. Der Spic mit dem Sonic, Mann, also der, der am anderen Ende war, also, der hat sich dann an den weißen Typen ran geschlichen, Mann, und dann hat der weiße Typ seinen Ballermann rausgeholt, Mann, und auf den Kopf von dem Spic gezielt und der ist einfach abgehauen, Mann – also, ich meine, so wie wenn er gerade noch da war, und dann war er einfach weg. Und der …«
»Du kennst dich aus mit Waffen, Briggs?«, unterbrach ihn Redfield.
»Häh? Was? Nee. Ich? Ich bin Künstler, Mann, kein beschissener Killer.«
»Dann weißt du auch nicht, ob es ein Revolver oder eine Automatik war. Oder welches Kaliber oder wie groß oder welche Farbe?«
»Wie, welche Farbe? Klar doch, die Farbe kenn ich. Sie war schwarz, Mann, schwärzer als ich, und, ja, es war eine Automatik. Ich meine, das sind doch die, die wie Spielzeugpistolen aussehen, also fast wie Wasserpistolen, stimmts? Und groß, nein, groß war die Knarre nicht, nicht wie bei Dirty Harry oder so, aber klein war sie auch nicht. Aber was zum Teufel … He, Sie haben doch die Kugel, Mann, oder?«
»Weiter«, sagte Neuman.
»Tja, wo war ich gerade? … Okay. Der Spic mit der Krankenschwester, Mann, also der geht Richtung Tür – weil die Bahn ja gerade hält, kapiert? – und der weiße Typ brüllt: ›Yo, Carlos‹, weil, der wusste ja, dass der Spic so heißt, stimmts, weil ja der andere Spic – also, der kleine Spic vorne im Abteil – ihn so genannt hat. Der Arsch. Mann, es gibt echt nur eins, was noch saudümmer als ein Spic ist, Und das sind zwei Spics, und das einzige, was noch blöder ist …«
»Meine Frau ist auch Hispanic«, sagte Neuman.
»Oh, Scheiße. He, Lieutenant, also, ich habs echt nicht so gemeint. Also, ich hab ja nur gesagt, dass es schon eine verdammt bescheuerte Sache ist, den Namen zu …«
»Weiter«, sagte Neuman nur.
»Wo war ich gerade? Okay. Also. ›Yo, Carlos‹, sagte der weiße Typ, und Carlos guckt irgendwie, also hinter der Krankenschwester vor, die er ja vor sich hält, wissen Sie, und dann erwischt es ihn, Mann – ich meine, also ein beschissener Schuss mitten in die Stirn, Mann. He, aber Sie haben ja die Leiche gesehen, Mann. Sie wissen, was ich meine. Tja, und die zwei anderen Spics, Mann – he, tut mir leid, Lieutenant, die anderen zwei Hispanics – ich meine, die sind dann raus. Und die Türen gehen wieder zu, und der Zug fährt los, und der weiße Typ, Mann, der hebt den verdammten Carlos einfach hoch – weil, Carlos ist auf die Schwester draufgefallen, Mann, als es ihn erwischt hat – also, hebt ihn einfach hoch und schmeißt ihn auf die verdammte Erde, Mann, also, als wenn der Typ aus Luft wäre …«
»Auf die Erde, Briggs?« wollte Redfield wissen. »Oder vielleicht auf den Boden des U-Bahn-Abteils?«
»Häh? Ja, Mann, auf die Erde, Mann, also, ich meine, auf den Boden.«
»Weiter«, sagte Neuman.
»Also, wo war ich gerade? Okay. Also. Der weiße Typ, Mann, der steigt also über die Schwester weg, Mann, und lächelt sie so an, Mann, und dann geht er zu der …«
»Wie hat er sie angelächelt?« fragte Neuman. »Glaubst du, er kannte sie?«