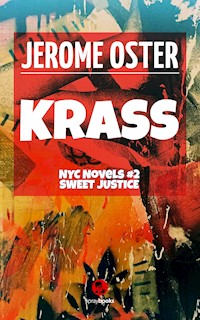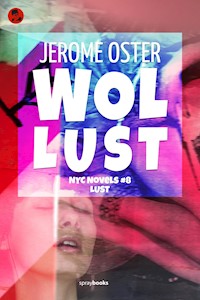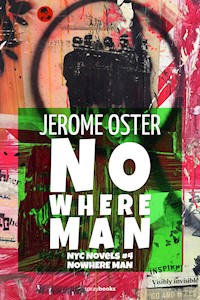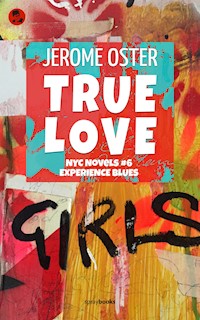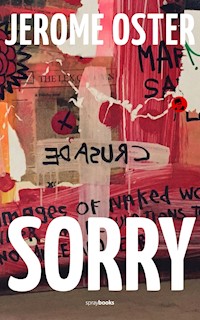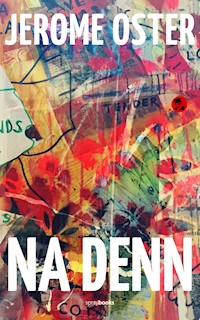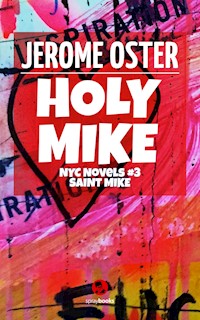
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: spraybooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: NYC Novels
- Sprache: Deutsch
Saint Mike ist ein Konglomerat verschiedener Stimmen: Gerede, Gerede, Gerede, würde Detective "Jake" Neuman seufzen. Ausufernde Assoziationsketten, die eigentliche Geschichte ist in unzählige Geschichten eingebettet. Widersprüche bleiben bewusst stehen. Die Wahrheit gibt es ohnehin nicht. Was für den einen einschneidend war, ist für den anderen eine Episode. Zwei Frauen treffen aufeinander: Die FBI-Undercover-Agentin und die High-Society-Lady, die mit Koks dealt. Sie ähneln sich. Um ihren Kampf geht es. Die Männer um sie herum sind schwafelnde, geil sabbernde Witzfiguren. Lächerlich, wenn sie - wie in früheren Romanen Jerry Osters - wieder und wieder ihren Hack mit Frauen bejammern: "Sie joggte fünf Meilen vor dem Frühstück und spielte Squash nach der Arbeit. Am Wochenende machte sie Rucksacktouren, und im Sommer fuhr sie in den Himalaja zum hochalpinen Bergsteigen. Sie war Gourmet-Köchin, lizenzierte Barfrau, schneiderte ihre Sachen selbst - wenn sie wollte, denn sie war selbstverständlich Weltklasse im Shopping; sie hatte einen schwarzen Gürtel (Karate), ein Jura-Diplom (Harvard), promovierte gerade in Hochenergie-Physik in Princeton und in romanischer Philologie (Sorbonne). Und sie war auch de facto keine Jungfrau mehr, dennoch bevorzugte sie einen Vibrator, ein Orgasmotron. Barnes kannte ihren Typ; er hatte denselben geheiratet." Jerry Oster schreibt jetzt leichter, schneller und ironischer. Stärker als bisher vermittelt sich das Tempo, der Rap der Millionenstadt New York. Er hat - auf Filme übertragen - mit Schwarz/Weiß angefangen, eine kleine Geschichte erzählt, dann nahezu klassische Detectives eingeführt, the good and the ugly cop, seinen "Jake" Neuman zum crash gebracht, in Dolby-Stereo-Ton, eine Madonna / Dimanche-Story, ein Marathonlauf durch Manhattan, Lotto-Fieber und raffinierte Luder, mit Miami-Vice-Versatzstücken gearbeitet und präsentiert nun Video-Clips, gekonnt geschnitten, dem Thema entsprechend in vielen ausgelegten Linien Koks. That's it. Ein sympathisch lächelnder New Yorker, der keine spektakuläre Biographie vorweisen kann, aber aufregende Romane schreibt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 400
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Holy Mike
NYC Krimis #3: Saint Mike
Jerome Oster
Übersetzt vonKirstin Ruge
Erste eBook–Ausgabe 2018, v1.0
Die amerikanische Originalausgabe erschien 1987 unter dem Titel »Saint Mike« bei Harper & Row, New York.
Copyright © 1987, 2018 by Jerome Oster
Unter dem Titel »Saint Mike« zuerst auf Deutsch erschienen 1990 im Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg.
Copyright © 1990, 2018 der deutschen Übersetzung by Kirstin Ruge
Überarbeitete und neu lektorierte deutsche Ausgabe
Redaktion Doris Engelke
Copyright © dieser Ausgabe 2018 bei spraybooks Verlag, März 2018
2018 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werks darf in irgendeiner Form ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
spraybooks Verlag Bielfeldt und Bürger GbR
Remigiusstr. 20, 50999 Köln
www.spraybooks.com
ISBN: 978-3-945684-20-7
Dieses Buch wurde – von Freunden umgeben – im Writers Room geschrieben. Die Personen, Ereignisse und Polizeiorgane, die in diesem Buch beschrieben werden, sind reine Fiktion. Jede vermeintliche Ähnlichkeit mit lebenden oder toten Personen, aktuellen Ereignissen und Behörden ist reiner Zufall.
In Erinnerung an Nathan Fain
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Werbung
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Über den Autor
Weitere Bücher von Jerome Oster
Mehr spraybooks …
Kapitel 1
Ein heftiger Donner.
Das Getöse schreckte eine Wachtel auf. Schimpfend stob sie aus der Hecke. Die blassblaue, wolkenlose Morgendämmerung ließ sie erstarren. Das war kein Gewitter. Diesen Krach hatten Menschen verursacht.
Zwei Ritter zu Pferde auf Kollisionskurs – zunächst vierzig Meter voneinander entfernt, dann zwanzig, dann zehn.
Der Ritter auf dem braunen Wallach hielt einen himmelblauen Schild mit goldenem Schrägkreuz, der Ritter auf der Rotschimmelstute einen rabenschwarzen Schild mit rotem Adler. Die Banner an ihren Lanzen flatterten.
Es war ein ungleicher Kampf, denn der Schwarze war zweifellos Anfänger. Er mühte sich nach Leibeskräften, sein Pferd in der Bahn und das Schild senkrecht zu halten und gleichzeitig die Waffe nicht aus dem Rüsthaken auf seinem Brustpanzer rutschen zu lassen. Der Himmelblaue musste mit seiner Lanze nur leicht gegen den Stoßkragen an der linken Schulter des Schwarzen tippen, um ihn aus dem Sattel zu holen. Schon wirbelte der Schwarze herum. Seine Füße flogen aus den Steigbügeln. Seine Lanze malte wirre Kringel in die Luft. Sein Schild schlug gegen den Hals der Rotschimmelstute, die daraufhin einen Satz nach links, rechts, links machte. Der Ritter verlor die Gewalt über die Zügel. Er stürzte scheppernd. Der himmelblaue Ritter wendete den Braunen am Ende der Bahn und ritt zu dem schwarzen Ritter zurück, der, mittlerweile auf Händen und Knien, nach Luft rang. Der Himmelblaue warf seine Lanze auf den Turf und sprang vom Pferd.
Der schwarze Ritter ging in die Hocke und kämpfte mit dem Visier seines Helmes. Der himmelblaue Ritter zog sein Schwert.
Der schwarze Ritter bekam das Visier auf. Er war kreidebleich und vor Angst wie versteinert. Seine Lippen bewegten sich tonlos.
Eine Autohupe schepperte.
Der himmelblaue Ritter drehte sich um, öffnete sein Visier, winkte.
Ein weißes Jaguar-Cabriolet, das im Licht der aufgehenden Sonne schimmerte, rumpelte von der Straße auf die Wiese; eine Blondine am Steuer und Phil Collins im Radio. Der himmelblaue Ritter schüttelte einen Handschuh ab, schraubte den Griff seines Schwertes auf und zog eine winzige Phiole hervor. Er entkorkte sie, klopfte etwas Kokain auf die andere, noch gepanzerte Hand und tupfte es erst in sein linkes, dann in sein rechtes Nasenloch. Er verschloss die Phiole wieder und ließ sie vor den schwarzen Ritter fallen. »Zieh dir was davon rein, Alter. Und dann gehen wir was frühstücken. Die holde Rachel naht.«
Kapitel 2
Es hätte ein großartiges Foto abgegeben – eines, das keiner Bildunterschrift mehr bedurfte. (Ungeachtet der landläufigen Ansicht, ein Bild sage mehr als tausend Worte, gibt es in Wirklichkeit kaum Abbildungen, die auf solche Unterschriften verzichten können.)
Zur Linken: einer der Obdachlosen der Stadt, ein menschliches Wrack, ein Stadtstreicher, ein Wilder, ein Penner (nebenbei: eine Bildunterschrift verrät so manches über ihren Verfasser), der auf der Schwelle seiner Bleibe hockte, eines Kenmore-Kühlschrankkartons, dessen Pappwände mit Lagen Zeitungspapier (den Daunen der Vogelfreien) isoliert waren. Der Karton duckte sich in den Windschatten eines Klinkerbaus, im Norden, auf der Sonnenseite der Straße. Der Mann trug eine braune Army-Mütze mit heruntergelassenen Ohrenklappen, ein tannengrünes Sweatshirt, zwei Anzugjacken, eine mit grauem Glencheck-Muster, die andere aus braunem Harris-Tweed, zwei Mäntel, einen kamelhaarfarbenen, einen marineblauen, eine Khaki-Arbeitshose über – den wattierten Beinen nach zu urteilen – mindestens einer weiteren Hose sowie hohe, schwarze Sneakers der Marke Keds. (Es war Spätfrühling und der Winter war endlich auf dem Rückzug, doch seinem Zuhause mangelte es an Schränken und seinem Leben an Sicherheit, und so war es ebenso praktisch wie weitblickend, wenn er immer alles übereinander trug, was er besaß: denn todsicher würde es eines Tages wieder kalt werden.) Er hatte einen Drei-Wochen-Bart, wettergegerbte Haut, eine Habichtsnase, eine hohe, schmale Stirn und kluge Augen: ein Gesicht, das, abgesehen von dem Bart und der wettergegerbten Haut, in jede Vorstandsetage gepasst hätte – oder auf ein Buchcover.
Zur Rechten: ein Traumpaar. Zwei perfekte Schönheiten, die sich – geschmackvoll umrahmt vom Fenster eines perfekten In-Lokals – in den Armen lagen. Es war eines jener Restaurants, die freilaufende Hühnchen und sonnengetrocknete Tomaten servieren (wofür ihre Klientel gern – ja geradezu dankbar – jeden Preis zu zahlen bereit war, ohne sich über die Bedeutung dieser Adjektive wirklich klar zu sein). Der Mann trug den doppelreihigen anthrazitfarbenen Nadelstreifenanzug eines Bankers, ein blaues Hemd mit weißem Kragen und weißen Manschetten, eine kastanienbraune Seidenkrawatte, ein dazu passendes Einstecktuch, schwarze Halbschuhe aus Ziegenleder und eine goldene Uhr. Er war nicht so groß, dass er mit dem Wort groß treffend zu beschreiben wäre, doch seine Schultern waren so breit und seine Hüften so schmal, dass er offensichtlich in einer ganz bestimmten Sportart Experte war: Er sah nicht aus wie ein ehemaliger (er war Anfang vierzig) Basketball- oder Footballspieler. Vielleicht war Tennis oder Baseball sein Sport gewesen, womöglich aber auch etwas Obskures. Etwas, das insbesondere andere Sportler ihm angesehen hätten, weil es diese seltene Kombination aus Kraft und Wachsamkeit, aus Koordinations- und Konzentrationsvermögen erforderte: Rudern oder vielleicht auch Stabhochsprung. Sein dunkelbraunes Haar war aus der hohen Stirn gekämmt und lockte sich leicht am Hemdkragen. Die Haut: hell, aber von gesunder Farbe. Die Augen: blaugrün. Die Nase: aristokratisch. Die Lippen: dünn, aber ausdrucksvoll. Sein Kinn: schmal, mit der Andeutung eines Grübchens.
Die Frau in seinen Armen war blond, doch ihr Blond verhielt sich zu anderem Blond wie Crème fraîche zu Magermilch. Ihr Haar fiel in Wellen und Spiralen über die Schultern, und besaß die luxuriöse Textur von etwas ganz besonders Seltenem; es war wie ein Kissen aus goldenem Seidentaft, welches das Juwel ihres Gesichts wunderbar zur Geltung brachte – das Gesicht eines Fotomodells, aber ohne dessen Leere, einer Herrscherin, ohne deren angeborenen Schwachsinn, ein Gesicht, das den Verkehr zum Erliegen bringen oder eine Invasion auslösen, Lärm im Keim ersticken oder eine Revolution verursachen konnte. Alabaster, Meißen, Elfenbein, Kornblume, Violett, Rubin, Kirsche: Worte wie diese versammelten sich im Geiste in der Hoffnung, als Attribut für ihre Haut, ihre Augen und ihre Lippen eingesetzt zu werden, und alle erfüllten ihren Zweck, mehr schlecht als recht, denn es waren bloß Worte, wohingegen sie aus Fleisch und Blut war.
Sie trug einen cremefarbenen doppelreihigen Blazer, darunter einen schwarzseidenen Rollkragenpulli (ärmellos, wie der aufmerksame Beobachter registriert hätte, wäre er ebenfalls im Restaurant gewesen, wo sie den Blazer ausgezogen und über die Rückenlehne des Stuhls gehängt hatte, wobei sie muskulöse Arme entblößte, die schmucklos waren – kein Armband, keine Uhr, keine Ringe) und (jetzt kommt das Allerbeste, jenes Detail nämlich, wodurch das Foto, wäre ein Fotograf greifbar gewesen, zum Klassiker geworden wäre) Bluejeans, nicht nur ausgeblichen, sondern völlig abgetragen, mit einem Riss am linken Knie und einer eingerissenen Gesäßtasche, die ein eckiges Stück Dunkelblau freigab. Außerdem trug sie verbeulte, abgestoßene, schlamm- und (vielleicht) mistverkrustete spitze Cowboystiefel …
Es küsste sich, dieses wahrhaft göttliche Paar, und der Kuss war leidenschaftlich und zart zugleich. Die Frau musste die Hand von seiner Wange nehmen, damit ihr die Krokodilledertasche nicht vom Arm rutschte. Die beiden lösten sich voneinander. Der Mann trat auf die Straße, dabei einen Arm lässig ausgestreckt wie ein Falkner, der einfach weiß, dass sich sein wohlerzogener Falke gerade im Sturzflug auf den Handschuh befindet – nur dass er damit ein Taxi herbeikommandierte. Das Tableau schmolz dahin, der entscheidende Moment war aus und vorbei.
Der Mann öffnete die Tür des Taxis, winkte der Frau zu und stieg ein, knöpfte seine Anzugjacke auf und flüsterte dem Fahrer sein Fahrtziel ins linke Ohr. Dann schlug er die Tür zu und lehnte sich zurück.
Plötzlich, als sei sie tatsächlich eine Göttin, die mit einem Wimpernschlag von hier nach da kommen konnte, stand die Frau am Fenster des Taxis, das, heruntergekurbelt, frische Luft hereinlassen sollte. Sie ging leicht in die Knie, um ihren Kopf besser durchs Fenster schieben zu können, es folgten die Schultern und dann der ganze Oberkörper. Sie küsste den Mann wieder auf die Lippen, dabei eine Hand an seiner Wange. Dann war sie mit einem Mal zurück auf dem Gehsteig und warf ihm noch eine Kusshand zu.
Das Taxi glitt davon, ostwärts. Die Frau machte kehrt, die Hände tief in den Taschen ihres Blazers vergraben. Sie hatte einen fast militärischen Schwenk vollführt, und jetzt schritt sie nach Westen. In ihrem Mannequin-Gang lag eine Spur von Cowgirl. Der Penner ließ sie nicht aus den Augen, bis sie an der Ecke Broadway abbog und Richtung Norden ging. Er schob eine Hand in die Hose und kratzte sich im Schritt.
Der Taxifahrer war der klassische, tingelnde Universalgelehrte:
Der Bürgermeister, die Mets, Arbitrage-Geschäfte, Meteorologie – bis zur Dreiundvierzigsten hatte er all diese Themen erörtert. Bis zur Zweiundfünfzigsten war er mit Hip-Hop und russischen Frauen durch, bis zur Siebenundfünfzigsten waren Bill Cosby, die Prinzessinnen von Wales und New York sowie diverse Fahrradkuriere abgehakt.
Kinder: »Die Kids sind heutzutage größer als früher. Meine Kinder haben Füße, also wenn ich manchmal ihre Turnschuhe im Flur rumliegen sehe, kriege ich ne richtige Scheißangst.«
Toleranzgrenzen: »Ein Pärchen, äh, Schwule ist in unseren Block gezogen. Hey, ist mir echt total egal, was Leute nachts so treiben. Aber ich will nicht, dass sie in ihren Ballettröckchen in der Gegend rumtanzen und meine Kinder sie sehen. Oder dass sie die Kleinen einladen, sich die schönen Gemälde anzugucken, die sie draußen auf Fire Island gemalt haben, und mal von ihrer Quiche kosten. Meine Frau sagt immer, Marvin, mit ihrer kreativen Ader und so, da tun sie der Gegend doch gut, sie pflanzen Blümchen und hängen nette Vorhänge auf. Ich sage, na schön, meinethalben mag ja der eine oder andere von diesen Aussätzigen ein Supertyp sein, aber deswegen will ich ihn noch lange nicht nebenan wohnen haben.«
Verkehr: »An manchen Tagen ist es so übel, dass sich die Leute, die morgens aus Brooklyn, Queens, Westchester, Jersey in die Stadt reinfahren, auf dem Nachhauseweg selbst begegnen. Was daran so schlimm ist? Hey, Mann, ganz einfach. Ich bin vielleicht kein Einstein, aber es gibt einfach zu viele Autos.
Die Leute, die in Brooklyn, Queens, Westchester und Jersey leben, die sollten dafür bezahlen, wenn sie in die Stadt rein wollen. Klar, ich weiß, die zahlen ja auch was. Aber ich rede hier von richtig blechen – zehn Scheine, zwölf, fünfzehn. Sehen Sie den Benz neben uns? Kostet locker fünfunddreißig Riesen. Und da will mir einer erzählen, der Kerl hätte keine zehn, zwölf, fünfzehn Scheine übrig, um in die Stadt zu fahren – kommt wahrscheinlich aus Searsdale oder Greenwich, ich kann sein Nummernschild nicht lesen.
Crosstown. Wir stehen hier jetzt seit zehn Minuten. Und wir fahren Uptown. Haben Sie schon mal versucht, um diese Zeit quer durchzukommen? Vergessen Sie‘s, Mann. Das Kongresszentrum. Das Coliseum ist ja zu klein, also bauen wir ein Kongresszentrum. Und zwar so weit, wie nur irgend möglich, von U-Bahnen, Hotels, Restaurants. Dazu keine Parkplätze, die Leute können schließlich Taxis und Busse nehmen, Transporter sollen sie aus den Hotels rüberschaffen; ab Neunundfünfzigster, Fünfzigster dürfen keine Privatwagen mehr parken, ab da gibt’s auch keine Ladezonen mehr – damit die Taxis, die Busse, die Transporter durch die Stadt flitzen können. Yeah, das wär’s.«
Es folgen freie Assoziationen: »Jake Javits. Gibt’s eigentlich noch jüdische Senatoren? Mir fällt keiner ein. Moynihan. Ha! D’Amato. Glauben Sie, dass es jemals einen jüdischen Präsidenten geben wird? Ich hätt’s gern gesehen, wenn Ted Kennedy es versucht hätte. Ich hab was übrig für diese ganze Camelot-Scheiße, selbst für diesen Quatsch mit Jack und Bobby und Marilyn Monroe und so.
Diese Freundin von Ihnen, vorhin die, na, die sieht vielleicht klasse aus. Mann, Sie sind ein echter Glückspilz, mein Freund, lassen Sie sich niemals was anderes einreden. Die Leute labern Ihnen vielleicht was von Kompatibilität vor oder so, wie man miteinander auskommt und alles. Aber es geht nicht darum, ob man gut zusammenpasst, es kommt drauf an, ob du auch noch nach zwanzig Jahren bei deiner Frau einen hochkriegst. Oder nach zwei Jahren. In zwei Jahren, also, ab jetzt gerechnet, in zehn, sogar in zwanzig Jahren wird Ihre Freundin noch fantastisch aussehen. Vielleicht sieht sie sogar noch fantastischer aus, Frauen wie sie sehen dann noch besser aus. Hoffentlich finden Sie meine Frage jetzt nicht unangemessen oder so, ist sie Schauspielerin oder was? Ein Modell …?
Schlafen Sie? Ich sollt’s Maul halten. Sie schlafen. Hey, ich wusste ja nicht, dass Sie schlafen. Ich sitze hier und rede und rede und rede, und Sie machen ein Nickerchen. Ich hatte keine Ahnung, dass …
Hey, Kumpel …?
Mein Freund …
Herr im Himmel …
Oh, leck mich doch! Hör mit deinem blöden Gehupe auf, Alter! Mit meinem Fahrgast stimmt was nicht, ich muss mal sehen, was ihm fehlt, ja, also hör jetzt gottverdammt mit dem beschissenen Gehupe auf … Himmel. Oh, nein.
Hey, Alter. Ja, genau, du! Mach mal das Fenster auf. Jetzt kurbel schon deine beschissene Scheibe runter. Hast du’n Telefon dabei? Du musst doch’n Telefon haben. Wenn du’n Benz fährst, hast du auch ’n Telefon. Du hast Telefon? Ruf neun-eins-eins, ja? Ich hab’n Toten hier in meiner Karre. Ja, ja, echt, einen Toten!«
Kapitel 3
Nicht nur die Toten kennen Brooklyn.
Auf den Stufen der sogenannten hinteren Veranda saß Susan van Meter – ohne Schuhe, ohne Socken – und spielte masochistisch mit einem Holzsplitter. Sie machte eine Verschnaufpause, blies in ihren Kaffeebecher (der unbestreitbar ihr gehörte, da er mit einem großen MOM bemalt war) und begutachtete, in ihren löchrigen Frotteemantel gehüllt, den Garten. Den eigenen und die ihrer Nachbarn, wobei sie inmitten der kargen Errungenschaften einer kleinen Gruppe von Lebenskünstlern nach etwas, irgendetwas Vertrautem suchte.
Was sie sah, waren Dinge, die sie schon so oft und so lange gesehen hatte, dass es sie einige Mühe kostete, sie überhaupt bewusst wahrzunehmen: kleine Swimmingpools, Barbecues, Japangrills, Chaiselongues, Aluminiumklappstühle, Sonnensegel, Picknicktische, Sonnenschirme, Planen, Zelte und Markisen. Was für ein Aufwand, um so zu tun, als nehme man alles leicht und sei am liebsten am Strand oder in der freien Natur! Hacken, Harken, Spaten, Forken, Schaufeln. Pflanzgitter, Saatpflöcke, Bastknäuel, säckeweise Torf und Dünger – Anzeichen eines Ackerbau-Triebes, der sie periodisch überkam. Wo doch ein paar miese Tomaten und dürftiger Efeu das einzige waren, was man hier ernten konnte.
Vorausgesetzt, man zählte die Kinder nicht mit: Karren, Lauflernstühle, Kindersportwagen, Gerry-Packs. Rasseln, Schnuller, Mobiles, flauschige und weniger flauschige Stofftiere. Fahrräder, Dreiräder, kleine rote Eisenbahnwagen. Bälle, Bälle und noch mal Bälle, runde und eiförmige, große und kleine, harte und weiche, und komische Dinger, mit denen man besagte Bälle schlagen oder auffangen konnte. Rollerskates und Skateboards, Schwimmflossen und einzelne Turnschuhe ohne Gegenstück, Slinkies, Frisbees, Bumerangs. Panzer, Lastwagen, Flugzeuge, Hubschrauber, Schwerter (Conan-Breitschwerter und Luke-Skywalker-Laserschwerter), Messer, Gewehre, Revolver, alles zerbröselnde Röntgenstrahlenkanonen, Maschinengewehre, Granaten, Panzerfäuste, Pfeil und Bogen, Pogo-Sticks, Trampoline und Springseile. Überdachte Sandkisten und flache Planschbecken, die sowohl Wasser und als auch Luft verloren, Schäufelchen, Eimerchen, Messbecherchen. Dampfgetriebene Schaufelbagger, Bulldozer, Planierraupen, Plastikkrokodile, Haie, Frösche und Enten, Schaufeln, Schaukeln und noch mehr Schaukeln.
Und sonst? In einer Ecke von Webers Grundstück erhob sich ein schwarzer Hügel, aus, wie es schien, überaus hartnäckigem, völlig verdrecktem Schnee. Er strahlte eine gewisse Würde aus, da die sonst vorherrschenden Farben Gelb- und Orangetöne waren, die die letzte Gewissheit dafür liefern, dass etwas vollkommen künstlich ist und garantiert keine natürlichen Substanzen mehr enthält.
Und dann erst die Wäsche. Susan kannte jede Socke, jeden Tanga, jeden Straps. Kauf dir ein paar zarte Dessous, doch häng sie lieber im Badezimmer zum Trocknen auf – es sei denn, du willst Susan van Meter unbedingt zeigen, was dich scharfmacht. Fleckige Laken? Wegschmeißen. Ein neuer Mann im Haus, mit schmutzigen Hemden? Schick ihn in den Waschsalon.
Irgendwelche Kondome?, fragte sich Susan. Irgendwelche Leichen? Irgendwelche Joints oder vielleicht Koks? Irgendwelche halbautomatischen Waffen? Erst letzte Woche hatte Paul ihr von einer Razzia erzählt, die die Cops in einem Crackhaus in der Bronx durchgezogen hatten. Die Kriminellen hatten die Drogen, das Zubehör und selbst die Kanonen in Beuteln aus dem Fenstergeworfen; den Cops, somit sämtlicher Beweismittel für den ganz großen Schlag gegen die Drogenmafia beraubt, blieb nichts anderes übrig, als sie wegen Umweltverschmutzung festzunehmen. Es war eine lustige Geschichte, auch spannend erzählt – eine typische Paul-Anekdote, mit einem Herz für Cops, wie es nicht viele FBI-Agenten aufbringen, trotzdem hatte Susan nicht gelacht. Vielmehr hatte sie ein Gesicht gezogen, das Carrie – früher, als sie noch über ihre Mutter lachen konnte – Wasserspeier-Fratze zu nennen pflegte.
Paul hatte es richtig gedeutet. »Ich weiß. Ich war lange weg.«
»Ja, wer weiß wo. Wer wusste es eigentlich?«
»Jamaica.«
»Jamaica. Du bist gar nicht braun.«
»Es war Nachtarbeit.«
»Klingt irgendwie nicht beruhigend.«
»Ich hab’s mir nicht ausgesucht. Die Bösen schlafen nie.«
»Jamaica. Weißt du, was ich lustig finde – ist es zwar nicht, eher erbärmlich –, also, meine Vorstellung von dem, was du da draußen so treibst, wenn ich tagelang nichts von dir höre – wie du in einer lausigen Karre in einer lausigen Gasse in der South Bronx oder in Bed Stuy hockst, zusammen mit einem Partner, der eine Rasur und Dusche genauso nötig hätte wie du, und ihr trinkt Muckefuck und esst kalte Pizza und wartet auf einen Junkie-Verräter, der klar genug im Kopf ist, um sich zu erinnern, was er euch eigentlich andrehen wollte, vorausgesetzt, er ist nüchtern genug, um überhaupt aufzutauchen – und vorausgesetzt, dass die Leute, die er verpfeifen will, ihn nicht inzwischen gekillt haben …«
Paul grinste. »Also weißt du doch, was ich mache.«
»… und stattdessen bist du auf Jamaica mit diesem Mädchen in dem nassen T-Shirt und diesen Brüsten, die du einfach zum Fressen findest. Calypso-Bands und Daiquiris.«
»Susan, man beneidet mich, dass ich eine Frau habe, die selbst mal im Job war, die kapiert, dass das Jamaica, wo ich war, nicht das Jamaica aus den Urlaubsprospekten ist.«
»Ich bin nicht mehr im Job. Ich bin Tippse. Archivarin.«
»Susan, ich will mich nicht drücken, aber ich kann nicht mit dir darüber reden, wenn du dich selbst schlechtmachst.«
»Research- Spezialistin.« Sie übertrieb es mit den Zischlauten. »Ich bin ein Arbeitstier.«
»Barnes sagte, dein Bolivien-Report wäre einer der besten, den er je gelesen hätte.«
Sie äffte Barnes’ altertümlichen Singsang nach. »Ausgezeichnet, Susan. Super. 1a. Hochspannendes Zeug. Hervorragend. Einfach nur hervorragend.«
»Joanna hat ihn rausgeschmissen.«
»Nein!? Jesus. Ist es die Möglichkeit? Ich kann nicht. Ich werd nicht. Ich tu’s nicht. Eines Tages wird er noch Direktor, nur weil er niemals einen vollständigen Satz von sich gibt. Kein Mensch weiß, was er wirklich denkt – über … Oh.« Paul stand hinter ihr und hatte die Hände auf ihre Brüste gelegt. »Ich hab dich vermisst.«
Susan legte ihre Hände auf seine. Seine Berührung, seine Lippen, seine Zunge, das Zusammenspiel seines und ihres Körpers – alles tat ihr wohl. Später, als Kleidungsstücke und Bettzeug überall verstreut lagen, sagte sie: »Nimm das, Jamaica!«
Durch die Fliegengitter hörte Susan den Imus im Radio verkünden, dass es nun sechs Uhr zweiunddreißig, achtundzwanzig Minuten vor sieben sei. Sechs Uhr zweiunddreißig, achtundzwanzig vor sieben, und der vierte Tag, an dem sie mit Imus statt ihrem Ehemann aufgewacht war, der wieder irgendeinen Einsatz hatte – auf Jamaica, in der South Bronx, in Bed Stuy oder sonst wo –, denn die Bösen schlafen ja bekanntlich nie.
Sie ging ins Haus, faltete die Wolldecke zusammen, unter der sie auf der Couch eingeschlafen war, und stopfte sie in den Schrank im Eingang. Der Fernseher lief noch. Als sie aufwachte, war gerade Jimmy Swaggart zu sehen, doch sie konnte sich nicht daran erinnern, was sie sich angeschaut hatte, um besser einzuschlafen. Oder was sie getan hatte, um wach zu bleiben?
Was machten all diese Ehefrauen, die nicht wie sie den Job aus eigener Erfahrung kannten, wenn ihre Männer nicht heimkamen? Riefen sie in der Zentrale an und machten eine Szene? Schnüffelten sie in den Schreibtischen ihrer Gatten, ob diese eventuell ihre Pässe mitgenommen hatten? Steckten sie ihre Nase in Schränke und Kommoden, um festzustellen, ob ihr Liebster für warmes oder für kaltes Wetter gepackt hatte? Und wenn ihre Männer dann nach Hause kamen, traten sie so lange in Koch- und Sex-Streik, bis sie ihnen hoch und heilig versprachen, nie wieder wegzubleiben, ohne zu sagen, wohin und für wie lange?
Dabei war alles mal ganz anders gedacht gewesen. Vor fünfzehn Jahren, da waren sie auf dem besten Weg gewesen, Batman und Robin zu werden, The Lone Ranger und Tonto, Superman und Wonder Woman, Robin Hood und Lady Marian, van Meter und van Meter, Mr. und Mrs. Narco. Sankt Paul und Sankt Michael …
»Szentmihalyi?« Vor fünfzehn Jahren hatte Paul sie in eine Ecke gedrängt, während einer Pause zwischen Ballistik und Pharmazie oder dergleichen, und wissen wollen, was für ein Name das war.
»Ungarisch. Bedeutet so viel wie Saint Michael.«
»Der Drachentöter?«
»Das war Georg. Der Erzengel Michael.«
»Susan van Meter ist ein schöner Name.«
»Ja, in der Tat. Deine Schwester?«
»Susan van Meter. Gefällt mir.«
»Ich kann dich leider erst nach der Mittagspause heiraten. Es sei denn, du bist die Sorte Mann, der es nichts ausmacht, wenn seine Frau mit einem anderen Mann zu Mittag isst.«
»Kommt ganz auf den Mann an.«
»John Barnes?«
»Mit dem warst du doch erst neulich essen.«
»Wenn du mich heiraten willst, van Meter, spionier mir nicht nach.«
»Ich wusste gar nicht, dass du eine der Frauen bist, die mit ihrem Lehrer ausgehen, um einen guten Abschluss zu machen.«
»Ich will nicht einfach nur eine gute Note. Ich will den besten Abschluss machen.«
»Tut mir leid, den mache ich schon. Aber ich wette, dass du die beste Frau sein wirst.«
»Wette angenommen.«
»Du wettest gegen dich selbst?«
»Falsch. Ich wette, dass ich besser bin als ihr alle.«
»Um einen Kuss?«
»Um eine Cola. Küssen werd ich dich ja sowieso.«
»Nach dem Mittagessen?«
»Am Samstag.«
Sie küsste ihn Samstagnacht und schlief mit ihm am Sonntagmorgen, und die Wette verlor sie. Paul van Meter wurde Klassenbester, und Susan Szentmihalyi war die zweitbeste Frau, nach Rita Arroyo, und in der Gesamtwertung lag sie auf Platz fünf. Die beiden heirateten tatsächlich, und sie nannte sich Susan van Meter, und eine Weile träumten sie davon, ein Team zu sein. Bis Susan schwanger wurde und Paul meinte, dass es dem Kind gegenüber nicht fair wäre, wenn beide in so einem riskanten Job arbeiteten. Also würde nur er das tun, und sie sollte einen Schreibtischjob übernehmen. Im Grunde hatten sie also nie wirklich denselben Job gehabt …
»Hi, hier ist wieder Imus mit seinem Frühstücksradio. Guten Morgen! Wir haben jetzt sechs Uhr sechsundvierzig, noch vierzehn Minuten bis sieben.« Zeit fürs morgendliche Preisboxen.
»Carolyn!« Taufe dein Kind niemals auf einen dreisilbigen Namen; du kannst ihn nie brüllen, ohne dass dir die Stimme überkippt. »Carrie!«
Lautes Schnarchen.
Susan pochte erst leicht gegen die Tür, dann klopfte sie, und bald boxte und hämmerte sie dagegen. »Was?«
»Zeit zum Aufstehen.«
»Noch zehn Minuten.«
»Ich komme rein!«
»Nein.«
»Dann steh auf.«
»Ich bin auf.«
»Sofort.«
»Ich bin aufgestanden.«
»Mach die Tür auf.«
»Komm ja nicht rein.«
»Mach sofort die Tür auf!«
Das typische Geräusch von Drogen, Drogenzubehör und halbautomatischen Waffen, die aus dem Fenster geworfen werden.
Susan öffnete die Tür. Aus der Packung, die Carrie gerade unter der Matratze verschwinden lassen wollte, fielen ein paar Zigaretten. »Hey, was soll das?« Tatverdächtige geben sich immer äußerst empört.
»Das war’s dann mit dem Ausgehen. Für den Rest der Woche und auch Samstagabend.«
»Du darfst hier nur reinkommen, wenn ich’s dir erlaube.«
»Du darfst nicht rauchen.«
»Das sind nicht meine, okay. Die gehören Jennifer.« Die hatte blaugefärbtes Haar, trug neun Ohrringe im linken Ohr und sechs im rechten, ferner schwarze Spitzenhandschuhe mit abgeschnittenen Fingern, um die Taille eine Motorradkette, darüber eine zerfranste Jeans-Weste und ein weites Unterkleid darunter sowie zerlöcherte Netzstrümpfe, einen Doc-Martens-Springerstiefel und einen schwarzen Converse-Sneaker. »Das sag ich Jennifers Mutter.« Die rauchte Selbstgedrehte und Marihuana und trank zum Frühstück Gin Tonic. »Oh, echt stark.«
»Und deinem Vater.« Der wer weiß wo war.
»Kommt Dad heute Abend nach Hause?«
»Ich weiß nicht.«
»Ist er okay?«
»Warum sollte er nicht?«
»Ja oder nein?«
»Ich weiß es nicht.«
»Scheint dir egal zu sein.«
Zur Hölle mit den Gören. Da versuchte man, mit gutem Beispiel voranzugehen, und sie meckern an allem herum. »Wenn du erst mal ausgezogen bist, junge Frau, kannst du über deine Mutter herziehen, so viel und so lange du willst.«
»Wenn ich ausgezogen bin, ändere ich als Erstes meinen Namen. «
»Frühstück«, verkündete Susan und ging den Flur hinunter. Carrie folgte ihr. »Es ist unfair, dass man mit einem Namen leben muss, den einem ein anderer verpasst hat.«
»Das tun Pferde auch. Und Hunde und Katzen. Und Boote und Autos und Städte. Die meisten Sachen. Denk mal drüber nach.«
»Das macht’s auch nicht fairer.«
»Cornflakes, Cornflakes oder Cornflakes?« Carrie schnappte sich eine Apfelsine aus der Schale auf dem Tisch und legte sie wie eine Kristallkugel vor sich. »Ich sehe, ich werde mich Cher nennen.«
Susan lachte. Sie liebte Cher. Sie fand es toll, dass sie bei jedem Auftritt total anders aussah. Es gefiel ihr, wie sie seinerzeit Barbara Walters im Fernsehen erklärt hatte, dass die Leute, die ihren Männerkonsum nicht mochten, sie offenbar für eine Art Staubsauger mit Bauchnabel hielten. »Cher ist schon vergeben.«
»Alle geilen Namen sind schon weg. Cher. Madonna. Vanity. Fiona. Apollonia.«
»Iss was, Carrie.«
Carrie ging zum Kühlschrank, allerdings nur, weil sie im Radio Z100 einstellen wollte. Sie tanzte nach irgendwas von Heart. Schließlich war Carrie doch kein Fan – oder vielleicht war sie’s nur in ihrem Allerheiligsten und auf der Straße – von Jennifers Lieblingsbands: Circle Jerks und Doggy Style.
Die Linie F war vollklimatisiert und nicht sonderlich überfüllt, trotzdem schwitzte Susan dermaßen, dass die Frau, die neben ihr saß, ihr einreden wollte, sie habe bestimmt Fieber und solle heimgehen.
Nein, sie hatte kein Fieber, sie hatte eine Frage. Da sie (fast) selbst mal beim Drogendezernat gearbeitet hatte, wusste sie, dass man in dem Laden mit hysterischen Anrufen keinen Blumentopf gewann. Außerdem konnte sie schlecht in den Koch- und Sex-Streik treten, solange Paul fort war. Und obwohl sie sich im Klaren war, dass sie beim Schnüffeln in seinem Schreibtisch, in seinem Schrank und in seiner Kommode nicht allzu viel Neues entdecken würde – schließlich konnte er undercover alles Mögliche sein –, hatte sie in seinen Sachen gekramt. Was sie dabei gefunden hatte, waren sein Pass und so gut wie alle seine Sachen. Was sie ebenfalls entdeckt hatte, in einem braunen Umschlag, ganz hinten in Pauls Sockenfach, wo nur ein verpeilter Anfänger etwas versteckt hätte – beziehungsweise jemand, der auch wollte, dass es gefunden würde: einhundert Hundertdollarnoten.
Kapitel 4
»Endlich bin ich dahintergekommen«, sagte Red Sayles, »warum die Schwergewichte in der Wirtschaft, also die Iacoccas und so, also, warum die immer dunkle Anzüge tragen.«
John Barnes, in dunkelgrauer Hose und blauem Blazer, legte den Kopf in den Nacken, um die Ziffern auf der Leuchtanzeige des Fahrstuhls auftauchen und wieder verschwinden zu sehen: sechsundvierzig – sein Alter – siebenundvierzig, achtundvierzig, neunundvierzig. Die Zeit verging wie im Flug, zumindest manchmal.
»Na, in erster Linie machen sie das, damit sie eine Zeitung rumschleppen können, ohne sich total mit Druckerschwärze einzusauen. Ferner, damit sie auf ihre Hosen kleckern können, ohne dass man’s sieht. Ich meine, beim Urinieren, richtig?« Rita Arroyo stieß eine damenhafte Stichflamme aus der Nase. Leider verging die Zeit bei Meetings wie dem, das ihnen gleich bevorstand, keineswegs wie im Flug. Er musste nämlich den Arschlöchern vom ATF, dem FBI, dem International News Service, der Zollbehörde, dem New York Police Department, dem Bürgermeisteramt, der US-Staatsanwaltschaft, der Bezirksanwaltschaft Manhattan, dem Ordnungsamt und nicht zu vergessen Nix – nein, Nix hatte es sich natürlich nicht nehmen lassen, aus diesem Anlass extra aus Georgetown rübergejettet zu kommen, um ihm die ganze Zeit über die Schulter zu schauen – also, er musste all diesen Arschlöchern verklickern, wie zum Teufel es möglich war, dass einer seiner Fahnder am helllichten Tage mitten in Manhattan auf dem Rücksitz eines Taxis umgenietet worden war.
»Die hohen Tiere werden einem vielleicht weismachen wollen, dass ihnen beim Pissen nie was danebengeht. Aber selbstverständlich bekleckern alle ihre Hosen – Anwesende natürlich ausgenommen, liebe Rita. Das kommt nun mal dabei heraus, wenn bei einer Handlung zwei mangelhafte Konstruktionen aufeinandertreffen – der Penis und der Hosenschlitz mit Reißverschluss.«
Rita warf den Kopf zurück wie eine Fandango-Tänzerin. »Nicht nur der Penis weist Mängel auf, mein Lieber, sondern der gesamte männliche Körper.«
Da ist man so nett und versucht, komplizierte Zusammenhänge auszuleuchten, und das ist der Dank: selbstgefällige, mehr oder weniger stille Zweifel. In Wahrheit sitzen sie da, in ihre Ledersessel versunken, die Ellenbogen lässig auf den Lehnen, mit aneinander gelegten Fingerspitzen und Schlafaugen, die trotzdem bis tief in dein Innerstes zu schauen vermögen, in Wahrheit sitzen sie da und beten, jawohl, doch man soll es ihnen nicht anmerken, wie sie beten: Lieber Gott, mach, dass ich niemals so ne Scheiße labere.
»Kurzum: Sie tragen dunkle Anzüge – selbst im Sommer tragen sie die, in Marineblau, in Graphit und so –, damit man ihre Pisseflecken nicht sieht.« Sayles warf einen kurzen prüfenden Blick auf den Reißverschluss seines beigen Anzugs (ein kürzlicher Ausflug aufs Herrenklo in eiliger Hast inspirierte ihn dazu), rückte seine Krawatte zurecht, schob das Hemd in die Hose und klopfte sich auf den Bauch. »Obendrein wirkt man in einem dunklen Anzug einfach schlanker und so. Nicht, dass ich zu viel essen würde. Weißt du, wie’s wirklich ist? Es ist genau, wie’s in dieser Levis-for-Men-Werbung gesagt wird. Hast du den Spot mal im Radio gehört, Rita? Also, da sagen sie nämlich, wenn ein Kerl ein gewisses Alter erreicht, dann braucht er nur einen Hauch mehr Platz im Schritt und um die Taille – aber nicht, weil er fett wird oder so, nein-nein, sondern wegen der Schwerkraft. Der Lauf der Natur, nicht wahr? Ich hab bloß einen Tick zugelegt, das ist alles.«
»Du hast einen Tick«, sagte Rita. Der Fahrstuhl hielt im sechsundsiebzigsten Stock, und eine Jungfrau stieg ein – eine Unschuld in einem kragenlosen schwarzen Kostüm. Ihr dunkelbraunes Haar war straff zurückgenommen und im Genick mit einem geflochtenen Band zusammengebunden, genau dort, wohin Barnes zielen würde, wenn er sie erschießen müsste. Vor ihren Ohren standen ein paar Strähnchen ab, keine zerzausten Ausreißer, sondern sorgfältig geschnittene und frisierte Strähnen. Koteletten, Korkenzieher oder wie immer man so was nannte, Barnes wusste es nicht. Möglicherweise wegen der kragenlosen Jacke wirkte ihr Hals um einiges dicker, als er persönlich es gut fand, andererseits aber mochte er das Zusammenspiel von Haaren und Hals; ab der Stelle, wo sie durch das Haarband gerafft wurden, fächerten sie auf wie ein Pinsel.
Sie sah weder geradeaus noch zur Decke und der indirekt beleuchteten Täfelung, sie starrte auch nicht auf ihre Fußspitzen, sondern mit leicht schräg geneigtem Kopf links an ihm vorbei, als erwarte sie, dass er jeden Moment zu sprechen anfinge. Sie hatte nichts in den Händen – kein Portemonnaie, keine Aktentasche, keine Ordner, keinen Teebecher –, und sie steckte sie in die Taschen ihres engen Rocks, der kurz oberhalb der Knie endete. Barnes vermutete, dass es große Hände waren, ihrem Hals und den gut entwickelten Waden entsprechend, ferner den großen Füßen in diesen schwarzen, vernünftigen Schuhen; ihre Knöchel waren vielleicht ein wenig robust, aber gut geformt.
Pferdeschwänze – die Jungfer trug keinen echten, dazu saß er viel zu tief – waren nur eines der vielen Waterloos von Barnes, dem Vater. Er hatte zwar gelernt, dass man, sobald man auch die letzte Strähne, die lang genug war für einen Pferdeschwanz, aufgenommen hatte, das Haar ohne Ende bürsten musste, noch viel länger, als man glaubte. Aber kaum wollte er das Gummiband darüber ziehen, war alles schon wieder hin. Denn Sallys Haar war so fein, dass es ihm jedes Mal aus den Fingern glitt, noch bevor er das Gummi drum herum schlingen konnte. Schließlich hielt er eine Art geplatzten Pferdeschwanz in Händen, überall hingen einzelne Haare, auch an ihrem Hals, und Sally war böse, weil er ihr weh getan hatte, und er war sauer auf sie, weil sie sein Haar geerbt hatte anstelle der dicken Locken ihrer Mutter, für die Pferdeschwänze überhaupt kein Problem darstellten. Von diesen Locken mal abgesehen, und auch mal abgesehen davon, dass sie sich selbst nie einen Pferdeschwanz machte, und ungeachtet der Tatsache, dass auch sie sich ärgerte, weil Sally das Haar ihres Vaters hatte: Joanna schaffte es im Nu, mit Fingern, so geschickt und kunstfertig wie ein Webervogel.
»John?« Sayles stand zwischen Fahrstuhltür und Flur, die Tür knallte bei ihrem Versuch, sich zu schließen, ihm wieder und wieder ins Kreuz. Rita eilte bereits mit großen Schritten den Korridor hinunter. »Acht-Neunzig. Damenunterwäsche und Mondumlaufbahn. Zu Venus und Mars bitte hier umsteigen.«
Die junge Frau ließ Barnes vorbei und lächelte über Sayles’ Türgeplänkel, schlug allerdings die Augen nieder.
»Haben Sie heute Mittag schon was vor?«
Sie sah auf und durch ihn hindurch. »Ich habe Fechtunterricht. «
Und sie joggte fünf Meilen vor dem Frühstück und spielte Squash nach der Arbeit. Am Wochenende machte sie Rucksacktouren, und im Sommer fuhr sie in den Himalaja zum Bergsteigen. Sie war Gourmet-Köchin, lizenzierte Bar-Frau, schneiderte ihre Kleidung selbst – wenn ihr danach war, denn selbstverständlich war sie Weltklasse im Shopping; sie hatte einen schwarzen Gürtel (Karate), ein Jura-Diplom (Harvard), promovierte gerade in Hochenergiephysik in Princeton (was ihre spezielle Antwort auf eine eher allgemein gehaltene Frage erklärte) und in romanischer Philologie (an der Sorbonne). Und de facto war sie auch keine Jungfrau mehr, bevorzugte jedoch einen Vibrator, ein Orgasmotron. Barnes kannte ihren Typ; er hatte eine von dieser Sorte geheiratet.
Nix (äußerst treffender Name, Nix wie Nichts war der doppelgesichtige Janus des Herrn Direktors und nur als solcher zu Rang und Ehren gekommen; an den Ideen der anderen fand er immer etwas auszusetzen, selber hatte er allerdings keine), dieser Nix spreizte nun seine kleinen rosa Hände auf dem Tisch, als wolle er seine Lieblings-Klaviersonate vorspielen. Auf seinem blauen Anzug, dessen Nadelstreifen so diskret waren, das sie fast unter Geheimhaltung fielen, waren keine nennenswerten Pisseränder zu erkennen. »John, warum fangen Sie nicht einfach an? Sie alle kennen unseren Bezirkschef, oder?«
Barnes faltete die Hände und spielte kurz mit dem Gedanken, ein Tischgebet zum Besten zu geben, begnügte sich dann aber damit, einen Stift zwischen den Fingern hin und her zu rollen.
»Gestern Nachmittag wurde Paul van Meter, einer unserer Agenten, in einem Taxi auf der Third Avenue durch einen offenbar gezielten Schuss getötet. Er war zu diesem Zeitpunkt im Dienst, doch es würde unsere Aktivitäten ernsthaft gefährden, wenn das publik werden sollte. Wir bitten Sie daher um Unterstützung, eine Geschichte für die Presse zu entwickeln, um deren zwangsläufige Neugier zu befriedigen. Sein Tod soll die Folge eines völlig willkürlichen Gewaltakts gewesen sein, eines Schusses aus einem zufällig vorbeifahrenden Wagen.« Er klappte eine Mappe zu, in der ein gelbes Blatt lag, das er immer wieder zu studieren vorgab, dabei war es bloß eine Liste von Immobilienmaklern in Hoboken. Der Untermietvertrag für sein Apartment an der Ninth Street, in dem es nach den Küchendünsten vom Balducci’s stank, lief demnächst aus; Joanna hatte das Schloss in der West End Avenue auswechseln lassen (und den Portiers eingeschärft, erst die Polizei und dann sie zu verständigen, falls er versuchen sollte, sich mit Geschwätz den Zutritt zu erzwingen); er konnte sich die Mieten in Manhattan nicht leisten, also musste er irgendwo am anderen Flussufer eine Wohnung finden.
»Äh, John?« Der Boss aller Detectives, William (Buffalo Bill, nach seiner Heimatstadt) Aldrich, beugte sich vor, damit Barnes ihn besser sehen konnte. »Ich habe mit diesem, äh, Szenario ein kleines Problem. Zum ersten: Nach dem Erkenntnisstand der Ballistik wurde Agent van Meter aus nächster Nähe erschossen, wir sprechen hier von ein bis zwölf Zentimetern, es ist also ziemlich unwahrscheinlich, dass der Täter in einem vorbeifahrenden Auto saß. Die Kugel stammt aus einer vermutlich schallgedämpften Zweiundzwanziger. Falls die Aussage des Taxifahrers« – Aldrich setzte seine Lesebrille auf und raschelte mit den Papieren – »der Mann heißt übrigens Marvin Needleman, korrekt ist, soll Agent van Meters Sitzhaltung während der ganzen Fahrt über annähernd dieselbe geblieben sein – damit meine ich, dass er mehr oder weniger aufrecht im Fond des Taxis gesessen hat. Aus dem Einschusswinkel lässt sich also folgern, dass der Täter direkt neben ihm im Taxi gesessen hat, ich meine, die Zweiundzwanziger muss in etwa so gehalten worden sein« – er formte mit der Hand eine Pistole, winkelte das Handgelenk um neunzig Grad ab und presste den Arm an den Körper – »vorausgesetzt, der Schütze war Rechtshänder, eine schlicht und einfach auf statistischer Wahrscheinlichkeit basierende Annahme. Van Meter hat es ziemlich genau hier erwischt.« Er kitzelte sich mit dem Mittelfinger der linken Hand direkt unterhalb des Herzens am Brustkorb. »Der einzige Schönheitsfehler an der Sache ist nur, dass laut Needleman während der gesamten Fahrt niemand außer van Meter in seinem Taxi gesessen hat.«
Aldrich betrachtete versonnen seine Hand mit dem noch immer gestreckten Zeigefinger, den drei gekrümmten übrigen Fingern und dem erhobenen Daumen, fast als überlege er, sie nun zu den restlichen Beweisstücken zu legen. Barnes fand, er solle sich damit einen Kopfschuss geben, zur Strafe für seine Syntax. »Was noch?«, fragte Nix.
»Äh? Wie meinen?« Aldrich setzte die Brille ab und schob einen Zeigefinger hinters Ohr.
»Sie sagten vorhin zum ersten, anschließend haben Sie uns die Zweifel der Ballistik bezüglich an einem in einem anderen Fahrzeug befindlichen Täter erläutert, ungeachtet dessen, dass van Meter der einzige Fahrgast war. Gibt es noch einen zweiten Punkt?«
»Tja, also … da ist noch diese Frau. Laut Needleman war eine Frau bei van Meter, als er einstieg. Als Needleman ihn sah. Van Meter sah.« Aldrich bekam einen roten Kopf, Pronomen waren immer so … unstet. »Sie hatten offenbar zusammen gegessen. Sie standen vor dem Wäldchen, als er van Meter bemerkte. Needleman. Der Oberkellner bestätigt, dass sie gemeinsam zu Mittag gegessen hätten. Van Meter und diese Frau. Sie hatten keine Tischreservierung, seien einfach auf gut Glück reingekommen. Er hätte keinen von beiden vorher je gesehen, und er arbeite seit zwei Jahren dort. Der Oberkellner. Er zahlte bar. Also, van Meter. Needleman, der Taxifahrer, meinte, sie habe sich noch ins Taxi gebeugt, um ihn zu küssen, also, um van Meter zu küssen. Da könnte es passiert sein.«
»Was für ein Wäldchen denn?« Der Typ vom FBI, eine vierschrötige irische Saufnase in einem blassblauen, stark kleckerverdächtigen Polyesteranzug.
Aldrich, mit einem Mal ganz Mann von Welt, lächelte gelassen.
»Dieses spezielle Wäldchen, Jim, ist der Name dieses Restaurants.«
»Ein sehr teures Restaurant«, warf Barnes ein.
Ein scharfer Blick und ein Lächeln von Rita, die neben Barnes Platz genommen hatte, ein leises Gackern von Sayles, der hinter ihm saß, und ebenso von der Vertreterin des Bürgermeisters, die ihn vom anderen Ende des Tischs aus fixierte. Eine rotblonde Jungfer in grauem Leinenkostüm, Hornbrille auf der Nase und locker gebundenen, weinroten Schal um den Hals – sie schlabberte unablässig schwarzen Kaffee und rauchte eine Camel Lights nach der anderen. Frühmorgens joggen – nein danke, sie hielt sich fit mit Nikotin, Koffein und Kokain.
Barnes legte sich für sie ins Zeug. »Ich denke, wir entfernen uns hier vom wesentlichen Punkt. Unsere Aufgabe ist doch, uns auf eine Version zu einigen, die von den Medien akzeptiert wird. Die Fakten, die nur uns allein bekannt sind, spielen da keine Rolle. Die Presse wird weder von den Erkenntnissen der Spurensicherung noch von der Frau erfahren. «
»In, äh, welchem Kontext hat eigentlich van Meter ermittelt?« Das war Bailey Rule von der Zollbehörde auf seine gewohnt förmliche Art.
»Drogenschmuggel«, erwiderte Barnes.
Rule lachte sein typisches, nach Buschtrommeln klingendes Lachen. »Hey, Babe, ich will kein Stück von deinem Kuchen, ich will mir nur einen Überblick über eure Pläne verschaffen.«
»Unsere Pläne sind hier irrelevant.«
»Mr. Barnes.« Der Typ von der Staatsanwaltschaft: randlose Brille, pissfleckenabweisender, graphitgrauer Nadelstreifenanzug, gewebte Krawatte, schwarze Budapester, Fünf-Uhr-Bart morgens um Viertel nach neun. »Keiner der hier Anwesenden will in ein laufendes Ermittlungsverfahren eingreifen, aber ich möchte mit allem gebotenen Respekt betonen, dass es für uns unbedingt erforderlich ist, einige der Details zu kennen, damit wir uns selbst eine Meinung bilden können, ob sie von Relevanz sind oder nicht.«
»Notiert.«
»Na, kommen Sie schon, Barnes.« Der FBI-Typ. »Niemand will Ihnen in die Parade fahren. Sie sehen doch, wie kooperativ wir bislang waren, es ist nichts an die Öffentlichkeit gedrungen …«
»In der Tat, John.« Aldrich beugte sich vor. »Die Streifenwagenbesatzungen, die auf den Notruf des Taxifahrers reagiert haben, der Chef des zuständigen Reviers, die Jungs von der Spurensicherung – nachdem die van Meters Colt durch die Computer gejagt und festgestellt haben, dass er Staatseigentum ist und damit dann auf euch gestoßen sind, die haben doch sofort die Sache unterm Deckel gehalten.«
»Also – wir haben euch etwas gegeben.« Typ Nummer eins hob die Hände vor die Brust und wackelte mit den Fingern. »Jetzt wollen wir was dafür haben.«
»Äh, John?« Wieder Aldrich, der in seinen Papieren blätterte. »Hier ist noch etwas: van Meter hat dem Taxifahrer eine Adresse genannt, ein Apartmenthaus Ecke East End Avenue und Einundachtzigste. Das ist nicht sein Wohnsitz. Also, der von van Meter. Der wohnt in Brooklyn. Handelt es sich dabei vielleicht um eine von Ihren – wie nennt Ihr das noch schnell? – konspirativen Wohnungen?«
»Wir sagen nicht konspirative Wohnung. Und nein, ist es nicht.«
»Wohl zu teuer, was?«, witzelte Typ Nummer eins und brach in ein Lachen aus, das hervorragend zu seinem Anzug passte.
»Wir haben van Meters Foto dem Hausmeister gezeigt, dem Portier, nur leider war das Ergebnis gleich Null«, sagte Aldrich. »Wir haben es mit der Beschreibung der Frau versucht, die der Taxifahrer uns gegeben hat. Die Frau, die bei van Meter war, aber diese Beschreibung war nicht besonders. Ein spektakuläre Schönheit mit blonder Mähne.« Aldrich verdrehte die Augen.
»Wissen Sie, eines ist doch merkwürdig. Van Meter hatte keine Schlüssel bei sich. Der Hausmeister und die Türsteher können sagen, was sie wollen, aber ich mache jede Wette: hätten wir Schlüssel bei ihm gefunden, dann hätten die garantiert zu einer Wohnung in diesem Haus gepasst –«
»Eine Garçonnière, wie die Franzosen es nennen?« Die Rotblonde trommelte mit dem Radiergummiende ihres Bleistifts auf den Tisch.
»Wie nennen wir denn so was? Polly?« Typ Nummer eins lachte. Polly. Perfekt.
Sie ignorierte den Kerl, und Rita feuerte erste giftige Blicke in ihre Richtung.
»Chief Aldrich, Sie sagten gerade, das Hauspersonal habe van Meter auf dem Foto nicht wiedererkannt.«
»Jep. Das, äh, stimmt, ja. Hm-hmh.« Aldrich war es nicht gewohnt, von Frauen ausgequetscht zu werden – außer von Mrs. Aldrich.
»Folglich?«
»Hören Sie, ich sage nur, dass wir keine Schlüssel gefunden haben. Hätten wir welche gefunden, hätten wir auch überprüft, ob einer davon – Sie verstehen? – zu einer Wohnung in diesem, äh, Wohnobjekt gepasst hätte.«
Polly sah Barnes an. »Mister Barnes?«
Er lächelte sie an. »Ja?«
»Was folgern Sie – wenn überhaupt – aus der Abwesenheit von Schlüsseln?«
Barnes folgerte herzlich wenig daraus, weil sie sich nämlich in seinem Bürosafe befanden. Als die Kollegen des NYPD Sayles ganz im Sinne der guten Zusammenarbeit zur gemeinsamen Inventur von van Meters Besitztümern eingeladen hatte, hatte dieser sie geschickt aus der rechten Jackentasche von van Meters Anzug gefischt.
Kapitel 5
Noch bevor er die Brieftasche mit 1.027 Dollar in bar, mitsamt den Kreditkarten und Führerschein sowie der Sozialversicherungskarte eines gewissen Charles Fuller Nelson in Augenschein genommen hatte, wusste Sayles, dass hier etwas faul war. Die Polizei hielt Charles Fuller Nelson für van Meters Deckname. Und sie glaubte, dass das Geld Regierungsknete war. Doch Sayles wusste, dass van Meters Märchenname Kenneth Meyers war und die 1.027 Dollar nicht langten, um sich die richtige – die nötige – Zeit damit kaufen zu können.
Er roch, dass auch irgendwas mit dem Anzug nicht stimmte, ein oxfordblauer, unbekleckert und zwei- bis dreimal teuer, wie van Meter ihn für Kenneth Meyers hätte erstehen dürfen; etwas stank, das erkannte er auch an van Meters Haar, das glatt zurückgekämmt war, anstatt links gescheitelt, an den Kontaktlinsen, die er statt der goldgefassten Pilotenbrille trug, an der goldenen Uhr an van Meters rechtem Handgelenk. Vor allem die Uhr war oberfaul. Sayles, ein Uhren-Freak, wusste es: eine Cartier-Pasha, wasser- und bis zu einer Tiefe von 11 Metern druckdicht, automatischer Aufzug, der jedoch für den Fall der Fälle mit einem kleinen Krönchen verschlossen war, das an einer hauchdünnen goldenen Kette hing und mit einem konkav geschliffenen Saphir besetzt war; von diesen Uhren gab es auf weltweit gerade mal 700 Stück, durchnummeriert; eine starke neue Uhr für den starken neuen Mann, ungeeignet für jemanden, der nicht war, was er vorgab. Dass van Meter Rechtshänder war und seine eigene Uhr stets am linken Handgelenk trug – Sayles hielt sich die Nase zu.
Die Schlüssel passten zu Apartment 14-D, vier Zimmer, anderthalb Badezimmer, eine Terrasse, Blick über den Fluss und so weiter. Es lag in einem Gebäude Ecke Einundachtzigste Straße und East End, und alle vier Räume waren im Stil des Home-Design-Supplements der New York Times eingerichtet.
Thomasville, Ralph Lauren, Villeroy & Boch, Yamazaki, Brunschwig & Fils, Einstein Moomjy, Schott, Laura Ashley, Baccarat, Roseline, Bali, Mikasa, ADS, Bang & Olufsen, Waterford, American Standard, Avery Boardman, Erté, Retroneu, Riedel, Thos. Moser, Kagan – alles, was Rang und Namen hatte, war von Charles Fuller Nelson für seine Nichts-Ist-Zu-Teuer-Wenn-Du-Den-Schoß-Des-Luxuslebens-Erstürmen-Willst-Kampagne angeheuert worden.
»Ja, das ist Mister Nelson aus Apartment 14-D«, sagte der Portier, als Sayles ihm eine unechte Goldmarke unter die Nase hielt, nebst einer Aufnahme, die man von van Meter gemacht hatte, als er auf dem Seziertisch im Leichenschauhaus lag (kein Archivfoto, wie die Cops, daher hatten sie auch null Erfolg). »Isser tot?«
»Häh? Oh, nein. Manchmal macht man ein Bild und der Betreffende hat gerade die Augen zu … et cetera pp? Tja, so ein Foto ist das.«
Der Portier schüttelte traurig den Kopf. »Denken Sie, nur weil ich ein Schwarzer bin, bin ich bekloppt? Es gibt ja ne Menge hirnamputierter Schwarzer, ich gehöre leider nicht dazu.«
»Ah, ja. Okay. Tut mir leid. Wie lange wohnte Nelson in 14-D?«
»Sechs, acht Monate. Seit Ende letzten Sommers.«
»Lebte er allein?«
»Totaaal allein, Mann.«
»Was soll das denn heißen?«
»Genau das.«
»Denken Sie, nur weil ich ein Weißer bin, bin ich ein bekloppter Weißer?«, sagte Sayles. »Es gibt ne Menge Weiße, die Idioten sind, aber ich gehöre nicht dazu.«
Der Portier grinste. »Wie war noch die Frage, Mann?»
»So, wie Sie totaaal allein sagten, als sei irgendetwas Eigenartiges dabei.« Sayles lebte bei seiner Mutter, deren Kochkünste an seinem Fettarsch schuld waren.
Der Mann zuckte die Achseln. »Schätze, manches kommt mir einfach komisch vor, so ab und zu.«
»Vielleicht, worauf van Meter abfuhr und so weiter?«
»Wenn Sie so wollen.«
»Hat er Männer mit raufgenommen?«
»Junge Typen, gutaussehend. Sie wissen schon, Dressmen.«
»Irgendwelche Frauen?«
»Nur eine.«
»Können Sie sie beschreiben?«
»Schwierig. Trug ständig große Schlapphüte, hatte das Haar drunter gesteckt.«
»Groß?«
»Einssechsundsiebzig bis einsachtzig.«
»Gewicht?«
»Mann, Gewichte kann ich nicht schätzen. Konnt ich noch nie. Wie viel wiegen Sie? Fünfundachtzig?«