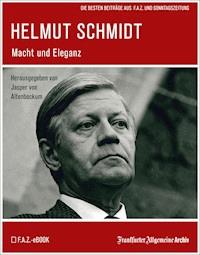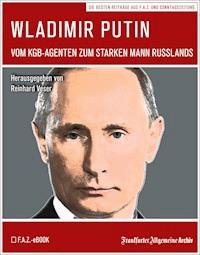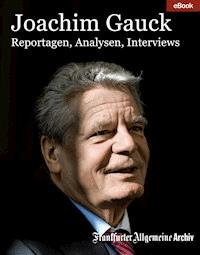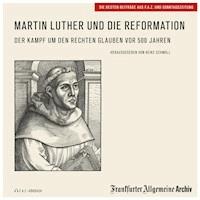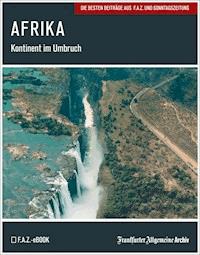
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Chancenkontinent Afrika? Dieses Schlagwort ist immer wieder zu hören, vor allem wenn von der Beseitigung von "Fluchtursachen" die Rede ist. Die Migranten selbst sehen das anders: Das Leben in der afrikanischen Heimat ist für sie eine schlimmere Perspektive als die Gefahren auf dem Weg nach Europa. Armut, Gewalt, Korruption prägen den Alltag ihrer Heimatländer. F.A.Z.-Autoren beschreiben und analysieren die Probleme, Entwicklungen und Chancen des afrikanischen Kontinents.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 127
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Afrika
Kontinent im Umbruch
F.A.Z.-eBook 52
Frankfurter Allgemeine Archiv
Herausgeber: Frankfurter Allgemeine ArchivRedaktion und Gestaltung: Hans Peter Trötscher
Projektleitung: Olivera Kipcic
eBook-Produktion: rombach digitale manufaktur, Freiburg
Alle Rechte vorbehalten. Rechteerwerb und Vermarktung: [email protected]© 2018 Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main
Titel-Grafik: © Adobe Stock / HandmadePictures
ISBN: 978-3-89843-463-8
Inhalt
Vorwort
Afrikas überhöhte Steuerlast
Die zweite kalte Enteignung
»Es fehlen 16 Millionen Jobs jährlich in Afrika«
Die meisten Herrscher Afrikas jubeln über die Bevölkerungsexplosion
»Wir können viel von Afrika lernen«
Ein Kontinent im Kerzenlicht
Die afrikanische Bildungsmisere
Kleine Investitionen zahlen sich auch in unruhigen Zeiten aus
Der deutsche Minister und Afrikas Wirklichkeit
Kenia wird zum Vorbild im Bankgeschäft
10 000 Dollar Miete für ein dunkles Loch
Afrikas Tragödie ist die geringe Produktivität
Marshallplan für Afrika soll Migration senken
Eine Pest namens Korruption
Die Landwirtschaft könnte Afrikas Hoffnung sein
Termitenhügel und Hochkaräter
Stachelige Kakteen statt eines flotten Löwen
Zwei Dutzend Milliardäre in einem armen Kontinent
Rising Star mit Schönheitsfehlern
Äthiopier leiden unter der Entwicklung ihres Landes
Die Arabellion hat Nordafrikas Wirtschaft ausgebremst
Wie die Ölkrise Afrikas Wirtschaft trifft
Bloß kein Marshallplan für Afrika
Der chinesische Lernprozess in Afrika
Deutsche Konzerne sind in Afrika noch zögerlich
Vorwort
Von Hans Peter Trötscher
Chancenkontinent Afrika? Dieses Schlagwort ist immer wieder zu vernehmen, vor allem wenn in Deutschland von der Beseitigung von »Fluchtursachen« die Rede ist. Die Migranten selbst sehen das anders: Das Leben in der afrikanischen Heimat ist für sie eine schlimmere Perspektive als die Gefahren auf dem Weg nach Europa. Armut, Gewalt, Korruption prägen den Alltag ihrer Heimatländer. Auch für viele Außenstehende wirken große Gebiete des Kontinents noch immer wie das Herz der Finsternis.
Das politische Deutschland, quer durch alle Bundestagsfraktionen, überlegt, was man in Afrika besser machen kann. Eine verbreitete Ansicht ist, dass es eine Art Marshallplan brauche, um die Länder Afrikas zu entwickeln. Da auch China starke Macht- und Wirtschaftsinteressen auf dem afrikanischen Kontinent verfolgt, wittern viele afrikanische Politiker eine gute Gelegenheit und versuchen die Europäer gegen die Chinesen auszuspielen. Es ist unklar, ob die Kooperationen mit dem Reich der Mitte aus Illusionen über die chinesischen Absichten entstanden sind, oder ob wieder, wie so häufig, der Versuch der hemmungslosen Bereicherung korrupter politischer Eliten dahintersteht: China geht es nur um eines: Rohstoffe. Und möglichst billig sollen sie sein.
Äthiopiens Ministerpräsident Hailemariam Desalegn zitiert zu diesem Thema Deng Xiaoping: »Zunächst einmal ist es für uns nicht wichtig, ob die Katze nun weiß oder schwarz ist, sondern ob sie in der Lage ist, Mäuse zu fangen«, um dem hinzuzufügen: »Wenn die Katze Mäuse fängt, dann ist es uns eigentlich egal, ob sie aus Deutschland oder aus China kommt. Wir möchten die chinesischen Investoren, wir möchten die deutschen Investoren, wir möchten amerikanische Investoren.« Sie müssten die Arbeitsplätze für die Bevölkerung schaffen. Sie müssten natürlich ihrerseits auch einen anständigen Gewinn erwirtschaften. Und sie müssten natürlich Steuern in Äthiopien bezahlen.
Die politische Kultur in Afrika ist immer wieder für Überraschungen gut. So kann es denn nichts schaden, wenn die deutsche und internationale Entwicklungshilfe stets auf die Einhaltung von Regeln pocht. Die Regeln müssen so sein, dass es Korruption möglichst schwer hat. Letztlich kommt es nach Einschätzung des deutschen Entwicklungshilfeministers darauf an, das richtige Umfeld für Infrastrukturinvestitionen und Investitionen in der privaten Wirtschaft zu schaffen. Er machte in der Vergangenheit mehrfach deutlich, dass es für ihn weniger darum geht, mehr Mittel nach Afrika zu lenken. Mehr Kreditmöglichkeiten für Entwicklungsländer könnten sich ziemlich schnell als ein Danaer-Geschenk erweisen – also sich in kurzer Zeit gegen sie selbst richten.
Die deutsche Entwicklungshilfe für Afrika betrug in der vergangenen Legislaturperiode rund zwei Milliarden Euro. Wären die Flüchtlingskosten nicht so hoch, wäre die Perspektive für Investitionen vor Ort wahrscheinlich besser.
Afrikas überhöhte Steuerlast
Die Wirtschaft setzt auf mehr Unterstützung aus Berlin für ihre Geschäfte
Von Manfred Schäfers
Um Afrika zu entwickeln und deutsche Unternehmen auf dem Nachbarkontinent zu unterstützen, muss die Bundesregierung aus Sicht der Wirtschaft mehr liefern als warme Worte und internationale Konferenzen. Insbesondere der Mittelstand sieht sich angesichts der »teilweise herausfordernden Rahmenbedingungen« im Stich gelassen. Den Unternehmen geht es um Investitionssicherheit, wettbewerbsfähige Finanzierungen und einen Schutz vor übermäßiger Besteuerung. Anfang nächster Woche lädt die Bundesregierung im Rahmen ihrer Präsidentschaft in der Gruppe der zwanzig großen Wirtschaftsnationen (G 20) zur Konferenz »Partnerschaft mit Afrika«.
»Afrika wächst seit Jahren stärker als die Weltwirtschaft. Aber noch immer hat der Kontinent enormen Aufholbedarf«, sagte der Vorsitzende der Subsahara-Afrika Initiative der Deutschen Wirtschaft (Safri), Heinz-Walter Große, dieser Zeitung. Entgegen dem Trend ging der deutsch-afrikanische Außenhandel 2016 um 2,4 Prozent auf 41,2 Milliarden Euro zurück. Die deutschen Importe aus Afrika sanken wegen der niedrigen Rohstoffpreise um 9,6 Prozent auf 16,6 Milliarden Euro. Die deutschen Exporte nach Afrika legten dagegen um 3 Prozent auf 24,6 Milliarden Euro zu. Die gesamten deutschen Direktinvestitionen auf dem afrikanischen Kontinent werden auf 8,6 Milliarden Euro beziffert, mehr als 60 Prozent entfallen davon allein auf Südafrika.
Nach Großes Worten gibt es eine gewisse Zurückhaltung deutscher Unternehmen gegenüber Afrika. Grund seien die teilweise schwierigen Rahmenbedingungen vor Ort. Daher würden insbesondere mittelständische Unternehmen noch immer abgeschreckt. Sie hätten anders als größere Unternehmen weniger Möglichkeiten, Risiken zu identifizieren und zu steuern. Die Finanzierung der oft langen Vorlauffristen von Geschäften sei gerade für sie eine große Herausforderung. »Hier braucht die deutsche Wirtschaft die Unterstützung der Bundesregierung«, betonte der Manager, der im Hauptberuf Vorstandsvorsitzender der B. Braun Melsungen AG ist.
Der Safri-Vorsitzende mahnte eine Bündelung der Afrika-Initiativen der Ministerien an. Tatsächlich gibt es drei verschiedene Ansätze: Das Entwicklungsministerium wirbt für einen Marshallplan für Afrika. Das Wirtschaftsministerium legte ein eigenes Papier mit dem Titel vor: »Pro! Afrika – Perspektiven fördern, Chancen nutzen, Wirtschaft stärken«. Das Finanzministerium arbeitet unter der wenig eingängigen Überschrift »Compact with Africa« an einem Konzept, das reformwillige Regierungen stärkt.
Wenige Tage vor der dem Nachbarkontintent gewidmeten G-20-Konferenz in Berlin hat die Initiative der Wirtschaft ein Diskussionspapier erarbeitet: »Mehr Wirtschaft mit Afrika – Was die Politik beitragen kann«. Darin findet sich die Forderung, die Außenwirtschaftsförderung und die Entwicklungszusammenarbeit enger zu verzahnen. Vor allem die Länder des afrikanischen Kontinents sollten verstärkt unterstützt werden, die von ihrem wirtschaftlichen Potential und aufgrund ihrer politischen Verantwortung in der Lage seien, nachhaltige Entwicklungserfolge zu erzielen und regionale Ausstrahlungseffekte zu erzeugen.
Die Wirtschaft dringt darauf, dass Berlin die Zahl der Doppelbesteuerungsabkommen mit Afrika erhöht und bestehende Abkommen aktualisiert. Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) appellierte an Bundeskanzlerin Angela Merkel und Finanzminister Wolfgang Schäuble (beide CDU), sich der Sache anzunehmen. Es gebe in Afrika 54 unterschiedliche Steuersysteme, »die nicht ansatzweise harmonisiert sind«, argumentierte der Verband. Einen gewissen Schutz vor überzogenen Besteuerungen lieferten Doppelbesteuerungsabkommen. Derzeit habe Deutschland aber nur mit zwölf afrikanischen Staaten ein solches Abkommen, mit drei weiteren werde verhandelt. »Das ist zu wenig«, heißt es in seinem Positionspapier.
Wie Karl Seeleitner von der Krones AG im Gespräch mit dieser Zeitung berichtet, ziehen Geschäfte in Afrika besonders oft überhöhte Steuerlasten nach sich. Häufig erhöben Regierungen einfach Steuern auf Zahlungen ins Ausland. Die Sätze bewegten sich zwischen 5 und 20 Prozent vom Umsatz. »Wenn Sie das umrechnen, müssten sie im Extremfall 80 oder 90 Prozent Umsatzrendite haben, um auf eine normale Steuerlast zu kommen«, sagte der Leiter der Steuerabteilung bei dem Hersteller von Getränkeabfüllautomaten. »Das hat der Maschinenbau nicht.« Zugleich sei in Deutschland die Anrechnung der im Ausland gezahlten Steuern »sehr mangelhaft«. Andere Länder seien in diesem Punkt wesentlich großzügiger, beispielsweise die Vereinigten Staaten und Japan.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 6.6.2017
Alle Rechte vorbehalten © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main. Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte für F.A.Z.-Inhalte erwerben Sie auf www.faz-rechte.de
Die zweite kalte Enteignung
Zimbabwe hat das Dollar-Bargeld durch eine Zombie-Währung ersetzt und erlebt eine neue Wirtschaftskrise
Von Thomas Scheen
Knapp zehn Jahre nach der Abschaffung der Landeswährung Zim-Dollar erhebt das Gespenst der Hyperinflation in Zimbabwe abermals sein Haupt. Dieses Mal sind es sogenannte Dollar-Bonds, die das Land in eine Wirtschaftskrise stürzen. Die Bonds sind Ersatzwährung für den amerikanischen Dollar, der seit 2009 faktisch das gängige Zahlungsmittel in dem afrikanischen Land ist. Damals kursierten am Ende der extremen Inflation Zim-Dollar Scheine mit Billionen-Werten (zwölf Nullen am Ende), und ein Laib Brot kostete viele Milliarden Zim-Dollar. Das Bruttosozialprodukt war in der Hyperinflation und Wirtschaftskrise um 70 Prozent gesunken, als die Zentralbank die Notbremse zog und amerikanische Dollar, und südafrikanische Rand zu offiziellen Zahlungsmitteln erklärte. In der Folge wuchs die zimbabwische Wirtschaft wieder. Damit ist es seit Einführung der Bonds aber vorbei.
Schon werden böse Erinnerungen wach: Die zimbabwische Wirtschaft war ins Bodenlose gefallen, nachdem ab 2000 viele weiße Farmer auf Geheiß von Präsident Robert Mugabe entschädigungslos enteignet worden waren. Das früher als »Kornkammer des südlichen Afrikas« bezeichnete Zimbabwe konnte sich anschließend nicht mehr selbst ernähren, und die brutalen Vertreibungen lösten eine nie dagewesene Kapitalflucht aus. Fast 80 Prozent aller Arbeitsplätze im Land gingen verloren, und mehr als drei Millionen Zimbabwer flohen nach Südafrika. Erst die Einführung des amerikanischen Dollars als Zahlungsmittel konnte die wirtschaftliche Talfahrt beenden und für ein bescheidenes Wachstum sorgen. Doch nun wird alles wieder aufs Spiel gesetzt.
Ende 2016 schränkte die Regierung des greisen Präsidenten den Bargeldverkehr drastisch ein und ersetzte die Dollar durch sogenannte Bonds. Das sind buntbedruckte Papiere, von denen niemand glaubt, dass sie wirklich durch die Dollarreserven der Zentralbank abgesichert ist. »Zombie-Währung« nannte die Finanznachrichtenagentur Bloomberg die Scheine. Doch die Zimbabwer haben keine Wahl, sie müssen die Bonds akzeptieren. Der Besitz von 50-Dollar- oder gar 100-Dollar-Noten ist verboten. Das tägliche Limit für Abhebungen vom Bankkonto ist auf 20 Dollar beschränkt. Selbst diese Summe gibt es so gut wie nie. Die Geldautomaten spucken seit Monaten kaum noch Geld aus, deshalb verbringen immer mehr Menschen Nächte vor den Bankfilialen in Harare in der Hoffnung, am frühen Morgen ein bisschen Bargeld zu ergattern. Unternehmern wiederum ist es untersagt, ihre Mitarbeiter in bar zu bezahlen. Stattdessen müssen die Gehälter auf Bankkonten überwiesen werden, wo sie außer Reichweite der Besitzer sind.
Zimbabwe steht das Wasser finanziell bis zum Hals. Zwar vermochte die Regierung im Oktober 2016, ihre Schulden beim Internationalen Währungsfonds (IWF) in Höhe von 110 Millionen Dollar zu tilgen. Doch für neue Kreditzusagen muss Zimbabwe zuerst die Schulden bei der Weltbank (1,15 Milliarden Dollar) und bei der Afrikanischen Entwicklungsbank (601 Millionen Dollar) abtragen. Zuletzt hatte es Ende April geheißen, Zimbabwe habe vom Rohstoffhändler Trafigura einen Kredit von 1,1 Milliarden Dollar erhalten, doch Trafigura dementierte umgehend. In Ermangelung neuer Kredite (selbst China zeigt sich kompromisslos) versucht die Regierung von Mugabe, ihre Schulden mit den Ersparnissen der einfachen Bürger zu begleichen. Nach der Hyperinflation von 2008 ist dies die zweite kalte Enteignung.
Die Folgen des finanzpolitischen Amoklaufs sind verheerend. Die Importe überwiegend aus Südafrika sind drastisch gesunken. Für dieses Jahr erwartet der IWF zwar bislang noch ein kleines reales Wirtschaftswachstum, doch nächstes Jahr eine Rezession. Dafür treibt die Schattenwirtschaft erstaunliche Blüten. Zimbabwer machen große Verrenkungen, um wenigsten etwas Dollar-Bargeld zu bekommen. Zunächst hatten die Supermarktketten auf die Einführung der Bonds dergestalt reagiert, dass sie ihren Kunden jene Dollars in bar auszahlten, die diese zuvor auf die mit der Bankkarte beglichene Rechnung aufgeschlagen hatten. Das ist inzwischen verboten. Seither kann man in den Supermärkten skurrile Szenen beobachten, nämlich Kunden, die anderen Kunden anbieten, ihnen die Einkäufe mit einer Bankkarte zu zahlen. Im Gegenzug zahlt der zweite Kunde dem ersten den Betrag in bar, abzüglich einiger Dollar »Cash-Gebühr«. Das ist inzwischen für viele Zimbabwer die einzige Möglichkeit, an ein bisschen Bargeld zu kommen.
Weil die aus Südafrika stammenden Kaufhausketten keine gesonderten Preise für Kartenzahlung und Barzahlungen ausweisen dürfen, haben sie einfach alle Preise erhöht und dadurch die Inflation befeuert. An den Tankstellen wiederum gibt es derzeit drei unterschiedliche Preise für dasselbe Benzin: einen für Kartenzahlung, einen für Bondzahlungen und einen für Barzahlungen. Großhändler in Zimbabwe bieten bis zu 50 Prozent Rabatt, sofern der Kunde bar bezahlt. Selbst die Bonds sind zum Spekulationsobjekt geworden. Wer Dollarnoten im Wert von 100 Dollar benötigt, um Importware in Südafrika zu kaufen, zahlt dafür zwischen 102 und 105 Dollar in Bonds.
Wie dramatisch die Situation inzwischen ist, zeigte jüngst ein Brandbrief des südafrikanischen Stromkonzerns Eskom. Eskom liefert täglich rund 300 Megawatt nach Zimbabwe. Das Land von Robert Mugabe kann nur so den Strombedarf von etwa 1400 Megawatt decken. Entweder zahle Zimbabwe seine Schulden von knapp 50 Millionen Dollar, oder die Lieferungen würden Ende Mai eingestellt, heißt es in dem Schreiben. Dabei ist Eskom ein staatliches Unternehmen, und die südafrikanische Regierung hat in den vergangenen Jahren stets viel Geduld im Umgang mit den Bankrotteuren im Nachbarland bewiesen. Das Ultimatum von Eskom kann deshalb auch anders gelesen werden: Nicht einmal Pretoria glaubt offenbar noch, dass Zimbabwe auf absehbare Zeit wirtschaftlich die Kurve bekommt.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 23.5.2017
Alle Rechte vorbehalten © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main. Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte für F.A.Z.-Inhalte erwerben Sie auf www.faz-rechte.de
»Es fehlen 16 Millionen Jobs jährlich in Afrika«
Bevölkerungswachstum und Arbeitslosigkeit sind groß / Junge Afrodeutsche fragen, welche Perspektiven es gibt
Von Philip Plickert
Die Herausforderungen in Afrika sind riesig: »Es gibt eine Bevölkerungsverdoppelung bis 2050, und jedes Jahr sind 20 Millionen neue Arbeitsplätze in Afrika nötig – in der Realität werden aber nur 4 Millionen geschaffen«, erklärt Stefan Oswald, Abteilungsleiter für Subsahara-Afrika im Bundesministerium für Entwicklungszusammenarbeit. »Die anderen 16 Millionen laufen ohne Perspektiven herum«, fügt er hinzu. Oswald ist einer der Hauptautoren des »Marshallplans« für und mit Afrika, den die deutsche Regierung in ihrer G-20-Präsidentschaft voranbringen will.
Wichtigstes Ziel sei es, Perspektiven für den afrikanischen Kontinent zu schaffen. Dabei hat die Bundesregierung auch den Migrationsdruck aus Afrika im Blick. »Aber die Migrationsproblematik steht nicht im Fokus«, sagt Oswald. Es gehe um eine bessere Zukunft für Afrika. Aus drei Säulen besteht der Plan: Wirtschaft, Handel und Beschäftigung in Afrika sollen gefördert werden, Frieden und Sicherheit sowie Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Es soll Reformpartnerschaften mit Ländern geben, die sich hervortun, etwa mit Ghana, der Elfenbeinküste und Tunesien. Und konkret stellt die Bundesregierung mehr Zuschüsse für Infrastrukturprojekte für Investoren in Aussicht. Das Paradox sei doch, dass mehr Geld Afrika verlasse, als nach Afrika fließe, sagt Oswald. Die deutsche Regierung hofft, mit mehr finanziellen Absicherungsinstrumenten private Investoren zu motivieren.
Ob der »Marshallplan« wirklich eine bessere Zukunft in Afrika befördern könne, war Gegenstand einer Expertendiskussion, die das Afro Deutsche Akademiker Netzwerk (ADAN) vor kurzem in Frankfurt organisierte. Gegründet hat ADAN eine Gruppe junger Leute, deren Eltern aus Afrika nach Deutschland eingewandert sind; in ihrem Beirat sitzen der deutsch-äthiopische Unternehmensberater und Buchautor Prinz Asfa-Wossen Asserate und andere Afrika-Kenner. Die etwa 60 ADAN-Mitglieder sind Studenten und Absolventen, arbeiten für Kanzleien oder Banken in deutschen Städten, fühlen sich aber dem Herkunftskontinent ihrer Eltern verbunden. Sie wollen Verbindungen schaffen zwischen der afrikanischen Diaspora, Deutschland und Afrika.
Hoch über den Dächern der Bankenmetropole diskutierten nun die jungen Afrodeutschen mit Entwicklungshilfeexperten und Wirtschaftsvertretern über die Zukunftsperspektiven. Schlagworte wie Korruption, Potentaten und Brain Drain, aber auch Aufbruch und Hoffnung fielen, am Ende war die Stimmung gemischt. Vom Engagement der deutschen Wirtschaft in Afrika sind sie enttäuscht. »Nur sehr wenige deutsche Unternehmen sind in Afrika aktiv«, beklagt ADAN-Vorsitzende Alhaji Allie Bangura. 800 sind es laut Statistik der Bundesbank. Ihre Direktinvestitionen betragen laut Statistik nur 9 Milliarden Euro, davon das meiste in Südafrika. Afrika-Investitionen sind weniger als ein Prozent der insgesamt eine Billion Euro deutscher Direktinvestitionen in der Welt.