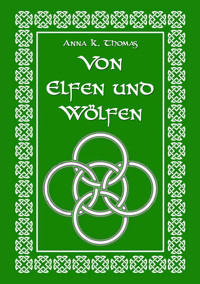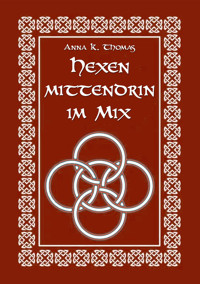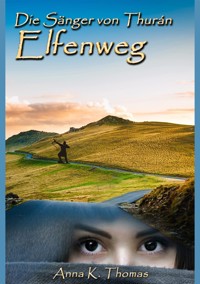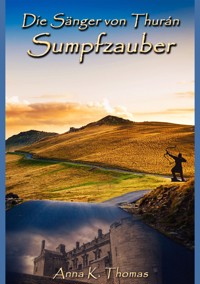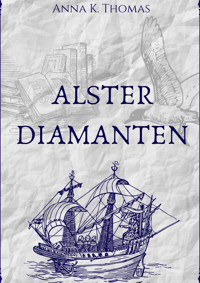
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Hamburg, 1838 – Sophie Achtmann ist die jüngste, etwas reizlose Tochter einer aufstrebenden Kaufmannsfamilie. Sie kennt die Rolle, die ihre Familie ihr zugedacht hat: Sie muss vorteilhaft heiraten und damit den Credit der Achtmanns mehren, ihrer älteren und schöneren Cousine gleich. Aber Sophie fürchtet, niemals einen Mann zu finden, den ihr Großvater akzeptieren wird. Und sie ist nicht die Einzige, die an der ihr zugedachten Aufgabe verzweifelt: Auch ihre Brüder hadern mit dem Schicksal, jeder auf seine Weise. Doch dann taucht ein junger, französischer Abt in Hamburg auf, der für jeden von ihnen immer die richtigen Antworten hat, der stets zur Stelle zu sein scheint, wenn es nottut. Sophie und ihre Brüder freunden sich mit Leander an – nicht ahnend, welche Gründe er wirklich für sein Handeln hat, nicht ahnend, dass sie nur Mittel zum Zweck sind und sein eigentliches Ziel ein ganz anderes Mitglied der Achtmanns …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 472
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
© 2022 Anderland Books
12105 Berlin
https://anderlandbooks.com/
ISBN 978-3-96977-111-2
Alle Rechte vorbehalten
Tag der Veröffentlichung 15.10.2022
Titelbild: Anderland Books
Stammbaum der Familie Achtmann
Prolog
Kapitel 1: Verlobung im Hause Achtmann
Kapitel 2: Die Comtesse und ihr Beichtvater
Kapitel 3: Der andere Bruder
Kapitel 4: Das Haus an der Elbchaussee
Kapitel 5: Konstanzes Hochzeit
Kapitel 6: Von Kleidern und Credit
Kapitel 7: Lehrstunden einer jungen Dame
Kapitel 8: Unruhe
Kapitel 9: Neue Aussichten
Kapitel 10: Abgründe
Kapitel 11: Die Dienste eines Beichtvaters
Kapitel 12: Innehalten
Kapitel 13: Sommer an der Elbe
Kapitel 14: Vergangene Schatten
Kapitel 15: Affären
Kapitel 16: Des Glückes eigener Schmied
Kapitel 17: Rebellion
Kapitel 18: Trügerische Ruhe
Kapitel 19: Kriminelle Wege
Kapitel 20: Gängeviertel
Kapitel 21: Die Geister, die ich rief …
Kapitel 22: Drama
Kapitel 23: Ist so kalt der Winter
Kapitel 24: Schiffbruch
Kapitel 25: Scherben, Scherben überall
Kapitel 26: Das Ende einer Ära
Kapitel 27: Himmel …
Kapitel 28: … und Hölle
Kapitel 29: Der verlorene Sohn
Kapitel 30: Vor dem Sturm
Kapitel 31: Inferno
Kapitel 32: Auf der Dolenburg
Kapitel 33: Aufräumarbeiten
Kapitel 34: Finis
Nachwort
Personen
Erfundene Personen
Historische Personen
Quellen
Stammbaum der Familie Achtmann
Prolog
Er hatte nie von sich behauptet, ein guter Mensch zu sein.
Bei all den abscheulichen, verdammungswürdigen Dingen, die er in seinem Leben vollbracht hatte, dies hatte er nie getan. Er hatte sich nie einen Heiligenschein aufgesetzt, nie vorgegeben, edel oder selbstlos zu sein, nie salbungsvoll oder moralisch gepredigt. Er wusste, er hatte viele Sünden auf sich geladen. Aber diese eine nicht.
Diese eine nicht.
Der Wind zerrte an seinen Kleidern, und dennoch stand er stumm da und starrte über die Dächer, starrte über das, was geschehen war, was er verursacht hatte, was er plante.
Lichter funkelten in der Stadt, kleine und große, Juwelen gleich, wie Alsterdiamanten von Reichtum kündend. Die Diskrepanz zur bitteren Armut in derselben Stadt stieß ihn immer noch ab. Aber er war sich inzwischen nicht mehr sicher, ob es überhaupt Gut und Böse gab, oder ob nicht am Ende alles nur am Maß der Selbstgerechtigkeit gemessen wurde. Und er wusste, wenn man über ihn urteilte, würde dieses Urteil vernichtend ausfallen.
Es war ihm gleich.
Nichts war wichtig, außer dem Ziel.
Kapitel 1: Verlobung im Hause Achtmann
Sophie Achtmann holte tief Luft, trat vor den Spiegel und hoffte auf ein Wunder.
Nein, sie hatte sich nicht über Nacht in eine adäquate, wunderschöne Tochter des Hauses verwandelt. Ihr Teint war zu dunkel, ihre Haare mattbraun, ihre Augen stumpfgrau, und ihre Figur viel zu mager. Außerdem war sie immer noch viel zu klein, ganz anders als die anderen Mitglieder ihrer Familie.
Es war wie immer. Auch heute war es wie immer. Im Frühling achtzehnhundertachtunddreißig sah sie genauso fade und unscheinbar aus wie letzten Winter oder im Vorjahr. Wunder gab es eben nicht.
Sie schalt sich, dass dies ganz richtig so war. Selbst, wenn es Wunder geben würde – nicht heute, nicht für sie. Heute sollte gar nicht sie im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen, heute war Konstanzes Tag, Konstanzes Verlobung.
Dumm war nur, dass es meistens Konstanzes Tag zu sein schien, dass meistens Konstanze im Mittelpunkt zu stehen schien, ihre Cousine mit dem goldfarbenen Haar, mit eisblauen Augen und dem rosigen Teint, eine perfekte Achtmanntochter.
Da konnte man schon irgendwann mal anfangen zu grollen.
Nein, rief Sophie sich energisch zur Ordnung, nicht heute. Heute war das Ende von etwas, und der Beginn von etwas Neuem. Konstanze war die Ältere, und von daher war es fair, dass sie als Erste verlobt wurde, dass sie öfter im Mittelpunkt stand. Und was tat es! Schon bald würde sie verheiratet sein, und Platz machen für ihre kleine Cousine, Sophie …
… die mausbraune, mausgraue spindeldürre Sophie, die niemals den Platz als Achtmanns strahlende Tochter des Hauses einnehmen konnte, wenn nicht wirklich bald ein Wunder geschehen würde. Sophie zupfte vergebens am Taillenstoff. Es war zum Verzweifeln.
Die Tür öffnete sich, und ihre Mutter trat herein. Wie immer glitt ihr Blick über ihre Tochter, schien kurz verwundert innezuhalten, dass sie, rank, schlank und hochgewachsen, ein solches Missgeschick zur Welt gebracht haben konnte, und wie immer wich dieser kurze Moment der gnädigen Gleichgültigkeit, mit der Sophies Mutter sie schon seit Jahren bedachte.
„Du bist jetzt siebzehn“, sagte sie, „und heute ist ein wichtiger Tag für die Familie. Deshalb finden wir, dass du dies tragen sollst.“
Dies entpuppte sich als eine äußerst feine, mehrfach geschlungene Perlenkette, welche Sophies Mutter ohne weiteres Vertun ihrer Tochter um den Hals wand und die Schließe eigenhändig schloss. Sophie unterdrückte eine Grimasse. Sie wusste, was dies bedeutete. Heute kamen Freunde und Verwandte, um Konstanze zu feiern und zu schauen, was es sonst so bei Achtmanns zu holen gab. Und wenn Sophie, die Jüngere, eben nicht mit strahlender Schönheit aufweisen konnte, dann sollte zumindest an die dicke Mitgift erinnert werden, die ihrer harrte.
Man konnte einfach etwas Zucker auf den Brocken streuen und das Beste hoffen.
Sie wusste nicht, ob es Vaters oder Mutters Idee gewesen war, oder am Ende gar die ihres Großvaters, aber das war auch nicht wichtig. Wichtig war, dass allen bewusst war, es bedurfte des Zuckers, um Sophie an den Mann zu bringen, und bei „allen“ schloss Sophie sich selbst mit ein.
Es gab eben keine Wunder. Auch heute nicht.
„Wir sollten hinunter gehen“, setzte die Mutter hinzu. „Die Gäste werden bald kommen, und wir müssen sie begrüßen. Wir sind die Achtmanns, wir sind nicht irgendwer. Ich hoffe, du bist dir dessen bewusst.“
Sophie verbiss sich ein Seufzen, während sie ihrer Mutter folgte. Sie war sich dessen bewusst, wirklich. Sie wusste, dass die Achtmanns seit Jahrhunderten in Hamburg ansässig waren, obwohl erst ihr Großvater die Familie durch ein paar günstige Ehen und Geschäfte zu dem heutigen Reichtum gebracht hatte. Heute war die Krönung des nächsten Coups: Mit der Ehe zwischen Konstanze und Hendrick Anckelmann würde die Familie endgültig familiäre Verbindungen in die Oberschicht der Stadt erwerben.
Sie war sich sicher, dass Friedrich Achtmann noch weitaus mehr plante, denn obwohl er die Siebzig dieses Jahr überschritten hatte, schien er nicht im mindesten müde. Wenn Sophie eher wie Konstanze wäre, mehr hermachen würde, wer wusste, wo sie sich wiederfinden würde?
Allerdings, dachte sie, als sie die Diele erreichten, beneidete sie Konstanze nur bedingt um ihren Verlobten. Hendrick Anckelmann mochte alter hanseatischer Kaufmannsadel sein, und zudem auch nicht hässlich, aber er war sterbenslangweilig und nicht mehr der Jüngste.
Und er war der einzige Sohn seiner Eltern. Es wurde höchste Zeit, dass er für Nachwuchs sorgte, denn die Anckelmanns in Hamburg wurden weniger und weniger. Es gab außer Hendrick und seinen Eltern nur noch einen Cousin, und das, obwohl sie zu den großen, alten Geschlechtern zählten. Erstaunlich, dachte Sophie, dass Hendrick nicht längst verheiratet war, und dass man ihn eine Tochter aus einem derart neuen Haus ehelichen ließ, denn obwohl Konstanze sehr schön war, war sie weder unbändig reich noch gut vernetzt.
Aber Hendrick hatte sich verliebt, und das war gut daran sichtbar, wie das Paar gerade vor Friedrich Achtmann stand, Hausherr und Patriarch, flankiert von seinem ältesten Sohn Frido auf der einen Seite – Sophies Vater – und Konstanzes Mutter Josephine auf der anderen. Konstanzes Vater war, wie meistens, in Geschäften in Übersee. Sophie fragte sich, wann sie Onkel Ben das letzte Mal gesehen hatte, und konnte sich nicht erinnern.
„Man hofft, dass Benedikt zumindest zu ihrer Hochzeit zurückkommt“, murmelte Sophies Mutter zu niemandem im speziellen. Sie tat das öfter, wisperte irgendwelche Sätze, die sie an keinen Menschen adressierte. Früher hatte Sophie manchmal gedacht, sie wäre gemeint, und hatte geantwortet, aber mittlerweile war sie schlauer. Sie hatte zu oft den verwunderten Blick ihrer Mutter ertragen, über sie hinweggleitend, als ob Dorothea Achtmann sich erst einmal erinnern musste, dass sie neben zwei strammen Söhnen auch noch dieses Wesen geboren hatte.
Zahlreich waren sie, die Achtmanns, wenn auch nicht so zahlreich wie sich der Großvater das wünschte, und wie es das große Haus sicherlich zugelassen hätte. Die Mutter hatte zu viele Fehlgeburten erlitten, und Tante Josephine – nun ja, man konnte Tante Josephine keine Vorwürfe machen, lediglich ein lebendes Kind zu haben, wenn ihr Mann ständig fort war und sie nicht mitnahm.
Die Hoffnungen für Kinderreichtum erstreckten sich nun auf die nächste Generation.
„Meine Eltern müssten jeden Moment kommen“, sagte Hendrick gerade. „Sie bringen unseren Hausgast mit. Die Comtesse sucht nach eigener Logis, ist aber noch nicht fündig geworden. Ah, da sind sie ja!“
In der Tat, Anckelmanns traten soeben durch das Tor in die festlich geschmückte Diele, beide schon ergraut und nicht mehr sehr rüstig. Sophie war ihnen ein paar Mal im Rahmen von Konstanzes Brautwerbung begegnet. Sie schätzte sie so ein wie ihren Sohn – nicht unfreundlich, aber auch nicht übermäßig interessant. All ihre Gespräche schienen sich um Bäume und Blumen zu drehen – sie besaßen ein Haus auf dem Lande, etwas, was Sophies Großvater nicht hatte.
Weitaus interessanter als die Eltern des Bräutigams war jedoch besagter Hausgast, direkt dahinter.
„Comtesse de Chambourg“, wurde sie vorgestellt, und Sophie sah die Augen ihres Großvaters blitzen.
Die Comtesse war deutlich jünger, eher im Alter von Sophies Mutter und Tante, und sie war bildschön. Aparte rote Haare waren zu einer eleganten Frisur aufgetürmt, die Haut wie Milch, und ihre Augen glitzerten grün mit irgendeinem privaten Witz, den Sophie nicht verstand. Obwohl schwarz – sie musste verwitwet sein – entsprach ihre Kleidung der allerletzten Mode mit eng geschnürter Taille und weitem Rock.
Sophie wollte spontan so sein wie sie.
Sie schalt sich dessen, knickste als sie vorgestellt wurde, beobachtete, wie ihre Brüder sich nacheinander über die Hand der Dame beugten, Freddy bewundernd und Conrad eher abschätzend. Konstanzes Gesicht verzog sich kurz, da nun Konkurrenz um den Rang der Schönsten ins Haus gekommen war, glättete sich aber gleich darauf, denn obwohl das Äußere der französischen Comtesse aufregend war, war Konstanze doch mindestens fünfzehn Jahre jünger. Ihre Pfirsichhaut konnte mit der Comtesse problemlos mithalten.
„Sind wir einander schon einmal begegnet?“ fragte Sophies Vater, seine scharfen Augen auf das rote Haar gerichtet.
Die Comtesse lächelte.
„Ich bin in Hamburg aufgewachsen“, sagte sie. „Als junges Mädchen bin ich nach Frankreich gegangen, was länger her ist, als ich zugeben möchte. Darf ich vorstellen: Mein Beichtvater, der Abbé de Guisé.“
Hinter der Comtesse, fast verdeckt von ihrer imposanten Gestalt, war in der Tat noch jemand, ein Mann im schwarzen Kleid eines Mönches. Als er sich kurz verbeugte, konnte Sophie die Tonsur in seinen dunklen Locken erkennen. Er war erstaunlich jung für die Position eines Beichtvaters, ganz zu schweigen von der eines Abbés.
Begrüßungen wurden gemurmelt. Das protestantische Hamburg stand Katholiken nicht mehr so abweisend gegenüber wie früher, und schon gar nicht würde eine Familie wie die Achtmanns sie anfeinden, denen Profit durchaus über Religion ging. Dennoch schien man erleichtert, als die ersten Gäste eintrafen, Konstanze und Hendrick vortraten und die Comtesse mit ihrem Beichtvater zur Seite wich.
„Beichtvater“, murmelte Tante Josephine. „Wenn der Jungspund ihr Beichtvater ist, fresse ich einen Besen.“
„Es ist doch durchaus möglich“, sagte Freddy. „Sie wird es sich leisten können. Und sie ist eine Katholikin in einer lutherischen Stadt.“
„Er ist niemals ihr Beichtvater“, höhnte Conrad, der Freddy wie erwartet sofort widersprach. „Wenn er ihr Beichtvater wäre, wäre er nicht so jung und hübsch.“
„Man würde denken, ein Abbé wäre bei seiner Abtei“, murmelte die Mutter.
„Nicht unbedingt“, behauptete Freddy. „Haben Äbte nicht auch Vertretungen, wenn sie reisen?“
„Ich habe nie von einer Abtei de Guisé gehört“, schnaufte Conrad.
„Du hast überhaupt noch nie von einer Abtei gehört“, grummelte Freddy.
Die Mutter, die zu bemerken begann, dass der brüderliche Streit Aufmerksamkeit zu erregen schien, schritt ein. „Keiner von uns kennt alle Abteien Frankreichs – wie sollte es auch anders sein.“
„Und dies ist Konstanzes Tag, den ihr nicht ruinieren werdet“, setzte Tante Josephine schrill hinzu. „Freddy, geh und kümmere dich um Madame la Comtesse!“
Freddy sah einen Moment lang so aus, als ob er aufbegehren wollte.
„Nimm Sophie mit“, setzte Tante Josephine hinzu. „Sie steht hier ohnehin nur rum.“
Das tat weh, obwohl es stimmte. Und Freddy, der Sophie einen raschen Blick zuwarf, sah dies bestimmt, denn er bot ihr sofort den Arm.
„Komm, Schwesterchen“, sagte er. „Halten wir unseren adligen Gast bei Laune.“
Sein zweiter Blick traf Conrad, voller Herausforderung. Sophie ergriff hastig den Arm und zog ihn mit sich, bevor der Streit erneut aufflammen konnte.
„Du hast sicherlich Recht“, beschwichtigte sie ihn halblaut auf dem Weg hinüber. „Warum sollte sie uns anlügen?“
Diesmal war sein Blick herablassend, als ob er Dinge wüsste, die sie nicht einmal im Ansatz begriff.
„Es ist nicht wichtig“, murmelte er. „Sie sind unsere Gäste, und wir werden unsere Pflicht tun. Madame la Comtesse! Sie haben noch kein Getränk!“ Er winkte den Diener herbei.
„Danke“, sagte die Comtesse. „Ich bin gerade nicht durstig.“
„Ist dies das erste Mal seit Ihrer Hochzeit, dass Sie wieder in Hamburg sind?“ bemühte sich Freddy um Konversation.
„Fast“, sagte Madame. „Zugegeben, in den Jahren nach meiner Eheschließung schien es wenig ratsam, mit einem französischen Namen und Titel hier zu erscheinen, aber die Wogen haben sich geglättet. Ich bin verwitwet und ein wenig nostalgisch geworden. Hamburg hat mir gefehlt.“
„Hamburg würde einem immer fehlen“, sagte Freddy, obwohl Sophie sicher war, dass er nicht so empfand, nicht er, ganz egal, was Großvater und Vater dachten.
Onkel Ben empfand garantiert nicht so, wenn er nicht einmal zur Verlobung seiner Tochter anreiste. Sophie hatte so ihre Zweifel, ob er es zur Hochzeit im Herbst schaffen würde.
„Sicherlich“, lachte die Madame und wandte sich halb um, so dass Sophie sich dem Beichtvater gegenübersah.
Er war viel zu jung, dachte sie, und dann traf sie plötzlich ein Blick aus grauen Augen, so scharf und seltsam, dass sie ihre Meinung spontan revidierte.
„Monsieur l’Abbé“, sagte sie mit trockenem Mund. „Es ist eine Ehre für uns.“
Sein Gesicht verzog sich für einen Moment spöttisch, als ob er dies bezweifelte, doch dann glättete es sich zu einer höflichen Maske.
„Es ist eine Ehre für mich“, sagte er.
Seine Stimme war tiefer und rauer, als Sophie es erwartet hatte. Sie suchte fieberhaft nach einem Thema, über das sie mit einem katholischen Geistlichen sprechen konnte. Sehr viel mehr als das Wetter fiel ihr nicht ein – außer …
„Ist die Abtei de Guisé sehr groß?“
„Verzeihung?“
„Oh – ich wollte nicht … ich dachte nur, wenn ein Abbé reisen kann, dann braucht er eine Vertretung, oder?“ Sie errötete und sprach hastig weiter. „Deshalb dachte ich, Ihre Abtei müsste groß sein … Aber ich gestehe, ich habe überhaupt keine Ahnung von Abteien.“
Einen Moment lang schwieg er, und sie befürchtete, irgendeinen Fauxpas begangen zu haben, der in einem Skandal enden würde und damit, dass sie Konstanzes großen Tag ruinierte. Dann jedoch glitt so etwas ähnliches wie ein Lächeln über sein Gesicht.
„Das Gegenteil ist der Fall, Mademoiselle“, sagte er. „Die Abtei ist so klein, dass sie außerhalb von mir nicht existiert. Dies ist ein Ehrentitel, mehr nicht. Ohne Madame la Comtesse würde ich verhungern.“
Sophie war verdutzt. Ein Abt ohne Abtei? Das ging? Aber nun denn, sie wusste wirklich so gut wie gar nichts über den katholischen Glauben. Also erwiderte sie sein Lächeln.
„Dann ist es gut, dass Madame einen Beichtvater benötigt“, sagte sie. „Zumal hier. Ich bin nicht sicher, ob so etwas in Hamburg existiert.“
Jetzt lächelte er richtig.
„Es gibt Priester in der Stadt“, sagte er, „aber Madame vertraut nur mir. Und ich komme in den Genuss zu reisen. In der Tat, ich kann mich über mein Schicksal nicht beklagen.“
„Sie müssen mich für sehr dumm halten“, seufzte sie. „Ich fürchte, die Feinheiten Ihres Glauben gehörten nicht zu meinem Unterricht.“
„Was auch niemand von einer hamburgischen Kaufmannstochter erwarten würde.“
„Sehr freundlich.“ Sie zog es vor, von ihrer Bildungslücke abzulenken und suchte nach irgendeinem anderen Thema. „Gefällt Ihnen Hamburg? Sie sprechen, wenn ich das sagen darf, erstaunlich gut deutsch.“ Und so akzentfrei, dachte sie. Selbst die Madame hatte einen stärkeren Akzent, und sie war hier geboren.
„Meine Wurzeln sind deutsch“, sagte er. „Aber ich möchte Sie nicht mit meiner verworrenen Geschichte langweilen. Ich kenne noch nicht viel von der Stadt. Mir wurde gesagt, dass Hamburg einzigartig sei.“
„Das ist es sicherlich. Jede Stadt ist einzigartig, auf ihre Art und Weise.“
„Sind Sie schon viel gereist, Mademoiselle?“
„Ich? Nein.“ Sophie war verwirrt. „Ich bin noch nie über diese Mauern hinausgekommen. Anders als meine Brüder – beide.“
„Und Ihr Onkel, richtig? Mademoiselle Konstanzes Vater ist nicht anwesend.“
„Mein Onkel ist für die Geschäfte in Übersee verantwortlich“, sagte sie. „Er ist momentan in Baltimore. Ja, er ist sicherlich am weitesten gereist von uns allen.“
„Man muss das Geschäft sehr wertschätzen, wenn man nicht einmal zur Verlobung der Tochter kommt“, meinte er. „Aber natürlich verstehe ich nichts von Geschäften.“
„Onkel Ben ist sehr pflichtbewusst“, sagte sie lahm.
Ein Blick traf sie, und sie ahnte, was er dachte, was keiner von ihnen aussprach: Ein pflichtbewusster Vater würde seine Tochter selbst weggeben und dies nicht seinem Bruder oder Vater überlassen. Ein pflichtbewusster Vater hätte seine Familie mitgenommen, wenn er auf Jahre die Stadt verließ.
Wann war Onkel Ben das letzte Mal daheim gewesen?
„Sophie! Da bist du ja!“
Sie spürte, wie ihr Gesicht einfror. Mit ungeheurer Anstrengung zwang sie ein höfliches Lächeln auf ihr Gesicht, wohl bewusst, dass dies unter den forschenden Augen des jungen Abbés geschah. Hanna Jessen stürzte auf sie zu, ein breites Grinsen auf dem Gesicht. Insgeheim hatte Sophie gehofft, dass man die Jessens nicht eingeladen hatte – ihr war sehr wohl bewusst, dass die Ambitionen ihrer Familie höher gingen, in Richtung Anckelmanns und Schröders, in Richtung Merck oder Amsinck, und vielleicht, vielleicht akzeptierte man auch noch die Sievekings und die Godeffroys, die Neureichen. Aber nicht die Jessens. Sie hatten sehr unter der Franzosenzeit gelitten – gut, das hatten die meisten – doch sie hatten sich nicht wieder erholt, und ein Friedrich Achtmann umgab sich grundsätzlich nur mit Menschen, die ihm nutzen konnten.
Mit Hanna Jessen hatte sie sich ein Zimmer im Pensionat geteilt, und seitdem suchte Hanna sie auf, wann immer sie konnte. Sophie war sich sicher, dass Hanna im Auftrag ihrer Familie versuchte, sich einen von Sophies Brüdern zu angeln, um die Familie wieder auf den aufsteigenden Ast zu bringen. Schon manches Mal war Sophie versucht gewesen, ihr zu sagen, dass dies sinnlos war. Niemals würde der Großvater seinen Enkeln gestatten, eine Hanna Jessen zu heiraten.
Hanna war … anstrengend.
„Wie hübsch Konstanze aussieht!“, begeisterte sie sich gerade. „Aber ach! Sie sieht immer so hübsch aus!“
Ein abwertender Blick traf Sophie, die diesen durchaus spürte. Sie war sich absolut sicher, dass Hanna, wäre Sophie nicht mit zwei Brüdern im heiratsfähigen Alter gesegnet, keinen Blick an sie verschwenden würde.
„Konstanze ist wunderschön“, sagte sie, und das meinte sie auch so. Dass ein Hauch Resignation in ihrer Stimme mitschwang, schien Hanna zu entgehen, jedoch anscheinend nicht dem kleinen Abbé, der ihr einen Blick zuwarf.
Sie errötete.
„Hanna, darf ich dir den Abbé de Guisé vorstellen, den Beichtvater von Madame la Comtesse?“, sagte sie, hauptsächlich, um das Mädchen abzulenken.
Normalerweise würde Hanna einem katholischen Geistlichen nicht einen Blick schenken, aber die Kombination aus hübschem Gesicht, jungem Alter und adliger Herrin verfehlte den Zweck nicht. Hanna hatte früher immer davon gesprochen, einmal in den Adel einzuheiraten, was nach Sophies Dafürhalten nur ein weiteres Zeichen war, dass die besten Tage der Familie Jessen vorbei waren. Eine echte Hamburgerin würde niemals einen Adligen akzeptieren, und schon gar nicht eine aus der Oberschicht.
So waren Comtesse und Abbé auch die einzigen Nicht-Bürger in der sich allmählich füllenden Diele. Hanna stürzte sich begeistert auf den Neuling. Sophie überließ sie dem Abbé und tat stattdessen das, was sie am besten konnte – in den Hintergrund zu rücken.
Es war nämlich durchaus interessant, was man so hörte, wenn einen niemand wahrnahm.
„Sie müssen raus aus diesem Haus und zu uns hinaus ans Elbufer ziehen“, sagte Johan Cesar Godeffroy zum Großvater. „Dies ist doch auf Dauer viel zu eng für Ihre Familie.“
Er war mit zweien seiner Söhne erschienen, ein ungeheurer Triumph für den alten Achtmann. Godeffroys Augen sagten, was seine Stimme verschwieg – konnten sich die Achtmanns ein Haus am Elbufer leisten? Die Neureichen hatten alle dort gebaut. Die Landhäuser der alteingesessenen Kaufleute hatten ursprünglich vor den Toren im Osten der Stadt oder in den Walddörfern im Norden gelegen, ein enger Kreis, der sehr auf den richtigen Namen achtete. Und die Godeffroys und Sievekings mochten reich sein, aber sie waren immer noch neu, und im Falle der Godeffroys sogar keine Lutheraner, sondern Calvinisten.
Sophie hörte nicht, was der Großvater antwortete, denn von der anderen Seite erklang Gelächter. Hanna hatte es tatsächlich geschafft und sowohl Freddy als auch Conrad in die kleine Gruppe gezogen, die sich um den Abbé gebildet hatte. Der Abbé lächelte, während ihre Brüder sich wieder einmal überboten. Conrads Augen funkelten gefährlich, und um Freddys Mund lag ein angestrengter Zug.
Sie sollte eigentlich dazwischen gehen und Frieden stiften. Die Tante würde es von ihr erwarten, die Mutter vermutlich auch. Sophie hatte keine Ahnung, wie Conrad es geschafft hatte, sich von den beiden loszueisen. Oh – doch – sie sah es: Die Comtesse hatte Tante Josephine in Beschlag genommen, und die Mutter organisierte die Bewirtung.
Getränke und Häppchen wurden gereicht, diskrete Diener bugsierten Tabletts durch die Gesellschaft. Das war ungewöhnlich, aber clever vom Großvater. Ob die Herren der Stadt sich auf ein längeres Engagement eingelassen hätten, war fraglich – aber einmal vorbei schauen bei Achtmanns, das Gesicht zeigen und gratulieren, das konnte man sich leisten. Natürlich waren keine der Töchter oder Gattinnen aus den Landhäusern mitgekommen – nein, alle vertretenen Frauen bewohnten nach altem Stil ganzjährig ein Kontorhaus, so wie Sophies eigene Familie.
Es war durchaus kein kleines Haus, mit Speichern und Wohnräumen, mit Gesindetrakt und Küche im Souterrain. Aber es lag eben in der Stadt, und deshalb gab es weder ausufernde Gärten noch elegant gestaltete Parks. Sophie hatte keines der neuen Häuser am Elbufer je gesehen, nur viel gehört, und es ließ sie träumen.
Sie fragte sich inzwischen, ob die Perlenkette an ihrem Hals nicht die pure Verschwendung war. Es gab ohnehin keinen Kandidaten, der ernsthaft an ihr interessiert wäre. Godeffroy hatte zwar vier Söhne, aber Cesar hatte vor kurzem geheiratet und sein kleiner Bruder Alfred war zu jung. Adolph, der im Alter vielleicht gepasst hätte, war letztes Jahr nach Kuba gegangen. Der vierte Bruder Gustav war offensichtlich nicht gekommen. Auch von den Mercks und Sievekings sah sie keinem in ihrem Alter, oder den Schröders und Amsincks. Sie biss sich auf die Lippen. Offenbar war man ihrer nicht bewusst oder nicht an ihr interessiert – und dies erstaunte sie zwar nicht, ließ sie dennoch ob ihrer Zukunft verzagen.
„Sie sehen unglücklich aus, Mademoiselle“, erklang die Stimme des Abbés an ihrem Ohr.
Sophie drehte sich erschrocken um. Die kleine Runde hatte sich überraschend aufgelöst. Hanna hatte sich durchgesetzt, denn sie trat am Arm von Freddy in den Hof. Conrad war von anderen Gästen ins Gespräch gezogen, was ihn vorerst ruhigstellen würde. Zumindest hier stand ein Streit nicht mehr unmittelbar bevor.
„Unglücklich? Wirklich?“, sagte sie schwach.
Wie ungünstig, dass es jemandem aufgefallen war, denn heute war doch ein Tag der Freude. Sie zwang ein Lächeln auf ihr Gesicht und sah den Abbé an.
Die grauen Augen waren unleserlich, aber nicht boshaft.
„Vielleicht sollte ich lieber sagen, einsam“, sagte er.
„Einsam? Es sind dutzende Menschen hier!“
„Meiner Erfahrung nach kann man genauso gut einsam in der Masse sein“, meinte er. „Aber wenn mich mein Eindruck täuscht, könnten Sie stattdessen Mitleid mit mir haben.“
„Weshalb?“ Sie war versucht zu lachen. „Sind Sie denn einsam?“
„Eher verloren“, gestand er. „All diese Grüppchen, diese Gespräche … die einen sticheln gegen die anderen, und alles unter dem Mantel des ehrbaren Kaufmanns – erklären Sie es mir?“
Sie runzelte die Stirn.
„Ich dachte, Ihre Wurzeln sind deutsch?“
Ein Schatten zog über sein Gesicht.
„Das stimmt“, sagte er. „Aber mein Heim war … lassen Sie es mich so ausdrücken: Dies ist das erste Mal, dass ich eine feine Diele von innen sehe. Für mich war Kaufmann immer gleich Kaufmann.“
Sie ahnte plötzlich, dass sich eine Geschichte voll Schmerz hinter diesen Worten verbarg, aber sie hakte natürlich nicht nach. Stattdessen holte sie tief Luft und nickte.
„Das ist natürlich nicht so“, sagte sie. „Ich bin mir nicht sicher, inwieweit Sie verstehen, wer in Hamburg Bürger werden kann …“
„Jeder, der über ein schuldenfreies Grundstück innerhalb der Stadtmauern und ein bestimmtes Einkommen verfügt, kann Bürger werden“, unterbrach er sie. „Vorausgesetzt, er ist nicht von Adel.“
„Er muss zudem der richtigen Religion angehören. Ein Jude hat keine Chance.“
„Und ein Katholik?“
„Das weiß ich nicht.“ Gab es überhaupt katholische Kaufmänner in Hamburg? Sophie war mit keinem bekannt.
„Es ist auch nicht wichtig, denn ich bin arm wie eine Kirchenmaus“, sagte der Abbé. „Und noch weniger wichtig für mein Verständnis hier.“
„Ja“, sie versuchte, sich auf das zu besinnen, was sie gelernt hatte. „Es gibt das normale Bürgerrecht und das Großbürgerrecht. Letzteres kostet mehr, aber ist notwendig, wenn man Handel nach Übersee betreiben will.“
„Hier sind also die Großbürger vertreten“, nickte er.
Sie war verblüfft, dass er das so schnell verstanden hatte. Alle großen Familien betrieben Handel mit Übersee, oder finanzierten diesen Handel zumindest, wie die Donners.
„Nicht nur, aber hauptsächlich“, sagte sie.
Die grauen Augen musterten sie, als sie nicht weitersprach.
„Ich überhörte eben, es sei ein Geniestreich gewesen, für Fräulein Konstanze einen Anckelmann zu angeln,“ setzte er halblaut hinzu. „Verzeihen Sie mir, dass ich das wortgetreu wiedergebe. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum ein Godeffroy so auftrumpft, und warum ein Gossler die Nase rümpft.“
„Ah“, sagte sie. „Ja. Es ist eigentlich nicht schwer. Die einen sind seit Jahrhunderten in Hamburg ansässig, lutherische Kaufleute, die schon in der mehrfachen Generation Handel betreiben. Die Mercks, die Amsincks, die Schröders. Die Gosslers und Abendroths, die Jenischs. Andere, wie die Godeffroys, sind noch keine hundert Jahre in der Stadt, und zudem keine Lutheraner. Da können sie noch so reich sein, sie werden weder in den Senat gewählt noch Bürgermeister.“
„Klassen innerhalb der höchsten Klasse?“
„Ist das so überraschend?“
„Nein, natürlich nicht“, murmelte er. „Und die Anckelmanns?“
„Sind seit dem sechzehnten Jahrhundert in der Stadt. Alteingesessener geht es kaum.“
„Die Achtmanns sind nicht alteingesessen?“
Sophie sah sich hastig um, obwohl seine Worte leise gewesen waren. Nein, weder einer ihrer Brüder noch Konstanze waren in der Nähe, und vor allem weder der Vater noch der Großvater.
„Alteingesessen sind wir durchaus“, gab sie halblaut zurück. „Unser Name stammt von den Achtmännern, den Finanzverwaltern in alter Zeit. Aber … mit dem Handel hat erst mein Großvater begonnen.“
Sie schluckte schwer. Alle wussten das, sie verriet kein Geheimnis, und nicht einmal der Großvater konnte sich beschweren, wenn ein ausländischer Priester davon Kenntnis bekam. Und trotzdem hatte sie das Gefühl, eine rote Linie überschritten zu haben.
„Oh, ich verstehe.“ Seine Worte waren kaum mehr als ein Hauch. „Ich vermute, die Amsincks und Gosslers der Stadt machen einen feinen Unterschied zwischen einem alteingesessenen Bürger und einem alteingesessenen Großbürger.“
Sie errötete und zuckte mit den Achseln. Abgesehen davon war der Großvater auch niemals so reich. Sie waren wohlhabend, sicher, doch ein Landgut an der Elbe stand vorerst nicht in den Sternen.
Die Neureichen, nach Anerkennung heischend, auf der einen Seite, die alteingesessenen Familien auf der anderen, die ihre Macht bewahren wollten, und irgendwo dazwischen, eine aufstrebende Familie wie die Achtmanns, die zwar auf jahrhundertealte Wurzeln zurückblicken konnte, aber eben nicht als Handelshaus.
Ja, die Heirat mit Hendrick Anckelmann war ein Geniestreich, verschwägerte sie automatisch mit dem großen Häusern. Wenn es ihren Brüdern jetzt noch gelingen würde, reiche Bräute heimzuführen, musste Sophie am Ende vielleicht gar nicht heiraten.
Nein, revidierte sie das sofort im Stillen, einen Blick auf das harte Gesicht des Großvaters werfend, und dann auf das nicht minder harte des Vaters, nein, sie musste. Man würde auch sie so lange vorführen, bis sie entweder Geld oder Namen gewonnen hatte.
Und was dabei von ihr auf der Strecke blieb, war den Herren des Hauses zweitrangig.
Kapitel 2: Die Comtesse und ihr Beichtvater
„Ich habe Madame la Comtesse um ihre Hilfe bei Konstanzes Brautkleid gebeten“, sagte Tante Josephine am nächsten Morgen.
Ihre Schwägerin Dorothea sah erstaunt auf.
„Weshalb?“, wunderte sie sich. „Wir haben die Stoffe doch bereits. Feinstes Leinen aus den besten Webereien, und dazu diese hinreißende Seide … wie ein Sommertag …“
Sie ließ ihre Hand sanft über den Ballen gleiten. Gleich nach dem Frühstück hatte Tante Josephine die Stoffe in den Salon bringen lassen, und so waren sie von Farben und Mustern umgeben.
„Madame kommt aus Frankreich!“, trumpfte die Tante auf. „Konstanze soll wunderschön aussehen! Sie muss das Neuste vom Neusten bekommen!“
„Aber eine Französin …? Hätten wir dann nicht lieber bei unseren englischen Freunden nachfragen sollen?“
Tante Josephine warf den Kopf in den Nacken.
„Pah!“, schnaufte sie. „Mögen die sagen, was sie wollen, die beste Mode haben immer noch die Franzosen! Wie war es denn in unserer Jugend? Wir alle eiferten der Kaiserin nach! Und jetzt, wo die Taillen wieder enger und die Röcke weiter werden, ist es immer noch Paris, das den Ton angibt!“
„Zumindest ist es das, was die Pariser behaupten“, erklang eine leicht belustigte Stimme von der Tür.
Madame la Comtesse war bereits da, bereits hinaufgeführt. Sie reichte ihren Schirm und einen Beutel nach hinten, wo ihn mitnichten die Achtmannsche Jungfer abnahm, sondern der junge Abbé.
„Aber vertrauen Sie mir, gnädige Frau Achtmann“, setzte die Comtesse freundlich hinzu, „ich kenne mich in der englischen Mode ebenfalls aus. Die Ärmel werden wieder schmaler, was ich persönlich sehr praktisch finde. Man konnte ja kaum noch Klavier spielen. Dafür muss der Rock jetzt bodenlang sein und anstelle der Unterröcke sollte Mademoiselle Konstanze vielleicht über eine Krinoline nachdenken.“
„Eine Krinoline?“, wiederholte Tante Josephine das Wort begierig.
„Das Sitzen wird schwieriger, aber man hat so viel mehr Beinfreiheit“, lächelte die Comtesse. „Ich erkläre es Ihnen gerne. Abbé, Sie müssen weghören. Es stört Sie doch nicht, wenn mein kleiner Abbé dabeibleibt? Ich habe ihn so gern um mich, und er versteht etwas von Röcken. Sie müssen sich nicht sorgen, er lebt im Zölibat. Frauen interessieren ihn nicht.“
Sophie sah, wie Konstanze einen neugierigen Blick zu dem jungen Abbé warf. Am Vortag hatte sie keine Chance gehabt, mit ihm zu sprechen, ihre Reize an ihm zu erproben. Aber auch jetzt gab der Abbé den Blick ungerührt zurück. Und das war durchaus bemerkenswert – Konstanze wusste, wie man junge Männer zum Erröten und Stottern brachte.
Ganz im Gegensatz zu Sophie.
„Nein, nein, es stört uns nicht“, sagte Tante Josephine sofort. „Die Schneiderin wird jeden Moment kommen, dann müssen Sie uns das mit dieser Krinoline erklären. Dorothea, wir sollten abräumen lassen.“
„Vielleicht möchte Madame la Comtesse eine Erfrischung?“, sagte die Mutter nüchtern.
„Aber doch nicht mit den Stoffen – oh, Madame la Comtesse – ich möchte nicht riskieren – aber natürlich können wir Tee bringen lassen …“ Tante Josephine schwankte zwischen Gastfreundschaft und Fleckengefahr. Bis zur Verlobung hatte der Großvater die teuren Stoffe unter Verschluss gehalten – die Tante sei zu hastig, zu exaltiert, hatte er behauptet. Und im nächsten Atemzug Sophies Mutter dazu verdonnert, ihrer Nichte und Schwägerin beizustehen.
Vielleicht, mutmaßte Sophie, hatte sogar der Großvater … nein, eher hatte die Mutter die Comtesse selbst geschickt beeinflusst, um Tante Josephine nicht allein bändigen zu müssen. Weder Sophie noch Konstanze waren dabei schließlich eine große Hilfe. Konstanze scherte es nicht, solange sie ihren Willen bekam, und auf Sophies Wort gab nicht einmal die Tante etwas.
Erneut Schritte, die Schneiderin erschien mit ihrem Dienstmädchen, bewaffnet mit Körben voll Bändern und Mustern, mit Maßband und Schere. Die Comtesse erhielt den Sessel neben Mutter und Tante, Konstanze landete in der Mitte, und Sophie sowie der Abbé wurden an den Rand gedrängt, während die Diskussion um Schnitte, Muster, Ärmelweite und Rocklänge entbrannte.
„Das muss Sie so sehr langweilen“, flüsterte Sophie nach einer Weile.
Konstanze stand vor den drei Damen, eine Bahn weißes Leinen über der einen, gelbe Seide über der anderen Schulter, und es wurde lebhaft debattiert.
Der Abbé grinste, erstaunlich jungenhaft, wie sie fand.
„Ich muss zugeben, dass ich von diesen Röcken doch recht wenig verstehe“, sagte er. „Aber was Madame la Comtesse will, bekommt sie.“
„Sollte ein Beichtvater nicht strenger mit ihr sein?“
„Was denn? Und riskieren, vor die Tür gesetzt zu werden?“
Er lachte leise, und obwohl das ganz und gar nicht schicklich war, stellte sie fest, sie musste sich ein Lächeln verbeißen.
„Ich bin sicher, das ist ungezogen.“
„Oh, ganz bestimmt. Nichts destotrotz auch sehr wahr.“
„Das wissen Sie besser als ich.“
„Es gehört zu den wenigen Dingen, die ich weiß. Ich vermute allerdings, dass Mademoiselle Konstanze noch einen weiten Weg vor sich hat, was ihr Brautkleid anbetrifft.“
„Es scheint, sie werden sich niemals einig, oder?“
„Ich denke, die Schneiderin hat nicht mit so viel Gegenwind gerechnet. Aber Ihre Tante ist sehr … hm … energisch.“
Sophie seufzte.
„Das ist freundlich ausgedrückt“, murmelte sie und beobachtete, wie Tante Josephine angesichts des rosa Damasts in entzückte Schreie ausbrach. Die Mutter verdrehte diskret die Augen, die Comtesse lachte charmant. Die Schneiderin wirkte entnervt, und Konstanze unentschlossen.
Dies würde noch Stunden dauern.
„Welchen Stoff würden Sie wählen?“ durchbrach die Stimme des jungen Abbés ihre Gedanken.
„Ich?“ Sophie wandte sich ihm zu, erschrocken und errötend. „Oh, ich … ich weiß es nicht. Jedenfalls nichts in Rosa.“
„Nein“, sein Blick musterte sie, „nein, kein Rosa. Ich glaube, die jadegrüne Seide wäre das Richtige für Sie. Oder dieses Türkisblau. Es würde Ihre Augen betonen.“
Der Atem stockte ihr.
„Meine Augen sind grau“, sagte sie schwach.
Einen Moment lang, einen schier ewig dauernden Moment sah er in sie hinein, und sie war nicht sicher, ob ihr Herz weiterschlug.
Dann räusperte er sich und wich ganz leicht zurück.
„Genau das meine ich“, sagte er leichthin. „Es würde das Blau herausholen. Mademoiselle Konstanze scheint sich jetzt doch für weiß zu entscheiden? Ah, Madame la Comtesse rät ihr dazu. Offenbar ist das der neuste Trend in Bezug auf Brautkleider.“
Konstanze würde wunderbar in weiß aussehen, dachte Sophie und versuchte, nicht neidisch zu werden. Es würde ihren rosigen Teint betonen, ihre blonden Locken, ach, einfach alles.
Konstanze war einfach perfekt.
Zum Maßnehmen wurde er dann doch hinausgeworfen. Er hatte sich schon gefragt, wie lange die Achtmannschen Frauen seine Gegenwart noch widerspruchslos hinnehmen würden. Sophie wirkte bedauernd, als er ging, was der junge Abbé durchaus registrierte. Aber er hielt sich nicht lange auf, sondern trat hinunter in die Diele.
Vor dem Kontor hatte er die Stimmen von Freddy und Conrad Achtmann vernommen.
Conrads Miene verzog sich spöttisch, sobald er seiner angesichts wurde.
„Oh, der kleine Abbé!“, stichelte er. „Halten Sie die Händchen der Damen?“
Er lächelte freundlich.
„Die Tugend eines Abtes ist es, zu wissen, wann sein Wort angebracht ist, und wann er besser schweigen sollte“, sagte er milde, was ihm ein Schnauben von Conrad und ein halbes Grinsen von Freddy eintrug. Achselzuckend fügte er hinzu: „Niemand stört sich daran, wenn ich Madame begleite, aber ein junges Mädchen in Unterwäsche zu sehen gehört nicht zu meinen Privilegien.“
„Ich beneide Sie nicht“, höhnte Conrad. „Weder um den Mangel an Wäsche noch um das Weibergeschwätz. Je weniger ich davon höre, umso besser!“
Er klang wie sein Vater, oder er versuchte es zumindest. Freddy hingegen, der optisch weitaus mehr nach Vater und Großvater kam, lächelte verhalten.
„Für einen katholischen Abt muss ganz Hamburg ein Alptraum sein“, sagte er.
Der junge Abbé zuckte mit den Achseln.
„Nein“, wehrte er ab. „Ich bin vielmehr neugierig. Ich bin … sagen wir einmal, ich hatte in meinem Leben bislang sehr wenig Mitspracherecht.“
„Als Abt?“ Freddy wirkte ungläubig.
Der Abbé schmunzelte.
„Ich bin ein Findelkind“, sagte er, „von katholischen Mönchen erzogen. Der Abbé fiel mir zu, auf Madames Wunsch. Ich sagte es schon gestern zu Ihrer Schwester – die Abtei de Guisé ist so klein, dass sie außerhalb von mir nicht existiert.“
„Warum …?“
„Warum ich dann nicht alles hinwerfe, in eine andere Abtei gehe oder dem Mönchsein abschwöre?“, vervollständigte der Abbé. „Zum einen ernährt es mich. Und zum anderen wüsste ich nicht wohin. Ich bin kein Mensch, der sein Leben in Schreibstuben oder Klostergärten verträumen kann. Madame bietet mir die Möglichkeit zu reisen. Ich wäre ein Narr, wenn ich davonliefe.“
„Das klingt jetzt aber nicht besonders religiös“, sagte Freddy Achtmann.
„Eher überhaupt nicht“, murrte Conrad.
„Ich denke, ich bin ausreichend religiös“, sagte der Abbé ausweichend. „Heißt es nicht von Hamburg, dass Toleranz großgeschrieben wird? Nirgends gibt es weniger Zensur als hier. Nirgends haben Andersgläubige mehr Rechte. Ihre Stadt ist weltoffen.“
Das hörten sie gerne, beide Hamburger Söhne, ganz egal, worüber sie eben noch gestritten hatten. Und dass es erst vor ein paar Jahren hässliche Ausschreitungen gegen die Juden gegeben hatte, thematisierte keiner von ihnen.
„Was steht ihr hier rum?“, ertönte eine scharfe Stimme hinter ihnen.
Frido Achtmann kam aus dem Kontor, seine Krawatte richtend. Seine kalten Augen glitten über den jungen Abbé, stuften ihn als bedeutungslos ein, und blieben bei den Söhnen hängen.
„Großvater geht jeden Moment zur Börse“, setzte er hinzu. „Ich muss zum Hafen, die Estonia ist zurück. Conrad, du wirst mich begleiten. Und du, Freddy, frag bei Heckscher nach dem Vertrag. Er sollte heute fertig sein, und wir brauchen die Schriftsätze.“
„Ich dachte, ich soll mich um den Vertrag kümmern …?“, stotterte Conrad.
„Nein, das muss Freddy machen, er vertritt uns“, beschied der Vater. „Du bleibst bei mir. Das letzte Mal, dass du allein losgezogen bist, hatte ich hinterher nur Klagen!“
Conrad lief rot an, wie ein Kind zurechtgewiesen. Freddy verbiss sich ein Lächeln, aber so schlecht, dass die Scham seines Bruders sich prompt in blanken Hass verwandelte.
„Dürfte ich Sie begleiten?“, mischte sich der Abbé rasch ein. „Ich habe noch nicht viel von der Stadt gesehen.“
„Zum Hafen?“ Ein unwirscher Blick traf ihn.
Der Abbé schluckte sichtlich.
„Nein, ich dachte an Ihren anderen Sohn, Freddy.“ Das schien bei weitem die freundlichere Alternative zu sein.
„Wollen Sie spionieren?“
Diesmal gab der Abbé den Blick stoisch zurück.
„Ich bin ein Priester“, sagte er kühl. „Ich handele nicht, auch nicht mit Informationen. Was ich gebe, gebe ich nicht für Geld. Und wem sollte ich Geheimnisse zutragen? Ich kenne praktisch niemanden in der Stadt!“
„Er kann mich doch auf dem Weg dorthin begleiten, Vater“, sagte Freddy begütigend. „Ich muss ihm ja nicht die Papiere zeigen, und falls Heckscher noch Fragen hat, besprechen wir diese unter vier Augen.“
„Nun gut.“ Frido Achtmann zuckte mit den Achseln. „Handle weise, Freddy. Denk daran, in deinem Alter hat Cesar Godeffroy bereits die Firma ganz allein geleitet!“
„Ja, Vater“, murmelte Freddy, und setzte für alle außer dem Abbé unhörbar hinzu: „Ich weiß.“
Kurze Zeit später liefen der junge Abbé und Freddy Achtmann Seite an Seite durch die geschäftigen Straßen der Hafenstadt. Sie mussten auf Karren und Kutschen achten und machten wohlweislich einen Bogen um die Gänge.
„Wird die Madame Sie nicht vermissen?“, fragte Freddy etwas verspätet.
Der Abbé schnaufte.
„Madame besitzt mich nicht“, sagte er. „Außerdem … dass sie mich heute mitnahm, geschah eher aus Mitleid. Wenn ich allein im Haus der Anckelmanns geblieben wäre, wäre ich noch schwermütig geworden.“
Freddy prustete kurz und schüttelte den Kopf.
„Sie sind ganz anders als die katholischen Priester, die mir bislang begegnet sind.“
„Ich weiß. Aber verstehen Sie mich nicht falsch.“ Der Abbé blieb stehen, sein Gesicht auf einmal sehr streng. „Ich nehme meine Gelübde ernst. Ich weiß, welche Gerüchte über mich und die Madame die Runde machen. Sie sind falsch. Fein, vielleicht schaut sie mich gerne an, aber sie schätzt mich wegen meiner Verschwiegenheit und Flexibilität, nicht wegen meines Körpers.“
„Flexibilität?“, wiederholte Freddy, halb fragend.
„Gesunder Menschenverstand ist für mich wichtiger als uralte geschriebene Worte.“
„Ah“, Freddy krauste die Stirn, „unser Priester würde das ganz anders sehen. Aber ich gestehe, manch Hamburger Kaufmann handhabt es ähnlich. Sie sollten nur Sorge tragen, dass Sie nicht ins Kreuzfeuer geraten.“
„Wer kümmert sich schon um einen kleinen Abbé ohne echte Abtei, Geld oder Namen?“
„Vermutlich niemand“, sagte Freddy und seufzte. „Ich beneide Sie. Aber da sind wir, und ich habe Ihnen gar nichts von Hamburg gezeigt. Wollen Sie warten, oder …?“
„Ich habe wirklich nichts zu tun. Wenn es Ihnen recht ist, warte ich. Vielleicht können wir auf dem Rückweg einen Umweg machen?“ Der Magen des Abbé knurrte. „Und eventuell etwas essen“, setzte er verschämt hinzu.
Freddy lachte.
„Füttert die Madame Sie nicht genug?“
„Anckelmanns frühstücken sehr früh. Ich war noch nicht auf.“
„Sie Armer“, grinste Freddy. „Dann lassen Sie mich meine Aufgabe erledigen und danach Sorge tragen, dass Sie uns nicht auf der Straße kollabieren.“
Der Abbé lächelte sanft.
Eine gute Stunde später kehrten sie in ein Gasthaus unweit des Jungfernstiegs ein. Der Botengang bei Heckscher hatte länger gedauert als erwartet, und Freddy war verstimmt.
„Ist alles in Ordnung?“, fragte der Abbé leise. „Wenn wir besser heimkehren sollten, lassen Sie es mich wissen. Es müsste doch auch jetzt Zeit fürs Mittag bei Achtmanns sein.“
Die Börse war vorüber, die Glocken hatten geläutet. Es waren wieder Frauen und Töchter der Kaufleute draußen unterwegs, etwas, was zu Börsenzeiten untersagt war, damit die Herren nicht abgelenkt wurden. Vermutlich war auch der alte Achtmann zurück, sowie Frido mit seinem jüngeren Sohn. Aber Freddy verzog das Gesicht.
„Nein, lieber nicht“, sagte er mürrisch. „Sie examinieren mich nur, und dann … der Schriftsatz ist noch nicht fertig. Ich konnte die offenen Punkte nicht beantworten.“
„Aber das ist doch nicht Ihre Schuld.“
„Natürlich ist es das. Ich bin die nächste Generation von F. Achtmann & Sohn. Ich müsste diese Dinge wissen.“ Halblaut setzte er hinzu: „Cesar Godeffroy wäre das nie passiert.“
Man hätte taub und dumm sein müssen, um die Bitterkeit in den Worten des jungen Achtmanns nicht zu hören. Der kleine Abbé war weder das eine noch das andere.
„Mögen Sie Cesar Godeffroy nicht?“, fragte er freundlich.
„Ach! Mit Cesar hat das nichts zu tun. Er ist schon in Ordnung – wenn er nur nicht so verdammt perfekt wäre. Mit zweiundzwanzig alles allein machen! Und es heißt, dass sein Vater dies Jahr wieder verreist und die Firma ihm überlässt. Bei uns sitzt sogar noch Großvater im Sattel – und Vater würde mir nie so vertrauen!“
Dem Ausbruch folgte ein Moment des Schweigens. Der kleine Abbé drehte seinen Krug in den Händen und öffnete schon den Mund, als Freddy deprimiert hinzusetzte: „Und sie haben Recht damit. Ich bin einfach … ich kann mir das alles nicht merken. Oder ich könnte, aber ich will nicht. Es interessiert mich einfach nicht so! Es …“
Er brach ab und sah betroffen auf. Sein Adamsapfel bewegte sich, als er schwer schluckte.
„Machen Sie sich keine Sorgen“, sagte der Abbé leise. „Ich kann sehr gut schweigen, und ich wüsste nicht, warum ich diesmal reden sollte. Wenn Sie jemanden brauchen, um Ihren Kummer abzuladen, dann gibt es schlechtere Möglichkeiten als mich.“
Freddy lächelte schief und unglücklich.
„Weil Sie niemanden in Hamburg kennen?“
„Ich kenne jetzt Sie. Und außerdem bin ich Priester. Betrachten wir es als Beichtgeheimnis.“
Da lachte der junge Achtmann auf und schüttelte den Kopf.
„Unser Pastor würde sich im Grab umdrehen“, unkte er, seine gute Laune wiederhergestellt. „Also fein, Monsieur l’Abbé … ist das überhaupt die korrekte Anrede?“
„Révérend Père wäre korrekt. Doch wenn es Ihnen recht ist …“
„Wenn mir was recht ist?“
Die Wangen des Abbé röteten sich leicht.
„Leander“, sagte er. „Das ist mein Name. Ich mag die Blicke nicht, wenn man mich hier mit Abbé anspricht.“
Freddy stockte einen Moment, dann streckte er seine Hand aus.
„Freddy“, sagte er. „Gehen wir zum Du über. Ist mir auch lieber, sonst verpetzt mich noch jemand beim Pastor.“
Der kleine Abbé grinste und schüttelte die angebotene Hand.
„Ich schwöre, ich schweige wie ein Grab“, beteuerte er.
„Ich verlasse mich darauf. Also fein, Leander, höre mein tiefstes, schlimmstes und vermutlich gar nicht so geheimes Geheimnis: Ich hasse es, ein Kaufmann zu sein.“
Der Abbé legte den Kopf schief.
„Warum?“, fragte er.
„Weil ich nicht gut bin“, gestand Freddy. „Ich sehe weder die Vorteile noch Nachteile eines Handels. Ich bin kein Cesar Godeffroy, oder ein Carl Sillem. Ich habe weder Ambitionen, der Beste zu sein, noch ein eigenes Geschäft zu leiten. Ich habe Alpträume davon, Bankrott anzumelden. Ich wünschte, ich wäre so frei wie du.“
„Frei und bettelarm“, korrigierte Leander trocken. „Aber du hast doch einen Bruder. Wenn du es hasst und nicht gut bist, warum lassen sie nicht ihn deinen Platz einnehmen?“
„Conrad wünscht sich nichts so sehr wie ich zu sein“, sagte Freddy bitter. „Aber er ist nicht der Erstgeborene. Er ist nicht das F. in F. Achtmann & Sohn.“
„Wegen des Namens? Wirklich?“
„Nicht nur“, seufzte Freddy. „Er muss ja auch Kaufmann werden, ob er will oder nicht. Wenn ich besser wäre, würden sie ihn vielleicht zu Studien nach Göttingen schicken. Er könnte Jurist werden und später Syndikus. Das machen sie natürlich nicht, weil allen klar ist, dass ich es allein nicht schaffe.“
„Es klingt, als sollten sie besser dich zum Studium wegschicken.“
„Das wäre auch nicht besser“, grummelte Freddy. „Jura liegt mir ebenso wenig. Außerdem werden sie mich niemals freilassen. Ich bin ein Achtmann, ich gehöre dem Namen. Sie haben mein Schicksal festgelegt, und das ist, ein erfolgreicher Kaufmann zu werden, das Haus zu Größe zu führen, und Geld zu scheffeln, egal, was dabei auf der Strecke bleibt – sogar, wenn ich es bin.“
Er klang so erschöpft bei diesen Worten, dass der Abbé die Stirn runzelte.
„Sie besitzen dich nicht, Freddy. Und wenn es dir nicht liegt …“
„Oh doch“, unterbrach ihn Freddy. „Sie besitzen mich. Sie besitzen uns alle. Ich muss den Namen groß machen, Conrad muss mir helfen, ganz egal, wie sehr er mich hasst. Die Mädchen müssen gewinnbringend heiraten, was Konstanze ja nun tut. Der armen Sophie wird auch nichts anderes übrigbleiben.“
„Will sie denn nicht heiraten?“
Freddy zuckte mit den Achseln.
„Sie will schon, denke ich“, meinte er. „Aber sie ist doch erst siebzehn, verdammt. Dieser Druck tut ihr nicht gut. Emmy Hanbury war zweiundzwanzig, als sie Cesar heiratete. Konstanze wird zwanzig. Sophie fühlt sich jetzt bereits furchtbar.“
Das Essen wurde gebracht, eine willkommene Pause. Der Abbé trank aus seinem Krug und wartete, bis die Bedienung wieder verschwunden war.
„Wenn du frei sein könntest“, sagte er leise, „wenn sie nicht wären – dein Vater, dein Großvater – was würdest du tun?“
„Wenn Vater und Großvater nicht wären müsste ich immer noch für die Frauen sorgen.“
„Gut. Nehmen wir an, du müsstest das nicht. Was wünscht du dir?“
Freddy sah auf. In seinen Augen brannte plötzlich ein Feuer, wild und unbeherrscht, und so verzweifelt.
„Ich würde malen“, hauchte er.
Leander zog die Augenbrauen hoch.
„Und das ist …“
„Brotlose Kunst“, unterbrach ihn Freddy. „Etwas, was sich vielleicht ein anderer leisten kann, ein Zweitgeborener einer anderen Familie, reich genug, um sich den Spleen zu erlauben. Aber nicht der älteste Sohn der Achtmanns. Sie bezeichnen es als Tollerei. Sie wollen nichts davon hören – nicht einer, nicht einmal meine Mutter. Ich sagte doch, ich gehöre ihnen.“
„Hat denn niemand in der Familie Verständnis?“, wunderte sich der Abbé. „Was ist mit deiner Schwester? Sie macht einen sehr verständigen Eindruck auf mich.“
„Ich kann Sophie damit nicht behelligen. Sie ist doch genauso gefangen wie ich, und zudem abhängig davon, dass ich erfolgreich bin. Wenn sie keinen Mann findet, muss ich sie versorgen. Und selbst wenn sie es verstünde – ihr Wort zählt ja noch weniger als meins.“
„So“, sagte der Abbé. „Das ist natürlich bitter. Vielleicht ist es dann doch besser, bettelarm und wurzellos zu sein, so wie ich. Wobei ich mir niemals dieses Essen hätte leisten können. Das sieht hervorragend aus!“
Freddy lächelte schwach.
„Dann ist das meine gute Tat für heute“, sagte er. „Iss, Leander. Die Rechnung geht natürlich auf mich.“
Das ließ sich der Abbé nicht zweimal sagen.
Kapitel 3: Der andere Bruder
„Der kleine Abbé sprach heute sehr wertschätzend von dir, Sophie“, sagte Freddy beim Abendessen.
Sie sah verdutzt auf, und er lächelte. Vermutlich hätte er das nicht gesagt, dachte sie, wenn Großvater und Vater da wären, und nicht bei Heckschers. Freddy, der die Einladung überbracht hatte und ursprünglich eingeschlossen gewesen war, hatte nicht mitgehen dürfen, aus Gründen, die man ihr nicht mitgeteilt hatte. Aber so, wie sie ihren ältesten Bruder kannte, war er nicht unglücklich darüber.
Unglücklich hingegen war Conrad. Er saß ihnen gegenüber und musterte Freddy mit finsterem Blick.
„Ich finde ihn sehr freundlich“, sagte sie. „Er war sowohl bei Konstanzes Verlobung als auch heute früh sehr höflich zu mir.“
„So, war er das?“ Conrad zog die Augenbrauen hoch. „Hat er vielleicht eigene Pläne, der kleine Pfaffe? Glaubt doch kein Mensch, dass er bei der Comtesse nur die Beichte abnimmt.“
„Conrad!“, tadelte die Mutter.
Freddys Lippen wurden zu einem dünnen Strich.
„Er mag katholisch sein, aber auf mich macht er einen anständigen Eindruck!“, schoss er zurück. „Und niemand hat Beweise für solche Unterstellungen! Du solltest es besser wissen, als schlecht über andere zu reden!“
„Bitte!“, mischte sich die Tante mit roten Wangen ein. „Kein Streit beim Essen! Und schon gar nicht zu einem so … ungehörigen Thema für die Mädchen!“
Konstanze rollte mit den Augen, aber Sophie senkte den Kopf. Sie war sich nicht sicher, worauf ihre Brüder anspielten. Sie war sich nicht einmal sicher, ob sie es wissen wollte.
Ach! Natürlich wollte sie es wissen! Sie brannte vor Neugier und wusste doch, dass ihr niemand Fragen gestatten oder gar beantworten würde. Manchmal hasste sie es, ein Mädchen zu sein.
„Ich habe mit ihm zu Mittag gegessen“, verteidigte Freddy den Abbé. „Wie Sophie schon sagte – sehr freundlich, sehr höflich. Er ist sich der Gerüchte durchaus bewusst und hat betont, sie wären haltlos. Er lebt im Zölibat.“
„Wer’s glaubt“, murrte Conrad.
„Ich würde es vorziehen, wir ergingen uns nicht in Tratsch“, mahnte die Mutter. „Madame la Comtesse war von unschätzbarer Hilfe heute Morgen.“
„Konstanzes Kleid wird wunderbar“, schwärmte die Tante. „Sie werden alle vor Neid erblassen! Und ja, kein Wort gegen die Comtesse. Das ertrage ich nicht!“
„Josephine hat Recht“, sagte die Mutter kühl. „Ich möchte nichts dergleichen hören. Madame la Comtesse wird uns wieder beehren, und sie wird ihren Beichtvater mitbringen. Ich will nicht, dass sie einen schlechten Eindruck von uns bekommt.“
Na nu, dachte Sophie, am Vortag hatten Mutter und Tante noch anders geklungen. Aber natürlich, der Eindruck, der war wichtig.
Conrad schien jedoch seine Zweifel zu haben.
„Hat er sich bei euch Weibsvolk eingeschlichen, der kleine Pfaffe, hm?“, machte er. „Vielleicht sollte ich ihn mir besser mal selber anschauen.“
„Du wirst deine Worte mäßigen, Conrad“, jetzt war die Stimme der Mutter eiskalt. „Und ja, vielleicht solltest du dich einmal mit dem Abbé unterhalten. Vielleicht lehrt dich ja ein katholischer Priester, was ein lutherischer nicht kann.“
Conrad lief hochrot an.
„Darauf könnt ihr euch verlassen“, zischte er. „So weit kommt’s noch, dass ein Pfaffe um eine Achtmann herumschwänzeln darf! Wer weiß, was er euch Weibern ins Ohr pustet! Freddy mag ein argloser Idiot sein, wie immer, aber ich …“
„Conrad!“ Tante Josephine war genauso rot.
„Das nimmst du zurück, du kleiner Mistkerl!“ Freddy ballte die Hände zu Fäusten.
„Es reicht.“ Die Mutter erhob sich. „Vater und Großvater mögen nicht da sein, aber ich bin immer noch die Hausherrin. Du wirst dich vom Tisch entschuldigen, Conrad. Ich möchte dich heute nicht mehr sehen.“
Sophie konnte erkennen, dass Conrad mehr als nur eine böse Erwiderung auf der Zunge lag, doch er schluckte sie herunter. Er musste aus leidvoller Erfahrung wissen, dass er den Kürzeren ziehen würde. Vermutlich wusste er auch, dass er zu weit gegangen war, aber eher würde die Hölle zufrieren, als dass Conrad Achtmann sich bei seinem Bruder entschuldigen würde.
Stattdessen stand er auf, warf seine Serviette auf den Tisch, neigte einmal den Kopf in Richtung Mutter, und verschwand.
Freddy war sichtlich der Appetit vergangen. Er schob sein Essen nur noch hin und her, auch nachdem die Mutter sich wieder gesetzt hatte.
„Wenn er mich nur nicht so hassen würde“, flüsterte er.
Sophie wusste, die Worte waren nicht an sie gerichtet, und dennoch streckte sie die Hand aus und drückte seine. Sie verstand durchaus, dass Conrads Hass aus einer wohlbegründeten Eifersucht rührte, aber seine Vehemenz stieß sie ab. Conrad kannte kein Maß.
„Erzähl mir doch vom Abbé“, sagte sie ermutigend.
Freddy warf ihr einen scharfen Blick zu.
„Sophie, du weißt, dass er nichts für dich ist, oder? Er mag hübsch sein, aber …“
„Ich bin eine Achtmann, und er ist ein Priester“, erwiderte sie. „Ich bin nicht dumm, Freddy. Ich glaube gar nicht, dass er an mir interessiert ist – nicht so, meine ich. Wie könnte er auch?“
Da war nicht nur seine Religion und der Standesunterschied, da war auch die Tatsache, dass sie keine Konstanze war, die Männer schmachten ließ. Sie war die kleine, die unscheinbare Cousine, und Freddy verstand ihre Worte durchaus.
Er seufzte.
„Sophie. Er ist an keiner Frau interessiert, doch selbst wenn er es wäre, könnte er dich niemals haben.“
„Und das verstehe ich auch. Also. Er war nett zu mir. Offenbar war er auch nett zu dir. Worüber habt ihr gesprochen?“
Aber Freddy, der ihr sonst gerne von seinen Unternehmungen berichtete, der es doch immer genoss, wenn die kleine Schwester seine Worte aufsog, war plötzlich seltsam einsilbig.
„Gibt es einen besonderen Grund, weshalb Sie mich sehen wollten?“, fragte Leander.
Conrad Achtmann war am Folgetag gegen Abend bei Anckelmanns aufgetaucht und hatte nach ihm verlangt. Jetzt liefen sie nebeneinander durch die ruhiger werdenden Straßen. Was auch immer der jüngere der beiden Achtmannsöhne mit ihm zu bereden hatte, es konnte offenbar nicht im Salon der Anckelmanns geschehen.
Das sollte dem jungen Abbé eigentlich Sorgen bereiten.
„Mein Bruder hat Sie gestern zum Essen eingeladen, heute bin ich dran“, sagte Conrad ausweichend. „Meine Familie hat mich praktisch gezwungen.“
„Tatsächlich? Ich war mir nicht bewusst, dass die Achtmanns ein solches Interesse an mir haben.“
Ein Blick aus misstrauischen Augen traf ihn.
„Vielleicht geht es eher um Ihr Interesse an uns“, erwiderte Conrad.
Leander runzelte die Stirn.
„Ich kenne bis jetzt niemanden außer Ihnen und Anckelmanns“, sagte er vorsichtig. „Und Anckelmanns sind … nun ja. Nicht besonders gesprächig mir gegenüber.“
„Oder besonders interessant“, rutschte es Conrad heraus.
Er errötete, aber der Abbé zuckte lediglich mit den Achseln.
„Das auch“, sagte er trocken. „So. Haben Sie wirklich vor, mich zum Essen einzuladen, oder wollen Sie mich in einer dieser Gassen erstechen und meine Leiche in einen Kanal werfen?“
Conrad blieb stehen, Verblüffung auf dem Gesicht, bevor es sich wieder verfinsterte.
„Zweifeln Sie meine Ehre an?“, zischte er.
Leander hob sofort die Hände.
„Auf gar keinen Fall! Ich habe eine lebhafte Fantasie, das ist alles!“
„Sie sollten niemals die Ehre eines Kaufmanns anzweifeln! Und schon gar nicht meine!“
„Schon gut! Ich habe verstanden“, sagte der Abbé, seine Stimme ruhig und beschwichtigend. „Verzeihen Sie mir, wenn meine unbedachten Worte Sie beleidigt haben.“
Conrad schnaufte, setzte jedoch seinen Weg fort. Nach einem Moment sagte er: „Es sind übrigens Gänge.“
„Bitte?“
„Keine Gassen, wir nennen sie Gänge. Es sind scheußliche Ecken, die Gängeviertel. Gehen Sie nur hinein, wenn Sie keine andere Wahl haben.“
„Das werde ich mir merken.“
„Und der Hamburger spricht von Fleeten, nicht von Kanälen.“
„Fleete. Verstanden.“
„Ich fürchte, die meisten von ihnen eignen sich nicht zum Entsorgen von Leichen. Sie laufen fast leer bei Ebbe. Und sie stinken.“
„Letzteres könnte allerdings hilfreich sein.“
„Stimmt.“
Sie tauschten einen Blick, und ein seltenes Lächeln tauchte auf Conrads Gesicht auf. Es verschwand jedoch sofort wieder, und er bemühte sich um eine strenge Miene.
„Hier“, sagte er und fasste nach dem Arm des Abbés. „Hier ist unser Gasthaus.“
Zwei Stunden später waren zwei Dinge eindeutig. Zum einen gab Conrad Achtmann sein Bestes, den Abbé betrunken zu machen und auszuhorchen. Zum anderen scheiterte er mit beidem, denn der Abbé hielt sich eisern an seinem ersten Krug fest und nippte nur, während Conrad schon beim dritten war und langsam Schwierigkeiten hatte, sich adäquat auszudrücken.
„Warum schwört ein Mann – wie alt sind Sie noch mal …?“
„Bald zweiundzwanzig.“
„Wie mein Bruder“, sagte Conrad geringschätzig. „Aber der schwört den Frauen nicht ab.“
„Ich hatte noch nie großes Interesse an fleischlichen Genüssen“, sagte Leander. „Der Zölibat fällt mir nicht schwer.“
„Sind Sie etwa einer von diesen warmen Brüdern?“
Leander blinzelte einmal, bevor er grinste.
„Nein“, sagte er. „Keine Sorge. Sie sind sicher vor mir.“
„Sie trinken gar nicht.“
„Ich trinke nie viel. Darf ich auch mal eine Frage stellen?“
„Gleich. Was wollen Sie von Sophie?“
„Ihre Schwester? Warum sollte ich etwas von ihr wollen?“
„Sie haben mehrfach mit ihr gesprochen. Und von ihr, zu Freddy“, stellte Conrad klar.
Leander lächelte schwach.
„Ich habe zweimal mit ihr gesprochen“, korrigierte er, „beide Male, weil wir nebeneinanderstanden und sie … einsam aussah. Es wäre unhöflich gewesen, nicht mit ihr zu reden. Außerdem, und genau das sagte ich Ihrem Bruder, scheint sie ein verständiges Mädchen zu sein. Ich glaube, die Gefahr ist äußerst gering, dass sie für einen mittellosen katholischen Priester zu schwärmen beginnt.“