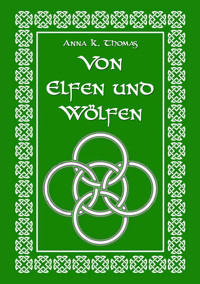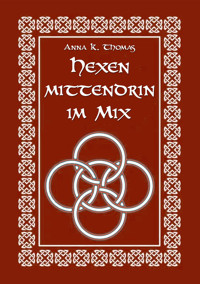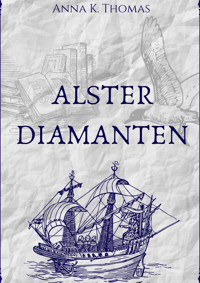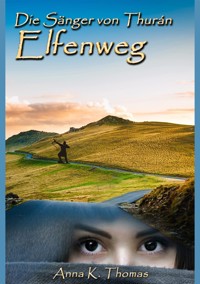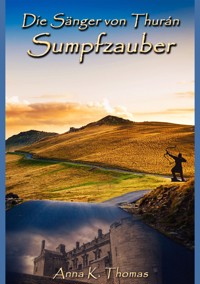5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Gianni ist erst zwölf und damit das unbedeutendste Mitglied einer Florentiner Kaufmannsfamilie zu Zeiten der Medici; doch sein Leben scheint bereits klar vorgezeichnet. In der Frühzeit der italienischen Renaissance ist die Zukunft aber alles andere als gewiss. Der Verlust seiner Verlobten ist dabei nur eines der Dinge, die nicht nach Plan verlaufen. Giannis Weg führt ihn über die Anfänge der Buchdruckkunst, die Werkstätten der Bildhauer und Künstler bis hin zur Politik Lorenzo des Prächtigen. Dabei verfolgt ihn immer dasselbe Geheimnis: Was ist seiner jungen Braut zugestoßen, die einst spurlos im Karneval verschwand?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 797
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Danksagung …
Prolog: Castinis Tochter
1. Teil: Die Söhne von Florenz – 1469
2. Teil: Zwischen Büchern, Bildern, Schwertern – 1471/72
3. Teil: Himmel und Hölle – 1473/74
4. Teil: Wen die Götter lieben – 1475/76
5. Teil: Unwirsche Zeiten – 1477/1478
6. Teil: Lebenslinien – 1479/80
Epilog: Was bleibt, sind die Bilder
Anmerkungen der Autorin
Anhang
Personenverzeichnis
Begriffsverzeichnis
Danksagung …
Ernsthaft – wer liest schon Danksagungen? Endlose Aneinanderreihung von Namen, die in der Regel nur dem Autor etwas sagen?
Und dennoch – ich muss Danke sagen. Ich verspreche, ich mache es kurz.
Ihr wisst, wer Ihr seid: Die Freundin, die sagt – Du schreibst so schön – und mich hielt, als ich verzweifelte; die Mutter, die alles, alles Korrektur las, bis es einfach nicht mehr ging; der Vater, der immer noch alles liest und mir hilft zu erkennen, was Sinn macht und was nicht; die vielen anderen, die zuhören und Tipps geben.
Und natürlich die Frau, die Freundin, die mit mir zusammen dieses Abenteuer anpackte, mit mir um Titel und Klappentexte rang und ohne die es vermutlich immer noch nicht geschehen wäre.
Danke.
Und ein kleiner Nachsatz: Die Masken von Florenz und Irrfahrt ins Gelobte Land entstanden 2007 und 2008 – es hat zehn Jahre bis zur Veröffentlichung gedauert. Das ist eine Menge Zeit, eine Menge Menschen. Deshalb bekommen sie beide dieselbe Danksagung. Und jetzt geht es wirklich los, versprochen.
Prolog: Castinis Tochter
Florenz, 1469
Sie hatte schon immer gewusst, dass sie anders war.
Das hatte ihr niemand gesagt. Sie wusste es, so wie sie ihren Namen kannte: Susanna Angelina Caterina Castini, einziges Kind des Umberto Castini und seiner verstorbenen Frau Caterina, selig bei den Engeln. Sie war anders. Daran ließ sich nichts leugnen.
Der Vater war nicht anders. Der Vater war streng, ein florentinischer Kaufherr, der sich auf seltene Luxusgüter spezialisiert hatte und damit reich geworden war. Die Mutter ebenfalls nicht – bildschön, wenn man den Worten der Amme glaubte, und sanftmütig und gehorsam, wenn es der Vater war, der von ihr sprach. Sie hatte nur die Worte der beiden, war die Mutter doch bei ihrer Geburt gestorben. Und die Mutter war ein Engel gewesen – nicht anders.
Aber sie, die Tochter, war es. Ob man das sah? Konnte der Maler das in seinem Bild einfangen? Sie wagte nicht, an ihrer strengen Pose zu rütteln, sondern warf nur einen vorsichtigen Blick unter ihren Wimpern zu dem Mann hinüber. Der Maler war noch ziemlich jung. Seit ein paar Tagen kam er jeden Vormittag für einige Stunden ins Haus, um ihr Porträt zu zeichnen. Ihr Verlobter, Gianni Montecaldo, hatte es angefordert – oder besser, dessen Vater, Francesco Montecaldo. Francesco wollte wissen, wie sie aussah, und weil Umberto Castini sich weigerte, sein Töchterchen vor der Hochzeit vorzuzeigen, hatte er extra den Maler bestellt. Das war an und für sich nicht ungewöhnlich: Florenz hütete seine jungfräulichen Töchter gut, vorausgesetzt, diese hatten Erbe und Namen vorzuweisen. Castinis Tochter verließ das Haus grundsätzlich nur zum Kirchgang, und der einzige Besuch, der ihr gestattet war, bestand aus ihren beiden Cousinen. Unüblich war da vielleicht eher, wie außerordentlich streng ihr Vater ihren Umgang beschnitt, wie ungewöhnlich tief ihre Verhüllung war, wenn sie sich außerhalb des elterlichen Hauses befand, und die unverständliche Tatsache, dass Umberto Castini nicht einmal einen Heiratsvermittler hatte hereinlassen wollen.
Dabei hatte er eigentlich Recht – er brauchte im Gegensatz zu den anderen florentinischen Familien mit heiratsfähigen Töchtern keinen Vermittler mehr. Sie war bereits seit der Wiege mit Gianni Montecaldo verlobt. Hätte der alte Montecaldo nicht so ein Gezeter veranstaltet und die Mitgift immer höher treiben wollen, hätte man es dabei belassen können. Am Ende hatte er sogar behauptet, Castinis einzige Tochter wäre entstellt – und da hatte der Vater nachgegeben und den Maler erlaubt. Ansonsten wäre aus der Hochzeit dieses Jahr nichts mehr geworden.
Sie saß im Licht nahe des Fensters und ließ sich malen, während sie sich die ganze Zeit fragte, ob man vielleicht dem Bild ihre Andersartigkeit anmerken würde, wenn es sonst schon niemand sah. Und es sah niemand, was sie immer, immer wieder verblüffte. Der Vater wäre aus allen Wolken gefallen, die Tante hätte vermutlich eine Ohnmacht erlitten, und ihre Cousinen wären ausnahmsweise einmal sprachlos geworden. Nein, niemand sah es, niemand wusste es. Castinis Tochter war für sie ein ganz normales junges, florentinisches Mädchen, mitnichten entstellt, wie die bösen Zungen behaupteten, mitnichten anders!
Sie wussten es nicht, weil sie es ihnen nicht gesagt hatte.
Als sie klein war, hatte sie geglaubt, jeder könne das, was sie konnte. Sie hatte gedacht, es sei so alltäglich, dass es sich nicht lohne, überhaupt darüber zu reden. Ihr Argwohn erwachte erst, als sie es das erste Mal ihrer Amme gegenüber erwähnte und damit große Bestürzung hervorrief. Die Amme war weiß wie die Wand geworden und hatte sie sogar beim Grab ihrer Mutter schwören lassen, niemals mehr davon zu sprechen. Und als ein Küchenmädchen starb und die Amme sie in die Kirche zerrte, damit der Priester sie segnete, da begann sie zu begreifen, dass sie sich geirrt hatte. Was sie konnte, war nicht alltäglich.
Was sie konnte, war anders.
Sie hielt danach ihren Schwur der Amme gegenüber, und sprach nicht mehr davon – warum auch, niemand in ihrem Umkreis hätte es verstanden. Die Amme starb, der Vater hatte kaum Zeit für sie, und die Tante war mit ihrer eigenen Familie beschäftigt. Und die Cousinen, Lucia und Antonia, waren beide auf ihre eigene Art ungeeignet, um ein solches Geheimnis zu bewahren.
Lucia und Antonia kamen täglich zu Besuch, denn sie wurden gemeinsam unterrichtet. Antonia war seit dem Herbst verheiratet, was zu einer enormen Zunahme ihrer Freiheit geführt hatte. Da ihr Mann seit der Hochzeit auf Handelsreisen war, hatte sie es zwar vorgezogen, kurzzeitig wieder bei ihren Eltern zu wohnen, ihre neugewonnene Freiheit als verheiratete Frau hatte sie sich jedoch nicht beschneiden lassen – und davon begann Lucia, die jüngere, jungfräuliche Schwester, zu profitieren.
Auch bei Castinis Tochter würde die Hochzeit nun nicht mehr lange auf sich warten lassen. Bekam Francesco Montecaldo sein Bild, würden die Verhandlungen über die Mitgift abgeschlossen werden, und der Tag der Vermählung festgesetzt. Sie fragte sich manchmal, ob der Vater den Lehrer für Antonia und Lucia weiterbezahlen würde, wenn sie fort wäre. Und wenn sie daran dachte, dann dachte sie auch an den unbekannten Gianni Montecaldo, so alt wie sie, und bald ihr Ehemann.
Ob er sehen würde, dass sie anders war?
„Wir sind für heute fertig, Madonna“, unterbrach der Maler ihre Gedanken.
Er packte seine Pinsel zusammen, reinigte die Tafel, und sie ließ erleichtert die Rose sinken, die sie immer gegen ihre Brust drücken musste. Es war jeden Tag eine neue Rose. Lächerlich. Sie mochte Rosen nicht einmal.
Der Maler hängte zum Schluss vorsichtig ein Tuch über sein Werk. Er durfte es nicht mitnehmen und Feinarbeiten daheim ausführen, weil sein Auftraggeber darauf bestand, dass er das gesamte Bildnis in diesem Hause anfertigte. Jedes Mal, bevor er ging, verhängte er sein Werk; niemand von der Dienerschaft durfte auch daran rühren. Sie wusste, der Maler porträtierte sie nur, weil er essen musste. Sie war freundlich zu ihm, in der Hoffnung, dass er sie dann hübsch zeichnen würde – und nicht anders.
Gesehen hatte sie das Bild noch nie.
Jetzt war er fertig. Eine kurze Verbeugung, sie neigte den Kopf.
„Morgen um dieselbe Zeit, Madonna“, sagte er, und sie nickte wieder. Dann war er draußen, der Dienerin folgend, die ihn zur Tür brachte. Und für einen kurzen, kostbaren Moment war sie allein.
Allein…
Ohne weiter nachzudenken, machte sie einen großen Schritt nach vorne. Das Herz klopfte ihr wie wild in der Brust, während sie behutsam – heilige Jungfrau, nicht die Farben verschmieren! – das Tuch anhob. Zwar hatte man es ihr nicht mit so drastischen Worten verboten wie dem Dienstvolk, aber erlaubt hatte man es ihr auch nicht, und sie war sich gar nicht sicher, was sie erwartete, wenn man sie dabei erwischte. Zitternd zog sie das Tuch beiseite.
Das Porträt war noch nicht ganz fertig. Ein Teil des Kleides war unbemalt, und die Partie um ihren Mund herum wirkte unscharf. Aber ihre Augen waren da. Ihre Augen waren echt. Es waren ihre Augen.
Sah man ihre Andersartigkeit? Würde Francesco Montecaldo beim Anblick des Bildes zornig aufbrüllen und es empört zu Boden werfen? Würde Gianni Montecaldo nur einen Blick voller Abscheu darauf werfen und sich dann angeekelt abwenden? Würde es sie verraten?
Es war das Bild eines jungen Mädchens, sittsam gekleidet, mit einem Hauch von Dekolleté unter dem durchsichtigen Schleiertuch. Die Rose, die sie gegen ihre Brust drückte, wirkte irgendwie affektiert, aber der Ausdruck in ihren Augen war in sich gekehrt, fast wie verloren. Die Haare waren so streng frisiert, dass es sie manchmal an der Kopfhaut juckte, wo die Strähnen allzu straff gespannt waren. Auf den Wangen lag ein rosiger Schimmer, den sie ganz bestimmt nicht besaß. Aber ihre Augen…
Sie hörte Schritte sich nähern. Ängstlich, besorgt forschte sie noch einmal nach dem Ausdruck der Augen. Dunkel, mit einem Schimmer grün darin. Nein, nicht anders. Aber… traurig.
Die Türklinke klackte. Sie ließ hastig das Tuch fallen und eilte zurück an ihren Platz am Fenster. Es war ihre Zofe, wie erwartet. Netta war lieb, jedoch ein wenig einfältig, was manchmal gut und manchmal ermüdend war.
„Hier seid Ihr, Herrin“, sagte sie, „ich habe Euch schon gesucht. Madonna Lucia und Madonna Antonia warten im Garten auf Euch!“
Susanna nickte. Sie ließ die Rose achtlos fallen – irgendjemand würde sie schon aufheben und dafür sorgen, dass morgen eine frische zur Verfügung stehen würde, wenn der Maler sie wieder benötigte. Und während sie stumm in den Garten hinunterging, dachte sie im Stillen, wie unwichtig doch so eine Rose war, im Vergleich zu ihrem Geheimnis.
„Ist er denn noch immer nicht fertig?“, fragte Antonia ungeduldig.
„Ein Porträt braucht eben seine Zeit“, erwiderte Susanna.
Antonia schüttelte den Kopf.
„Also, ich an deiner Stelle könnte nicht so ruhig bleiben“, beschied sie, „je schneller der Maler fertig ist, desto schneller bekommt dein Verlobter das Bild und desto schneller kannst du heiraten. Oh Susanna! In ein paar Wochen wirst du Hochzeit halten!“
Susanna war sich gar nicht sicher, ob das wirklich so wunderbar war. Lucia hingegen schlang ungestüm die Arme um sie.
„Ich werde dich vermissen!“, beteuerte sie, „ich werde dich so sehr vermissen!“
Antonia rollte mit den Augen.
„Sie ist doch nicht aus der Welt“, sagte sie verächtlich, „du Heulsuse! Die Montecaldos wohnen nur ein paar Straßen weiter weg. Und wenn Susanna erst einmal Gianni Montecaldos Frau ist, kann sie ausgehen, wann sie will!“
„Sie wird nicht ausgehen können, wann sie will“, widersprach Lucia, „Signore Montecaldo ist sehr streng. Er wird bestimmt nicht zulassen, dass sie sich sittenlos aufführt!“
„Nun“, spottete Antonia, „zum einen wird sich Susanna allein schon deshalb nicht sittenlos aufführen, weil sie gar nicht weiß, wie das geht, und weil sie es überhaupt nicht kann – Tugendschäfchen! Und zum anderen kann niemand strenger sein als Onkel Umberto!“
„Oh, Antonia!“, schimpfte Lucia.
Susanna lächelte. Die Cousine hatte sicher Recht. Im Haus der Montecaldos würden ihr mehr Freiheiten gestattet sein als hier.
„Morgen ist Kirchgang“, sagte sie unvermittelt mit einem tiefen Seufzen, „wie ich mich freue!“
Antonia und Lucia hielten in ihrem Streitgespräch inne. Dann schlangen beide spontan die Arme um sie.
„Oh, Liebes, das verstehen wir“, beteuerte Lucia, „wir holen dich früh ab, ja? Und du kannst dich wirklich freuen – Antonia hat eine Überraschung für uns!“
„Was für eine Überraschung?“, fragte Susanna verblüfft.
Antonia lächelte stolz.
„Es gibt eine kleine Tuchmesse im Anschluss“, sagte sie, „immerhin veranstalten sie nächste Woche Lorenzos Turnier für diese komische römische Pute. Da wollen die Händler noch schnell ihre Ware unters Volk werfen und schauen, dass keine Frau ungeschmückt bleibt! Gleich nach der Kirche gehen wir hin. Oh, keine Sorge, Susanna! Ich habe Mutter vorgeschickt, und dein Vater hat es erlaubt. Wenn ich dabei bin, darfst du mitkommen!“
Es stand zu bezweifeln, dass Antonias Gegenwart ausschlaggebend für die ungewohnte Erlaubnis war. Viel wahrscheinlicher war, dass Umberto Castini glauben gemacht worden war, seine Schwester selbst würde die Mädchen begleiten, und vermutlich aus allen Wolken fallen würde, wenn er erführe, allein die kleine Antonia wäre verantwortlich. Susanna kannte doch ihre Cousine – aber sie tat unwissend und sagte nichts. Seit Antonias Hochzeit begann auch sie von den neuen Freiheiten zu profitieren.
Sie lächelte.
„Tuchmesse, wie schön!“, sagte sie inbrünstig.
Lucia klatschte die Hände zusammen und hüpfte auf und ab.
„Oh ja!“, seufzte sie, „ich wünschte, ich könnte mir ein Kleid kaufen! Ah – ein gelbes, mit grünen Bändern!“
„Ein gelbes?“, Antonia schüttelte den Kopf, „du Gans, du! Ich wollte ja, wir könnten zu dem Turnier gehen, aber da stellt sich selbst meine Mutter quer. Die Tuchmesse ist besser als nichts.“
„Die Tuchmesse ist großartig!“, behauptete Susanna rasch.
„Großartig!“, echote Lucia.
Antonia lächelte geschmeichelt.
„Na gut“, meinte sie, „aber lass deine Zofe diesmal zu Hause, Susanna!“
„Oh ja“, murmelte Lucia, „bitte…“
Das kam nicht in Frage. Susanna schüttelte den Kopf.
„Netta muss mit“, sagte sie bedauernd, „das wisst ihr doch. Ich werde ihr sagen, dass sie still sein soll.“
Antonia seufzte.
„Wenn’s sein muss“, murrte sie, „Hauptsache, sie hält sich dran. Ihr Geschwätz ist unerträglich. Und ihr Gerede vom schwarzen Tod in den Tüchern aus dem Osten hat Lucia das letzte Mal nicht schlafen lassen.“
„Oh, Antonia“, protestierte Lucia und errötete.
„Sie ist eben sehr abergläubisch”, gab Susanna zu, „ich rede ihr noch einmal ins Gewissen. Du darfst sie nicht so piesacken, Antonia.“
„Hast du gehört, Antonia?“, bekräftigte Lucia.
Die rollte mit den Augen.
„In Ordnung“, brummte sie, „Hauptsache, sie ist still.“
„Ich rede mit ihr“, versprach Susanna.
Sie nahm sich das auch ganz fest vor. Das tat sie immer.
*
„Und auf Murano“, plapperte Netta, „soll der Teufel den Glasbläsern ins Feuer gefahren sein und alle Gläser verzerrt haben, so dass die kleinen Dinge jetzt ganz groß sind, wenn man hindurchschaut. Ich hab’s erst gestern gehört, Madonna! Es ist gerade erst passiert!“
„Susanna – sie plappert“, murmelte Antonia genervt.
„Ich weiß“, flüsterte Susanna zurück, „bitte, lass sie. Sie freut sich doch genauso wie ich.“
„In Venedig sind die Menschen sowieso alle mit dem Teufel im Bunde. Erst letzte Woche…“
„Na gut“, murmelte Antonia ergeben, „aber nur, weil ich dich so lieb hab, Susanna. Das nächste Mal lass sie zu Hause! Oder rede zumindest mit ihr!“
„Ich versuch’s“, gab Susanna leise zurück.
Das versprach sie jedes Mal, und nie hielt sie sich daran, weil sie es in letzter Sekunde nicht über das Herz brachte, Nettas kindliches Staunen und ihr reges Mitteilungsbedürfnis zu verletzen. Daheimlassen durfte sie die Zofe natürlich ohnehin nicht. Netta war ihr Schutz, klebte an ihr, wann immer sie das Haus verlief. Ohne sie hätte Susanna sich vermutlich nackt gefühlt. Und weil dem so war, und weil die Zofe ständig in der Nähe ihrer Herrin sein musste, kam Netta genauso selten wie Susanna aus dem Haus. Die Folge war, dass sich das Mädchen bei den seltenen Ausflügen nicht im Griff hatte und alle mit ihrem Gerede überschwallte.
Susanna trug wie immer einen schlichten Mantel und den dichten Schleier über ihrem Gesicht. Lucia, als reiche, jungfräuliche florentinische Tochter, war natürlich ebenfalls verschleiert – aber bei diesem Wort hörten die Gemeinsamkeiten schon auf. Lucia hatte ein zart besticktes Tuch an den Rändern ihrer Kappe befestigt, welches in leichten Falten bis zu ihrem Kleid fiel und eher zum Träumen anregte als verbarg. Susannas Schleier bestand aus dick gewebtem Stoff, der nicht eine Linie dahinter erahnen ließ. Der größte Unterschied war jedoch, dass Lucias Augen frei waren, und Susannas nicht. Sie brauchte Netta allein schon, um nicht irgendwo gegen zu laufen. Und dennoch – sie sah die Schemen, sie roch die Farben, die Gewürze, sie höre die Leute und spürte, spürte, dass sie lebte, wenn sie hier war. Auch wenn der Schleier sie abschnitt – er schnitt nicht so stark ab wie es die Mauern des Palazzo Castini taten. Lieber mit Schleier hinaus als gar nicht.
„Da drüben! Antonia, Susanna – seht doch nur, dieses herrliche Gelb!“
Lucia zerrte aufgeregt am Arm der Schwester und zog sie in die angegebene Richtung. Netta, die Susannas Ellbogen ergriff, steuerte diese ebenfalls hinüber. Jemand rempelte sie im Gewühl an.
„Pass doch auf!“, schimpfte Netta, „olles Hinkebein! Kannst du die Dame nicht sehen? Na los, verschwinde!“
Eine Woge von Sandelholz hüllte sie ein und machte sie beinahe schwindlig. Jemand griff nach ihrer Hand.
„Finger weg!“, fauchte Netta, „wirst du wohl die Dame nicht anfassen! Elender!“
„Verzeiht, Herrin, verzeiht“, sagte eine raue Stimme, „es war keine Absicht, Madonna, wirklich nicht!“
Ein Mann, ohne Zweifel, aber ein junger. Über die Gebühr mit Sandelholz parfümiert, was eigentlich schlecht zu einem Bettler passte. Susanna versuchte, das Gesicht auszumachen, was ihr nicht gelang. Sie nickte nur hoheitsvoll, in der Hoffnung, die Szene damit zu beenden.
„Passt du so auf deine Herrin auf, Netta?“, sagte Antonia empört, „na komm, Susanna. Wir sind hier drüben.“
Die Woge aus Sandelholz verschwand, während die Cousine sie vorwärts zog. Zurück blieb nur ein leichter Hauch, wie eine Erinnerung.
Plötzlich war sie traurig.
Sie konnte sich nicht einmal richtig über das strahlende Gelb oder das leuchtende Rot freuen, noch nahm sie Anteil an dem regen Austausch über Spitzen und Bordüren. Wenn sie wollte, das wusste sie, konnte sie beim Vater ein ganzes Paket an Putz in Auftrag geben, und sie würde es erhalten. Aber sie wollte nicht. Wozu sich putzen, wenn sie nie jemand sah?
Stimmengewirr unterbrach ihr Gespräch. Weiter vorne schien es einen Aufruhr zu geben. Lucia war ängstlich, aber Antonia voller Neugier und drängte vorwärts. Während Lucia ihre Schwester bittend und bettelnd zurückhalten wollte, folgte ihr Susanna an Nettas Arm kurzentschlossen.
„Was ist?“, fragte sie die Zofe.
„Ich glaube, sie streiten sich wegen der Ware“, erklärte Netta, „ein junger Herr hat sich ein Stück Samt abgeschnitten, und der Händler fordert, dass er den Ballen bezahlt… anscheinend hat der junge Herr ein riesiges Loch gemacht. Es scheint, als ob er sein Schwert dafür benutzt hätte.“
„Sein Schwert?“, wunderte sich Susanna.
Waffentragen war in der Stadt verboten, seit dem Aufstand der Wollarbeiter, der Ciompi, vor vielen Jahrzehnten. Aber es gab immer welche, für die die Gesetze nicht zu gelten schienen. Sie konnte die zornige Stimme des Händlers hören, die arrogante des jungen Herrn und viele andere.
„Meine Existenz ruiniert! Das wird Folgen haben! Ihr werdet mir den Schaden erstatten!“, jammerte der Händler.
„Wenn du dich zuerst um mich gekümmert hättest, wäre das nicht passiert“, schnitt der Edelmann ihm gelangweilt das Wort ab, „du solltest mir den Ballen als Entschuldigung für die Beleidigung schenken!“
„Ich hatte eine Dame zu bedienen! Ihr werdet ja wohl einer Dame den Vorrang lassen!“
„Nun bezahle es doch, Renaldo“, sagte ein anderer, „ich habe keine Lust mehr zu warten!“
„Nein, Sebastiano, mir wurde Unrecht getan. Ich werde nicht bezahlen!“
„Aber der Händler hat doch Recht…“, das war ein Vierter, sehr leise und schüchtern. Der Edelmann namens Renaldo schnaufte.
„Das hatte er nicht! Sebastiano, ruf deinen Bruder zur Ordnung! Ich werde nicht bezahlen!“
„Ich langweile mich! Wir wollen weiter!“, widersprach Sebastiano.
„Wir könnten bezahlen…“, sagte der Vierte wieder, noch leiser.
„Unsinn, Gianni“, antwortete Sebastiano, „wofür unser Geld verschwenden? Renaldo ist schuld, weil er nicht warten konnte. Und der Händler, weil er so einen Aufruhr macht. Jetzt regele die Sache endlich!“
„Ihr habt den Ballen ruiniert, Herr!“, beharrte der Händler, „man hätte einen Mantel daraus machen können, oder eine Robe – und jetzt? Allein Flickzeug bleibt noch! Das lässt sich nicht beheben! Ich kenne Euren Vater – ich werde ihn aufsuchen! Man wird Euch einsperren! Wenn Ihr nicht sofort bezahlt…!“
„Sebastiano!“, flüsterte der Junge namens Gianni schockiert, und dann gab es ein lautes Kreischen.
„Zurück, zurück!“, donnerte Antonia und schubste Lucia, Netta und Susanna nach hinten. Susanna stolperte, drehte blind den Kopf, wurde von Netta gehalten und hastig in eine Richtung gezogen. Ein erneutes Kreischen erklang.
„Er hat den Stand umgeworfen!“, rief Lucia entsetzt, „glaubt man es! All die Ballen! Alles durcheinander!“
„Vorsichtig!“, rief Antonia, aber bereits nicht mehr erschrocken, sondern mit einem Lachen in der Stimme.
Um sie herum drängten auch andere Menschen davon. Schnelle Schritte wurden laut, dann schubste sie schon wieder jemand.
„Pass doch auf!“, sagte Lucia schrill.
„Oh, Damen!“, das war Sebastiano, die lachende Stimme von vorhin, „verzeiht, edle Damen. Sehr hübsch, edle Damen!“
„Verschwindet!“, zischte Antonia.
Gelächter erklang, wieder schnelle Schritte und erneut lautes Gebrüll. Susanna war völlig verwirrt.
„Hier entlang“, kommandierte Antonia, „kommt. Lucia, heul nicht. Kommt hierher. Es ist doch gar nichts passiert. Gut, er hat den Stand umgeworfen, und da hat man jetzt bestimmt andere Sorgen als einen zerschnittenen Ballen. Gut, du bist gefallen und er hat deine Beine gesehen. Ist das so schlimm? Niemand hat sich was gebrochen. Susanna, setz dich hierhin. Beruhigt Euch. Wisst Ihr eigentlich, wer das war?“
„Nein“, sagte Susanna, die gehorchte und sich neben die schniefende Lucia auf die Brunnenbrüstung setzte, „ich habe doch nichts gesehen!“
„Oh“, sagte Antonia nach einem Moment, „wie schade. Aber ich hab’s gesehen. Das waren Renaldo de’ Pazzi und sein Freund, Sebastiano Montecaldo. Und bei sich, da bin ich ganz sicher, hatte Sebastiano seinen kleinen Bruder Gianni.”
Gianni? Gianni Montecaldo? Der schüchterne Junge mit der leisen Stimme war ihr Verlobter?
Susanna wurde ganz anders.
Ihr Verlobter! Da war er gewesen, nur ein paar Meter von ihr entfernt! Sie hatte seine Stimme gehört, vielleicht war es sogar er gewesen, der sie gestoßen hatte – und sie hatte nichts gesehen! Gar nichts! Diese Maske, dieser Schleier verbarg sie ja nicht nur von der Außenwelt, sondern auch die Außenwelt vor ihr! Sie war eingesperrt, nichts weiter!
„Bist du sicher, Antonia?“, sagte Lucia, die Tränen vor Verblüffung vergessend.
„Oh ja“, Antonia nickte heftig, „jeder kennt doch Sebastiano Montecaldo! Ein richtiger Tunichtgut ist das, sagt man, und dass es mit ihm noch schlimm enden wird!“
„Das glaube ich“, meinte Lucia befriedigt, „er hat den Stand umgeworfen. Und mich! So benimmt sich kein Ehrenmann! Er war unhöflich!“
„Susanna soll ja auch nicht ihn heiraten, sondern Gianni“, sagte Antonia, „zum Glück! Aber der ist ja noch sehr jung, oder?“
„Er soll so alt sein wie ich“, meinte Susanna mit klopfendem Herzen.
„Wirklich?“ Antonia schnaubte verächtlich, „ich fand, er sah jünger aus. So klein und blass! Aber… aber, Susanna, er ist viel hübscher als Sebastiano, und bestimmt auch viel besser erzogen!“
„Genau“, sagte Lucia hastig, „er wollte den Schaden begleichen! Er war höflich! Er kann doch nichts dafür, wenn sein großer Bruder ein Lümmel ist!“
Susanna schwieg. Zu gerne hätte sie sich selbst ein Bild gemacht, hätte den zukünftigen Ehemann mit eigenen Augen gesehen und beurteilt, wie er sich verhalten hatte. Warum durfte sie eigentlich kein Porträt anfordern? Warum tat ihre Meinung gar nichts zur Sache?
Warum sperrte man sie immer und immer wieder so ein?
Sie holte zitternd Luft. Ja, sie kannte die Regeln, wusste, dass es sich für sie nicht schickte, unverschleiert und offen auf die Straße zu gehen. Sie kannte sie zu gut, waren sie ihr doch immer und immer wieder vorgebetet worden. Nie hatte sie das in Frage gestellt – aber dennoch, jetzt, heute, wo Gianni Montecaldo ihr zwischen den Fingern entwischt war, spürte sie trotzige Rebellion in sich aufsteigen.
„Einmal“, sagte sie inbrünstig, „nur einmal will ich ohne diesen Schleier das Haus verlassen! Einmal will ich die Welt so sehen, wie sie ist, ohne ein Tuch vor meinen Augen, so dick, dass es mich blind macht! Nur ein Mal, ohne dass mich alle Welt anstarrt und tuschelt, sich fragt, ob ich entstellt bin! Nur ein einziges Mal!“
Stille antwortete ihr. Sie war selbst ein wenig verblüfft darüber, wie erbittert, wie verzweifelt ihre Stimme geklungen hatte. Sie senkte den Kopf. Der Vorteil eines dichten Schleiers war auch, dass man die Tränen nicht sah, die darunter liefen.
Eine Hand legte sich um ihre und drückte sie. Lucia, ohne Worte. Antonia hingegen räusperte sich.
„Ich habe das auch schon gedacht“, sagte sie, „so streng wie dein Vater ist… ich hab’s nur nie gesagt, weil du ja mit allem einverstanden schienst. Aber ich finde, du solltest die Welt einmal sehen dürfen – und zwar noch vor deiner Hochzeit.“
„Wie soll denn das gehen?“, murmelte Lucia.
Susanna schwieg.
Antonia holte tief Luft.
„Natürlich geht es“, sagte sie hart, „sei kein Schaf, Lucia. Es liegt auf der Hand! Karneval, Susanna!“
Karneval?
„Ich gehe dieses Jahr auf die Piazza“, fuhr Antonia fort, „Mutter bleibt daheim, Vater bewirtet Gäste, deshalb werden die Diener mich begleiten. Ich habe Vater und Mutter überreden können, dass Lucia mitkommen darf. Und vielleicht dürftest du das ja auch!“
Karneval…
„Du könntest deinen Vater darum bitten“, setzte Antonia hinzu, „du könntest dich verkleiden. Eine Susanna Castini kann bestimmt ein schönes Kostüm finden!“
Karneval – Kostüme und glitzernde Masken, wilde Gestalten und laute Musik… Sie war immer mit der Amme auf die Balkone des oberen Stockwerks gegangen und hatte durch die Brüstung gespäht, verzaubert vom Taumel der Nacht. Oben, über dem Trubel, wie immer Lichtjahre entfernt, nur eine Beobachterin…
„Und du könntest eine Maske tragen, mit Schlitzen für die Augen“, schloss Antonia, „so viele tun das im Karneval! Du könntest dein Gesicht hinter einer Maske verbergen, niemand würde dich anstarren, niemand über dich tuscheln – und du könntest alles sehen!“
Alles sehen!
„Antonia!“, sagte Lucia schockiert, „Onkel Umberto wird das nie erlauben!“
„Und warum sollte er nicht?“, widersprach Antonia, „sie geht mit uns! Unsere Diener werden uns begleiten. Er kann ihr ja auch Diener mitgeben. Dann ist sie so sicher wie in Abrahams Schoß! Karneval, Susanna! Er ist nur einmal im Jahr. Danach kommt die Fastenzeit, und wenn die herum ist und Ostern war, wirst du heiraten. Wer weiß, ob die Montecaldos dich zum Karneval gehen lassen?“
„Aber Onkel Umberto…“
„Onkel Umberto will nicht, dass man Susannas Gesicht sieht, und das wird keiner!“, beharrte Antonia, „sie trägt eine Maske, die Diener beschützen sie – oh bitte, Lucia! Wir werden nicht die einzigen Damen da draußen sein. Nicht im Karneval! Also – was sagst du, Susanna? Willst du es nicht versuchen?“
Karneval – ein wildes Fest, mit wilden Menschen, mit ganz eigenen Gesetzen und Bräuchen. Aber ja, Antonia hatte Recht, es war perfekt für sie, um sich in der Masse der Masken und Scharaden zu verbergen. Und wenn Diener um sie waren, waren sie sicher, nicht wahr? Sie würde Netta mitnehmen, wie immer. Wenn man Antonia und Lucia allein auf die Straße ließ, warum dann nicht auch sie? Es durfte sie doch lediglich niemand sehen – und das würde man sie nicht, nicht an Karneval!
Nicht an Karneval…
Plötzlich schien die Welt wieder hell.
„Ja“, sagte sie atemlos, „ja, das will ich!“
Tränen und Betteln nützten nicht viel bei Umberto Castini. Sie wusste schon lange, dass wochenlanges Heulen nicht zum Ziel führte. Wann immer sie etwas hatte durchsetzen wollen, hatte der Vater sie erst angehört, als sie vernünftig gesprochen hatte. Und das tat sie diesmal wieder. Kein Jammern, Heulen oder Zähneklappern – nein, Umberto Castini, der seine Tochter sowieso nie tröstend in die Arme genommen hätte, sollte sehen, wie erwachsen und zuverlässig sie war, dass er ihr vertrauen konnte, dass sie das Versprechen an die Mutter ehren würde.
Manchmal, in der Nacht, träumte sie von Sandelholz…
Am Tag war sie nüchtern. Sittsam, brav stand sie dem Vater gegenüber, legte mit sachlicher Stimme ihre Argumente dar, während draußen Turniere begangen und die Verlobung des jungen Medici mit der Orsini gefeiert wurde. Davon sprach Susanna nicht. Ihr ging es nicht um Feierlichkeiten, sondern um Masken. Sie verbarg ihr klopfendes Herz und ihre schweißnassen Hände, senkte artig den Kopf, hörte seine Gegenargumente, nahm ihren ganzen Verstand beisammen und zerlegte sie, eines nach dem anderen, immer darauf bedacht, nicht aufmüpfig zu wirken. Das Gespräch dauerte den ganzen Nachmittag. Am Ende ließ er sie auf die Bibel schwören, dass sie das Andenken an ihre Mutter ehren und ihre Tugend schützen würde, und dass sie mitnichten die Erlaubnis nutzen wollte, um sich mit irgendeinem Flegel zu treffen – den sie im Übrigen ja auch niemals hätte kennen lernen können. Sie schwor. Und sie bekam die Erlaubnis, am späten Nachmittag für zwei Stunden mit ihren Cousinen und Netta auf die Piazza zu gehen, abgeschirmt durch die bewaffneten Bedienten.
Sie war so außer sich vor Glück, dass sie Netta sofort mit einer Botschaft zu den Cousinen schickte. Nur kurze Zeit später erschienen Antonia und Lucia bei ihr mit einem Kopf voller Ideen für Verkleidungen und Kostüme. Was dies anbetraf, so musste Susanna sie zügeln. Der Vater hatte ihr nur ein schlichtes Gewand mit einer Samtmaske zugestanden, mehr nicht. Schmücken durfte sie sich nicht.
„Egal“, sagte Antonia nach kurzem Zögern, „vollkommen egal! Oh, Susanna! Wie ich mich freue! Vielleicht sehen wir ja sogar die Montecaldos wieder!“
„Sebastiano Montecaldo will ich gar nicht sehen“, murrte Lucia.
„Wer spricht denn von dem Flegel“, sagte Antonia wegwerfend, „wir interessieren uns nur für Gianni!“
„Nun ja“, sagte Susanna errötend, „Vater hat mich auch schwören lassen, den Montecaldos aus dem Weg zu gehen. Er möchte wohl nicht, dass Francesco Montecaldo denkt, ich wäre sittenlos.“
„Weil du einmal auf den Karneval gehst?“, empörte sich Antonia.
„Du gehst doch mit uns!“, stimmte Lucia ins selbe Horn.
Susanna lächelte schwach.
„Er hat es mich schwören lassen“, sagte sie, „aber das ist auch nicht so wichtig. Du hast es doch selbst gesagt, Antonia. Nach Ostern werde ich heiraten, und dann sehe Gianni Montecaldo sowieso jeden Tag. Das hat Zeit. In dieser Nacht möchte ich die Welt sehen!“
„Und das wirst du, meine Liebe“, sagte Antonia befriedigt, „das wirst du!“
*
Carnevale…
Einmal im Jahr die Gesetze aufgehoben, einmal im Jahr Rausch und Farben, Taumel und Trubel, Masken und schillernde Kostüme. Noch nie hatte Susanna bislang dabei sein dürfen. Wie verzaubert, nahezu trunken folgte sie ihren Cousinen durch die Straßen. Sie klammerte sich an Nettas Arm, aber nicht, weil sie nicht sehen konnte, sondern weil sie so viel sah.
Ein Mann mit drei Köpfen, schwer zu sagen, welcher davon echt und welche aus Pappmaschee waren…
Eine große Frau ganz ohne Gesicht, erst bei genauerem Hinschauen entdeckte man die winzigen Löcher auf ihrer Brust, durch die der Träger des Kostüms heraus blinzelte…
Ein atemberaubendes Kleid aus schillerndem Satin und Spitzen, dazu eine hohe Frisur und eine geschmückte Maske, welche die Dame verbarg, die sich kichernd an den Arm ihres Galans hängte – mochten die Kirchenmänner auch hoffen, es sei ihr Ehegemahl…
Ein Boot mit gespannten Segeln, aus dem ein paar Beine herausragten…
Ein lebensechter Widderkopf auf einem menschlichen Körper…
Und Masken, Masken, überall wo sie hinsah, Masken. Schlichte wie ihre, aufwendig geputzte, menschlich verfremdete – alle Arten von Masken, so dass sie, Susanna Castini, zum ersten Mal in ihrem Leben in der Masse unterging und fast betäubt war von den vielen Eindrücken, die an sie heran schwappten.
„Susanna – gebrannte Nüsse! Probier mal!” Lucia, selbst ganz aufgelöst, schob ihr ein paar kandierte Leckereien in den Mund.
„Sieht nur, da hinten!“, rief Antonia, deren dunkle Wangen heute regelrecht glühten, „eine Frau auf einem Seil! Sie tanzt!“
Jubelnd, Beifall klatschend, atemlos fasziniert drängte sich die Menge um die todesmutige Künstlerin, die hoch über ihnen balancierte. Ein älterer Mann sammelte Münzen für sie ein, pries und lobte sie, und die Leute schnappten nach Luft, als das Mädchen ein Rad schlug und sicher zum Stehen kam. Susanna wurde etwas zu trinken in die Hand gedrückt, sie nahm einen Schluck, ohne nachzudenken. Es schmeckte scharf auf ihrer Zunge. Netta schlug den Becher weg und zog sie fort. Antonia, die inzwischen eine neue Lustbarkeit entdeckt hatte, schob sie weiter. Lucia plapperte, und Netta, die doch sonst so geschwätzig war, hatte es vor Staunen die Sprache verschlagen.
Susanna empfand ähnlich. Auch sie hatte keine Worte für das Spektakel um sie herum, die vielen Eindrücke, die fremden Menschen, und den ungehinderten Blick, den sie hatte. Vier Diener schirmten sie so gut wie möglich ab, doch da Antonia und Lucia ungebremst von einer Attraktion zur nächsten sprangen, war dies alles andere als eine leichte Aufgabe. Die Zeit verrann wie im Fluge, sie war sich nicht sicher, ob die gestatteten zwei Stunden nicht längst vergangen waren. Es wurde dunkel, aber weder Antonia noch Lucia oder Netta und die Diener wiesen auf die fortgeschrittene Stunde hin. Und sie, Susanna, war viel zu überwältigt, um umkehren zu wollen. Nur noch ein bisschen weiter, nur noch ein bisschen länger…
Es näherte sich eine große, ausgelassene Truppe von jungen Leuten, allesamt fabelhaft maskiert und beschwipst. Die Menschen wichen ihnen aus, wo sie es nicht taten, wurde nachgeholfen. Eine Frau lachte hoch und schrill. Susanna nahm sich plötzlich vor, in den Gesichtern um sie herum doch nach einem zu suchen, dass Gianni Montecaldo gehören konnte, und schalt sich sogleich für ihren Ungehorsam. Was war denn nur los mit ihr?
Ein Geruch von Sandelholz senkte sich auf sie herab.
„Vorsicht, Vorsichtig!“, warnte Netta, denn die laute Truppe kam ihnen immer näher.
Jemand drängte sie nach hinten, plötzlich waren ganz viele Menschen da. Eine Parade? Ein Umzug? Sie verlor Nettas Arm. Getöse wurde hörbar, jemand war zu Boden gegangen, empörte Stimmen erklangen. Sie wich von selbst zurück, mitten in einem Händel wollte sie nicht stehen, und dann zogen die Masken wieder weiter, rissen sie ein Stück mit, lauter strahlende, lachende Leute, deren Heiterkeit sie ansteckte und für einen Moment folgen ließ, als würde sie doch ihr Versprechen brechen wollen. Fast wie in Trance ließ sie sich mitführen im Strom der Ausgelassenheit, betört von dem Gelächter und den Gerüchen. Dann stolperte sie über einen Stein, wäre fast gestürzt. Die Erschütterung brachte sie wieder zu sich. Sie löste sich aus der Truppe, trat schnell beiseite, ein, zwei Stufen hinunter, und ließ die anderen allein vorbeitaumeln. Schließlich warteten auf der anderen Seite dieser Horde Netta und ihre Cousinen, und die durfte sie nicht verlieren. Wo waren überhaupt die Diener?
Sie sah sich erschrocken um. Ein wenig isoliert stand sie, niemand belästigte sie, alle waren damit beschäftigt, die Masken zu begutachten und zu johlen. Kein bekanntes Gesicht war um sie. Ihr wurde plötzlich mulmig – und da war er dann wieder, der betäubende Geruch von Sandelholz, der ihr in die Nase drang und sie schwindlig machte. Sie drehte sich um.
Er stand hinter ihr. Ein junger Mann, ein Junge vielleicht noch, nur wenig älter als sie. Ein Bein war krumm, als sei es gebrochen worden und schlecht verheilt. Seine Kleidung war arm, jedoch sauber. Er schaute sie einfach nur an. Ihr stockte der Atem.
Er kam einen Schritt näher.
„Hab keine Angst“, sagte er.
Seine Stimme klang ein wenig rau, als habe er den Stimmbruch noch nicht lange hinter sich und sei es nicht gewöhnt, viel zu sprechen.
„Hab keine Angst“, wiederholte er, „ich tue dir nichts. Mein Name ist Luca. Ich weiß, du hast mich noch nie gesehen. Aber ich, ich habe dich schon oft gesehen, und ich weiß, wer du bist, Susanna Castini.“
Sie sagte nichts. Das Herz klopfte ihr bis zum Hals.
Er streckte die Hände aus, die Handflächen nach oben.
„Hier“, sagte er, „ich bin nicht bewaffnet, und ich will dich nicht bedrohen. Ich will dich nur wissen lassen, dass du nicht allein bist. Ich will dich wissen lassen, dass ich verstehe, was du bist, und warum man dich versteckt.“
Nun, was das anbetraf, wusste er mehr als sie. Sie sprach noch immer nicht.
Der Junge namens Luca lächelte.
„Wir sind verwandt, du und ich“, sagte er, „das mag dir seltsam vorkommen, mit deinen Juwelen und prächtigen Kleidern, und deinen vielen Dienstboten. Aber wir sind gar nicht so weit auseinander. Unsere Großmütter waren Schwestern.“
Sie schluckte. Es war ihr klar, dass er das bemerken musste. Aber sie sprach noch immer nicht, und sie schrie auch nicht, was sie hätte tun sollen.
Lucas Lächeln vertiefte sich.
„Deine Großmutter ist tot“, sagte er, „wie deine Mutter und meine. Aber meine Großmutter lebt noch. Sie schickt mich. Wir kennen dich. Wir verstehen dich. Du bist so wie wir.“
Sie hörte seine Worte. Sie zitterte – nicht vor Angst, sondern vor Aufregung.
„Rosalba, meine Großmutter“, fuhr er fort, „sagt, du bist allein. Du bist einsam. Sie sagt, du brauchst uns. Sie will dich schon so lange befreien, aber du… an dich kommt man ja nicht heran. Bis heute – bis jetzt. Deshalb bin ich hier, Susanna. Ich bin hier, um dich zu holen. Komm mit mir.“
Sie öffnete den Mund. Ihre Lippen waren ganz trocken, sie musste sie erst befeuchten.
„Wer bist du?“, fragte sie, obwohl er das ja längst gesagt hatte.
Luca hob die Schultern.
„Ein Gaukler bin ich“, sagte er, „ein Hanswurst, ein Tagedieb, wenn man die Herren befragt. Ein ganz tauglicher Gehilfe, fragt man den Gewürzhändler und den Apotheker. Ein kluger Kopf, der die Welt versteht, sagt Rosalba. Aber du hast Recht, Susanna – ich bin kein reicher Bürgersohn, kein Patrizier, kein geleckter Galan. Ich bin einer von denen, die du sonst nicht siehst, einer von den Verborgenen. Ich bin einer von denen, über die man nicht spricht, weil man sie nicht versteht. Ich bin einer von denen, die anders sind.“
Sie schluckte erneut. Ihr war ganz schwindlig, in ihren Ohren rauschte es. Er streckte wieder die Hand aus.
„Ich bin so wie du“, flüsterte er, „ich bin dein Bruder. Komm mit mir, Susanna. Bei uns bist du sicher, bei uns musst du dich nicht verstecken. Bei uns kannst du lernen. Folge mir, und ich zeige dir unsere Welt. Du wirst sie mögen, ich verspreche es dir.“
Sie rührte sich nicht. Still und stumm starrte sie auf die ausgestreckte Hand, auf diesen seltsamen Jungen mit dem lahmen Bein, und auf die dunklen Stufen hinter ihm, die wer-wusste-wohin führten.
„Komm!“, wiederholte er drängend, „sie suchen dich! Sie werden gleich hier sein! Wenn sie dich finden, nehmen sie dich wieder mit, und du musst zurückkehren! Komm jetzt mit mir, Susanna! Vertrau mir! Folge mir!“
Sie hörte wie von Ferne die Stimmen von Lucia, Netta und Antonia – besorgt, nach ihr rufend, bereits eine panische Note in der ausgelassenen Heiterkeit. Sie sollte sich umdrehen, die Stufen hinaufgehen und Sicherheit und Schutz bei ihrer Familie suchen. Sie sollte nicht in dieses Gesicht schauen, mit grünen Augen wie ihren, betörenden Worten lauschen und im Schatten das sehen, von dem sie irgendwie immer gewusst hatte, dass es da war.
Ihr Mund war trocken, ihr Herz schlug wie rasend. Luca sagte nichts mehr, machte nur noch eine bittende Bewegung mit seiner Hand.
Und Susanna lächelte.
Dann löste sie die Maske von ihrem Gesicht, ließ sie fallen, ergriff seine Hand und folgte ihm in die Schatten.
1. Teil: Die Söhne von Florenz – 1469
„Ihr seid zu spät – wieder einmal“, sagte Cesare Montecaldo scharf, „wo seid ihr gewesen?“
„Hier und da“, gab Sebastiano achselzuckend zurück, „was soll’s. Haben wir das Essen verpasst? Macht nichts, wir haben schon was gegessen.“
„Auf der Straße, natürlich“, spottete Minerva, „wie deine Freunde, die Lümmel!“
„Neidisch auf meine Freunde, Schwesterchen?“, stichelte Sebastiano.
„Pah!“ Minerva warf den Kopf zurück.
Die Geschwister saßen im Palazzo Montecaldo, im oberen Sala, das Essen war gerade abgetragen worden. Der obere Saal diente als Speisezimmer, denn die Küche lag im Stockwerk darüber, und so war der Weg der warmen Speisen nicht weit. Der Palazzo war vergleichsweise alt und klein, und ließ deshalb solchen Komfort vermissen, wie in dem erst vor einigen Jahren fertiggestellten Palazzo Medici. Aber für die wenigen Familienmitglieder der Montecaldo war er durchaus ausreichend.
„Es reicht“, unterbrach Cesare den Streit, „Vater war zornig, Sebastiano. Er ist ins Kontor gegangen, aber wenn er zurückkommt, will er Antworten haben!“
„Er kriegt dieselben wie immer“, erwiderte Sebastiano nachlässig, „warum bemüht er sich überhaupt noch?“
„Das frage ich mich manchmal allerdings auch“, murmelte Minerva.
Cesare schüttelte den Kopf.
„Du bist ein hoffnungsloser Fall“, tadelte er, „fein, wenn du dich so aufführen willst, dann tue es halt…“
„Danke“, unterbrach Sebastiano frech.
„Aber“, fuhr Cesare ungerührt fort, „warum musst du unseren kleinen Bruder mit hineinziehen? Gianni. Du solltest es besser wissen!“
„Soll das heißen, ich bin ein schlechter Einfluss auf den Kleinen?“, witzelte Sebastiano.
„Allerdings!“, fauchte Minerva.
„Du bist der Ältere, du solltest Vorbild sein“, mahnte Cesare, „Gianni tut es nicht gut, wenn du ihn ständig Streit und Gefahren aussetzt!“
„Ich wusste gar nicht, dass ich das mache“, sagte Sebastiano, „ich dachte bloß, wir würden ein bisschen Spaß haben und etwas Farbe in dieses graue Leben bringen. Jetzt hört aber auf. So eine Lappalie – wenn ich Euch erst sage, was wir auf der Piazza erfahren haben, seid ihr bestimmt nicht mehr böse!“
„Das müssen ja großartige Neuigkeiten sein“, erwiderte Minerva sarkastisch.
Sebastiano feixte bloß.
„Möglich”, meinte er lässig.
„Und, was sind sie?“, forderte Cesare, „heraus damit! Vielleicht bewahrt dich das ja diesmal vor Vaters Strafen.“
„Nun“, Sebastiano grinste, „zumindest wird er andere Dinge im Kopf haben, als mich zu züchtigen. Vater! Da seid Ihr ja! Gianni und ich haben uns etwas verspätet.“
Francesco Montecaldo, groß gebaut und kräftig, betrat mit polternden Schritten den Raum, und alle seine Kinder nahmen unwillkürlich Haltung an, sogar der ungestüme Sebastiano.
„Etwas?“, knurrte der Hausherr, „etwas? Du hast Nerven, mein Sohn!“
„Sebastiano hat etwas Wichtiges erfahren“, sagte Cesare rasch, „das hat ihn aufgehalten.“
Der Vater hielt tatsächlich inne.
„Nun denn?“, sagte er, „heraus mit der Sprache!“
Sebastiano grinste wieder.
„Tja“, sagte er, „es wird Euch umhauen. Sie versuchen noch, es geheim zu halten, aber das gelingt ihnen nicht mehr. Es wird ein Riesenskandal!“
„Und was?“, sagte Minerva ungeduldig.
Sebastianos Grinsen vertiefte sich noch ein Stück.
„Die Neuigkeit ist“, sagte er und machte eine dramatische Pause, „dass Susanna Castini, einziges Kind des Umberto Castini, vor zwei Tagen spurlos verschwunden ist!“
Es schlug tatsächlich ein wie eine Bombe, Sebastiano konnte mit seiner Ankündigung zufrieden sein.
„Verschwunden!“, rief Cesare ungläubig.
„Verschwunden!“, echote Minerva.
„Bitte – verschwunden?“, knurrte der Vater.
Gianni sagte nichts.
„Sebastiano!“, forderte der Vater, „das musst du genauer berichten! Was ist passiert? Was erzählt man sich? Und warum hat Castini sich noch nicht gemeldet?“
„Nun“, Sebastianos Grinsen war nahezu unerträglich, „der alte Castini hat sich wohl tatsächlich getraut, sein behütetes Töchter im Karneval unter dem Schutz ihrer Cousinen auf die Straße zu schicken. Es kam, wie es kommen musste. Sie wurde von ihren Begleitern getrennt – und niemand hat sie wieder gesehen. Spurlos verschwunden, wie vom Erdboden verschluckt! Die Cousinen können nichts erklären, die Zofe weiß nichts, die Diener nicht – die kleine Castini hat sich in Luft aufgelöst!“
„Niemand löst sich in Luft auf“, sagte der Vater grimmig, „weiter!“
„Was wohl weiter“, spottete Sebastiano, „Lucia und Antonia sind kreischend zu ihrem Onkel gerannt und haben ihn informiert. Seitdem suchen sie. Natürlich ist es ziemlich schwierig, im Karneval ein verschwundenes Mädchen zu finden. Aber heute ist Aschermittwoch, und sie ist immer noch nicht wieder aufgetaucht. Tja, Gianni, deine Braut ist futsch!“ Er lachte heftig und schlug dem Bruder auf die Schulter.
Gianni sagte noch immer nichts.
„Und Castini versucht, die Sache zu vertuschen, bis er sie wieder hat, was?“, folgerte der Vater, „aber so nicht mit mir!“
„Es ist wohl nicht davon auszugehen, dass die kleine Castini unversehrt wieder auftauchen wird“, grinste Sebastiano.
Cesares Gesicht verfinsterte sich.
„Es liegt doch auf der Hand“, sagte er hart, „das Mädchen ist ein Flittchen! Castini hat uns mit seiner Strenge und seinem keuschen Gebaren getäuscht. Sie hat den Trubel genützt, um sich mit ihrem Liebhaber zu treffen! Vielleicht sind sie sogar durchgebrannt! Und Castini will uns weiter täuschen! Du musst die Verlobung sofort lösen, Vater!“
„Cesare!“, sagte Minerva schockiert, „es kann dem Mädchen doch auch etwas zugestoßen sein! Vielleicht hat man sie entführt! Immerhin ist Castini reich, nicht wahr? Und er hat sie immer eingesperrt – sie wird nicht in der Lage sein, sich zu wehren. Das arme Ding! Allerdings…“ sie zögerte und sah zu dem stummen Gianni, „allerdings, wenn sie nicht mehr unberührt ist, darf Gianni sie nicht mehr nehmen.“
„Eben!“, sagte Cesare, „du musst die Verlobung lösen!“
„Ich? Pah!“, sagte der Vater trocken, „nichts dergleichen werde ich tun! Ich bin doch nicht dumm! Hat sie ein Abenteuer gehabt, die kleine Castini, ist sie jetzt beschädigt – na und? Ihr Vater hat Geld wie Heu! Er soll mir den Verlust mit Münzen ausgleichen, dann findet die Hochzeit nach wie vor statt! Vielleicht ist es sogar von Vorteil!“
Er beugte sich zu seinem Jüngsten und zerzauste ihm grob die Haare.
„Hat wenigstens einer von euch Feuer im Hintern“, murmelte er, und dann, lauter, „ich schicke einen Boten zu Castini. Wir bieten ihm an, bei der Suche zu helfen, vorausgesetzt, er lässt sich auf unsere Bedingungen ein. Wissen wir jetzt endlich, wie das Mädchen aussieht? Ist sie entstellt?“
„Das Bild soll noch nicht fertig sein, Vater“, sagte Cesare, „aber Angelica hat ihre Cousinen befragt. Die behaupten beide, die kleine Castini sei so schön wie ein Engel!“
„Natürlich behaupten sie das“, schnauzte der Vater, „zahlt Castini doch ihre Kleider und Lehrer! Ich will wissen, wie das dumme Ding aussieht, damit wir sie finden können! Hach – dann muss ich eben selbst zu Castini gehen!“
Er drehte sich um und verschwand wieder nach hinten, Richtung Kontor, von wo er gekommen war. Zurück blieben seine vier Kinder, drei davon ernüchtert, und eines immer noch boshaft grinsend.
„Wusste ich doch, dass er sogar daraus Kapital schlagen würde“, sagte Sebastiano gehässig, „na klar! Francesco Montecaldo! Nichts ist zu schade für seinen Aufstieg! Er verkauft sogar seinen Sohn an eine Schlampe!”
Und da gab Gianni einen Laut von sich, wandte sich ab und lief ans Fenster.
Minerva und Cesare tauschten einen stirnrunzelnden Blick.
Gianni rührte sich nicht mehr.
„Gianni?“, fragte Cesare fordernd.
Keine Reaktion. Minerva legte Cesare die Hand auf den Arm.
„Lass mich“, sagte sie.
Sie trat zu dem Kleinen und fuhr ihm durch die wirren Locken, wie zuvor der Vater.
„Gianni?“, fragte sie ein wenig ruppig, „ist alles in Ordnung? Du musst dich Vaters Willen beugen, das weißt du doch, oder? Ganz egal, was du von Castinis Tochter hältst, wenn er es will, wirst du sie heiraten.“
Gianni sagte nichts.
Minerva seufzte.
„Sieh es doch mal so“, fügte sie hinzu, „vielleicht ist ihr gar nichts geschehen. Oder vielleicht ist sie völlig unschuldig!“
Wieder nichts. Jetzt lachte nicht einmal mehr Sebastiano.
„Hey, Gian“, sagte er, „was ist denn los mit dir?“
Gianni zog kurz die Nase hoch.
„Warum ist sie weggelaufen?“, fragte er erstickt.
Die drei Älteren tauschten einen Blick. Sebastiano wurde plötzlich rot.
„Aber das weißt du doch gar nicht“, sagte Minerva verdutzt, „sie kann auch entführt worden sein. Es gibt viele Gerüchte über Castinis Tochter, und viele, die an ihrem Erbe interessiert sind.“
„Aber man kann sie nicht einfach so entführen“, sagte Gianni folgerichtig, „nicht in Florenz. Und man kann sie auch nicht gegen ihren Willen und den ihres Vaters verheiraten. Sie ist weggelaufen, oder? Warum?“
„Hör mal, Gian“, begann Sebastiano unbehaglich.
Gianni schüttelte den Kopf.
„Ist es meinetwegen?“, fragte er, „weil wir nach Ostern heiraten sollen? Hat sie Angst vor mir?“
„Gianni“, sagte Cesare stirnrunzelnd, „sie kennt dich doch gar nicht. Warum sollte sie dich fürchten?“
„Aber wir sind uns begegnet“, beharrte Gianni, „bei der Messe, nicht wahr, Sebastiano? Als Renaldo sich mit dem Tuchhändler angelegt hat! Da war sie dabei!“
„Sebastiano?“, forderte Cesare scharf.
Der schluckte.
„Ich habe mich mal umgehört“, sagte er, „ich weiß, wer diese Cousinen sind. Ich dachte, es kann ja nicht schaden. Wenn dann ein tief verschleiertes Mädchen mit Lucia und Antonia unterwegs ist, wer soll das denn sein, wenn nicht die kleine Castini? Aber sie hat kein Wort gesprochen, und Gianni hat es erst hinterher erfahren, von mir. Also.“
Er sprang von seinem Platz und kam mit kräftigen Schritten auf den kleinen Bruder zu, um ihn bei den Schultern zu fassen.
„Was ich da vorhin gesagt hab, Gian, das war Unsinn“, sagte er ernst, „ich dachte, du wüsstest das. Wenn die kleine Castini wirklich weggelaufen ist, wird sie nicht eine Sekunde dabei an dich gedacht haben – eben, weil sie dich nicht kennt und nicht weiß, was für ein Glück sie hat, ausgerechnet den besten von uns zu kriegen. So, und jetzt macht nicht so ein Gesicht, ja? Es ist nicht deine Schuld. Es wird sich alles klären. Vielleicht ist es bloß ein dummes Missverständnis! Und nach Ostern hast du vermutlich eine bildhübsche Braut an deiner Seite und kommst aus dem Grinsen gar nicht mehr heraus. Na los, Gian! Sei kein Idiot!“
Das half, es half immer. Giannis unsicheres Gesicht hellte sich zunehmend auf, bis ein kleines Lächeln darauf erschien.
„Na, wenn du meinst“, murmelte er.
„Was hast du denn zu ihm gesagt, Sebastiano, dass er glauben musste, er sei schuld?“, fragte Cesare scharf.
Sebastiano sah ihn gar nicht an.
„Ich habe ihn wieder mal verdorben, was sonst“, gab er kalt zurück, „nerv mich nicht, Cesare. Komm, Gianni, wir gehen in die Küche und schauen mal, was wir da so stibitzen können. Ja?“
„Ich dachte, ihr habt schon gegessen“, entgegnete Minerva spitz.
Sebastiano zuckte großartig mit den Schultern.
„Ein echter Mann“, behauptete er, „kann immer essen. Und das sind wir, Gian, was? Echte Männer! Also komm!“
„Ja“, sagte Gianni leise, „das sind wir. Lass uns gehen.“
*
Aber die kleine Castini tauchte weder am nächsten Tag auf noch an dem darauf, und erst recht nicht in der folgenden Woche. Allem Suchen zum Trotz blieb sie spurlos verschwunden. Ostern kam, ohne dass die Rede von einer neuen Braut im Hause Montecaldo sein konnte.
„Es ist spät, Gianni!“, sagte Sebastiano ärgerlich, „nun komm schon! Ich werde hier nicht stehen und auf dich warten!“
„Ich bin gleich so weit“, sagte Gianni.
„Was machst du da überhaupt?“, fragte Sebastiano.
Gianni deckte schnell die Hand über das Papier.
„Es ist für Minerva“, sagte er, „lass es, Sebastiano. Du weißt, wie wütend sie werden kann.“
Sebastiano trat einen Schritt zurück und zuckte mit den Schultern.
„Wenn du meinst“, sagte er nachlässig, „aber ich finde, Kleiner, du solltest dich von unserer Schwester nicht als Botenjunge missbrauchen lassen. Du bist ein Montecaldo! Sie kann Diener beschäftigen!“
„Diener können reden“, murmelte Gianni.
„Und du bist stumm?“, hänselte Sebastiano.
„Nein, nein“, lenkte er sofort danach ein, „ich will dich nicht aufziehen. Schließlich weiß ich es genauso wie unser Schwesterlein zu schätzen, dass du keine Petze bist. Apropos – jetzt reicht es. Wir wollen los.“
„Ich bin ja auch so weit“, sagte Gianni hastig, rollte das Papier zusammen und steckte es in seine Tasche. Lächerlich war es irgendwie schon, das Ganze, Sebastiano hatte Recht. Aber ihm, Gianni, fiel es schwer, seiner älteren Schwester entgegen zu treten und einen Gefallen, den sie von ihm forderte, abzulehnen. Allerdings hatte Minerva ihn noch nie in Schwierigkeiten gebracht. Sebastiano hingegen tat das ständig.
„Was drängelst du überhaupt so?“, fragte er, „die Messe hat noch nicht einmal angefangen! Es sind noch Stunden, bis wir zu Giuliano gehen!“
„Mag sein, aber wir sind mit Renaldo verabredet“, erklärte Sebastiano, „und du weißt ja, was geschieht, wenn man ihn warten lässt.“
„Renaldo?“ Gianni zog unbehaglich die Schultern zusammen, „wirklich? Ich dachte, er hätte Hausarrest?“
„Wegen dem bisschen Ärger? Pah“, erwiderte Sebastiano herablassend, „das hat doch keine Konsequenz für einen Pazzi!“
„Ich habe gehört, der Händler ist vor den Rat gegangen.“
„Na und?“, spottete Sebastiano, „sein Vater hat den Ballen bezahlt. Wenn der Händler auch so jammert!“
„Wir sind ebenfalls Händler“, erinnerte ihn Gianni besorgt.
Sebastiano lachte auf und zerwuschelte ihm die Haare.
„Oh bitte!“, sagte er, „du kannst ja wohl so ein kleines Licht wie den nicht mit Francesco Montecaldo gleichstellen, oder? Wo kämen wir da hin! Der Meister unter den Kaufleuten, der Messias der Handeltreibenden, der Erleuchtete, der…“
„Sch! Hör auf“, sagte Gianni, aber er lachte schon wieder, „du bist unmöglich! Wenn er dich hört!“
„Er ist gar nicht da“, erwiderte Sebastiano verächtlich, „mit Cesare hinten im Lager sind sie, und zählen. Heute! Aber was will man erwarten!“
„Ich weiß“, murmelte Gianni, „Cesare wollte, dass ich ihm helfe.“
Er zog unbehaglich die Schultern zusammen. Der gestrenge Blick seines ältesten Bruders verursachte ihm mitunter mehr Bauchschmerzen als die Aufmerksamkeit des Vaters. Aber von der bekam er ja glücklicherweise als Jüngster sowieso recht wenig ab. Immerhin standen sie alle vor ihm in der Reihe – der Mustersohn Cesare mit seinen Kalkulationen und Schuldscheinen, die willensstarke Minerva mit ihrem verschollenen Ehemann, und der Aufwiegler Sebastiano, der sich mitunter einen regelrechten Spaß daraus zu machen schien, den Vater auf die Palme zu bringen. Nein, für ihn, Gianni, den jüngsten, den kleinsten, blieb da wenig Zeit. Aber seine Geschwister sorgten schon dafür, dass er sich nicht langweilte. Und wenn er wählen konnte zwischen Minervas Aufträgen, Cesares strengen Lehrstunden über das Geschäft und Sebastianos Streichen – na, da wusste er, was er nahm. Das tat er sogar, wenn ein eingebildeter Patriziersohn wie Renaldo de’ Pazzi zu Sebastianos Freunden gehörte. Also gut. Mochte er Renaldo wegen dessen Dünkelhaftigkeit auch nur wenig leiden – wenn der Bruder ihn als Freund sah, dann bitte. Er, Gianni, würde Sebastiano auch durch die Hölle folgen, wenn es nötig wäre.
An diesem Tag war es zum Glück nicht die Hölle, sondern die Ostermesse – und hinterher ein Essen im Haus ihres Freundes Giuliano. Das waren wirklich gute Aussichten. Giulianos Familie war großzügig, hatte ein Haus voller Kunstwerke und Kuriositäten, interessante Lehrer und immer Zeit für Sorgen und Nöte.
Und abgesehen davon, wenn er sich irgendjemanden auf der Welt hätte aussuchen können, um so wie dieser zu sein, dann wäre es Giuliano de’ Medici gewesen.
*
„Venedig, also?“, fragte Giuliano leise.
„Venedig“ bestätigte Sebastiano seufzend, „und es könnte so schön sein, wenn nur Gianni und ich gehen würden und nicht der Mustersohn Cesare!“
„Na, hör mal, Sebastiano“, meinte Giuliano lächelnd, „sei ehrlich. Du bist doch froh, dass Cesare dabei ist und das Geschäftliche übernehmen wird. Sonst würde die ganze Verantwortung auf deinen Schultern ruhen!“
„Und wehe, was mir blühte, käme ich ihr nicht nach“, seufzte Sebastiano komisch, „du hast schon Recht, aber das meinte ich nicht. Ich würde viel lieber eine Vergnügungsreise machen und Gianni die besten Hurenhäuser Venedigs zeigen. Es wird Zeit, er ist schon zwölf.“
„Also wird es definitiv nichts mit der Hochzeit?“, hakte Giuliano nach.
Sebastiano verdrehte die Augen.
„Wie denn, wenn die Braut verschollen ist?“, meinte er spöttisch, „Cesare liegt Vater in den Ohren, das Verlöbnis zu kündigen. Keine Spur von der kleinen Castini, seit dem Karneval. Wenn sie noch lebt, dann bestimmt nicht in unversehrtem Zustand. Aber Vater…“
Er brach ab. Giuliano musterte ihn vorsichtig. Der bittere Tonfall war zwar selten an dem leichtsinnigen jungen Montecaldo, jedoch nicht völlig ungewohnt.
„Dein Vater…?“, fragte er sanft.
Sebastiano schnaubte.
„Vater sind Macht und Geld wichtiger als die Ehre seines Sohnes“, sagte er bitter, „wenn die größte Hure von Florenz ihm beides bieten würde, würde er ohne zu zögern mich oder Gianni an sie verkaufen!“
„Na“, machte Giuliano, „das kann ich dann aber doch nur schwer glauben!“
„Und warum hält er sonst diese Verlobung aufrecht?“, beharrte Sebastiano.
Giuliano lächelte.
„Seltsam, gut“, gab er zu, „aber man weiß überhaupt nicht, was mit der kleinen Castini geschehen ist. Vielleicht ist sie unschuldig! Die größte Hure von Florenz ist sie bestimmt nicht. Abgesehen davon – war es nicht der Wunsch eurer Mütter, dass die beiden heiraten sollen?“
„Mutter war mit Caterina Castini befreundet“, sagte Sebastiano achselzuckend, „und ja, Caterina Castini hat sie auf dem Sterbebett darum gebeten. Vielleicht hat sie deshalb zugestimmt – aber Vater hat lediglich eingewilligt, weil die Kleine Castinis einzige Erbin war. Und das ist sie eben immer noch, egal, wo sie ist.“
„Was ist denn mit den Cousinen?“
„Nur, wenn Castinis Tochter tot wäre“, meinte Sebastiano, „aber er weigert sich, sie für tot erklären zu lassen. Soll sie immer noch suchen. Na, meinetwegen kann er suchen, solange er will. Gianni und ich gehen nach Venedig, jetzt, wo die Hochzeit abgesagt ist.“
„Und für wie lange?“
„So lange, wie es dauert.“
„Ich frage nur, weil Lorenzo im Juni heiraten wird“, sagte Giuliano, „es wäre schade, wenn ihr das verpasst. Ich soll nach Rom fahren, um Clarice abzuholen. Sie planen die ausgefallensten Spektakel. Andrea hat einen neuen Lehrling, der soll ganz verrückte Ideen haben. Mechanik und so – auch wenn ich echte Zweifel habe, ob sich das wirklich umsetzen lässt.“
„Bis Juni sind wir bestimmt zurück“, behauptete Sebastiano, „und sonst komme ich so vorbei. Das werde ich mir schließlich nicht entgehen lassen! Hey, Gian!“
Sein kleiner Bruder wandte den Kopf. Er stand ein wenig abseits, ins Gespräch mit Vespasiano da Bisticci vertieft, und er hatte ganz rote Wangen. Bisticci legte ihm einmal die Hand auf die Schulter und nickte mit dem Kopf, bevor er sich umdrehte und davonging. Giannis Röte vertiefte sich, als er näherkam.
Giuliano lächelte aufmunternd.
„Ich höre, man kann dir zu einer Reise gratulieren?“, sagte er freundlich.
„Ja“, antwortete Gianni und schluckte, „die Hochzeit findet nicht statt.“
„Sei doch froh“, meinte Giuliano und beugte sich vertraulich vor, „ich finde, mit zwölf ist man sowieso noch viel zu jung zum Heiraten. Lorenzo ist zwanzig und heiratet erst jetzt im Sommer. Und ich… ich werde noch ganz lange warten!“
„Du willst nicht heiraten, weil alle Töchter von Florenz an dem Tag Trauer tragen würden“, spottete Sebastiano, „und du würdest es nicht über’s Herz bringen, sie derart zu bekümmern!“
„Unsinn“, wehrte Giuliano ab, obwohl seine Wangen jetzt ebenfalls glühten, „ich bin einfach noch zu jung. Und Gianni ist erst recht zu jung!“
„Dante war auch zwölf, als er heiratete“, sagte Gianni und wurde feuerrot, als sie ihn ansahen, „es stimmt! Bisticci hat es mir gerade gesagt. Er meinte, es wäre schade, dass ich nicht in die Fußstapfen unseres großen Dichters treten würde. Na, und damit hat er bestimmt nicht meine Verse gemeint.“
„Dante hat aber auch Zeit seines Lebens Beatrice angeschwärmt“, meinte Sebastiano kopfschüttelnd, „ich bin dann doch eher für fleischliche Liebe. Hat so was Handfestes. Außerdem sagt Aristoteles, erst mit dreißig sei der Mann perfekt und solle heiraten. Schau dich doch mal um! Wer macht es heute schon noch so wie Dante!“
„Sei froh, dass Vater dich nicht gehört hat, oder Sandro“, sagte Giuliano amüsiert, „kein Wort gegen Dante! Aber du hast ja Recht…“
„Ich weiß, dass ich Recht habe“, unterbrach Sebastiano ihn grinsend, „und wo wir davon reden. Hast du Marco Vespuccis Braut schon gesehen?“
„Du meinst Simonetta Cattaneo?“ Giulianos Gesicht verfärbte sich bereits wieder, diesmal zartrosa.
„Ich meine Simonetta Vespucci“, korrigierte Sebastiano, „das verstehe ich als ja. Was für ein Augenschmaus!“
„Sie ist wirklich sehr schön“, sagte Giuliano, „Sandro schwärmt von ihr. Er will sie malen, aber noch hat Marcos Vater nicht zugesagt. Er meint, Simonetta sei zu jung.“
Sebastiano schlang einen Arm um die schmalen Schultern seines kleinen Bruders und drückte sie.
„Na, Gian?“, meinte er, „sollen wir dich zu Vespucci mitnehmen? Ein Abend mit der gottgleichen Simonetta wäre doch mal was!“
„Marco würde dich umbringen“, sagte Giuliano amüsiert, „und wenn nicht der, dann Sandro. Außerdem wird nichts daraus, wenn ihr diese Woche noch nach Venedig abreisen wollt.“
„Tja, so ein Pech“, spottete Sebastiano, „aber weine nicht, Kleiner. Simonetta läuft dir nicht weg!“
Giannis Gesicht glühte.
„Simonetta Vespucci ist mir ganz egal!“, sagte er mit einem seltenen kurzen Aufflammen von Zorn. Er wirkte wie ertappt, und setzte rasch hinterher: „Habt ihr gewusst, dass sie seit kurzem nördlich der Alpen Hunderte von Büchern drucken?“
Giuliano und Sebastiano sahen sich verblüfft an.
„Gedruckte Bücher?“ Giuliano schüttelte sich, „ja und?“
„Aber…“
„Hast du schon einmal ein gedrucktes Buch gesehen, Gianni?“, stieß Sebastiano ins selbe Horn, „hässlich! Und was für ein Aufwand! Für jede Seite muss eine Holzplatte geschnitzt werden!“
„Federico da Montefeltro weigert sich, auch nur ein gedrucktes Buch in seine Bibliothek zu nehmen“, sagte Giuliano abschätzig, „also sollen sie im Norden drucken, wie sie wollen. Sie haben kein Feingefühl! Ein gutes Buch darf nicht so verunstaltet werden. Stellt euch vor, sie würden das mit Dante machen! Oder mit Petrarca!“
„Nein“, Gianni wirkte aufgeregt, „das war es nicht, was Bisticci meinte. Er sagte, sie drucken Hunderte von verschiedenen Büchern, nicht immer ein und dasselbe mit einem Holzschnitt! Er sagt, in Mainz haben sie ein neues Verfahren entwickelt, und er sagt auch, dass ein paar Deutsche seit vier Jahren bei Rom drucken, unter dem Schutz des Papstes, und dass… dass zwei Brüder aus Speyer in Venedig sind und angefangen haben, Cicero zu drucken, die Epistolae ad familiares. Und Bisticci fand es gar nicht barbarisch!”
„Unser Bisticci? Bist du sicher?”, sagte Giuliano verblüfft.
„Vespasiano da Bisticci?”, hakte Sebastiano erstaunt nach, „der Buchhändler? Der schon Anfälle bekommt, wenn einer in der Nähe seiner Schätze niest?”