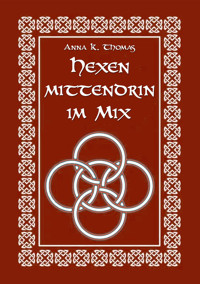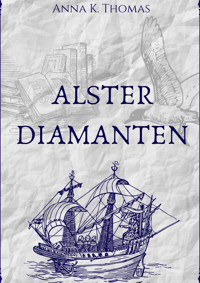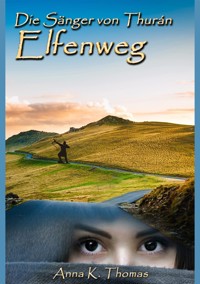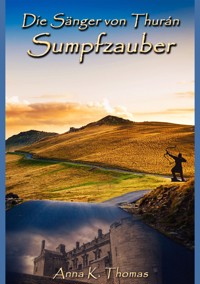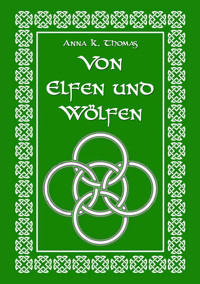
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Lucie Martin ist neu – das ist ihr nicht unbekannt. Normalerweise hat sie keine Probleme, Freunde zu finden. Aber bei den Kindern des Nachbarhauses stößt sie auf eine echte Herausforderung. Dabei sind diese ungewöhnlich genug: eine Tochter mit Aggressionsproblemen, ein Haufen Pflegekinder, der Älteste von ihnen ein verschlossener Junge mit schlohweißen Haaren, die sich nicht färben lassen. Lucie ist wider Willen fasziniert von Noel Tyll. Da ist noch etwas anders an ihm, etwas, das seine Pflegeschwester Cara alle Geschütze ausfahren lässt, etwas, das über seine Haare und seine seltsam betörende Stimme hinausgeht. Aber als Lucie schließlich herausfindet, was Noels Geheimnis ist, erfährt sie mehr, als sie wissen wollte – und auch mehr über ihre eigene Familie und ihre eigenen Wurzeln …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1142
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Lucie, die Neue
Lucie, die Naturgewalt
Lucie auf Abwegen
Noel
Lucie
Interim
Lucie in geheimer Mission
Noel
Lucie
Noel
Lucie
Noel
Lucie
Noel
Anhang
Nachwort
Personen
Lucie, die Neue
Ich kann nicht sagen, dass ich besonders gerne in das Haus am Waldrand gezogen bin.
Ich kann allerdings auch nicht sagen, dass ich besonders ungern dorthin gezogen bin. Seien wir einmal ehrlich, häufiges Umziehen und ein unstetes Leben gehören zu Penelopes Lebensentwurf. Penelope ist meine wundervolle, verrückte und sehr besondere Mutter. Da ich erst sechzehn bin und ihrer Obhut unterstehe, bin ich genauso wie sie betroffen, als ihr letzter Mäzen mit seinem (und ihrem) letzten Geld ein Flugzeug in die Karibik besteigt und nicht wiederkommt. Mit anderen Worten – meine Mutter ist wieder einmal in ihrem Leben mittellos und kurz davor, auf die Straße gesetzt zu werden.
Und ich natürlich mit ihr.
Aber da gibt es ja noch meinen Vater. In stillen Momenten wundere ich mich immer darüber, dass so jemand wie meine Ma – künstlerisch und offen, empathisch und verrückt – und mein Vater – ernst, leistungsorientiert, diszipliniert und verschlossen – jemals lange genug zueinander gefunden haben, um mich zu zeugen. Sie haben damals sogar geheiratet. Offiziell sind sie es sogar immer noch, weshalb der Nachname meiner Mutter derselbe wie meiner ist, was die Sache durchaus erleichtert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Penelope im Falle einer Scheidung den prosaischen Namen Martin beibehalten hätte und nicht zu ihrem Vorigen zurückgekehrt wäre. Eigentlich wundert es mich, dass sie überhaupt jemals gewechselt hat. Aber wie schon gesagt, an der Romanze meiner Eltern wundert mich so manches.
Etwas von den alten Gefühlen hat die Trennung noch vor meinem zweiten Geburtstag überlebt. Anders ist es nicht erklärbar, dass mein Vater immer in den Momenten auftaucht, in denen meine Mutter ihr Leben wieder einmal gegen die Wand gefahren hat, und einen Ausweg anbietet, den sie – wie meist nach einer hitzigen Diskussion – auch annimmt, zumindest für einige Zeit. Dieses Mal ist es eben das Haus am Waldrand.
Es gehört nicht meinem Vater, sondern seinem Bruder, der noch ernster, leistungsorientierter, disziplinierter und verschlossener ist, und den Mama und ich beide auf den Tod nicht ausstehen können. Mein Onkel hat das Haus vor ein paar Jahren gekauft, wenige Monate mit seiner Familie hier gewohnt, bevor er geschäftlich wieder irgendwo anders hin musste und Frau und Kinder mitnahm. Letzteres ist gut. Ich bin nämlich sicher, dass ich niemals in ein Haus gezogen wäre, in dem meine Cousins Jane und John wohnen.
Ja. Sie heißen tatsächlich Jane und John. Jane und John Martin. Sie sind tausendmal arroganter als das klingt. Und sie können mich genauso wenig leiden wie ich sie.
Ich komme sehr nach der Seite meiner Mutter. Ich habe ihre wilden Locken geerbt, ihre Neugier und ihre Offenheit. Leider habe ich nicht ein Gramm ihres künstlerischen Talents abbekommen, und das ist wirklich bedauernswert. Man kann über Penelope sagen, was man will – unstet, undiszipliniert, unfähig mit Geld umzugehen – aber sie ist unfassbar begabt. Sie malt, sie macht Skulpturen, designt Schmuck. Sie findet die verborgenen Figuren im Weiß der Leinwand, im zähen Ton, versteckt im Stein oder Metall.
Ich hingegen – nicht so sehr.
Mein Vater hat deshalb die Hoffnung, dass ich vielleicht doch insgeheim nach ihm schlage. Er hat mich in den Ferien schon ein paar Mal in Praktika in eine seiner Firmen gezwungen – ja, Mehrzahl, leider, zu beidem – und jedes Mal habe ich mich bockig geweigert. Wenn ich Ferien habe, habe ich frei! Und es ist zudem unfair, mir vorzuwerfen, etwas Disziplin würde mir nicht schaden – wer macht denn bei uns daheim den Putzplan und den Einkaufszettel und sorgt dafür, dass wir weder im Dreck ersticken noch verhungern? Bei einer Mutter wie Penelope musste ich ein bisschen Disziplin lernen, um überhaupt zu überleben!
Aber meinem Vater reicht das nicht. Er erwartet mehr von mir. Am Tag unseres Einzuges in das Haus am Waldrand hält er mir schon wieder so einen Vortrag.
„Lucie“, sagt er über eine Topfpflanze hinweg, die meine Mutter auf keinen Fall den Umzugsleuten anvertrauen konnte. „Du bist jetzt sechzehn. Du musst doch langsam wissen, was du einmal mit deinem Leben anfangen willst!“
Tja, da haben wir es. Ich bin sechzehn und habe noch keinen Masterplan, der Studium, Berufswahl und Rente mitumfasst.
Zum Glück ist Penelope in solchen Momenten auf meiner Seite, obwohl wir uns einig sind, dass ich mein Geld außerhalb der Kunst werde verdienen müssen – wegen des mangelnden Talentes, was sogar sie einsieht. Sie zieht ihn rasch von mir fort, bedankt sich mehrfach auf ihre spezielle Art und Weise für das Haus – ein wirklich charmantes Haus, wirklich! – und schmeißt ihn dann raus, bevor sie erleichtert zwischen die Kisten sinkt. Ich hingegen mache mich ans Auspacken. Wie gesagt, eine von uns muss das ja übernehmen, das mit dem Organisieren.
Viel besitzen wir zwar nicht, und das Haus ist bereits vollständig eingerichtet. Aber irgendwo müssen Penelopes Arbeitssachen hin – die leere Scheune nebenan – und irgendeines der vielen Zimmer sollte ich mir aussuchen, um meine Habseligkeiten auszubreiten. Ich wähle das Kleinste von ihnen, weil ich hoffe, dass weder Jane noch John darin geschlafen haben. Eine ganze Weile verteile ich meinen Kram, um es wohnlicher zu gestalten, bis ich zum ersten Mal aus dem Fenster sehe. Das Nachbarhaus ist eine große, alte Villa, die auch schon einmal bessere Tage gesehen hat. Aber das ist es nicht, was mich entzückt: Im Garten dieser Villa sehe ich Spielgeräte und ein junges Mädchen. Sie ist zwar jünger als ich, aber definitiv zu alt für das Spielzeug.
„Mama!“, brülle ich die Treppe hinunter. „Kennst du unsere Nachbarn? Hat Papa was dazu gesagt?“
„Nein!“, brüllt sie zurück – Penelope ist praktisch nie leise, zum Glück, ansonsten hätte ich sie in dem Riesenhaus gar nicht gehört. „Soll ich mal rübergehen?“
„Warte!“, kommt meine donnernde Antwort. „Nimm lieber Kekse mit!“
Ich kann vielleicht nicht malen, bildhauern, rechnen oder meine Tage begeistert am Computer verbringen, aber ich kann backen. Habe ich schon über die Dinge gesprochen, die ich lernen musste, um bei Penelope zu überleben?
„Die Kekse sind alle!“, erklingt ihre betrübte Antwort.
Verdammt. Also lasse ich Bücher und Kissen Bücher und Kissen sein und komme hinunter in die große, glänzende Küche, die auf den ersten Blick so wenig zu uns passt wie dieses Haus. Auf den zweiten bin ich entzückt. Fein, ich werde es niemals so fleckenlos und rein hinterlassen, wie wir die Küche aufgefunden haben, aber hier gibt es praktisch alles!
Ich bin schon öfter mit Penelope umgezogen. Zu meinen erlernten Überlebenstaktiken gehört es, mir vorher anzuschauen, wo wir landen, und im Zweifelsfall, so wie hier, genügend Lebensmittel mitzubringen, dass die ersten Tage gesichert sind. Wir haben also alle Zutaten, die ich zum Glücklichsein brauche, und die meine Mutter nutzen soll, um die Nachbarn von uns zu begeistern.
Habe ich schon erwähnt, dass ich offen und kommunikativ bin und Freunde wie die Luft zum Atmen brauche? Und habe ich erwähnt, dass ich bereits mehrfach in meinem Leben umgezogen bin und jedes Mal besagte Freunde hinter mir lassen und von vorne anfangen musste? Aber ich kann ja schlecht einfach hinübergehen, klingeln und sagen – hallo, ich bin Lucie, darf ich mit ihren Kindern spielen? – zumal dies mit sechzehn auch etwas albern klingt. Besser ist es, Penelope geht zuerst, überzeugt die Frau des Hauses von ihrer wundervollen Tochter und ich habe ein Heimspiel. Das Haus am Waldrand liegt nämlich wirklich abgelegen. Die nächsten Nachbarn sind ein paar Bauernhöfe, bei denen ich so meine Zweifel bezüglich des Nachwuchses habe. Deswegen würde ich mich momentan auch mit jüngeren Kindern anfreunden.
Hauptsache, es sind Menschen! Ich brauche Menschen!
Penelope weiß das. Und weil sie nicht nur verrückt, künstlerisch und unstet ist, sondern auch meine mich liebende Mutter, nimmt sie, sobald ich fertig bin, die frisch gebackenen Kekse, lässt ihr neues Atelier im Stich und macht sich auf den Weg. Ich habe ihr dafür versprochen, den Rest wegzuräumen.
Wir haben vielleicht nicht viel, dennoch muss ich mir bei jedem überlegen, wohin es in diesem gigantischen Haus hin soll, damit ich es hinterher wiederfinde. Deshalb brauche ich ziemlich lange und bin ziemlich irritiert, dass ich fertig bin, als sie endlich wiederkommt. Ich habe sogar schon das Abendessen in den Ofen gestellt und bin kurz davor, die Polizei zu rufen.
Aber sie kommt. Und bei Lasagne und Ciabatta, was ich mindestens genauso gut kann wie Kekse, erzählt sie mir, dass der Bauernhof zu unserer Linken tatsächlich doch zwei Kinder hat: einen Sohn ein wenig älter und ein Mädchen ein paar Jahre jünger als ich, Roger und Melina. Noch spannender ist, was sie über das direkte Nachbarhaus zur Rechten zu sagen hat. Dort wohnt nämlich ein Paar namens Oliver und Sandra, und diese haben nicht nur eine leibliche Tochter in meinem Alter, sondern auch noch eine Unzahl an Pflegekindern.
Jackpot!
Ich will alles wissen. Leider hat Penelope sich mit Sandra über andere Dinge verquatscht und kann mir keine Details zu den Kindern liefern. Aber, so sagt sie, ich werde sie auf jeden Fall am nächsten Schultag an der Bushaltestelle kennenlernen. Wir teilen uns nämlich denselben Bus.
Ach ja. Der Bus.
Die nächste vernünftige Schule liegt leider in der nächsten vernünftigen Stadt, und dies bedeutet fast eine Stunde Busfahrt jeden Morgen hin, und fast eine Stunde jeden Nachmittag zurück. Wir wohnen so weit ab vom Schuss, dass die Bushaltestelle im Dorf tatsächlich die Endhaltestelle der Linie ist! Der Vorteil, so tröstet mich meine Mutter, ist, dass ich immer einen Sitzplatz bekommen werde.
Auch wieder wahr.
Ich bin also versöhnt, räume nach dem Essen das Geschirr ein und verbringe den restlichen Abend damit, mir sehr genau zu überlegen, was ich am nächsten Morgen anziehen möchte. Ich habe schon die verschiedensten „Hallo, ich bin die Neue!“ Outfits ausgetestet. Ein absoluter Reinfall war das Nerd-Outfit, das verstand nämlich niemand außer mir. Ebenso gescheitert ist die Femme Fatale, damit ließ mich Penelope nicht hinaus. Gut, ich war erst zwölf. Hippie ist machbar, aber schwierig, man landet zu leicht in einer Schublade, und solange ich die Schule nicht kenne, weiß ich nicht, in welche Schublade ich gesteckt werden will. Ich hätte noch die Rockerbraut im Angebot, doch unter den spärlichen Infos, die ich von Penelope bekommen habe, ist die, dass Sandras leibliche Tochter Cara total auf Punkrock abfährt. Meine Imitation kann funktionieren und uns sozusagen zu Spontanfreundinnen machen, oder aber voll nach hinten losgehen, weil ich irgendein Detail aus Unwissenheit verhaue. Und da Sandra Penelope ebenso anvertraut hat, dass Cara unter Aggressionsproblemen leidet, nehme ich von der Idee lieber Abstand.
Ich entscheide mich am Ende für eine Lucie-Variante von Jeans und T-Shirt. Es mag schlauer sein, erst einmal Undercover das Terrain zu klären, bevor ich mich etabliere. Ich kann das später immer noch damit erklären, dass meine Mutter auf meinem braven Outfit zum ersten Schultag bestanden hat.
Habe ich auch schon gemacht.
Zu den rücksichtslosen Dingen, die Penelopes Mäzen getan hat, gehörte, nicht am Ende des Schuljahres abzuhauen, sondern im Herbst. Ich muss also mittendrin die Schule wechseln – was mein Vater natürlich längst effizient arrangiert hat – und mir neue Freunde erobern, was mir keiner abnehmen kann. Dementsprechend nervös bin ich, als ich am nächsten Morgen aus dem Bett springe. Ich nehme mir viel Zeit zum Duschen und Haare waschen und schlüpfe in mein bereit gelegtes Outfit. Am Ende kann ich doch nicht umhin, es mit ein wenig Schmuck aufzubrezeln.
Gut, es ist mehr als nur ein wenig. Penelope versorgt mich immer mit dem, was sie nicht verkaufen kann, und so habe ich einen reichen Fundus, aus dem ich schöpfe. Aber falls ich merke, dass dies gar nicht ankommt, kann ich die Ketten und Armreifen ja wieder abmachen.
Ich fülle noch meinen Rucksack mit meinem Mittagessen – schließlich weiß niemand, ob das an der neuen Schule genießbar ist! – und bin bereit. Penelope, die müde über ihrer Kaffeetasse hängt und nur mir zuliebe aufgestanden ist, drückt mich und will mich gar nicht loslassen.
„Es tut mir so leid, Lucie-Schätzchen!“, jammert sie.
Als ob es ihre Schuld wäre, dass der Typ durchgebrannt ist!
Ich kann mich endlich befreien, bevor der Bus noch ohne mich fährt, und eile aus dem Haus, den gepflasterten Weg hinunter und die restlichen Meter zur Bushaltestelle. Ich bin nicht zu früh – dort warten schon zwei Personen auf mich, und wenn ich sie mir so anschauen, passen sie vom Alter her am ehesten zu den Bauernkindern, von denen Penelope gesprochen hat. Das Mädchen aus dem Garten nebenan ist es zumindest nicht.
„Hallo!“, schmettere ich ihnen freudig entgegen. „Ihr müsst Roger und Melina sein! Ich bin Lucie, und ich wohne dort!“
Wild wedele ich mit dem Arm in Richtung dieses dicken Hauses und lächele entschuldigend. Vielleicht sollte ich ihnen sagen, dass ich die Wahl zwischen dem Monsterhaus und einer Brücke gehabt habe.
Die beiden wirken irritiert. Ich fürchte, ich muss einen Gang hinunterschalten.
„Hi“, sagt der Junge namens Roger schließlich.
„Hi“, sagt Melina. „Ich habe gesehen, dass ihr gestern eingezogen seid. Sind John und Jane auch wieder da?“
„Zum Glück nicht“, rutscht es mir heraus, bevor ich mir auf die Lippen beiße. Am Ende waren John und Jane hier total beliebt, und ich handele mir nur Probleme ein, wenn ich unsere gegenseitige Antipathie kundtue. Aber bevor ich vorsichtig nachbohren kann, kommen die anderen, die Kinder aus dem Haus der Pflegeeltern.
Und sie sind ... anders.
Vorweg laufen zwei Mädchen, ich schätze sie auf zwölf oder dreizehn. An ihnen ist verwunderlich, dass die eine unglaublich dünn ist und die andere unglaublich dick ist. Sie können sich offenbar auch nicht besonders gut leiden und scheinen ein eifersüchtiges Verhältnis in Bezug auf Melina zu hegen. Zumindest versuchen beide sofort ihre Aufmerksamkeit zu erringen, und zwar noch bevor sie mich richtig wahrgenommen haben. Melina tut mir fast ein bisschen leid.
Ein bisschen bin ich aber auch neidisch.
Und dann sehe ich die Zwei dahinter.
Sie, das muss Cara sein, die Punkrockerin. Ich bin schlagartig froh, Abstand von meinem Outfit genommen zu haben. Ihre Haare sind bunt, sie hat mehrere Piercings in den Ohren und der Nase, und ihre Kleidung ist schwarz und zerrissen. Sie sieht mich so finster an, dass ich unwillkürlich schlucken muss.
Aber es ist der Junge, einen Schritt hinter ihr, der mich zum Erstarren und Anstarren bringt. Er muss so alt sein wie sie – und damit ich – und seine Haare sind schlohweiß. Nicht seine Augenbrauen, die sind dunkel, und seine Haut ist leicht gebräunt, also kein Albino. Doch die Haare auf seinem Kopf sind so weiß wie Schnee. Er schaut mich an, ertappt mich prompt, und während ich erröte, verengen seine Augen sich zu Schlitzen.
Es ist nicht so, als ob ich etwas gegen auffällige Haare hätte – bitte, ich bin rothaarig – es ist nur so, dass dieser Kontrast zwischen seiner Haut, seinen Augen und seinen Haaren so erstaunlich ist, dass es mir die Sprache verschlägt.
Dieser Junge ist wunderschön.
Cara schiebt sich vor ihn und funkelt mich an.
„Gibt es ein Problem, Cousine von Jane und John?“, zischt sie.
Ich werde offiziell zum Feuermelder.
„Hi, ich bin Lucie“, stottere ich, gar nicht so offen und freundlich, wie ich das sonst tue.
„Das wissen wir“, sagt Cara kalt. „Wir wissen auch, dass deinem Onkel das Haus gehört, in dem du wohnst. Möchtest du sonst noch was, Cousine?“
Okay. Ich schätze, John und Jane waren bei Cara nicht beliebt. Das wundert mich nicht. Ich bemühe mich um ein Lächeln und wünsche mir insgeheim, dass Penelope, wenn sie Caras Mutter schon all dies erzählen musste, doch auch bitte erwähnt hätte, wie sehr wir die Familie meines Onkels verabscheuen. Aber gerade, als ich meinen Mund öffne, um Klarheit zu schaffen, kommt der Bus um die Ecke. Cara schubst mich grob zur Seite.
„Halte Abstand!“, faucht sie mich an.
Jetzt bin ich völlig verunsichert. Ich war ja schon oft die Neue, aber noch nie bin ich so offen angefeindet worden. Bedrückt lasse ich den anderen den Vortritt beim Einsteigen. Cara, ihr weißhaariger Pflegebruder und Roger belegen sofort die hintersten Plätze, Melina und die beiden anderen Mädchen die davor. Ich hole tief Luft, um mich tapfer dazuzusetzen und noch mal von vorne anzufangen, doch als ich am Busfahrer vorbeikomme, hält der mich plötzlich am Arm fest.
„Hey, kleine Neue“, sagt er zu mir. „Bleib mal lieber hier vorne bei mir. Letztes Jahr musste ich eine Prügelei zwischen deiner Cousine und Cara beenden. An deiner Stelle würde ich dem Mädchen besser aus dem Weg gehen.“
Er schließt die Tür, und während ich mich entmutigt auf den ersten Platz sinken lasse, setzt er trocken hinzu: „Wäre mir lieb, wenn es dieses Jahr keine blutigen Fehden im Bus gäbe.“
Oh, mir auch. Und wie.
*
Der Tag ist also offiziell so schlecht gestartet, wie ich es nie erwartet hätte. Zum Glück wird es besser. Nach ein paar Stationen steigt ein bebrilltes Mädchen mit Pferdeschwanz ein, das mich zwar etwas irritiert auf dem ersten Platz entdeckt, sich dann aber einfach daneben zwängt. Ihr Name ist Judith, und anscheinend sitzt sie normalerweise alleine hier vorne. Ich schöpfe wieder etwas Mut. Die alte Lucie kommt zurück, die, welche sich von der bissigen Cara-Attacke hat verscheuchen lassen.
Judith ist überraschend nett und aufgeschlossen und anscheinend froh, jemanden zum Reden zu haben. Ich bin es auch. Ich gieße den ganzen Charme, den ich mir für meine Nachbarn aufgehoben hatte, über ihr aus, und am Ende der Busfahrt sind wir Freunde.
Leider ist Judith nicht in meinem Jahrgang und kann mir nicht viel durch den Tag helfen. Aber sie zeigt mir zumindest das Sekretariat, wo ich meinen Stundenplan bekomme, eine Sicherheitseinweisung und einen Gebäudeplan. Mein Vater hat zwar dafür gesorgt, dass ich all dies vorab schon per E-Mail erhalten habe, und es mir sogar ausgedruckt, doch das sage ich der netten Dame nicht. Außerdem war aufgrund des Umzuges noch keine Zeit, mir meine AGs auszusuchen. Eine ist Pflicht, werde ich informiert, und da ich mitten im Halbjahr dazu stoße, ist meine Auswahl begrenzt. Ich lande schließlich im Chor – ich kann ja den Mund einfach auf- und zumachen, ohne wirklich zu singen – und zum Halbjahr darf ich tauschen, wenn neue AGs beginnen.
Damit bin ich zufrieden. Die nette Dame bringt mich auch gleich zu meinem ersten Kurs, und hier beginnt das Spiel, was ich schon so oft hinter mich gebracht habe, dass ich mein Sprüchlein auswendig kann: Einmal vor der gesamten Klasse stehen, strahlend lächeln und sagen: „Hallo, mein Name ist Lucie Martin, und ich bin gerade mit meiner Mutter hergezogen. Ich bin sechzehn, kann leider weder toll malen noch singen, und habe auch sonst kein besonderes Talent, aber ich verspreche, ich bin echt nett!“
Das funktioniert jedes Mal. Irgendwer lacht immer, und die meisten sehen mich danach freundlich an. So ist es auch dieses Mal, nachdem ich mit Erleichterung festgestellt habe, dass weder Cara noch ihr Bruder – der, wie ich inzwischen von Judith weiß, Noel heißt – in diesem Kurs sitzen. Denn dass sie beide in meinem Jahrgang sind und ich ihnen über kurz oder lang über den Weg laufen muss, das weiß ich inzwischen ebenfalls.
Es passiert schließlich noch vor der ersten großen Pause. Ich betrete den Raum, etwas später als die anderen, weil ich ihn ja erst noch finden musste, und da sitzt er, hinten, in der letzten Reihe. Wenn dies eine kitschige Liebesgeschichte wäre, wäre natürlich der einzige freie Stuhl im Raum neben ihm, aber so ist es nicht. Im Gegenteil, links und rechts von ihm sitzen zwei äußerst hübsche Mädchen, und der einzige freie Platz im Raum ist in der ersten Reihe. Na, auch gut. So kann ich mir zumindest einreden, es gibt niemanden im Raum, der mich die ganze Zeit misstrauisch anstarrt.
Ich kann doch überhaupt nichts für meine Familie, oder? Und ich bin nett! Sie sollten mir wirklich eine Chance geben!
Ich sehe keinen der beiden bis zur Mittagspause wieder, wo sie mit den anderen coolen Kids die Bänke unter den Bäumen belegen. Ich habe Judith wiedergefunden, die von mir alles über meinen ersten Tag wissen will und mir abrät, die Schulmensa auszuprobieren. Ich bin dankbar für mein in weiser Voraussicht eingepacktes Essen und teile es großzügig mit ihr. Damit habe ich mir offenbar die nächste Stufe ihrer Freundschaft erkauft, und so wage ich es schließlich, sie ein wenig über meine bösen Nachbarn auszufragen.
Es sind nämlich komische coole Kids. Ich habe viel Erfahrung, und bislang waren die coolen Kids nie eine so bunte Mixtur. Ja, Cara ist sicher cool, und Noel vermutlich ebenso, aber Roger? Im karierten Flanellhemd? Und dann sitzt da noch so ein zarter Junge mit einem Zeichenblock und einer Hornbrille, hübsch, sicher, aber genauso offensichtlich schwul wie uncool. Und das andere Mädchen, das schließlich vorbeikommt, sieht einfach nur normal aus. Dann erscheint zumindest ein richtiger Rocker, und er und Cara kleben ihre Lippen aufeinander.
„Was ist mit denen?“, hake ich vorsichtig bei Judith nach.
Zwischen Lasagne (Reste vom Vortag) und Keksen werde ich darüber aufgeklärt, dass dies Caras und Noels Freunde sind, und dass Cara und Noel mit dem Mädchen namens Leonie und dem Rocker namens Sam in einer Punkrockband spielen, den sogenannten Fairytales. Sie existieren seit einem Jahr und haben offenbar eine gewisse lokale Berühmtheit erreicht. Mika, der zarte Junge, ist ein Freund von Noel – hm, ist Noel etwa schwul ...? – und Roger ein Freund von Cara.
Also ist es der Punkrockband-Status, der sie zu den coolen Kids macht, und ihre Freunde per Assoziation. Interessant. Ich breche den letzten Keks großzügig für Judith und mich auseinander.
„Sind sie gut?“, frage ich. „Und warum haben sie einen so dämlichen Namen?“
Offenbar sind sie sehr gut. Zumindest schwärmt Judith mehrere Minuten lang, bis sie eingesteht, dass sie selbst noch nie zu einem Konzert hat gehen dürfen. Aber der Name, das hat sie aus verlässlicher Quelle, den hat sich Leonie ausgedacht, weil sie meint, Noel sehe aus wie Legolas.
Ich kenne meinen Tolkien. Das ist kein Legolas, ganz bestimmt nicht. Nicht einmal die Haare lasse ich gelten: Legolas im Film ist hellblond, nicht schlohweiß, und seine Haare sind meterlang, nicht kurz. Er hat auch keine grünen Augen. Aber als ich anfange, meine Argumente vor Judith auszubreiten, wiegelt sie ab und meint, Leonie hätte gesagt, Noel würde so singen, wie sie sich immer vorgestellt hat, dass Legolas singt.
Ein Elbe als Punkrocker? Rauchen die etwa Gras?
Ich komme nicht mehr dazu, meinen Punkt weiter zu verteidigen, denn die Mittagspause ist vorüber. Ich habe noch einen Kurs mit Cara – wenn Blicke töten könnten – und dann meine Chor-AG. Nach der Diskussion mittags bin ich nicht überrascht, hier Noel wiederzutreffen. Doch ob er singen kann, oder nicht, erfahre ich nicht, denn ich kann unmöglich seine Stimme in dem Gewirr identifizieren. Er steht auch viel zu weit weg von mir Pseudo-Sopran. Und außerdem bin ich viel zu beschäftigt damit, mein Singen vorzutäuschen.
Ein bisschen böse Überraschung erwartet mich im Chor: Offenbar hat jemand hässliche Gerüchte über mich gestreut. Einige der Schüler gehen mir ganz offensichtlich aus dem Weg. Ich kann mir schon denken, woran das liegt. Danke, Jane. Ich bin noch keinen Tag hier und habe schon deine Erzfeindin geerbt, und die ist auch noch eine von den coolen Kids, mit denen es sich niemand verderben will.
Danke, wirklich.
Bei der Rückfahrt versuche ich es gar nicht erst, mich nach hinten durchzuzwängen. Für einen Tag habe ich genügend garstige Blicke kassiert. Ich bleibe also brav vorne, neben Judith, die auf der Rückfahrt jedoch deutlich früher aussteigt, weil sie noch Geigenunterricht hat. Das arme Kind. Sie ist der klassische Nerd, und das erklärt auch, warum sie so begeistert von meinem Freundschaftsangebot war. Das bedeutet allerdings auch, dass ich den größten Teil der Rückfahrt alleine verbringen muss und am Nachmittag einsam zu Hause sitze und nicht, wie ich insgeheim gehofft hatte, mit einem Haufen neuer Freunde.
Nun ja. Morgen ist ein neuer Tag. Und wenn ich eines von Penelope geerbt habe, dann ist es ihr unverwüstlicher Optimismus.
*
Mein Optimismus wird in den folgenden Wochen auf eine harte Probe gestellt. Offenbar war die Feindschaft zwischen John, Jane und den Kindern aus dem Pflegehaus tief, und der Kampf zwischen Jane und Cara legendär. Ich tue mein Bestes, um alle, denen ich begegne, davon zu überzeugen, dass ich das Gegenteil meiner arroganten Cousine bin. Aber es wird ein harter Job. Zunächst einmal muss ich einen Haufen Leute dazu bringen, überhaupt mit mir zu reden.
Bei Noel und Cara versuche ich es gar nicht erst.
Die jüngeren Mädchen sind leichter. Lena und Mona wissen offenbar nichts von der bösen Feindschaft, oder sie ist ihnen egal. Lena, die Dicke, vertraut mir eines Tages an, als nur wir zwei den Bus zurücknehmen, dass ihre Zwillingsschwester und sie beide an Essstörungen leiden – Überraschung – und dass es ein harter Kampf für sie war, überhaupt auf diese Schule gehen zu dürfen. Sie erzählt mir außerdem, dass sie nach Noel die ersten Pflegekinder der Familie sind, die das geschafft haben, und wie stolz Sandra deshalb auf sie sei. Ich lächele beeindruckt und erkundige mich vorsichtig nach den anderen Bewohnern des Hauses.
Aber hier macht sie dicht. Offenbar hat ihre große Pflegeschwester sie scharf angewiesen, mir nichts über die anderen zu verraten, warum auch immer. Ich bohre nicht nach. Was sollte es bringen? Solange Cara mich hasst – und Noel mich ignoriert – werde ich ihr Haus ohnehin nie betreten. Und was Cara anbetrifft, bin ich hin- und hergerissen zwischen Verzweiflung und zunehmendem Ärger: Ich habe ihr schließlich nichts getan! Ich habe ihre Feindschaft nicht verdient!
Ich gebe jedoch zu, dass ich ihren schönen Pflegebruder gerne heimlich beobachte. Nicht durchs Fernrohr oder so, nicht in seinem Zimmer, in das ich überhaupt nicht sehen kann, sondern in der Schule, wenn es keiner bemerkt. Allerdings kann ich von meinem Fenster auf das Vordach ihres Hauses sehen, und eines Abends beobachte ich etwas Erstaunliches.
Vor meinem Fenster ist eine gemütliche Bank eingelassen, seit längerem mein bevorzugter Leseplatz. An diesem Abend fesselt mich mein Roman länger als gewöhnlich, und so sitze ich immer noch da, versteckt hinter den dicken Vorhängen, als etwas aus dem Augenwinkel mich aufblicken lässt.
Die Nacht ist hell, der Mond scheint voll auf das Dach gegenüber. Und dort hat sich ein Fenster geöffnet und eine, nein, zwei Personen klettern hinaus, eine Decke mit sich ziehend. Im fahlen Mondlicht kann ich Noels weiße Haare ausmachen, womit klar ist, dass die zweite Person Cara sein muss.
Es ist ein guter Platz für etwas rare Zweisamkeit, von der es, so viel habe ich aus Lena herausbekommen, nicht viel in einem Haus voller problembehafteter Pflegekinder geben kann. Kein weiteres Fenster geht auf dieses Vordach, von unten kann man es nicht einsehen. Man muss schon so einen privilegierten Platz wie ich haben, um die Zwei überhaupt zu bemerken.
Ich bin ein wenig neidisch.
Nein, ich bin total neidisch. Wenn Jane nicht so eine Bitch wäre – und Cara auch nicht – könnte ich vielleicht jetzt mit ihnen da drüben sitzen und die Sterne anschauen. Oder vielleicht auch nicht – vielleicht haben Cara und Noel ja ein heimliches Verhältnis.
Nein, Cara, so erinnere ich mich, ist mit Sam zusammen. Und Noel, den ich ja immer wieder heimlich beobachtet habe, schaut sie nie wie ein Liebender an, sondern wie ein Bruder. Ich tröste mich mit diesem Gedanken, stelle erschrocken fest, dass ich das Bedürfnis verspüre, mich trösten zu müssen, und verbiete mir daraufhin mit Nachdruck, für Noel zu schwärmen, ganz egal wie hübsch und ungewöhnlich er aussieht. Damit ringe ich immer noch, als etwas wirklich Verblüffendes geschieht.
Die weißhaarige Gestalt auf dem Vordach schält sich aus der Decke, erhebt sich, und tritt, nach einem Kuss auf den Scheitel der anderen, zum Rand des Vordachs und springt.
Mein Mund steht offen. Es sind bestimmt vier Meter bis zum Boden, wenn nicht mehr. Aber er kommt federnd auf, ohne zu fallen, ohne auch nur zu stolpern, auf beiden Füßen, und sprintet sofort los, in den großen alten Wald, der sich hinter unseren Häusern ausbreitet. Ehe mein Mund sich schließt, ist er darin verschwunden. Ich reibe mir über die Augen, nicht sicher, ob ich das nicht geträumt habe.
Von welcher Höhe aus kann ein Mensch springen, ohne sich die Beine zu brechen? Und warum rennt er mitten in der Nacht in den Wald?
Als ich mein Buch endlich schließe und ins Bett krieche, viel zu spät natürlich, und ohne, dass Noel wieder aufgetaucht wäre, stelle ich fest, dass ich ein Problem habe. Ich mag mir vielleicht fest vornehmen, nicht für einen süßen Jungen zu schwärmen, der offensichtlich entschlossen ist, mich zu ignorieren – aber jetzt ist meine Neugier geweckt.
Und meine Neugier war schon immer mein Untergang.
*
Vielleicht, vielleicht, vielleicht wäre ich darüber hinweggekommen, wenn nicht am nächsten Tag noch etwas anderes geschieht, was meine Neugier weiter anheizt: Im Chor werden Solos und Duette für den nächsten Auftritt vergeben. Inzwischen hat die Leiterin mitbekommen, dass ich nicht singen will (oder kann), und so werde ich natürlich übergangen. Aber Noel bekommt eines – ein Duett mit unserer Starsängerin Brigit, die ihn, zu meiner Überraschung, grimmig mustert und sagt: „Diesmal sing gefälligst richtig, Noel, nicht so ein Scheiß wie beim letzten Mal.“
Er lächelt schwach und zuckt mit den Achseln. Ich bin natürlich sofort neugierig und leider immer noch nicht gut genug etabliert, um herauszufinden, was denn beim letzten Mal passiert ist.
War der Herr Punkrocker sich vielleicht für ein Schulkonzert zu schade?
Ist er nicht gekommen oder hat es mit Absicht versaut?
Die Chorleiterin runzelt nur die Stirn und lässt uns üben; die einzelnen Partien mit den verschiedenen Stimmlagen, den allgemeinen Teil, und schließlich, das Duett. Es beginnt mit Brigit, dann steigt Noel ein. Und ich, ich vergesse sogar, meinen Mund auf- und zuzumachen, was jedoch nicht weiter auffällt, denn außer mir scheinen noch ein paar andere das Singen zu vergessen.
Noel singt nicht gut.
Noel singt atemberaubend.
Fesselnd.
Betörend.
Berauschend.
Da ist etwas in seiner Stimme, viel zu voll und kräftig für jemanden so jung, das mich packt und festhält, weich und hart zugleich, sanft und donnernd, als ob etwas mitschwingt, als ob er auf einer anderen, für meine Ohren nicht wahrnehmbaren Ebene singt, als ob ... Ich vergesse zu atmen und bin den Tränen nahe, als er ans Ende seines Parts kommt. Ich kann nicht anders, ich starre ihn an. Und da, in diesen Moment, sieht er auf, und seine grünen Augen fangen meine ein.
Meine!
In den Seinen liegt eine seltsame, fast schelmisch zu nennende Herausforderung. Oder bilde ich mir das am Ende nur ein?
„Noel!“, schnappt Brigit giftig.
Er lacht, sein Blick lässt mich los, und er sagt entschuldigend: „Ich weiß. Ich wollte es nur einmal ausprobieren. Komm, wir versuchen es noch mal.“
Brigit ist nicht wirklich versöhnt, doch die Chorleiterin, deren Augen ein wenig glasig scheinen, lässt keine Ausrede gelten. Wir üben das Stück erneut, und diesmal, obwohl ich ganz genau hinhöre, klingt Noel so, wie man es von einem Schüler unseres Alters erwarten würde. Nichts Betörendes, nichts Berauschendes – ganz normal.
Ich bin enttäuscht. Vermutlich habe ich mir alles nur eingebildet, und das in der Nacht zuvor auch.
Doch als wir fertig sind und hinausgehen, geschieht es, dass er und ich zeitgleich an der Tür sind. Für einen Moment denke ich, er drängelt sich vor und lässt mich stehen, wie immer bisher. Aber diesmal hält er inne, macht eine kleine, spöttische Verbeugung und hält mir die Tür auf.
Nein. Ich täusche mich nicht. In seinen Augen liegt eine Herausforderung. Ich wäre nicht ich, wenn ich darauf nicht hereinfallen würde.
Und wie ich darauf hereinfalle.
*
Das Erste, was ich zu Hause mache, ist herauszufinden, wann die Fairytales das nächste Mal auftreten. Es ist ein Samstagabend in zwei Wochen, in einem Club der Stadt. Da ich natürlich nicht meine Mutter als Taxi verdingen kann, verbringe ich die nächste halbe Stunde damit, die Nachtbusse zu studieren. Ich habe Glück – es fährt einer um elf Uhr abends. Ich muss dann zwar noch ein Stück laufen, weil er natürlich nicht bis zu unserer einsamen Endhaltestelle fährt, aber es ist machbar. Logistisch gesehen ist es für mich machbar, zu diesem Konzert zu gehen.
Punkt zwei ist, Penelope zu überzeugen. Ich bereite es langsam vor, jammere ein wenig über unser einsames Leben, und wie schwer es mir fällt, Freunde zu finden, wenn man so weit weg wohnt. Natürlich fängt sie mit Sandras Kindern an, aber da seufze ich nur vielsagend. Meine Mutter kennt mich gut genug und weiß, wenn es mit Sandras Kindern nicht klappt, wird es wohl kaum daran liegen, dass ich es nicht versucht habe. Schließlich erzähle ich ihr von dem Konzert, zu dem ein paar meiner neuen Freundinnen gehen würden – das ist nicht gelogen, ich wette, ich kenne Leute, die dorthin gehen werden – und kann ihr am Ende die Erlaubnis abringen. Bei meinem Vater wäre mir das nie geglückt, aber sie weiß, wie sehr ich unter Einsamkeit leide.
Schritt drei: Judith. Natürlich will ich nicht allein auf das Konzert! Judith selbst zu überreden ist leicht getan, sie brennt schließlich darauf. Schwieriger ist es, die Erlaubnis ihrer Eltern zu erlangen. Zumindest ist sie vor kurzem sechzehn geworden, sonst hätten wir uns wohl die Zähne ausgebissen. Aber mit sechzehn, hat ihre Mutter ihr versprochen, darf sie auch mal ausgehen. Judith meint, wenn ihre Mutter erfährt, dass sie mit mir und nicht mit einem Jungen ausgehen will, stehen die Chancen besser.
Also werde ich am Folgetag zu Judith nach Hause eingeladen, um ihre überbehütende Mutter und ihren strengen Vater kennenzulernen. Ich kleide mich vorbildlich. Ich verhalte mich vorbildlich. Ich lächele sehr viel und sage ständig danke und bitte.
Ich bin vertrauenswürdig! Hurra!
Judiths Nachtbus ist ein anderer als meiner, und sie muss den um zehn nehmen, sonst gibt es Ärger. Dass meiner ein anderer Bus ist, verschweigen wir ihren Eltern. Ich verschweige es auch lieber meiner Mutter, man weiß ja nie. Immerhin gelingt es uns so, die Erlaubnis für uns beide einzuholen. Noel und Cara, vermute ich, werden von ihren Freunden gefahren.
Den Samstagnachmittag verbringen Judith und ich damit, uns akribisch vorzubereiten. Ich gebe ihr ein paar Tipps, wie sie ihren Stil aufbessern kann und dennoch damit bei ihren Eltern durchkommt. Make-up packe ich sowieso für uns beide ein. Penelopes größte Sorge ist, ob mein Mantel warm genug ist, immerhin ist es schon Dezember. Sie besteht auf Jeans, und ich gebe nach. Vermutlich ist es ohnehin besser, nicht im Winter im Kleidchen durch die Nacht zu stapfen.
Außerdem, wenn dies gut klappt, gibt es bestimmt weitere Möglichkeiten.
Ich bin so gut gelaunt, dass Penelope strahlt, als sie mich verabschiedet. Sie hat ja keine Ahnung von meiner geheimen Agenda!
Judiths Eltern wollten ursprünglich, dass ich zu ihr komme und sie uns fahren, doch ich kann sie davon überzeugen, dass wir beide im Bus gut aufgehoben sind. Sie wirken zweifelnd, aber am Ende sogar ein wenig stolz auf das neue Selbstvertrauen ihrer kleinen Tochter.
Judith ist ein Nervenbündel, als sie zusteigt.
Sie zappelt und zittert so sehr herum, dass ich sie, als wir endlich angekommen sind, erst einmal im Club auf die Toilette schleife, um dort ihr Make-up zu machen anstatt wie geplant im Bus. Ich packe ihr auch sicherheitshalber die Abschminktücher in die Tasche – nicht, dass wir am Ende getrennt werden und ihre Eltern eine angemalte Tochter daheim empfangen! Ich werde sie unbedingt am Ende des Abends noch einmal daran erinnern müssen, sich spätestens im Nachtbus die Schminke abzuwischen.
Mit meinem eigenen Outfit bin ich zufrieden. Fein, es war nicht das heiße Kleidchen, sondern eine schwarze Jeans, aber zumindest ein heißes Oberteil und natürlich massenhaft Ketten und Armbänder. Ich bin die Tochter einer Künstlerin, und deshalb gestatte ich mir das aufwendigere Make-up von uns beiden.
Der Club fängt an sich zu füllen, als wir beide wieder hinauskommen. Ich finde noch einen Tisch in einer Ecke, zum Glück, weil ich glaube, dass Judith mir sonst kollabieren würde. Dann besorge ich uns beiden eine Cola. Später will ich ein Bier, aber vorerst darf ich meine Freundin nicht überfordern.
Ob sie schon da sind? Sehe ich irgendwo Noels weißen Schopf?
„Warum bleicht er sich eigentlich die Haare?“, frage ich Judith unvermittelt.
„Wer bleicht sich die Haare?“, wiederholt sie verwirrt.
„Na, Noel!“, meine ich. „Er ist so hübsch! Warum diese weißen Haare? Da muss man ihn doch anstarren!“
Gut, vielleicht würde man ihn auch so anstarren, aber dennoch ...
„Er bleicht sich nicht die Haare“, sagt Judith.
„Was?“ Ich schaue sie amüsiert an. „Natürlich tut er das. Sie sind ja praktisch weiß! Oder ist er über Nacht ergraut?“
„Er bleicht sich nicht die Haare“, wiederholt sie mit Nachdruck. „Er war schon immer so. Alle wissen das. Noels Haare waren schneeweiß, als er als Baby gefunden wurde. Niemand spricht drüber. Und besser, auch du sprichst nicht drüber. Cara bringt jeden um, der es wagt, Noel wegen seiner Haare zu ärgern.“
Oh. Das lässt manche Dinge in einem ganz anderen Licht erscheinen. Cara schützt ihren Pflegebruder vor Spott? Aber wer würde über Noel spotten ...?
Ah. Eine Erleuchtung.
„Jane und John haben über Noels Haare gelästert, oder?“, frage ich nüchtern.
An Judiths Erröten sehe ich die Antwort. Ich schnaufe durch die Nase.
„Das wundert mich nicht“, sage ich grimmig. „Jane ist so eine Bitch! Und Cara ist vermutlich voll auf sie losgegangen, oder?“
Judith kichert.
„Und wie!“, gesteht sie. „Der Busfahrer musste sie mit Gewalt trennen! Jane hatte Nasenbluten. Und danach haben sie sich natürlich gehasst.“
„Es ist einfach, Jane zu hassen“, stimme ich gutmütig zu.
Judith sieht mich scheu an.
„Du bist ganz anders als die beiden“, meint sie leise.
Ich muss grinsen.
„Ich weiß“, sage ich unbekümmert. „Ich komme nach meiner Mutter. Und ich bin froh drum!“
„Ich auch,“ Sie lächelt mich an.
Es dauert erwartungsgemäß noch ein bisschen, bis die Band endlich startet. Wir verbringen die Zeit damit, mit den Leuten um uns herum ins Gespräch zu kommen. Na ja, besser ausgedrückt, ich rede mit ihnen und Judith lächelt scheu. Immerhin kriege ich so endlich mein Bier, obwohl der Junge, der es mir ausgibt, mir ein bisschen zu nahe auf die Pelle rückt. Aber auch damit kenne ich mich aus. Jemanden charmant in die Schranken zu weisen, habe ich schon mit dreizehn gelernt.
Als die Band endlich auf die Bühne kommt, ist der Club wie entfesselt – alle stürmen nach vorne, auch Judith. Und jetzt bin ich es, die plötzlich scheu wird. Ich bleibe hinten an unserem Tisch zurück, mich großzügig zum Wächter über unsere Jacken und Taschen erklärend.
In Wirklichkeit habe ich ein wenig Angst. Was, wenn ich wieder so auf seine Stimme reagiere wie im Chor?
Zunächst einmal ist ihr Auftritt natürlich überhaupt nicht wie der Chor. Es ist Punkrock, kein Schulgesang. Die Fans kreischen, die Gitarre auch, der Bass dröhnt, das Schlagzeug donnert. Zu meiner Überraschung singt nicht nur Noel, sondern ebenso Leonie. Sie sind gut zusammen, das muss ich neidlos anerkennen, Leonie härter und heftiger, und wenn die hohen Töne kommen, springt Cara mit ein. Auch Noel klingt sehr viel rauer als im Unterricht. Aber dann kommt eine Ballade, und die singt nur er allein.
Die singt nur er.
Wenn man auf einer Bühne steht, ist es wegen der Scheinwerfer praktisch unmöglich, Gesichter im Publikum zu erkennen, selbst wenn es ein so kleiner Saal ist wie hier. Ich bin mir ziemlich sicher, er hat keine Ahnung, dass ich da bin. Und trotzdem, trotzdem werde ich das Gefühl nicht los, er sieht mich an, während er singt.
Ein Schauder läuft mir über den Rücken, und seine Stimme, seltsam heiser und klar zugleich, nimmt mich gefangen.
Ich bin nicht allein damit.
Sie sind nur eine ganz normale Schülerband, das habe ich spätestens nach den ersten Stücken kapiert. Der einzige Grund, weshalb sie mehr Erfolg haben als eine ganz normale Schülerband, ist seine Stimme, sind diese Balladen, sind die weicheren Partien der härteren Lieder, die er singt, als ob er etwas beschwört. Es ist einfach nicht in Worte zu fassen.
Ich halte mich an meinem mittlerweile warmen Bier fest und bin froh, im Schatten geblieben zu sein. In meinem Innersten kann ich all die glasigen Blicke um mich herum verstehen. Ich bin ziemlich sicher, dass ich beim ersten Mal genauso aussah.
Bei der dritten Ballade wird mir jedoch etwas klar. Das erste Mal, dass ich ihn so singen hörte, war ich wie verzaubert. Das zweite Mal zumindest betört. Und noch immer fasziniert mich seine Stimme, berauscht mich, doch sie lässt mich nicht mehr mit den Tränen kämpfen, und mein Mund steht nicht mehr offen – fast so, als ob eine Art Gewöhnungseffekt eingesetzt hat. Das scheint bei den anderen Fans nicht so zu sein. Sie wiegen sich hin und her, wenn er sanfter singt, sie kreischen und trampeln, wenn die Band abrockt. Als sie schließlich die letzte Zugabe gegeben haben, ist es verdammt dicht dran an zehn Uhr. Ich muss mich vorkämpfen zur Bühne, Judith von dort wegzerren, in ihren Mantel stopfen und zum Bus schleifen.
Meine eigenen Sachen lasse ich in der Obhut meines neuen Bekannten. Ich habe schließlich noch Zeit. Judith hingegen muss los. Ich wische ihr lieber selbst gleich die Schminke ab und setze sie in den Bus. Sie hat nach wie vor diesen glasigen Ausdruck.
Hätte ich meine Tasche mitgenommen, wäre ich jetzt aus lauter schlechtem Gewissen mitgefahren, auch wenn ich dadurch vermutlich meinen eigenen Transport verpasst hätte. So überlasse ich sie dem Busfahrer, dem ich einbläue, wo sie auszusteigen hat. Ich bin sehr nachdenklich, als ich zurück zum Club laufe – wo meine einsame Tasche auf mich wartet.
Nein. Sie ist nicht einsam. Noel sitzt neben ihr.
Ich zögere. Judith ist nicht die Einzige, die zu den Nachtbussen gestürmt ist. Der Club ist deutlich leerer. Ich sehe keine Spur von Cara und den anderen Mitgliedern der Band, bloß ihn. Er sitzt alleine an unserem Tisch, was mich aus mehr als nur einem Grund verwundert.
Eben noch hat er den Raum zum Kochen gebracht.
Und jetzt kümmert sich keiner um ihn?
Noel hebt den Kopf und sieht mich an, mich direkt. Ich erröte ein wenig, aber ich bin nicht so feige, umzudrehen, aufs Klo zu flüchten oder mich irgendwo zu verstecken. Das ist meine Tasche, mit meinem Make-up. Ich bin nicht reich genug, das alles im Stich zu lassen. Außerdem habe ich noch eine halbe Stunde bis zu meinem Bus zu überbrücken. Das ist mein Platz.
Ich bewege mich vorsichtig auf ihn zu und setze mich wieder. Mein Bier ist warm. Es ist auch fast leer. Vielleicht ist es überhaupt nicht mehr mein Bier. Ich rühre es lieber nicht an.
„Lucie“, sagt er.
„Du kennst meinen Namen?“, kann ich mir nicht verkneifen. Bislang hat er mich nicht einmal angesprochen.
Er grinst.
„Ich wette, inzwischen kennt jeder an der Schule deinen Namen“, sagt er. „Cara meint, es wäre absolut nervtötend, wie kommunikativ du bist.“
Ich habe es ihr also schwer gemacht, mir das Leben schwer zu machen, lese ich daraus und kann mir mein eigenes Grinsen nicht verkneifen.
„Wo ist sie denn?“, frage ich. Sitzt mir gleich eine Furie im Nacken?
Noel zuckt mit den Schultern.
„Sie schläft heute Nacht bei Sam“, antwortet er. „Sie sind schon weg.“
„Ernsthaft?“, platze ich heraus. „Sie darf bei ihrem Freund übernachten? Mit sechzehn?“
Sein Blick ist ein wenig mitleidig.
„Cara ist letzten Monat siebzehn geworden“, antwortet er. „Oliver und Sandra wollen sich auf den Kampf nicht mehr einlassen.“
Siebzehn? Sie ist also doch älter als ich. Und natürlich, bei ihrem Temperament werden ihre leiderprobten Eltern bestimmt irgendwann den Weg des leichtesten Widerstands gehen. Müssen sie vielleicht sogar, bei so vielen Kindern daheim.
„Ich dachte, wir sind gleichaltrig“, murmele ich, was ein wenig albern ist, schließlich werde ich im Frühjahr siebzehn.
„Cara und ich sind gleichaltrig“, stellt er fest.
„Wann hast du denn Geburtstag?“, rutscht es mir heraus.
Sein Gesicht verfinstert sich schlagartig.
„Warum willst du das wissen?“
Ich rümpfe die Nase. Was ist denn jetzt schon wieder? So eine harmlose Frage!
„Vielleicht will ich dir ja was schenken?“, meine ich herausfordernd.
Und da passiert ein kleines Wunder: Ein Lächeln bricht sich Bahn auf seinem Gesicht, ein echtes, warmes, an mich gerichtet. Es ist nicht so, als ob ich ihn noch nie hätte lächeln sehen.
Bislang galt es nur nie mir.
„Du kommst zu spät“, informiert er mich. „Ich hatte vierzehn Tage vor Cara. Am ersten November, um genau zu sein. Willst du es dir für nächstes Jahr in deinen Kalender eintragen?“
„Pah.“ Ich werfe meinen Kopf zurück. „In einem Jahr! Was in einem Jahr alles passieren kann! Vielleicht mag ich dich dann längst nicht mehr!“
„Also magst du mich jetzt?“
Uups. Lucie, dein Mund war schneller als dein Kopf.
Mag ich ihn? Natürlich mag ich ihn. Er fasziniert mich.
„Ich kenne dich eigentlich gar nicht“, winde ich mich heraus.
Noel seufzt und fährt sich mit der Hand durch die Haare.
„Was an uns liegt und nicht an dir“, gibt er zu. „Jane und Cara ...“ Er bricht ab.
„Ich habe von dem legendären Kampf gehört“, meine ich zuvorkommend. „Von mehreren Seiten. Ich weiß alles!“
„Tatsächlich?“ Er sieht zweifelnd aus. „Wirklich alles?“
Also gut, die Karten auf den Tisch. Ich hole tief Luft und sprudele heraus: „Jane hat sich über deine Haare lustig gemacht – ehrlich, ich wusste das bis heute Abend nicht, ich dachte wirklich, du bleichst sie – egal, also Jane hat sich darüber lustig gemacht, und Cara ist im Bus auf sie losgegangen, so dass der Busfahrer sie gewaltsam trennen musste. John stand natürlich auf Janes Seite, arroganter Arsch, der er ist, und Jane, die verloren hat, hat Cara bestimmt mit solcher Inbrunst gehasst, dass sie Pickel bekommen und nie wieder auch nur ein Wort mit euch gewechselt hat, wenn sie überhaupt je mit jemandem geredet hat, elende Bitch. Und Cara hat sich bestimmt nicht für Versöhnung stark gemacht, und du auch nicht, warum solltest du auch. Ihr hasst euch. Richtig so? Wenn es dich tröstet, ich hasse sie ebenso. Ich kann überhaupt nicht glauben, dass wir verwandt sind.“
Noel, der meinem Wortschwall ziemlich fassungslos gelauscht hat, schüttelt jetzt den Kopf, als könne er mir kaum folgen.
„Stimmt es nicht?“, frage ich zögernd.
Oder habe ich ihn schon wieder irgendwie beleidigt?
Bei denen weiß man ja nie.
„Ich kann auch nicht glauben, dass ihr verwandt seid“, meint er. „Es stimmt, so ungefähr zumindest. Du bist echt das krasse Gegenteil von Jane.“
„Ich weiß“, sage ich mit Befriedigung.
Es gibt bestimmt Mädchen, die beleidigt wären, würden sie als das krasse Gegenteil der schlanken, blonden Jane mit ihren sportlichen und akademischen Auszeichnungen bezeichnet werden, aber hallo? Ich bin Lucie Martin. Ich bin das krasse Gegenteil meiner Cousine, das ist nichts als die Wahrheit!
Noel lächelt schwach und malt mit der Hand Kringel in das Kondenswasser auf den Tischen.
„Cara ist immer noch misstrauisch“, gesteht er. „Ich kann es ihr nicht einmal übelnehmen. Sie hatte sich schon mit Jane gestritten, bevor das im Bus geschah. Cara vergisst nicht leicht. Und vergeben fällt ihr noch schwerer.“
„Aber ich habe doch gar nichts gemacht“, sage ich hilflos.
Er verzieht das Gesicht.
„Ihr seid verwandt“, erwidert er. „Das zählt für sie. Komm jetzt. Wenn wir den Bus nicht verpassen wollen, müssen wir los.“
Erst da geht mir auf, dass mit Sam ja auch sein Transportmittel nach Hause verschwunden ist, und dass wir denselben Weg haben. Ich packe schweigend meine Sachen zusammen, folge ihm aus dem Club hinaus und zur Haltestelle. Es ist immer noch erstaunlich, dass keine Fans an ihm kleben, aber das werde ich ihm nicht sagen. Stattdessen kichere ich leise vor mich hin.
Zu meiner Überraschung hält er sich auf dem Weg neben mir, und als er mich hört, zieht er die Augenbrauen hoch.
„Was ist so lustig?“, will er wissen.
Ich grinse ihn an.
„Der Punkrockstar fährt mit dem Nachtbus nach Hause“, sage ich lachend. „Tut mir leid, Noel, aber dein Coolnessfaktor ist gerade um ein paar Grad gefallen!“
„Wie soll ich denn sonst zurückkommen?“, erwidert er. Zu meiner heimlichen Erleichterung lächelt er dabei. „Ich bin siebzehn! Ich habe keinen Führerschein! Und ich bin ein Findelkind. Da gibt es niemanden, der mir einen fahrbaren Untersatz spendiert. Fürs Fahrrad ist es einfach zu weit.“
Ich habe ein Fahrrad für diese Strecke nicht einmal ansatzweise in Betracht gezogen, mal davon abgesehen, dass ich Fahrradfahren hasse. Und nicht nur das – auch Rollschuhlaufen, Schlittschuhe, Ski, Schlitten – alles, wo meine Füße nicht fest auf dem Boden stehen, ist nichts für mich. Aber er hat natürlich recht. Niemand wird ihm ein Auto schenken. Mir hingegen schon, ich habe schließlich einen reichen Vater.
„In anderthalb Jahren werde ich achtzehn“, schlage ich ihm spontan vor. „Wenn ich dann immer noch hier wohne, fahr ich dich, wohin du willst!“
Er lacht. Er lacht zum ersten Mal direkt neben mir, und ich mag sein Lachen.
„In anderthalb Jahren werde ich volljährig sein“, erklärt er. „Dann bin ich es, der hier weg muss.“
Das trifft mich. Verstört bleibe ich stehen. Er ist ein Pflegekind, ein Findelkind, vielleicht eine Waise. Prompt spüre ich Tränen in meinen Augen.
„Wirst du mit achtzehn völlig auf dich gestellt sein?“, flüstere ich. Ich wüsste nicht, wie ich reagieren würde, wäre ich so allein auf der Welt.
Er bleibt ebenfalls stehen und schaut mich bestürzt an.
„Ich wollte dich nicht erschrecken“, sagt er langsam. „Und nein. Ich lebe seit sieben Jahren bei Oliver und Sandra. Sie werden mich nicht in meinem Abschlussjahr vor die Tür setzen. Sie werden ... sie werden meine Familie bleiben, ich weiß das. Außerdem gibt es Hilfen für solche wie mich. Ich bin nicht allein, Lucie. Schau nicht so traurig. Du brauchst kein Mitleid mit mir haben.“
Ich habe kein Mitleid. Doch, habe ich, aber man nennt es höflicherweise Mitgefühl. Ich weiß nicht, ob es für ihn einen Unterschied machen wird, wenn ich ihn darauf hinweise.
Spontan nehme ich seine Hand und drücke sie.
„Ich weiß, es geht mich nichts an“, sage ich. „Aber wenn ich dir helfen kann ...“ Mist, nun habe ich doch mit dem Mitleid angefangen. Zornig auf mich selbst schüttele ich meinen Kopf.
„Anders“, sage ich entschlossen. „Ich weiß, wie es ist, allein zu sein. Ich bin nicht gerne allein. Ich wette, du bist es auch nicht.“
„Richtig“, sagt er. „Aber ich bin nicht allein. Komm jetzt, wir verpassen den Bus.“
Er hat meine Hand nicht losgelassen. Er lässt sie erst los, als wir den Busfahrer bezahlen müssen. Leider ergreift er sie im Bus nicht wieder, obwohl wir nebeneinandersitzen. Es ist anfangs ziemlich voll, es ist ja auch nur ein Kleinbus. Doch selbst, als der Bus sich nach und nach leert, reden wir nicht. Schließlich steigen wir gemeinsam an der letzten Haltestelle aus. Ich seufze innerlich. Es ist eine halbe Stunde Fußmarsch von hier nach Hause, und ich bin jetzt wirklich müde.
Noel nimmt plötzlich wieder meine Hand.
„Ich kenne eine Abkürzung“, sagt er. „Vertraust du mir? Ich weiß, du hast wenig Grund dazu, aber man braucht nur die Hälfte der Zeit, wenn man über die Wiesen und durch den Wald geht.“
Durch den Wald? Jetzt, mitten in der Nacht? Im Winter? Ich sehe ihn fassungslos an. Durch die Wolle meiner Handschuhe kann ich seine Körperwärme spüren. Seine Hände sind bloß. Offensichtlich ist er nicht so verfroren wie ich.
„Ist der Wald nicht auf der anderen Seite des Dorfes?“, frage ich unsicher.
Verdammt sei mein orientierungsloser Orientierungssinn!
Noel lächelt auf mich herunter.
„Nicht der Alte Wald“, korrigiert er mich sanft. „Geh nachts nie in den Alten Wald. Ich meine das kleine Wäldchen auf dem Weg zwischen hier und unserem Dorf. Es gibt einen Weg hindurch. Vertraust du mir?“
Er ist nachts allein in diesen Alten Wald gelaufen, erinnere ich mich. Jetzt zieht er mich langsam in eine andere Richtung, zu einem Feldweg hin.
Vertraue ich ihm? Bin ich nicht sicherer auf der Landstraße?
„Was ist denn im Alten Wald?“, frage ich, während ich ihm zögerlich folge. Besser gesagt, ich lasse seine Hand nicht los, und meine Füße bewegen sich von allein.
Er lacht leise auf.
„Monster“, sagt er grinsend. „Ganz viele Monster. Aber fürchte dich nicht. Ich beschütze dich!“
Seltsamerweise glaube ich ihm das. Ich glaube es ihm sofort. Und da meine Füße ohnehin schon in seine Richtung gehen und meine Hand warm in seiner ruht, gebe ich meinen Widerstand auf.
Mein Vater würde Zustände kriegen. Seine einzige Tochter läuft mitten in der Nacht mit einem fremden Jungen in den Wald! Einem Pflegekind zudem, aus dem System!
Ich fühle mich sicher.
Ich fühle mich verzaubert.
Noel führt mich über die kahlen Felder zu einem kleinen Wald, und durch denselben hindurch. Wir kommen unterhalb der Bauernhöfe hinaus, auf der Seite der Wiesen. Es ist sternklar, kalt und wunderschön. Leichter Frost liegt in der Luft und über dem Land.
Er bleibt stehen.
Sieht auf mich herab.
Und dann, unerwartet, und doch wieder nicht, ist seine freie Hand auf meiner Schulter, gleitet behutsam, fast vorsichtig von dort in meine Haare, zum Unterrand meiner Wollmütze. Legt sich in meinen Nacken und dreht mein Gesicht empor, ihm entgegen.
Plötzlich ist seines direkt vor mir.
„So süß“, flüstert er.
Sollte ich Angst haben? Vermutlich. Ich stehe mitten in der Nacht mit einem Jungen in der Feldmark, der mich offiziell hasst, und er hält mich auch noch fest. Aber ich habe keine Angst.
Ich bin eine Idiotin.
Ich bin eine Idiotin, die von Noel Tyll geküsst wird. Ja, ich kenne seinen Nachnamen. Ich bin gründlich bei meinen Recherchen.
Der Kuss dauert nicht lange. Es ist eher ein Hauch, ein Moment, den seine Lippen meine berühren. Dennoch habe ich das Gefühl zu schweben, und immer noch zu schweben, als er den Kopf hebt und mit seiner Nase gegen meine tippt. Seine ist warm. Meine ist vermutlich wie Eis.
„Du musst ja frieren“, murmelt er.
Friere ich? Keine Ahnung. Wen interessiert das schon?
Noel scheint es zu interessieren. Er lässt mich mit der einen Hand los und zieht mich an der anderen weiter, den Feldweg entlang, zu unserem Dorf. Ich glaube immer noch zu schweben, bis wir vor seinem und meinem Haus angekommen sind und er mich leider ganz loslässt.
Das Lächeln, das er mir schenkt, wirkt geheimnisvoll, und seltsam zurückhaltend.
„Das behalten wir besser für uns, oder?“, meint er leise.
Ich kann gar nicht anders, ich nicke, als ob mich seine Augen dazu zwingen, seine wunderschönen, waldgrünen Augen. Ich schweige, nicke und drehe mich um, um in mein Haus zu gehen, wo Penelope entweder über ihrem Kaffee eingeschlafen ist oder in der Scheune vollkommen die Zeit vergessen hat. Ersteres ist der Fall – sie liegt quer über dem Sofa und schnarcht. Ich decke sie mit einer Wolldecke zu, bevor ich nach oben in mein Zimmer gehe.
Noel Tyll hat mich geküsst.
Noel hat mich geküsst.
Noel hat mich geküsst und möchte, dass wir es für uns behalten.
Noel hat mich geküsst und will ein Geheimnis daraus machen.
Noel will ein Geheimnis aus mir machen?
Ein Geheimnis?
Aus mir?
Es ist, als ob mit der Distanz mein gesunder Menschenverstand wieder einsetzt, der, welcher normalerweise verhindert hätte, dass ich mit einem praktisch Fremden von der normalen Straße abweiche und mich mitten zwischen den winterkahlen Feldern küssen lasse – der gesunde Menschenverstand, der mir schon als Neunjähriger klar gemacht hat, dass ich besser kochen und backen lerne, will ich jemals in meinem Leben selbstgemachte Kekse und etwas anderes als Nudeln essen. Der dafür sorgt, dass wir nie im Dreck ersticken, und dass ich immer weiß, wie ich meinen Vater erreichen kann, wenn Penelope ihr Leben wieder einmal gegen die Wand gefahren hat.
Wo war mein gesunder Menschenverstand, als Noel Tyll meine Hand gehalten hat???
Ein Geheimnis? Bin ich etwa eine Affäre, etwas, das man geheim halten muss? Auf gar keinen Fall! Jeder Junge kann sich glücklich schätzen, mich als Freundin zu haben, jawohl! Nun gut, vielleicht nicht jeder, ich rede ziemlich viel, und ich bin vielleicht niedlich, aber keine klassische Schönheit, und sonderlich begabt bin ich auch nicht, aber dennoch! Ich bin Lucie Martin und man muss mich nicht verstecken! Ich habe niemandem etwas getan, kein Verbrechen in meiner Kartei, keine unnötige Gemeinheit – alle, die ich begangen habe, waren gerechtfertigt! Ich bin nett! Ich bin schlau! Ich bin organisiert! Und Noel will mich verstecken, als ob ich nicht gut genug für ihn bin?
Ich koche vor Zorn, als ich ins Bett gehe. Es dauert lange, bis ich endlich einschlafe, sehr lange.
Was für eine Frechheit!
*
Am nächsten Morgen verschlafe ich, und zwar gründlich. Das passiert mir selten, ist jedoch verständlich, wenn man bedenkt, dass ich vor dem Morgengrauen kaum ein Auge zugetan habe. Es ist also schon Mittag, als ich endlich aufwache. Und das mag ich nicht, nicht wirklich. Ich hasse Tage, an denen ich den Morgen verschlafe. Überhaupt, ich hätte daheimbleiben sollen. Was interessiert mich schon dieser dumme Noel?
In dieser Stimmung stapfe ich ins Bad. Meine Laune hebt sich nicht ein bisschen, als ich mein verschlafenes, zerknautschtes und verschmiertes Gesicht sehe. Ich sehe aus wie nach einem Zugunglück. Da hilft nur noch eines – ich stelle mich unter die Dusche, so wie ich bin.
Okay, den Schlafanzug ziehe ich vorher aus.
Eine halbe Stunde später, mit sauber geschrubbtem Gesicht und zusammengedrehten Haaren, in bequemen Jogginghosen und einem warmen Shirt mache ich mich auf den Weg in die Küche. Inzwischen knurrt mein Magen wie wahnsinnig. Ich habe nichts zu essen vorbereitet, weil ich nicht damit gerechnet habe, so auszufallen, und der Gedanke an Fertigpizza verbessert meine Laune nicht im Geringsten.
Ich betrachte Fertigpizza als persönliches Versagen, als Ultima Ratio, wenn der Hunger größer ist als mein Bedürfnis, mich selbst versorgen zu können. Aber in der Küche erwartet mich eine Überraschung. Nicht nur, dass es aus einem der Töpfe auf dem Herd duftet – versteht mich nicht falsch, das ist eine von mir zubereitete und eingefrorene Suppe, die da auftaut – nein, es sitzen auch zwei Leute bei einer Tasse Tee: meine Mutter und Mika.
Mika?
„Mika?“, frage ich verwirrt.
Penelope steht auf und kommt mit breitem Grinsen auf mich zu.
„Das muss ja ein toller Abend gewesen sein“, strahlt sie. „Wenn du erst jetzt aus den Federn kriechst! Ich freue mich so, dass du wieder Freunde gefunden hast, Lucie-Schatz! Hattet ihr viel Spaß?“
Hatten wir? Nun ja. Bis zu dem unrühmlichen Ende, ja.
„Ja“, sage ich und schnuppere unwillkürlich Richtung Herd. Kürbiskokossuppe. Meine Stimmung schnellt um einige Grade nach oben.
Penelope ist meinem Blick gefolgt.
„Ich bin an die Truhe gegangen“, entschuldigt sie sich. „Kokoskürbis klang lecker. Ich habe schließlich Mika zum Essen eingeladen, und du ... Nun ja, Mika. Es ist so. Ich bin die Künstlerin in unserer Familie und meine Tochter die Köchin. Wir tauschen nie. Es lohnt sich nicht.“
„Solange du mich nicht als deine Haushälterin bezeichnest“, flachse ich. „Sonst müsstest du mich bezahlen! Kokoskürbis ist fein, Mama. Aber noch mal – warum ist Mika hier?“
Mika, der zarte Junge mit der Hornbrille, ist inzwischen knallrot.
„Deine Mutter gibt mir Unterricht“, nuschelt er. „Ich zeichne. Ich will auf die Kunsthochschule, und meine Eltern meinten, wenn sie schon hier ist ...“
Ja, Penelope kreiert nicht nur Dinge, sie gibt auch Unterricht. Zum Glück, möchte ich meinen. Sie ist zwar wirklich gut, aber Kunst braucht eben ihre gut betuchten Liebhaber. Man wird nicht reich davon, zumindest nicht so schnell, oder zu Lebzeiten, und schon gar nicht, wenn man nebenbei noch eine Tochter großziehen muss.
„Ah“, mache ich verstehend und sehe Mika gleich viel großzügiger an. Er könnte der Grund sein, dass ich zu Weihnachten eine Gans zubereiten kann, und nicht nur ein Hühnchen. Eine ganze Gans ist vielleicht zu viel für Penelope und mich, aber ich habe mich noch nicht davon verabschiedet, viele Freunde einladen zu können. Außerdem wollte ich schon seit Ewigkeiten eine Gans in den Ofen schieben. Allein wie das klingt! Und dieser Ofen ist auch bestimmt groß genug dafür!
„Mika malt in jeder Pause“, vertraue ich meiner Mutter schamlos an.
Hey, er ist ohne mich vorzuwarnen in mein Heim eingedrungen, jetzt darf ich aus dem Nähkästchen plaudern. Mika ist rot wie eine Tomate.
„Ich habe dich auch mal gezeichnet“, flüstert er.
Oh Himmel, ich habe richtig Mitleid mit ihm. Wenn er so scheu ist, wie überlebt er dann eine Stunde mit Penelope?
Aber ich bin ungerecht. Meine Mutter kann sehr einfühlsam sein. Wenn sie will.
„Zeig es Lucie doch mal!“, ruft meine ach-so-einfühlsame Mutter gerade.
Doch Mika will anscheinend wirklich zeigen. Er holt sein Skizzenbuch hervor, und ich darf zum allerersten Mal einen Blick hineinwerfen.