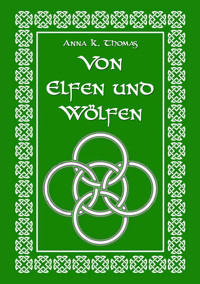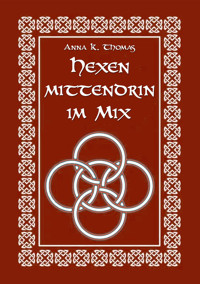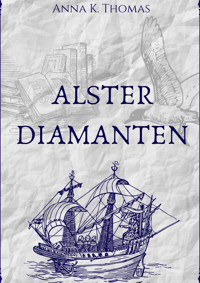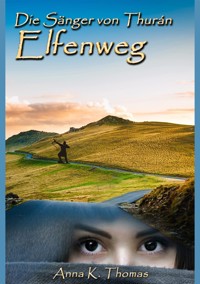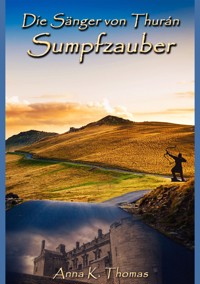5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Gabriel Zurmühlen kennt seine Herkunft nicht – als Neugeborener fand man ihn einst im barocken Berlin, eingewickelt in ein Seidentuch mit einem mysteriösen Wappen. Von diesem Rätsel angetrieben ist er in den Diensten des skrupellosen Grafen von Winsterburg gelandet. Im Auftrag seines Herrn taucht Gabriel in das glanzvolle, aber gefährliche Paris Ludwigs XIV. ein, verführt Männer und Frauen, gewinnt Freunde und Feinde, stiehlt, mordet und setzt dabei mehrfach sein Leben aufs Spiel. Aber erst, als das Schicksal den Haushalt des Grafen zurück an die Spree führt, beginnt er, die Hintergründe seines Lebens besser zu verstehen – und damit sich selbst.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 676
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Anmerkung zu den Anreden und Fußnoten
1 – In Diensten des Grafen Winsterburg
2 – Ein Abend im Palais Royal
3 – Geheimnisse einer Kurtisane
4 – Erkenntnisse aus dem Hôtel de Soissons
5 – Pariser Wunder
6 – Das stehende Skelett
7 – Fragen der Moral
8 – Barocke Liebe
9 – Prunk und Nöte
10 – Verschiedene Arten von Gift
11 – Gaunereien
12 – Fieberträume
13 – Rekonvaleszenz
14 – Eine Art Heimkehr
15 – Monsieur und Madame
16 – Alternative Wege
17 – Ehe aus Vernunft
18 – Rückkehr nach Paris
19 – Das Erbgrafenpaar
20 – Ausflug ins Quartier Latin
21 - Männergeschäfte
22 – Am Hof des Königs
23 – Ein Tanz in vielerlei Hinsicht
24 – Höflinge
25 – Ein Problem und seine Lösung
26 – Die dunkle Seite
27 – Vorbereitungen
28 – Angriff und Verteidigung
29 – Klare Worte
30 – Gift, Sex und Gerüchte
31 – Liebe und Gewalt
32 – Hoher Besuch
33 – Unbequeme Fragen
34 – Ein neuer Wind
35 – Abschied
36 – Zurück an der Spree
37 – Wiedersehen
38 – Der Kurprinz
39 – Zukunft und Vergangenheit
40 – Gasthaus Bense
41 – Zwei Welten
42 – Kollaps
43 – Ein anderes Leben
44 – Neuer Alltag und Probleme
45 – Schurkenstreich
46 – Die Witwe und ihr Schankknecht
47 – Rückkehr der Kreatur
48 – Der fremde Mann
49 – Caroline von Trellow und ihre Kinder
Nachwort der Autorin
Anhang
Personenverzeichnis
Fiktive Personen
Historische Personen
Links zu Karten
Paris 1652
Berlin – Memhardt-Plan 1652
Berlin 1688
Quellen
Links zu Wappen
Gesamtwappen des Großen Kurfürsten
Gewidmet all denen, die mich schon so lange unterstützen
Und vor allem Steffi – mit tausend Dank für den Titel!
Anmerkung zu den Anreden und Fußnoten
Die Anreden – ach die Anreden des Barocks …
Der Status spielte eine immens wichtige Rolle für die Leute. Und deshalb lasse ich z.B. Liselotte von der Pfalz Gabriel erzen und ihn ihr gegenüber nur die distanzierte Form verwenden („Ich bringe Madame Nachricht …“), denn die ansonsten äußerst direkte und unverblümte Liselotte war sehr ahnenstolz und legte großen Wert auf die Abstammung.
Das heißt nicht, dass sie nicht mit Niedergestellten sprach, im Gegenteil. Aber die korrekte Anrede, die war ihr wichtig, und darin war sie vermutlich ein Abbild ihrer Zeit.
Und noch eins: Bei Der Geist in Brand hatte ich aufgrund der langen Zeit und Recherche beschlossen, die Fußnoten drin zu lassen. Für dieses Buch habe ich keine zwölf Jahre gebraucht, die Praxis dennoch beibehalten. Wer das nicht mag, kann sie einfach ignorieren.
Nun genug der Vorreden! Der Vorhang hebt sich!
1 – In Diensten des Grafen Winsterburg
Gabriel Zurmühlen genoss sein Leben, aber nur, wenn er nicht gerade vor einem gehörnten Ehemann auf der Flucht war.
Er fiel mehr aus dem Fenster, als dass er sprang – zum Glück war es ebenerdig – rollte flink über eine Schulter ab und kam auf die Beine. Im Laufen schloss er die Hose. Hemd und Jacke flatterten hinter ihm her, während er auf die Straße stürzte. Ein wütendes Brüllen ertönte, er warf hastig einen Blick zurück.
Oh, verdammt. Der Ehemann hatte die Verfolgung aufgenommen, und er hatte einen Degen.
Es blieb Gabriel keine Zeit, darüber nachzusinnen, woher er diesen hatte, und warum auch noch griffbereit, denn obwohl ihm sein Leben in diesem Moment nicht sonderlich gefiel, hing er doch sehr daran. Und so rannte er weiter, wich den Passanten aus, die ihm spöttische Rufe nachsandten, hastete durch die leerer werdenden Gassen von Paris. Der König mochte vor ein paar Jahren die allgemeine Beleuchtung eingeführt und die Straßen damit deutlich sicherer gemacht haben, doch es blieb ein gefährliches Pflaster, eine Heimat für Unruhestifter und Tunichtgute.
So wie ihn.
Hinter ihm brüllte der Ehemann erneut, aber Gabriel, mit der Agilität der Jugend, schien an Vorsprung zu gewinnen. Er sprang erneut über ein Hindernis, hetzte weiter – und da geschah es: Er rutschte auf den nassen, eisigen Steinen aus, verlor das Gleichgewicht, purzelte eine kleine Treppe hinunter und schlug irgendwo hart mit dem Kopf an.
Die Welt verdunkelte sich, und das lag nicht an der einsetzenden Dämmerung.
Ein Teil von Gabriel schrie ihn an, dass er weiterrennen musste, dass der Ehemann ihn töten würde – immerhin hatte er ihn praktisch in flagranti im Bett seiner jungen Ehefrau erwischt. Hier würde es enden, auf den Straßen von Paris, wenn er es nicht schaffte, zu fliehen, und dabei war er noch keine zwanzig Jahre alt, viel zu jung für einen solchen Tod …
Er hätte schon viel früher sterben sollen, kurz nach seiner Geburt, auf dem Pfad zur Mühlenbrücke. Ein Gesicht tauchte vor ihm auf, ein bärtiges, ernstes; dann ein warmes, gütiges, und ein drittes, so alt wie er selbst – Geister der Vergangenheit, Geister, die ihn nicht sterben lassen wollten. Gabriel riss sich mit aller Kraft zusammen und setzte sich mühsam auf. Das war gerade noch rechtzeitig, um zu sehen, wie der gehörnte Ehemann mit einem Schrei des Triumphes die kleine Treppe hinuntersprang, den gezückten Degen nach wie vor in der Hand – und wie dann, wie aus dem Nichts, eine Keule heranschwang und ihn am Kopf erwischte.
Er fiel um wie ein Baum.
Gabriel blinzelte.
Dann blinzelte er noch einmal, als aus dem Schatten ein ungeschlachter Hüne mit vernarbtem Gesicht zu ihm trat und ihm eine Hand hinstreckte.
„Du bringst dich noch um, Kleiner“, murrte der Ältere, ihn hochziehend.
Gabriel, dem noch immer sehr schwummerig war, taumelte und wurde fest an den Schultern gepackt. Nichtsdestotrotz strahlte er.
„Hagen! Wie schön dich zu sehen!“
„Das ist eine Art, es auszudrücken“, brummte Hagen. „Kannst du laufen, oder muss ich dich tragen?“
„Ich kann laufen. Ist er tot?“
„Nein, zu deinem und meinem Glück. Komm jetzt.“
„Ich hätte gar nichts dagegen, wenn er tot wäre. Er wollte mich aufspießen.“
„Du hast mit seiner Frau geschlafen. Wirklich, Gabriel. Musstest du dir von allen Weibern in Paris ausgerechnet die aussuchen, deren Ehemann berühmt für seine Eifersuchtsanfälle ist?“
„Sie macht Madame de Montespan die Handschuhe. Ich hatte wohl kaum eine Wahl.“
Hagen verengte die Augen. Hinter ihnen stöhnte der gehörnte Ehemann, langsam wieder zu sich kommend, und so legte er Gabriel eine Hand auf den Rücken und schob ihn vorwärts.
„Komm, bevor er aufwacht. Hat er dich erkannt?“
„Ich glaube nicht. Ich war schnell“, sagte Gabriel und setzte sich gehorsam in Bewegung, mit einem großen Bogen um den Mann am Boden.
„Wird seine Frau dich verraten?“
„Nicht, wenn sie schlau ist, und das ist sie“, meinte Gabriel.
„Aber nicht schlau genug, um dich nicht in ihr Bett zu lassen, wenn er euch erwischen konnte“, gab Hagen zurück.
„Er hätte überhaupt nicht hier sein sollen, sondern in Lyon. Keine Ahnung, warum er vorzeitig zurückgekehrt ist.“
„Unwichtig jetzt“, entschied Hagen. „Wir müssen uns beeilen. Der Graf wird auf uns warten.“
„Vielleicht hatte er mehr Erfolg als ich.“
„Du lebst noch. Das ist erstmal Erfolg genug. Alle leben noch“, grummelte Hagen.
Gabriel lächelte ihn als Antwort lediglich strahlend an.
Einträchtig liefen sie nebeneinander bis zum Gasthaus, in dem Graf Winsterburg Quartier bezogen hatte, betraten es durch den Seiteneingang, grüßten im Vorübergehen das Küchenpersonal – Gabriel fröhlich und Hagen mürrisch – und erreichten schließlich nach kurzem Anklopfen das Zimmer des Grafen. Dieser war, wie von Hagen angekündigt, zurück und hatte sich noch nicht umgekleidet.
Die Garderobe des Grafen von Winsterburg war ein Ereignis für sich. An den Füßen trug er glänzende Schnallenschuhe, dazu feine Strümpfe aus Seide, die unter einer Kniebundhose aus türkisem Satin endeten. Darüber fiel ein Rock aus demselben Material, prächtig bestickt an Ärmelaufschlägen, Taschen und am Revers. Er war knapp genug, um den Blick auf die noch prächtigere Weste darunter freizugeben, schillernd wie das Gefieder eines Pfaus. Am Hals und an den Handgelenken schäumte reine, weiße Spitze, und gekrönt wurde das Ganze von einer riesigen Perücke, die den ohnehin nicht besonders kleinen Grafen noch einmal um eine Handbreit erhöhte. Dass er nur noch ein Bein hatte und der rechte Unterschenkel mit Holz ersetzt war, fiel bei dieser Aufmachung kaum auf.
Sein Gesicht hingegen, unter der hellen Schminke, war scharf und hellwach.
„Ihr seid zurück, gut“, sagte er, als die beiden das Zimmer betraten. „Neuigkeiten?“
„Das Einzige, was ich herausgefunden habe, ist, dass Madame de Montespan schwanger und schlechtgelaunt ist“, berichtete Gabriel.
„Pff“, machte der Graf. „Das ist wenig überraschend. Der König schaut sich wieder einmal um, und ihre Hofdame interessiert ihn nicht mehr. Hast du noch etwas Sinnvolles in Erfahrung gebracht?“
„Tut mir leid, Herr.“
„Also ist alles beim Alten“, murmelte der Graf. „Der König hat keinen Grund, den Krieg zu beenden. Warum sollte er auch, seine Armee hat sich allen überlegen bewiesen.“
Gabriel und Hagen schwiegen; diese Fakten waren ihnen bekannt. Alle, die sich mit Politik befassten, schauten dieser Tage nach Paris.
„Wir müssen besser sein als die anderen“, setzte Graf Winsterburg halblaut hinzu.
Auch der Ehrgeiz ihres Dienstherrn war den beiden bekannt. Hagen räusperte sich.
„Mit Verlaub, Herr“, sagte er, „aber erwarten Sie wirklich, dass die Handschuhmacherin von Madame de Montespan eine hilfreiche Quelle ist? Gabriel hätte das heute fast mit seinem Leben bezahlt.“
„Hm? Wie das?“
„Ihr Mann kam vorzeitig zurück, Herr.“
„Er hat mich die Gassen runtergejagt“, sagte Gabriel mit erstaunlicher Fröhlichkeit, „den Degen in der Hand. Ich wusste nicht einmal, dass er einen Degen hat, um ehrlich zu sein. Und er sollte eigentlich die ganze Woche in Lyon bleiben.“
„Vielleicht hat er Gerüchte gehört, dass sein trautes Weib mit einem Galan rumschäkert“, grummelte Hagen.
„Möglich“, gab Gabriel zu. „Hagen hat mich davor gerettet, durchbohrt zu werden und mein Leben auf den Gassen von Paris auszuhauchen.“ Er grinste, während Hagen mit den Augen rollte.
Der Graf hingegen zeigte keinerlei Reaktion bezüglich des Mordversuchs.
„Hat er dich erkannt?“, fragte er stattdessen scharf.
Gabriel zuckte mit den Schultern.
„Ich glaube nicht“, meinte er. „Die Jungfer warnte uns. Ich war aus dem Bett und dem Fenster raus, bevor er im Zimmer war. Es ist natürlich trotzdem möglich.“
„Ist es das Risiko wert, Herr?“, fragte Hagen.
Der Graf musterte sie einen Moment.
„Nein, vermutlich nicht. Die Frau weiß einfach nicht genug. Wir brauchen andere Quellen, andere Patronage. Vielleicht sollten wir uns auf Monsieur konzentrieren. Gabriel, nimm das nächste Mal deinen Dolch mit.“
„Herr?“ Hagen wirkte erschüttert, im Gegensatz zu seinem jungen Freund.
„Ein Dolch hätte mir nicht gegen einen Degen geholfen“, sagte dieser ziemlich nüchtern.
„Es ist besser als nichts, und er lässt sich besser verbergen“, erwiderte der Graf. „Ich bin morgen im Palais Royal. Ihr werdet mich begleiten. Ich erwarte die korrekte Garderobe.“
„Selbstverständlich, Herr“, sagte Hagen, sein Gesicht eine einzige Maske. „Wenn ich noch auf ein Wort …?“
„Meinetwegen. Geh zu Bett, Gabriel, es ist spät, und ich brauche dich morgen in Höchstform.“
„Wie Sie wünschen, Herr.“ Gabriel verbeugte sich, drehte sich um und verließ das Zimmer.
Draußen jedoch, neben der Tür, hielt er inne. Er hatte sie nicht ganz zugezogen, und er war neugierig. Es gab Dinge über Hagen, die er zu gerne gewusst hätte, Dinge, die sein großer Freund vor ihm verbarg. Und obwohl Gabriel wusste, dass Hagen ihn mochte und immer auf ihn aufpassen würde, ja, dass er ihm bedenkenlos sein Leben anvertrauen konnte, verspürte er keinerlei Skrupel, ihn zu belauschen.
Was er jedoch hörte, war enttäuschend.
„Herr“, sagte Hagen. „Ich muss Sie noch einmal bitten. Der Junge hat keinen Respekt für das Leben, nicht einmal für sein eigenes. Er geht zu große Risiken ein, er spielt ein zu riskantes Spiel. Wäre ich heute nicht dazugekommen, hätte es blutig geendet. Wenn Gabriel so weitermacht, wird er keine zwanzig.“
„Wir hatten diese Diskussion schon, Hagen“, seufzte der Graf. „Das letzte Mal hieß es, er würde keine neunzehn. Und, was ist? Er hat letztes Jahr seinen neunzehnten Geburtstag gefeiert.“
„Pures Glück“, grummelte Hagen.
„Gabriel kann immer nein sagen. Ich zwinge ihn zu nichts.“
„Euer Hochgeboren, mit Verlaub, Sie haben den Jungen praktisch großgezogen. Er ist seit bald zehn Jahren bei Ihnen – Sie sind nicht nur sein Herr, Sie sind auch sein Vaterersatz. Er würde mit Sicherheit etwas vorsichtiger werden …“
Nein, das war langweilig. Winsterburg hatte vollkommen recht – Hagen führte diese Diskussion seit Jahren, nahezu seit dem Tag, an dem auch er in die Dienste des Grafen getreten war, unter Umständen, die Gabriel bis heute nicht begriff. Sicher war nur, dass Winsterburg Hagen anders behandelte und ihm andere Dinge erlaubte als Gabriel selbst. Und natürlich durfte Gabriel nein zu den Spezialaufträgen sagen, zu denen der Graf ihn schickte – nun ja, zumindest vermutete er das, denn er hatte noch nie nein gesagt. Ehrlich gesagt war er sich nicht sicher, was geschehen würde, wenn er dann mal nein sagen würde.
Vorerst jedoch plante er nicht, das herauszufinden. Stattdessen verließ er seinen Lauschposten und machte sich auf den Weg nach oben, wo, in einer weitaus kleineren Kammer, sein und Hagens Domizil war.
Auf dem Treppenabsatz wurde er wider Erwarten aufgehalten. Clélie, die Tochter ihrer Wirtin, fasste nach seinem Arm.
„Sie sollten nicht mitgehen ins Palais Royal“, wisperte sie, somit beweisend, dass auch sie wieder einmal an der Tür gelauscht hatte.
Er reagierte milde, viel milder, als wenn einer der anderen sie erwischt hätte. Aber dann, einem der anderen gegenüber hätte sie dies auch nicht verraten.
„Du bringst dich in Schwierigkeiten, Clélie“, sagte er freundlich.
„Nicht ich werde in Schwierigkeiten enden, sondern Sie“, beharrte sie, ihre Augen sorgenvoll geweitet. „Reicht es nicht, dass Sie sich ständig mit diesem finsteren Kerl abgeben müssen?“
„Finsteren …? Oh, meinst du Hagen?“ Gabriel schüttelte den Kopf.
Clélie zog schaudernd die Schultern hoch.
„Er macht mir Angst“, wisperte sie.
Gabriel seufzte.
„Er muss dir keine Angst machen. Ehrlich, er ist vollkommen harmlos. Dir droht weitaus mehr Gefahr von mir als von ihm.“
Clélie errötete.
„Ich meine nicht diese Art von Gefahr“, nuschelte sie.
Ich auch nicht, dachte Gabriel, aber das sagte er nicht laut. Es half ihm, dass man in ihm nur den hübschen Jungen sah und außer Acht ließ, dass er schon mit fünfzehn in den Krieg gezogen war und seitdem in den verschiedensten Städten Europas überlebt hatte. Clélie hatte ganz offenbar keinerlei Ahnung von seinen diversen Fertigkeiten und sah in ihm, was viele sahen: ein potenzielles Opfer.
Sie griff erneut seinen Arm, ihr Gesicht flehend.
„Wenn Sie ins Palais Royal gehen, werden Sie nur in einem ihrer Betten landen. Und ich meine nicht das Bett von Madame.1“
Er musste sich auf die Lippen beißen, um nicht aufzulachen. Nein, es war überall bekannt, dass Madame, die pfälzische Ehefrau des einzigen Königsbruders, nicht der allgemeinen Galanterie folgte. Ihr Mann hingegen, Monsieur, war eine andere Sache.
„Nur weil Monsieur dem eigenen Geschlecht zugeneigter ist als dem seiner Frau, heißt das noch lange nicht, dass er mich in sein Bett zerren wird“, meinte er.
Clélie wirkte nicht im Mindesten beruhigt.
„Es ist nicht Monsieur.“ Ihre Stirn war tief gerunzelt. „Der Chevalier de Lorraine und der Marquis d’Effiat fackeln nicht lange, wenn sie einen Jungen schön finden.“
„Du solltest nicht so viel auf Klatsch geben, Clélie.“
„Das ist kein Klatsch. Es steht sogar in den libelles!“ Sie hielt ihm ein Blättchen unter die Nase.
Er schnappte es sich und überflog es rasch. Der Inhalt brachte ihn dazu, unverschämt zu grinsen.
„Libelles sind praktisch der Inbegriff von Klatsch“, behauptete er. „Wo hast du das überhaupt her? Lässt deine Mutter dich solche Dinge auf der Straße kaufen?“
Sie verdrehte ihre Augen.
„Als ob Mutter das von mir fernhalten könnte, hier, in einem Gasthaus“, murrte sie. „Ich weiß, wer’s geschrieben hat – Gaston, der mir immer schöne Augen macht. Aber ich will ihn gar nicht, den Lumpen, ich will …“ dich. Ihre Augen sagten es.
Gabriel überlegte kurz, sie mit hinauf in die Kammer zu nehmen – immerhin war sein Schäferstündchen rüde unterbrochen worden – entschied sich jedoch dagegen. Hagen würde nicht ewig beim Grafen bleiben, und Hagen sah ihn jetzt schon so tadelnd an. Außerdem mochte ihre Wirtin es gar nicht, wenn er mit ihrer Tochter tändelte.
„Deine Maman hat dich nicht ohne Grund Clélie2 genannt“, murmelte er stattdessen. „Bist du nicht mit der carte des tendres vertraut?“
Ihr Gesicht wurde ganz rot, ihr Mund öffnete sich leicht.
„Ich bin überhaupt nicht wie diese dumme Romanheldin“, erwiderte sie. „Und so ein elend langes Buch. Monsieur Gabriel, die carte des tendres ist mir zu …“
Ein Türschlagen ließ sie zusammenfahren. Gabriel räusperte sich und trat einen Schritt zurück.
„Ich danke dir für deine Warnung“, sagte er.
Ihre Augen blitzten.
„Sie sollten nie unterschätzen, was ein Mädchen aus einem Gasthaus alles weiß“, sagte sie.
Er lächelte, aber dieses Mal nicht spöttisch.
„Das würde ich niemals. Ich bin selbst in einer Schenke aufgewachsen.“
„Sie? Aber ich dachte …“
Sie dachte, was viele dachten – dass er von Adel war, vielleicht ein unehelicher Sohn des Grafen, vielleicht ein verarmter Verwandter. Gabriel grinste sie erneut an.
„Meine Geburt ertrinkt förmlich in Mythen und Spekulationen“, sagte er, und dachte, als er an dem staunenden Mädchen vorbei nach oben huschte, dass das nicht einmal gelogen war.
2 – Ein Abend im Palais Royal
Das Pariser Palais Royal war zu Beginn des Jahrhunderts von dem alten Kardinal Richelieu erbaut worden und nach dessen Tod in den Besitz der Krone übergegangen. Früher hatten hier die Königinmutter Anna und ihre minderjährigen Söhne Louis und Philippe gewohnt, ganz abgesehen vom Nachfolger Richelieus, des weitaus charmanteren, aber ähnlich gehassten Kardinal Mazarin. Hier hatte der junge König Louis zur Zeit der Fronde in seinem Bett gelegen und so getan, als schlafe er, während seine Mutter das aufrührerische Volk in Schach hielt. Vielleicht lag es daran, dass Louis XIV schon seit Jahren nicht mehr im Palais wohnte, sondern seine Schlösser außerhalb der Stadt bevorzugte – Fontainebleau, Saint-Germain und das ehemalige Jagdschloss Versailles.
Philippe, der jüngere Bruder, war entweder nicht so zart besaitet oder hatte andere Erinnerungen, denn wann immer er in Paris war, bewohnte er das Palais, was faktisch in seinen Besitz übergegangen war.
Mazarin mochte erst fünfzehn Jahre tot sein, und die sittenstrenge alte Königin Anna gerade mal zehn, aber in dieser einen Dekade hatte Philippe es bereits geschafft, dass das Palais Royal in Paris für seine Ausschweifungen verschrien war. Daran dachte Gabriel, als er neben Hagen hinter dem Grafen das Gebäude betrat. Die Klatschblätter mochten viel ausschmücken und übertreiben – im Gegensatz zu der streng zensierten Presse – doch so ganz von der Hand zu weisen war dies sicherlich nicht.
Er fragte sich, ob der Graf wieder einen Spezialauftrag für ihn hatte, und ob er diesmal nein sagen konnte.
Ob er nein sagen wollte.
Er beschloss, diese Entscheidung solange zu verschieben, bis es akut wurde. Es half schließlich nicht, sich den Kopf über Dinge zu zerbrechen, die vielleicht nicht einmal eintreten würden.
Zunächst aber wurden sie zu einem der geräumigen Zimmer gebracht, in denen bereits eifrig gespielt wurde. Graf Winsterburg ließ seinen Blick kurz schweifen.
„Basset, Pharo und Brelan“, sagte er. „Wie gewagt, Pharo ist in Paris verboten. Gut, erst die Grundlage schaffen. Hagen bleibt bei mir. Gabriel, höre dich um.“
„Gibt es etwas Besonderes, auf das wir achten sollen, Herr?“ fragte Hagen.
„Alles kann interessant sein. Gabriel, wenn sich eine Möglichkeit bietet, tiefer einzutauchen, ergreife sie. Halte dich nur von Monsieur und dem Chevalier de Lorraine fern. Das könnte Schwierigkeiten bedeuten, die ich nicht brauchen kann. Verstanden?“
„Ja, Herr.“ Gabriel verbeugte sich leicht.
Also hatte er freie Hand. Er war recht erleichtert, sich gerade von diesen beiden fernhalten zu müssen. Dazu hatte er Clélies Warnung gar nicht bedurft.
Zunächst blieb er an Hagens Seite, während der Graf sich einen Platz beim Brelan ergatterte. Anders als das populäre, bei Todesstrafe verbotene Pharo konnte man hier mit Strategie und nicht nur mit Glück gewinnen, und Graf Winsterburg, der wie immer knapp bei Kasse war, wusste das auszunutzen. Später am Abend würde er vielleicht wechseln, um das Geschwätz und die Gerüchte der weniger an Strategie interessierten Spieler aufzugreifen, doch zuerst, wie er gesagt hatte, musste die Grundlage geschaffen werden.
Sie mussten die Zimmer im Gasthaus bezahlen.
Sobald der Graf zu spielen angefangen hatte, begann Gabriel, durch den Raum zu schlendern. Obwohl er eigentlich ein Diener des Grafen war, steckte dieser weder ihn noch Hagen in eine Livree, sondern stattete sie mit zwar schlichter, aber für einen Kleinadligen adäquater Kleidung aus. Dies hatte diverse Vorteile, die der Graf weidlich ausnutzte.
Und Gabriel hatte natürlich überhaupt nichts dagegen.
Er stand eine Weile in der Nähe eines anderen Tisches und beobachtete die Spieler, während er an seinem Wein nippte.
„Oh, Dangeau, nicht schon wieder!“, jammerte einer und warf die Karten hin. Der Angesprochene lächelte sanft und sammelte seinen Gewinn ein.
„Marquis, Sie gewinnen entschieden zu oft“, grummelte eine der Damen am Tisch, die offenbar gerade eine Menge Geld verloren hatte.
Eine der anderen lachte. Sie schien seltsam alterslos und war auf eine besondere Art und Weise berückend.
„Ich würde es vermeiden, mich mit Ihnen an einen Tisch zu setzen, Philippe“, neckte sie, „wenn Ihre Gesellschaft nicht so unfassbar unterhaltsam wäre!“
Der Marquis verbeugte sich leicht.
„Schöne Ninon, es würde mir das Herz brechen, sollten Sie meine Gegenwart aufgrund meines Glückes meiden“, erwiderte er galant.
Glück? Wohl kaum, dachte Gabriel, der mit geschultem Auge den professionellen Spieler erkannte. Offenbar nutzte der Marquis die Vergnügungssucht und Unfähigkeit der Anwesenden, um seinen Geldbeutel aufzubessern, ähnlich wie Graf Winsterburg. Aber das hielt die anderen am Tisch nicht davon ab, eine neue Runde zu beginnen.
Einmal so gelangweilt und reich sein, dass er sein Geld derart fortwerfen könnte. Gabriel verstand es nicht.
Doch auch die Dame, die der Marquis als schöne Ninon bezeichnet hatte, hielt sich zurück. Ihr Auge war gewitzt, um ihren Mund tanzte ein Lächeln. Sie fing seinen Blick auf, und ihr Lächeln vertiefte sich.
Ah. Ob das ein Weg sein konnte, mehr zu erfahren?
Wenn, war es gewiss ein charmanterer als der Chevalier oder der Bruder des Königs …
Sie bedeutete ihm mit einer Bewegung ihres Fächers, näher zu treten. Er beugte sich zu ihr herab.
„Madame?“
„Willst du nur zusehen, oder wirst du mir eine Erfrischung besorgen?“ Ihr Ton war leicht, lockend und brachte ihn unweigerlich auf Ideen.
„Ihr Wunsch ist mir Befehl. Was wünschen Madame?“ Auch er konnte locken und schmeicheln.
Sie lachte perlend.
„Überrasche mich, mon petit.“
Er verbeugte sich erneut. Überall liefen Diener mit Getränken und Süßigkeiten umher, aber sie wollte offenbar ein anderes Spiel. Er musste etwas Besonderes finden.
Als er sich zum Gehen wandte, stichelte der erste Herr: „Wirklich? Der Junge könnte Ihr Sohn sein!“
„Ich habe kein Interesse an Kindern“, sagte die Dame namens Ninon. „Und er soll mir doch nur eine Erfrischung bringen.“
Worauf der ganze Tisch in Gelächter ausbrach.
Fein, dachte sich Gabriel. Zwei konnten das Spiel spielen. Er schaute zum Grafen, der ihn über seine Karten hinweg einen Blick zuwarf. Gabriel konnte keinen Tadel erkennen, nichts, was ihn zum Innehalten gezwungen hätte. Er ignorierte die Diener mit den Tabletts und trat auf den Gang. Wenn er die Küche fand, bekam er bestimmt etwas, was Madame überraschen würde.
Er folgte einem jungen Lakaien, der einen leeren Korb davonschaffte, und überlegte gerade, ob er ihn einholen und ausfragen sollte, als plötzlich, aus dem Nichts, ein Arm hervorschoss, der den Jungen vom Gang zog.
Dieser quietschte und der Korb landete auf dem Boden.
Gabriel stoppte irritiert, und alle Warnungen von Clélie fielen ihm wieder ein. Er sah sich um, aber sie waren allein. Er hörte den Jungen betteln, doch verstand die Worte nicht.
Vorsichtig schlich er näher.
„Monsieur, bitte, bitte nicht …“
„Wehr dich nicht, mein Kleiner … es ist so viel einfacher, wenn du dich nicht wehrst …“
Gabriel spähte um die Ecke. Es war, wie er vermutet hatte: einer dieser dekorierten Gecken hatte sich den hübschen Lakaien geschnappt und war dabei, ihm gegen seinen Widerstand die Hosen zu öffnen. Der Junge schrie nicht, aber wehrte sich so vehement, dass kein Zweifel daran bestehen konnte, die Aufmerksamkeit des Mannes war unerwünscht.
Gabriel zögerte. Dies ging ihn nichts an. Das Letzte, was er brauchte, war ein Skandal, der mit seinem Rauswurf aus dem Palais endete.
Andererseits … die schöne Ninon wollte etwas Ausgefallenes, und er wusste schließlich aus eigener Erfahrung, dass Bediente immer mehr sahen und wussten, als ihre Herrschaften wahrhaben wollten. Der Junge konnte ihm nützlich sein.
Lautlos huschte er näher, so dass er hinter den beiden war. Ein rascher Blick, niemand in Sichtweite. Dann, bevor er es sich noch anders überlegen konnte, griff er mit beiden Händen um den Hals des Mannes, an der Perücke vorbei, und drückte kräftig auf die Gefäße links und rechts des Kehlkopfs.3
Der Mann kollabierte in seine Arme.
Der Dienstbote, plötzlich seines Bedrängers ledig, wirbelte herum.
„Mein Gott!“, stieß er aus, als er Gabriel sah. „Haben Sie … ist er ...?“
„Er ist nicht tot, nur bewusstlos“, sagte Gabriel und ließ den Mann zu Boden sinken. „Er wird gleich wieder erwachen. Dann sollten wir allerdings besser nicht mehr hier sein.“
Die Augen des Jungen waren wild. „Er würde uns umbringen!“
„Möglich. Wer ist er denn?“
„Wissen Sie nicht – großer Gott, das ist der Chevalier de Lorraine!“
Das war also der berüchtigte Chevalier, Geliebter des Königsbruders, und für seine Grausamkeit verschrien. So, auf dem Boden, wirkte er recht harmlos, aber der Junge hatte recht: Wenn er erwachte und sie noch hier waren, war ein Rauswurf vermutlich Gabriels geringste Sorge.
Noch dazu wurden auf dem Gang Stimmen laut.
„Los, verschwinden wir!“, befahl er.
Der Junge schaltete blitzschnell.
„Hier lang!“
Es war eine schmale Tür, durch die sie huschten, in einen Dienstbotengang. Der Junge hielt da nicht inne, sondern hastete den Gang weiter hinunter, bis sie einen kleinen Alkoven erreichten.
„Mit Verlaub, aber ich glaube, wir sollten eine Weile ungesehen bleiben. Oder ich, zumindest. Sie hat er ja nicht gesehen.“ Seine gedämpfte Stimme zitterte.
Gabriel legte den Kopf schief und änderte aus einem Impuls heraus seine Strategie.
„Du brauchst nicht so förmlich zu mir zu sein“, meinte er. „Ich bin Gabriel.“
Der Junge schluchzte einmal auf, der Schreck schien ihn einzuholen. Er presste die Hand gegen den Mund.
„Ich werde dir nichts tun“, setzte Gabriel behutsam hinzu. „Ich kenne die Bredouille, in der du warst. Hier, beruhige dich. Wie heißt du?“
Der Junge nahm das Taschentuch entgegen und wischte über sein Gesicht.
„Linot.“
„Warum arbeitest du im Palais Royal, wenn es dir zuwider ist?“
„Normalerweise bin ich flink genug.“ Der Junge holte mühsam Luft. „Und ich will nicht verhungern“, setzte er nüchterner hinzu.
„Was ich durchaus verstehen kann“, murmelte Gabriel. „Nun denn. Ich wollte dich eigentlich bitten, mir bei etwas zu helfen.“
„Stattdessen haben Sie mir geholfen. Was soll ich tun, Monsieur?“
„Gabriel. Ich bin kein Monsieur.“
„Fein. Gabriel.“ Linots Blick blieb misstrauisch. „Was soll ich tun?“, wiederholte er.
„Ich brauche etwas Besonderes für eine Dame, die, so glaube ich, schon fast alles gesehen hat. Ich muss sie beeindrucken.“
Das Misstrauen wich. Linot sah seine Tugend nicht mehr bedroht.
„Welche Dame?“, fragte er.
Gabriel biss sich auf die Lippen.
„Ich kenne ihren Namen nicht. Sie ist sehr schön.“
Linot verdrehte die Augen.
„Ich muss sie sehen“, forderte er Gabriel auf.
„Wie …?“
„Da, die Löcher in der Wand. Man kann von hier die Gesellschaft beobachten.“
Was für eine unverhoffte Chance, dachte Gabriel, während er die Augen an die Löcher presste. Der Winkel war anders, aber er fand sich schnell zurecht. Besagte Dame saß nach wie vor an dem Tisch, an dem er sie zurückgelassen hatte.
„Dort, neben dem Marquis de Dangeau“, meinte er, sich an den Namen des glücklichen Spielers erinnernd.
„Oh! Das ist Madame de l’Enclos!4 Da hast du dir ja eine ausgesucht!“ Linots verschwundenes Misstrauen schien dafür zu sorgen, dass er die vertraute Anrede zulassen konnte. Gabriel bemerkte es mit Genugtuung.
„Wieso?“
„Sie ist eine Kurtisane. Am Hof wird sie nicht empfangen, aber sie führt einen der angesagtesten Kreise von ganz Paris. Alle lieben sie. Es ist sehr selten, dass sie hierherkommt. Vielleicht war sie auf Zerstreuung aus.“
„Wird es sich für mich lohnen, ihre Zerstreuung zu sein?“, murmelte Gabriel, halb zu sich selbst.
Linot warf ihm einen amüsierten Blick zu.
„Madame de l’Enclos nimmt sich, wen sie will“, behauptete er. „Früher soll sie es noch wilder getrieben haben. Die meisten sind rasend verliebt in sie. Was willst du denn von ihr, wenn du nicht rasend verliebt bist?“
War er jemals rasend verliebt gewesen? Für einen Moment tauchte Maries Gesicht vor seinem inneren Auge auf, aber Gabriel wies es streng zurück. Er hatte keine Zeit mehr für eine Gastwirtstochter, deren Vater ihn nie als würdig genug angesehen hatte.
Das tat noch immer weh …
„Informationen, hauptsächlich“, sagte er vage. „Ich bin immer an Informationen interessiert.“
„Nun, gut informiert ist sie bestimmt. Sie ist aber auch schon alt. Sie könnte deine Großmutter sein.“
Etwas Ähnliches hatte der Herr an ihrem Tisch ebenfalls gesagt – auch wenn er vermutlich aus Gründen der Galanterie etwas jünger getippt hatte.5
„Hm“, meinte Gabriel. „Und wenn. Wer sind die anderen, die mit ihr da sitzen?“
„Der Marquis d’Effiat und Madame de Grancey. Die haben es faustdick hinter den Ohren. Und natürlich der Marquis de Dangeau. Der hat es auch faustdick hinter den Ohren, nur anders.“
„Weil er immer beim Spiel gewinnt?“
„Das weißt du also?“
„Ich hatte es mir gedacht. Was ist besonders am Marquis d’Effiat?“
„Er ist einer der Verbündeten des Chevaliers“, grummelte Linot. „Genauso wie die Grancey. Ich halte mich lieber fern von ihnen.“
„Würdest du dich auch von Madame de l’Enclos fernhalten?“, hakte Gabriel nach.
„Nicht so“, sagte Linot nach einer kurzen Pause. „Sie zwingt niemanden. Sie hat es nicht nötig, sie ist reich, schön und unabhängig.“
Interessant.
„Wer waren bislang ihre Liebhaber?“
„Sie hat alle gehabt“, behauptete Linot. „Sie ist berühmt.“
„Also ist sie gut informiert?“
„Das habe ich doch schon gesagt.“
Sie war der Anstrengung wert, entschied Gabriel.
„Womit könnte ich sie beeindrucken?“, fragte er Linot. Der warf ihm einen Blick zu, jetzt gar nicht mehr voll Ehrfurcht, sondern vielmehr verschwörerisch.
„Keine Schokolade – die Königin liebt sie, und Madame wird wohl kaum mit einer betrogenen Ehefrau gleichgesetzt werden wollen. Besser etwas Frisches. Ein Sorbet aus Pfirsichblüten vielleicht?“
„Um diese Jahreszeit?“
„Monsieur6 ist derzeit verrückt danach. Es gibt einen geheimen Vorrat. Komm. Die Köchin mag mich. Ich helfe dir!“
Er hatte auf das richtige Pferd gesetzt. Kurz darauf war er im Besitz von Monsieurs geliebtem Sorbet und erschien wieder im Gesellschaftszimmer. Der Blick, den Ninon de l’Enclos ihm zuwarf, verriet Ungeduld. Er hatte zu lange gebraucht.
Mit einer eleganten Bewegung kredenzte er ihr das Glas. Sie nahm es, die Brauen gerunzelt. Er beugte sich rasch vor und flüsterte in ihr perfektes Ohr, „Ich flehe Sie an, verraten Sie mich nicht. Es hat einige Mühe gekostet, dies zu besorgen, und ich möchte nicht den Unmut des Hausherrn auf mich ziehen.“
Ihre Stirn blieb gerunzelt, bis sie den ersten Schluck trank. Dann jedoch gab sie einen Laut des Erstaunens von sich. Er hatte sie überrascht.
„Dürfen wir wissen, womit der Junge Sie so in Entzücken versetzt?“, fragte der Marquis d’Effiat.
Gabriel hielt die Luft an.
„ – Nein“, erklärte Ninon de l’Enclos. „Es bleibt ein Geheimnis. Aber ich brenne darauf zu erfahren, wie er dies geschafft hat.“
Und während sie weiter nippte, das Glas nicht aus den Händen lassend, fixierte ihr Blick ihn, schwül, geheimnisvoll, und vor allem –amüsiert.
3 – Geheimnisse einer Kurtisane
Gabriel hatte keinerlei Illusionen, als Ninon de l’Enclos ihn mit nach Hause nahm. Die Schöne war ebenso wenig in ihn verliebt wie er in sie. Er war ein hübsches Spielzeug, eine Zerstreuung, vielleicht genau die, die sie sich erhofft hatte, als sie, wider ihre Gewohnheit, nicht die Hausherrin ihres eigenen Empfangs gespielt hatte, sondern ins Palais Royal gegangen war.
Er gab sich alle Mühe, sie nicht zu enttäuschen.
Zu seinem Erstaunen war sie ihm jedoch mehr als ebenbürtig. Sie lachte, als er erschöpft neben sie in die Kissen sank.
„Sie verblüffen mich“, gab er keuchend zu.
„Hattest du gedacht, ich gehöre schon zum alten Eisen, und du könntest mich ganz leicht verführen?“, stichelte sie.
„Niemand, der Sie näher kennenlernt, würde das wagen“, erklärte er im Brustton der Überzeugung. „Madame müssen jünger als ich sein!“
„Das wohl kaum“, seufzte sie. „Nein, verrate mir nicht, wie viele Jahre du zählst. Ich will mich nicht alt fühlen.“
„Ich glaube, Sie sind alterslos. Geben Sie mir fünf Minuten, und ich beweise es Ihnen.“
Sie lachte erneut.
„Überanstrenge dich nicht, mein Hübscher. Erkläre mir lieber, warum du wirklich mit mir kommen wolltest. Ich habe schon sehr viele Verliebte gesehen, und du bist es nicht. Was ist der Grund? Eine Wette?“
Er war erschüttert. Unter ihrem Blick, forschend, eine gewisse Härte hinter der Sanftheit, fühlte er sich zum ersten Mal nackt.
„Nein, gewiss nicht. Mit wem sollte ich wetten?“
„Mit deinen Freunden? Jungen Männern deines Alters?“
Er musste wider Willen lachen.
„Ich habe nur einen Freund. Der ist älter als ich und würde ganz bestimmt nicht über eine Dame wetten.“
Sie jedoch blieb ganz ernst.
„Nur einen Freund? Das ist nicht gut. Du brauchst mehr. Und du brauchst ein Mädchen deines Alters, mit dem du tändeln kannst.“
„Ich brauche ganz bestimmt kein Mädchen meines Alters“, widersprach er mit unerwarteter Heftigkeit. Und als sie ihn anstarrte, setzte er errötend hinzu, „Sie würde sich nur in mich verlieben. Was kann ich denn einem Mädchen bieten? Ich habe nichts und bin nichts.“
Er war nicht gut genug gewesen. Nie würde er das vergessen.
Ninon de l’Enclos legte ihm sanft die Hand auf die Schulter.
„Aber, aber. Nicht so bitter, mon petit. Bist du deshalb hier? Weil du Unterschlupf und Geld brauchst?“
So sollte es nicht sein. Nicht sie sollte ihm Geheimnisse entlocken, nein, andersherum hatte er es geplant. Unter ihren forschenden Augen errötete er erneut.
„Ich habe eine Stellung“, gestand er. „Beim Grafen Winsterburg.“
„Hat er dich geschickt? Warum?“
„Nein, er hat mich nicht geschickt.“ Was im Grunde genommen stimmte. „Aber … wir sind erst seit dem Jahreswechsel in Paris und kennen fast niemanden. Sie kennen alle Welt, und alle Welt kennt Sie. Sie müssen mich nicht aushalten.“
„Gut, denn das hatte ich auch nicht vor“, sagte sie trocken. „Außerdem muss ich dich enttäuschen. Meine wilden Tage sind schon eine ganze Weile vorbei. Heutzutage beschäftige ich mich mehr mit den Künsten als mit Klatsch.“
Er hielt ihrem Blick Stand, obwohl dies ganz anders verlief als er gehofft hatte.
„Alles, alles kann wichtig für mich sein“, sagte er.
Sie seufzte und drehte sich auf den Rücken, die Decke mit sich nehmend. Plötzlich fror er.
„Was willst du denn wissen? Dass alle Welt dieser Tage zu Wahrsagern rennt und sich die Zukunft vorhersagen lässt? Dass Madame de Montespan wieder in aller Heimlichkeit ein Kind bekommen wird? Dass man nicht erst seit der Hinrichtung der Marquise de Brinvilliers letztes Jahr von Gift spricht? Oder dass Mademoiselle de Scudéry taub geworden ist?“
Nein. Nein, so konnte er das nicht stehen lassen. Fein, er hatte seine Fähigkeiten im Vergleich zu einer stadtbekannten Kurtisane überschätzt, aber ihr Ton gefiel ihm überhaupt nicht.
„Jetzt klingen Sie bitter“, sagte er sanft, streckte die Hand aus, und als sie ihn nicht abwies, zog er sie zurück an sich, wickelte die Decke um sie beide. „Was kann ich tun, um das Lachen zurückzubringen? Ich mag nicht verliebt sein, aber ich liebe dieses Lachen in Ihrer Stimme.“
Sie musterte ihn.
„Zeig mir, was du kannst“, verlangte sie.
Er lächelte und küsste ihre Schläfe, dann ihren Hals.
„Das kann ich natürlich tun“, gestand er, „aber lieber wäre es mir, Sie würden mich lehren. Ich glaube, Sie könnten mich so unfassbar viel lehren. Ich wäre sehr gerne Ihr Schüler.“
Er hatte es geschafft, es zuckte um ihre Mundwinkel.
„Du bist unmöglich“, tadelte sie ihn. „Ich sollte dich wirklich fortschicken.“
„Ich muss noch früh genug weg“, seufzte er und schob seine Hand unter ihr Hemd. „Ich kann nicht bleiben.“
„Nein, das kannst du nicht. Aber du kannst etwas sanfter sein, und hier etwas fester, und du kannst mich so küssen – so – und …“
Er kam ihren Aufforderungen mit Begeisterung nach. Es war ihm egal, ob sie seine Mutter sein konnte oder nicht. Noch nie hatte er eine derart faszinierende Frau getroffen, noch nie sich in einer so verloren. Und da er nicht nur ein williger, sondern auch begabter Schüler war, war ihr Lächeln zurück, als er gehen musste.
„Darf ich wiederkommen? Bitte sagen Sie, dass ich wiederkommen darf!“
„Du bist – uff – nicht so ungestüm. Ja, du darfst wiederkommen“, lachte sie. „Lass mir deine Adresse da. Ich schicke dir Nachricht.“
„Ich wohne in einem Gasthaus.“
„Wie unangenehm. An wen soll ich die Nachricht schicken?“ zog sie ihn auf. „An Monsieur Zurmühlen oder Monsieur le Comte?“
„Bitte an mich, nicht an meinen Dienstherrn.“
„Hah, heißt das, dass du doch ein wenig unabhängig bist?“
„Unbedingt. Dies hier würde ich niemals dem Grafen überlassen.“
„Als ob du das entscheiden könntest, mein Hübscher“, spottete sie. „Ich suche mir meine Liebhaber selbst aus. Nein, schmoll nicht, ich sagte doch, du darfst wieder kommen und weiter von mir lernen. Und vielleicht …“, sie lächelte dieses ganz bestimmte, geheimnisvolle Lächeln, „vielleicht habe ich tatsächlich ein paar nützliche Informationen für einen jungen Mann wie dich.“
„Madame, Sie müssen vorsichtig sein“, lachte er, „oder ich verliebe mich doch noch in Sie!“
*
Er war gut gelaunt, als er heimeilte, obwohl es so spät war, dass der Himmel sich schon verfärbte. Summend erreichte er das Gasthaus und kletterte die Stiege hinauf, bis er seine Etage erreichte. Dort wäre er allerdings fast über ein schlafendes Mädchen gestolpert.
„Clélie! Was tust du hier?“
Die Gastwirtstochter war halb von ihrer Stufe gepurzelt. Ihre Augen waren groß und sehr müde.
„Ich habe auf Sie gewartet. Man ist ohne Sie wiedergekommen, Monsieur Gabriel, und sie wollten mir nicht sagen …“
War es erst ein paar Stunden her, dass er darüber nachgedacht hatte, ob er sie verführen sollte? Eine Welt schien dazwischen zu liegen – Clélie erschien ihm auf einmal so jung und wenig reizvoll. Er runzelte die Stirn.
Offenbar musste er wirklich aufpassen, sich nicht in die Kurtisane zu verlieben.
Sanft beugte er sich zu dem Mädchen herunter.
„Nichts Schlimmes ist mir geschehen. Und du kannst nicht meinetwegen die ganze Nacht aufbleiben, das bin ich nicht wert.“
„Doch, das sind Sie, Monsieur Gabriel – Gabriel …“ Ihre Augen glänzten wie zwei Sterne.
Er schüttelte mit Nachdruck den Kopf.
„Du darfst dich nicht in mich verlieben, Clélie“, bestimmte er. „Du darfst nicht, hörst du?“
„Warum nicht?“ Sie schob ihre Unterlippe vor wie ein Kind. „Ich habe nicht vergessen, was Sie gesagt haben. Sie sind ein Gastwirtssohn, ganz so wie ich …“
Es traf unerwartet hart und heiß. Er schob sie brüsk von sich.
„Das bin ich nicht“, erklärte er harsch. „Ich mag in einem Gasthaus großgeworden sein, aber ich bin kein Gastwirtssohn. Und dies führt zu nichts.“
Er ließ sie auf der Treppe stehen und eilte weiter in das Zimmer, das er sich mit Hagen teilte. Wie er befürchtet hatte, blinzelte der Riese ihn schlaftrunken an.
„Was war denn das?“, brummte er.
„Nichts, gar nichts.“ Gabriel zog sich rasch bis aufs Hemd aus, kroch unter die Decke und schloss die Augen.
„Mann, bin ich erschöpft“, murmelte er, und dann war er auch schon weg.
Hagens abgrundtiefen Seufzer bekam er schon nicht mehr mit.
*
Am nächsten Morgen wurde er recht rüde von seinem Freund geweckt. Das mochte allerdings auch daran liegen, dass er sehr müde war und Hagens sanftere Versuche zu keinem Erfolg geführt hatten.
„Ich steh ja schon auf“, grummelte er schließlich, als man ihm seine Decke weggezogen und mit kaltem Wasser gedroht hatte. Immerhin war es mitten im Winter.
„Wage es nicht, mich mit diesem übelriechenden Zeug zu begießen“, setzte er grimmig hinzu. „Oder willst du mich umbringen?“
„Der Herr wird dich umbringen, wenn du dich nicht beeilst. Er erwartet einen vollständigen Bericht.“
Gabriel verzog das Gesicht.
„Oh, Freude“, murmelte er, aber verließ gehorsam das warme Bett.
Während er sich reinigte und anzog, warf er einen angewiderten Blick auf das Wasser, welches Hagen von unten besorgt hatte. Es roch faulig und sah auch so aus.
Vater Bense hätte das niemals einem Gast zugemutet. Er hatte immer Sorge getragen, dass der Brunnen im Hof funktionierte. Darauf hatte er bestanden, denn, wie er behauptete, wenn Soldaten durch die Stadt zogen und man sich verstecken musste, wenn alle Biervorräte ausgesoffen worden waren, war nichts schlimmer als Durst.
Da waren sie schon wieder, die ungewollten Erinnerungen an seine Kindheit. Es wurde Zeit, dass sie aus diesem Gasthaus fortkamen. Es tat ihm nicht gut.
Er polterte die Stiege hinunter und hoffte auf ein schnelles Frühstück, aber wurde enttäuscht. Hagen fing ihn ab, bevor er zur Gaststube abbiegen konnte, und Clélie wartete nach gestern Nacht natürlich nicht mit frischem Gebäck auf ihn.
Vielleicht hätte er nicht ganz so schroff sein sollen.
So landete er müde und hungrig, aber zumindest äußerlich ansehnlich in dem weitaus geräumigeren Zimmer, welches der Graf für sich und seinen Leibdiener requiriert hatte. Anton war nicht da, wie Gabriel mit einem Blick bemerkte. Vermutlich machte er Besorgungen.
Der Graf hielt sich nicht mit langen Vorreden auf, sondern schoss ihm lediglich einen Blick zu. Gabriel brauchte keine weitere Aufforderung und begann damit, wie er auf Ninon de l’Enclos aufmerksam geworden war – beziehungsweise sie auf ihn – und was sich daraus entwickelt hatte.
„Ich denke, Sie können zufrieden sein“, beendete er seinen Bericht – in den er wohlweislich nicht jedes Detail eingeschlossen hatte, zumal der Graf das auch nicht verlangte. „Ich habe jetzt einen Kontakt unter den Bedienten des Palais Royal und einen Kontakt zur berühmtesten Gesellschaftsdame von Paris.“
„Wohl eher zur berühmtesten Kurtisane“, bemerkte der Graf spitz. „Und dein Eingreifen beim Chevalier hätte nach hinten losgehen können. Du weißt, dass dieser Trick auch versagen kann?“
„Er hat aber nicht versagt. Und jetzt habe ich einen Stein im Brett bei Linot.“
„Ein Lakai.“
„Besser als nichts. Außerdem wissen die Bedienten immer mehr, als man ihnen zutraut.“
Der Graf gab nach.
„Fein“, sagte er. „Du kannst deinen Lakaien und deine Kurtisane weiter kultivieren. Der Abend hat sich auch auf andere Art und Weise ausgezahlt. Wir sind ins Hôtel de Soissons geladen.“
„Ist Madame la Comtesse nicht am Hof?“
„Sie braucht wohl eine Nacht im eigenen Bett“, sagte der Graf spöttisch. „Es gelten dieselben Spielregeln wie gestern – wobei ich es vorziehen würde, wenn du diesmal keine Kavaliere ausschalten würdest, Gabriel.“
Gabriel verbeugte sich leicht und überlegte, ob das Risiko eines Lakaien, im Hôtel de Soissons attackiert zu werden, genauso hoch war wie im Palais Royal.
Was ihn daran erinnerte – Linot würde durch sein Eingreifen nicht auf Dauer geschützt sein. Wenn er sich also ein länger währendes Wohlwollen des Lakaien sichern wollte, musste er sich etwas einfallen lassen.
Aber zunächst wurde er losgeschickt, Libellen besorgen. Das waren die berühmten Klatschblätter von Paris, oft nur ein Zettelchen, auf denen in schmieriger Druckerschwärze die schlimmsten Zoten gedruckt wurden. Gabriel las sie mit Vergnügen, und der Graf betrachtete sie als Informationsquelle.
Sie mochten erst seit dem Jahreswechsel in Paris sein, aber die Umgebung hatte er bereits gut ausgekundschaftet. Er fand den Weg zu Les Halles, den Markthallen von Paris, einen Bogen um den Friedhof Les Innocents machend, und dann ebenso um den Fischmarkt, des Gestankes wegen. Am Rand traf er die Blumenbinderinnen, mit denen er schon geschäkert und sich einige Freundinnen gemacht hatte.
Unweit von ihnen bot ein gewitzter Junge seine Klatschblätter an. Ein weiterer hielt nach der Polizei Ausschau, welche den Auswüchsen von Paris den Kampf angesagt hatte.
Gabriel kannte sie bereits, und sie kannten ihn. Ein paar Sou7 wechselten den Besitzer, ebenso ein paar Blättchen. Er faltete sie rasch und schob sie in seine Tasche. Er würde später eine ruhige Ecke finden, um sie zu lesen, bevor er sie dem Grafen brachte.
„Was gibt es Neues, meine Hübschen?“, fragte er die Blumenbinderinnen lachend.
„Minette ist ein Ritter in ihrer Zukunft vorhergesagt worden!“, vertraute ihm sofort Babette an, und besagte Minette errötete und warf ihm einen scheuen Blick zu.
„Na“, machte Gabriel, der sofort an den Chevalier de Lorraine dachte. „Dann hoffe ich, es ist einer von den Guten.“
„Oh, Monsieur Gabriel!“
Er grinste, um die Worte abzumildern, schäkerte noch ein wenig mit ihnen und kaufte ein kleines Sträußchen Veilchen, in das er seine Nase stecken konnte, als er erneut am Fischmarkt vorbeimusste.
Dahinter fand er endlich eine ruhige Ecke und zog die Libellen hervor.
Wieder eine über Madame de Montespan und das wilde Liebesleben des Königs – eine über Madame de Ludres, von der er noch nie gehört hatte – das übliche über Louvois, den schwitzigen Kriegsminister – und eine über Colbert, eiskalt wie der Norden. Dazwischen gab es allerdings noch eine, die seine Aufmerksamkeit auf sich zog.
Ein Abend im Palast der Reichen,
ein hübscher Jüngling wollt nicht weichen.
Wusst gar zu schmeicheln und zu locken,
hat sich erwählt den reifsten Brocken.
Großmütterchen, ich will Euch wohl gefällig sein!
Da nahm Ninon den Kerl mit heim.
Na, so was. Gabriel musste lachen. Er war erst einen knappen Monat in Paris und hatte es schon auf ein Klatschblatt geschafft! Wer wohl im Palais geplaudert hatte? Und ob Ninon die Sache auch so gelassen sehen würde?
Er hoffte es, sehr.
Er war noch lange nicht fertig mit der alterslosen Schönheit.
4 – Erkenntnisse aus dem Hôtel de Soissons
Das Palais der Grafen von Soissons lag unweit des Louvre und war die uneingeschränkte Residenz Olympe Mancinis, eine der berühmten Nichten des verstorbenen Kardinals. Jung, arm und gierig nach schönen Dingen waren die sogenannten Mazarinetten in den 1640ern und 1650ern nach Paris gekommen, wo ihr Onkel ihnen Ehemännern verschaffte, mit denen sie mehr oder weniger glücklich wurden. Sie hatten einst mit dem Kind-König und seinem Bruder gespielt. Sie standen ihm nahe, und so war es wenig verwunderlich, dass Olympe ein Liebling am Hof war.
Für ihren sanften, mittlerweile verstorbenen Ehemann hatte sich die Comtesse nie besonders interessiert, und auch nicht für ihre zahlreiche Kinderschar, die sie irgendwo in diesem Haus versteckt hielt. Wollte man den Libellen glauben, hatte Madame de Soissons sich ein höheres Ziel gesteckt.
Aber wenn dem so wäre, sollte sie nicht hier sein, sondern in Versailles, wo der Hof derzeit residierte, etwa zwei Stunden Kutschfahrt außerhalb von Paris.
Gabriel betrat das Hôtel de Soissons mit derselben Neugier, mit der er am Vorabend ins Palais Royal gegangen war. Und die Szenerie, wenn auch vielleicht etwas geschmackvoller und weniger überbordend gestaltet, war praktisch dieselbe: Tische standen herum, spielhungrige Adlige saßen daran, warfen Karten oder Würfel darauf, fluchten, weinten und forderten sich gegenseitig. In den Ecken wurde getändelt, und während Gabriel zusah, verschwand immer mal wieder ein kicherndes Pärchen, um sich ein etwas privateres Plätzchen zu suchen.
Er hatte diesmal keinen Tisch gefunden, der ihn besonders interessierte. Ninon hallte immer noch in ihm nach. Stattdessen hatte er den Grafen, der wie immer seine Finanzen aufbessern wollte, mit Hagen zurückgelassen, war herumspaziert und hatte auf eine Chance gehofft, entweder eine Bande zu einem Dienstboten oder einem Anwesenden zu knüpfen. Bislang hatte sich keine ergeben.
Doch jetzt geschah etwas Neues: Die Hausherrin klatschte in die Hände und kündigte eine Überraschung an. Sie hätte über verschwiegene Kanäle eine Wahrsagerin aufgetan, eine uralte Dame mit dem Namen Marquise de Jumerile8, welche ihren Gästen nun ihre Künste vorführen würde.
„Die Marquise ist das Opfer eines alchemistischen Unfalls“, erklärte die Comtesse mit funkelnden Augen. „Sie ist bereits über einhundert Jahre alt und mit der Gabe der Weissagung gesegnet! Sie glauben mir nicht? Sehen Sie selbst!“
Auf ihr Zeichen hin öffnete sich die Tür und eine kleine Gestalt hinkte hinein, auf einen riesigen Stock gestützt und in die Mode des letzten Jahrhunderts gehüllt. Gabriel konnte nicht umhin, die Mundwinkel amüsiert zu verziehen, aber er konnte genauso wenig umhin, ein angenehmes Gruseln zu verspüren.
Die Marquise humpelte in die Mitte des Raumes, wo sie gut von allen gesehen werden konnte. Dann hob sie den Schleier von ihrem Gesicht.
Ein Keuchen ging durch die Reihen. Gabriel zuckte zurück. Unter dem Schleier war ein faltenloses, totenbleiches Antlitz mit tief in den Höhlen liegenden Augen aufgetaucht, ein blutroter Mund, der sich jetzt schnarrend öffnete: „Ich brauche meine Gerätschaften!“
Auf einen weiteren Wink hin eilten die Bedienten der Comtesse herbei, schleppten einen Tisch, einen Stuhl heran. Die Marquise breitete ein kabbalistisches Tuch darüber aus und verlangte mehrfach geläutertes Wasser, in einem derart muffigen, unverschämten Ton, dass Gabriel erwartete, man würde sie zurechtweisen.
Was aber niemand tat. Die Gesellschaft schien fasziniert von der wunderlichen Gestalt, die sich gestelzt und bitter über die Jugend von heute erging und sich schließlich dazu überreden ließ, am Tisch Platz zu nehmen und eine erste Lesung durchzuführen. Sie brauchte ewig, um aus all ihren Utensilien einen Stab auszusuchen, mit dem sie schließlich, unter seltsamem Gesinge, im Wasserglas rührte.
Gabriel schauderte es.
„Ah, ah“, sagte jemand neben ihm. „Fürchten Sie sich nicht, Monsieur. Ich bin fast sicher, dass sie keine hundert Jahre alt ist.“
Gabriel sah sich um. Neben ihm lehnte der Marquis de Dangeau, den Kopf schief gelegt, die gruselige Wahrsagerin fixierend.
„Woher wollen Sie das wissen? Schauen Sie sie doch an!“
„Ja, es ist eine schöne Geschichte“, gab der Marquis zu. „Ein missglücktes Experiment, auf dessen Geheimnis jeder insgeheim hofft, eine Greisin, die jung und alt zu sein scheint – jedoch, Monsieur, die einzige alterslose Dame, die mir jemals begegnet ist, ist unsere schöne Ninon.“ Er drehte den Kopf und zwinkerte Gabriel zu. „Ich vermute, Sie wissen, was ich meine, oder?“, setzte er sanft hinzu.
War Dangeau derjenige gewesen, der den Libellenschreibern ihr Tête-à-Tête gesteckt hatte? Falls ja, war Gabriel sich nicht sicher, ob er dem Marquis dankbar oder wütend auf ihn sein sollte.
„Schauen Sie doch ihr Gesicht“, murmelte er stattdessen. „Wie grausig. So sieht kein normaler Mensch aus!“
„Es ist Schminke, mein Bester. Treffliche Schminke von jemandem, der sein Handwerk perfekt versteht, aber dennoch Schminke.“
„Wie kommen Sie …?“
„Ich kann Menschen lesen“, sagte der Marquis amüsiert. „Mein Erfolg hängt davon ab. Und dieses kleine Monstrum da ist eine sehr clevere, sehr raffinierte Betrügerin. Ich werde sie nicht entlarven, Gott bewahre. Ich bewundere vielmehr, was sie tut. Hm. Ob sie wirklich im Wasserglas lesen kann?“
„Glauben Sie nicht an Wahrsagerei? An das Okkulte?“, fragte Gabriel, neugierig geworden.
„Oh, ich würde niemals die Existenz des Teufels abstreiten“, erwiderte der Marquis. „Zumal die Kirche selbst darauf besteht. Ich bestreite nur manche Fähigkeit meiner Mitmenschen, mit ihm in Kontakt zu treten. Neulich durfte ich einer anderen Weissagung beiwohnen, im Haus einer gewissen Monvoisin.9 Ich muss sagen, es war deutlich weniger erfreulich als dies hier. Sieh mal einer an! Entweder sie kann tatsächlich im Wasser lesen oder in den Menschen, so wie ich!“
Madame de Jumerile hatte ihre erste Lesung vollendet und offenbar eine gestellte Prüfung glänzend absolviert. Man fing an, sich um sie zu drängen, was sie zu der keifenden Aussage veranlasste, man dürfe ihr das Wasser nicht trüben. Der Nächste, der vor ihr Platz nahm, bat darum, ihm das Glück beim Spiel vorherzusagen, was Dangeau zum Glucksen brachte.
„Der Herr hätte sehr viel mehr Glück, wenn er einfach aufpassen würde“, lästerte er. „Aber dann, es kommt mir zupass.“
„Ich versteh dies nicht“, gestand Gabriel offen. „Diese Spielerei, dieses Wegwerfen des Geldes – ich habe mitbekommen, wie eine Dame heute Abend allein mehrere tausend Livres verloren hat. Sie war betrübt, aber sie hörte nicht auf.“
„Das ist noch gar nichts. Madame de Montespan hat an Weihnachten siebenhunderttausend verloren. Und im nächsten Atemzug gewann sie hundertfünfzigtausend zurück.10“
„Wieviel??“
„Genau das ist es, diese Hoffnung auf ein plötzliches Glück, was sie alle an den Tischen hält“, sinnierte Dangeau. „Sogar unsere Königin spielt. Verliert Unsummen dabei, das arme, naive Ding. Und da ist es ganz gleich, dass man Pharo verboten hat, sie verliert trotzdem.“
„Im Palais Royal hat man gestern Pharo gespielt“, gab Gabriel zu bedenken.
„Das Palais Royal ist ein besonderer Ort“, erwiderte Dangeau. „Niemand wird vom König so genau beäugt und hat dennoch so viel Narrenfreiheit wie Monsieur. Oder glauben Sie, unser allerchristlichster König würde das italienische Laster so tolerieren, wenn nicht sein eigener Bruder ihr verfallen wäre?“
„Die italienische … die Liebe zwischen Mann und Mann ist nicht allein italienisch, will ich meinen.“
„Mag sein. Aber für die Franzosen kommt alles Schlechte aus Italien11“, sagte der Marquis. „Man denke nur an Mazarin!“
Madame de Jumerile vollführte eine weitere Lesung, erneut von Ahs und Ohs begleitet. Gabriel fasste sie genauer ins Auge. Wenn er tatsächlich hinter all die Schminke blickte, dann glaubte er fast, ein junges Mädchen zu sehen, das sich diebisch freute, die Anwesenden so hinters Licht zu führen.
Vielleicht hatte Dangeau recht.
„Warum sind Sie so offen zu mir?“, fragte er plötzlich. „Warum sprechen Sie überhaupt mit mir?“
„Ah.“ Der Marquis lachte leise. „Sie haben Ninon bezaubert, Kleiner. Und ich mag unsere schöne Ninon sehr. Ich möchte sicherstellen, dass Sie ihr nicht schaden wollen.“
„Wie könnte ich ihr schaden?“ Gabriel war verblüfft.
Dangeau musterte ihn.
„Wie gesagt, ich kann sehr gut in Menschen lesen“, sagte er leise. „Sie sind nicht unsterblich verliebt. Sie treibt etwas anderes an. Junge Männer sind oft so rücksichtslos. Ich muss es wissen, ich war selbst mal einer.“
Jetzt war Gabriel noch mehr verblüfft. Der Blick des Marquis war herausfordernd, warnend, und er verstand, dass er hier auf die Probe gestellt werden sollte. Er riss sich zusammen.
„Ich habe nicht die Absicht, Madame de l’Enclos zu schaden“, sagte er leise. „Ich bin nur … neu in der Stadt und sehr neugierig. Auf alles mögliche.“
„Mademoiselle de l’Enclos. Ninon hat nie geheiratet. Sie verabscheut die Ehe.“
„Sie schien nichts dagegen zu haben, dass ich sie Madame nannte.“
„Mag sein, sie ist sehr tolerant. Sie sollten jedoch wissen, wenn Sie ihr schaden, werden Sie einen Feind in mir haben, und ich bin äußerst gut vernetzt.“
Gabriel erwiderte den Blick mit aller Offenheit, zu der er fähig war.
„Und was muss ich tun, damit Sie in mir einen Freund und keinen Feind sehen?“, gab er zurück. „Wenn es nur darum geht, Mademoiselle de l’Enclos nicht zu bekümmern, sehe ich keine Gefahr.“
„Hm. Wir werden sehen.“ Der Marquis drehte den Kopf wieder nach vorne. „Ah, ich habe mich gefragt, wann dies Thema werden wird.“
Eine neue Lesung fand statt. In diesem Fall bat eine rotblonde Dame darum, ihr ihren nächsten Liebhaber vorherzusagen, was der Comtesse de Soissons nicht zu gefallen schien. Die besagte Rothaarige schien sehr siegesgewiss.
„Erklären Sie mir das?“, bat Gabriel.
Dangeau lächelte süffisant.
„Das ist Madame de Ludres. Alle wissen, dass das Auge des Königs auf sie gefallen ist, zumal Madame de Montespan wieder eine ihrer robes volantes12 trägt. Jeder weiß, was das zu bedeuten hat.“
„Ich bin offenbar nicht jeder“, meinte Gabriel, obwohl er ahnte, worauf das hinauslief.
„Die Montespan ist schwanger“, sagte Dangeau unverblümt. „Das Auge des Königs schweift, je dicker sie wird. Jede der hier Anwesenden erhofft sich seine Gunst.“
„Jede?“
„Mit Sicherheit. Auch unsere bezaubernde Gastgeberin, die, Gerüchten zufolge, diese bereits einmal besaß. Wie grimmig sie jetzt guckt. Ich frage mich, wie unsere Wahrsagerin sich aus dieser Bredouille rettet. Sie sollte Madame la Comtesse nicht verärgern, aber falls Madame de Ludres Erfolg hat und sie es nicht vorhersagt, schadet sie sich selbst.“
Gabriel bekam nicht mit, was die kleine Marquise prophezeite, denn er war damit beschäftigt, diese Informationen zu verarbeiten.
Was hatte der Graf doch gleich in Rom gesagt, wo er sich von seiner schweren Verletzung erholt hatte, nach dem Verlust in Kleve? Wenn man den König nicht mehr auf dem Schlachtfeld begegnen konnte, musste man ihn eben anders besiegen, musste man Informationen finden, die den Gesandten von Nutzen waren, die den Grafen in den Augen des Kurfürsten unentbehrlich machten. Damals, in Rom, war dies Gabriel sinnvoll erschienen.
Aber jetzt, wo er über die Gesellschaft der Comtesse blickte, fragte er sich, ob die französischen Adligen überhaupt etwas anderes interessierte als ihr Vergnügen.
Dass ihr Land Krieg führte, schien hier ganz weit weg zu sein.
„Was für eine elegante Lösung“, murmelte der Marquis, der im Gegensatz zu seinem Gesprächspartner die Geschehnisse weiterhin aufmerksam verfolgte. „Sie lässt sowohl Madame la Comtesse als auch Madame de Ludres im Unklaren. Somit hat sie auch keine der beiden enttäuscht. Raffiniert.“
„Könnte sie nicht auch einfach wirklich die Zukunft im Glas sehen?“, fragte Gabriel aus einem spontanen, leicht verzweifelten Impuls heraus.
Der Marquis wandte sich ihm zu und musterte ihn nachdenklich.
„Ich kann das natürlich nicht ausschließen“, sagte er nach einem Moment. „Wie alle anderen auch schwanke ich zwischen dem Verlangen, mein Schicksal zu kennen, und der Furcht davor. Wollen Sie Madame de Jumerile um eine Lesung bitten? Ihre Preise werden nach dem heutigen Abend in die Höhe schnellen.“
Er hatte natürlich längst erkannt, dass Gabriel nicht vermögend war. Der seufzte.
„Ich werde mich wohl auf altmodische Art informieren müssen“, grummelte er. „Monsieur – dürfte ich Sie um etwas bitten?“
Der Marquis verengte die Augen.
„Um was?“
Gabriel holte tief Luft.
„Mademoiselle de l’Enclos … wenn Sie sie vor mir sehen, richten Sie ihr doch bitte aus, dass ich an den Libellen nicht schuld bin. Und dass ich es bedauere, wenn es ihr Ungemach bereitet hat.“
Eine ganze Weile ruhte der Blick Dangeaus forschend auf ihm, und Gabriel hielt ihm Stand, so offen, wie er nur konnte.
Dann lächelte der Marquis schwach.
„Beunruhigen Sie sich nicht, mein Kleiner“, meinte er lässig. „Ninon steht über allen Gerüchten. Wenn sie das nicht täte – ja, wenn sie etwas auf diese Meinungen geben würde, hätte sie sich längst in die Seine stürzen müssen.“
Was Gabriel nur bedingt beruhigte.
5 – Pariser Wunder
Es wartete kein Billet von Ninon auf Gabriel, als sie zum Gasthaus zurückkehrten, und es kam auch keines am Folgetag. Sie hatten keine Einladung, was der Graf dazu nutzte, den brandenburgischen Gesandten13 aufzusuchen. Er nahm hierzu nur Hagen mit und ließ Gabriel mit den Worten zurück, sich irgendwie nützlich zu machen.
Gabriel streifte eine Weile sinnlos durch die Straßen und beobachtete das bunte Treiben. Als es zu dämmern begann, machte er sich auf den Heimweg. Dort angekommen, suchte er Clélie auf, die in den oberen Stockwerken zugange war.
„Clélie, mein bezauberndes Mädchen!“, sagte er fröhlich.
Die Gastwirtstochter warf ihm einen unwirschen Blick zu.
„Oh, jetzt bin ich wieder bezaubernd? Liegt es daran, dass Monsieur immer noch keine Nachrichten erhalten hat, obwohl er täglich danach fragt?“
„Sei doch nicht so kühl zu mir. Können wir nicht Freunde sein?“
Sie war nicht versöhnt.
„Ich bin beschäftigt.“ Von der Straße her ertönte ein langgezogener Pfiff. Clélie öffnete eines der Fenster, löste das dort befestigte Seil und ließ eine Laterne herab. Als sie sie wieder hochzog, brannte sie hell.
„Das ist wirklich ein Wunderwerk“, sagte Gabriel anerkennend. „Ich kenne keine andere Stadt, die nachts so hell erstrahlt wie Paris.“
„Keine?“ Clélie schien wider Willen geschmeichelt.
„Dies habe ich weder in Rom noch in Regensburg gesehen“, erklärte er. „Nicht einmal in Köln, nicht in Florenz …“
Clélie warf sich in die Brust.
„Monsieur de La Reynie hat bestimmt, dass Paris die sauberste und anständigste Stadt der Welt werden soll. Er hat sich das System ausgedacht. Er hat die Bettler und Diebe verjagt!“
„Alle?“ Da hatte Gabriel doch Zweifel.
„Es war viel schlimmer, früher“, behauptete Clélie. „Maman erzählt immer von der Cour des Miracles, wie es früher war.“
„Hof der Wunder?“
„Oh ja, Monsieur.“ Clélie kicherte. „Das muss ein Anblick gewesen sein! Tagsüber die ärmsten, siechsten Gestalten, verkrüppelt und erbärmlich – aber kamen sie heim – oh Wunder! – fielen alle Gebrechen von ihnen ab und sie waren geheilt!“
Gabriel stimmte in ihr Gelächter mit ein und lehnte sich an den Sims neben sie.
„Besser als jeder Arzt!“
„Ganz bestimmt!“
Für einen Moment trafen sich ihre Blicke, und alle Schranken schienen fort. Er biss sich auf die Lippen.
„Clélie, wenn ich … du bist doch hier daheim und kennst dich gut aus.“
„Ja?“
„Wenn ich eine Weissagung haben wollte, eine, die nicht ganz so teuer ist – wohin würde ich gehen?“
Ihre Augen wurden groß.