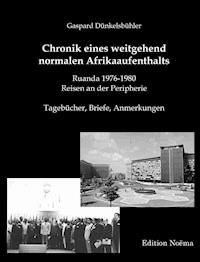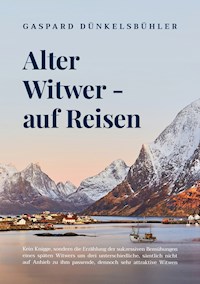
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Ein seit langem pensionierter Jurist verliert als hoher Siebziger seine viel jüngere Frau, mit der er hoffte, auch weiterhin seinen Lebensabend ruhig in seinem alten Bauernhaus im Chiemgau, im Alpenvorland, zu verleben. Zuvor hatten sie während eines Vierteljahrhunderts ein mehr oder weniger bewegtes Dasein im diplomatischen Milieu der Entwicklungsländer Afrikas und Asiens verbracht. Jetzt steht er allein und ohne Aufgabe da und macht sich nach dem Beispiel einiger gleichalter Freunde und Kollegen, ebenso verwitwet wie er, auf die Suche nach einer zu ihm passenden Lebensgefährtin. Zu Anfang versucht er, eine Anleitung zu finden, eine Art Benimmbuch, wie man es gewöhnlich mit dem Namen des Freiherrn von Knigge verbindet. Es gibt aber keinen Leitfaden, an dem er sich orientieren könnte. Aber es gibt, wie er bald feststellt, nicht wenige reizvolle, nicht leicht zu durchschauende, aber sehr begehrenswerte Frauen. Er gibt sich große Mühe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 504
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Hinweis
Der Verfasser hat sich bei den von ihm benutzten Zitaten aus Gedichten und anderen Quellen,
auch aus Schlagertexten, die in seiner Lebenszeit populär waren, nicht an den Originalwortlaut
gehalten, sondern sie so zitiert, wie sie von seinen Gestalten nach seinen Notizen oder nach
seiner Erinnerung verwendet worden sind. Hierfür wird um Verständnis gebeten. G. D.
Inhalt
Vorwort
Einführung
Erster Teil
Der alte Witwer
Zweiter Teil
Das Postschiff und ein paar seiner Passagiere
Dritter Teil
Die gusseiserne Taube, oder Anne, die Witwe von Welt
Vierter Teil
Eine Zeitungsanzeige; Zuschrift Nr. 37
»Das Alter ist eine Maske, die das Leben uns zu tragen zwingt.«
Simone de Beauvoir, 1908 – 1986
»Das Glück findet man unterwegs und nicht am Ende des Weges.«
Zettel am Fenster des ehemaligen Dorfkiosks von Obing, Bundesstraße 304, 2014
»Wenn du ein Buch suchst, das es nicht gibt,
so setze dich hin und schreibe es selber!«
Toni Morrison, 1931 – 2019, Nobelpreis für Literatur 1993
Vorwort
Der bis heute weltweit und auch vom Autor dieses Buches verehrte Naturforscher und Forschungsreisende Alexander Freiherr von Humboldt (1769 – 1859) hat dem im Jahre 1845 bei I. G. Cotta in Stuttgart und Tübingen veröffentlichten ersten Band seines bekannten Werkes »Kosmos, Entwurf einer physischen Weltbeschreibung« die nachfolgende, von einer großen Bescheidenheit zeugende Einschränkung vorangestellt, welche dem hier zu Wort kommenden Autor während mehrerer Jahre bei der sich hinziehenden Arbeit immer wieder in den Sinn kam:
»Ich übergebe am späten Abend eines vielbewegten Lebens dem Publikum ein Werk, dessen Bild in unbestimmten Umrissen mir fast ein halbes Jahrhundert lang vor der Seele schwebte. In manchen Stimmungen habe ich dieses Buch für unausführbar gehalten: und bin, wenn ich es aufgegeben, wieder, vielleicht unvorsichtig, zu demselben zurückgekehrt. Ich widme es meinen Zeitgenossen mit der Schüchternheit, die ein gerechtes Misstrauen in das Maaß meiner Kräfte, mir einflößen muss.«
Mögen die Leser, mögen vor allem aber die oftmals sehr unzulänglich abgebildeten weiblichen Gestalten, welche die Probleme, die Würze und, unleugbar, den Inhalt der späten Jahre bildeten und immer noch bilden, sowie deren misstrauische Familien und einige erwähnte gemeinsame Freunde großmütige Nachsicht üben! Für die Verwendung eines Zitats von Alexander von Humboldt in einem so privaten Gemälde sei die Leserschaft ausdrücklich um Vergebung gebeten!
Der Verfasser
Einführung
Bei seiner Kur in Oberstaufen im Allgäu, in dem von ihm in jedem November zum Entschlacken aufgesuchten Sanatorium des Dr. Kessel, kam Fridtjof Häusser, ein pensionierter Jurist, der in seinem Berufsleben in verschiedenen Funktionen, zuletzt als Diplomat, tätig gewesen war, einige Jahre nach dem Tod seiner Frau, mit einem anderen Stammgast ins Gespräch, dem früheren Inhaber einer GmbH für Getreidehandel in Bremen. Die Inhaberin des Naturheilzentrums und Witwe des Gründers, Frau Kessel, hatte auf Empfehlung ihrer Assistentin, Roswitha Berner, die beiden alten Herren zusammen an einen Tisch gesetzt. Beide waren im Hause seit Langem bekannt, waren aber bisher selten zur gleichen Zeit und beide nie ohne Begleitung dagewesen, stets zur Schrothkur, der Spezialität des Sanatoriums. Beide waren angenehme Patienten, durch ihre Berufe in der Welt herumgekommen, die ein paar Wochen lang die Ruhe im Haus Kessel genossen. Nun fanden beide Serviettentaschen mit ihren Namen auf einem der Zweiertische am Eingang des Speisesaals vor. Der etwa vierzig Gäste fassende Saal war jetzt, in der zweiten Novemberhälfte – die Nebensaison war kostengünstiger – schwach besetzt; insgesamt waren es nicht mehr als fünfzehn Gäste, die Mehrzahl Damen. Die Kurgäste bekamen morgens ein Kännchen Kräutertee mit zwei Scheiben Knäckebrot und einer Kugel Quark und einem Döschen ihrer bevorzugten Marmelade, mittags und abends gab es eine proteinlose Diät, abends bildete dabei eine Schale Kompott den Abschluss. Man kam täglich auf nicht mehr als fünfhundert Kalorien. Während der Kur wurde weder Fleisch noch Fisch serviert, gewürzt wurde ausschließlich mit Kräutersalz, und, um den Blutdruck nicht unnötig zu erhöhen verzichtete man auf Kaffee und Schwarztee. Den angenehmen Höhepunkt bildete an vier von sieben Abenden der Wein. Ein halber Liter für die Männer, ein Viertelliter für die Frauen. Den gestrengen Auftakt eines jeden Wochentages bildete der sogenannte »Schrothwickel«, nach Johannes Schroth, dem längst verstorbenen böhmischen Schöpfer der nach ihm benannten Entschlackungsmethode, zu dem die Patienten morgens, etwa um vier Uhr, von der »Packerin«, einer schweigsamen und robusten Frau in einer großen Schürze geweckt wurden. die sie – nackt – mit ein paar kundigen Handgriffen in nasse Leintücher einschlug und unter Wolldecken in ihren Betten verstaute – ehe sie das Licht wieder löschte.
Die beiden hier erwähnten Herren, deren Gesundheitsprobleme der Kurärztin seit vielen Jahren bekannt waren, waren von dieser Prozedur befreit. Beide fielen erst in der Morgendämmerung in einen Schlummer, der nicht gestört werden sollte. Nach dem Frühstück verbrachten sie eine bestimmte Zeit, Häusser meist eine halbe Stunde, im Leseraum, wo die Tageszeitungen auslagen. Sie unterbrachen die Lektüre, um sich – ein Stockwerk tiefer oder eine Treppe höher – zum Massieren zu begeben, oder dienstags und donnerstags, vier Stockwerke tiefer, im so benannten Großen Gemeinschaftsraum, an den Yoga-, Chi-Gong- oder Pilatesübungen teilzunehmen. Ihre aufgeschlagenen Zeitungen konnten – oben – so lange warten. Die verordneten Heilbäder oder Unterwasserübungen fanden gegen Mittag statt. Wie alle Kurgäste trugen auch die beiden bis vor dem Mittagessen die großen weißen Bademäntel, welche das Haus zur Verfügung stellte. Wie von der Kurärztin, Frau Dr. Montini, der Tochter des Gründers, empfohlen, ergingen sie sich so gut wie jeden Nachmittag an der frischen Luft. Aber sie umrundeten nicht mehr den Staufen, also den Namensberg, wie in früheren Jahren (die jüngeren Patienten taten es noch immer), sondern wählten weniger anstrengende Wege; sei es oben im Nagelfluhpark oder auf dem Imberg, oder sie gingen gleich nach Tisch hinauf ins Dorf Oberstaufen, mit seinen gut sortierten Annehmlichkeiten, den drei kürzeren, beinahe parallel verlaufenden Einkaufsstraßen und einer vierten, längeren, die im rechten Winkel zu diesen abging. Gekonnt dekorierte Schaufenster mit einer repräsentativen Auswahl an guter Kleidung und Markenschuhen, wo man sich für die nächsten Tage etwas Erfreuliches vornehmen konnte, etwa die Anschaffung eines neuen Kaschmirpullovers oder eines Lodenjankers, oder etwas Nützliches, wie den fälligen Austausch der Batterie in der Armbanduhr. Auch die üblichen Mitbringsel für die Heimkehr gab es dort reichlich zur Auswahl: Allgäuer Käsesorten und Schnäpse, oder – für die Enkel der Zugehfrau – eine buntgefleckte Allgäuer Porzellankuh, als Spardose.
Dann – und damit endete in der Regel der nachmittägliche Spaziergang – ließ man sich in einem der drei Cafés nieder, freilich nur zu einem Kräutertee oder Mineralwasser. Oder ging in eine der beiden Buchhandlungen, um sich vom Besitzer oder seinen Angestellten über Neuerscheinungen der Frankfurter Buchmesse oder Allgäuer Kriminalromane informieren zu lassen.
Weihnachten stand vor der Tür und die Abende in der Kurklinik waren lang. Beide Herren folgten, in etwa, dieser Umlaufbahn.
Bei einem Abendessen an einem der sogenannten Weintage, welches beide relativ spät, ihren Lebensgewohnheiten entsprechend, gegen sieben oder noch etwas später einzunehmen pflegten, ehe man mit seinem Glas ins Kaminzimmer zu dem behaglichen Feuer der Wintermonate hinabstieg, geschah es, dass sich das erste, beiläufige Gespräch zwischen den beiden ergab.
Während sie das kalorienarme Abendessen verspeisten und an diesem Tag in einem »Bolognese von gedünstetem Kohlrabi«, einem appetitanregenden Etwas auf einem modernen viereckigen Teller, herumstocherten, ehe sie sich dem Nachtisch zuwandten, einem winzigen Glasteller »Kompott von Schattenmorellen«, hatten beide Herren neben sich ihre Lektüren liegen: der Kaufmann die Financial Times, der Jurist den neuen Roman Circle von Dave Eggers. Neben keinem sah man ein Smartphone (oder Tablet), wie es sich bei einigen der anderen Gäste gelegentlich durch diskretes Summen in Erinnerung brachte! Es war Häussers dritter Abend, der zweite des am Vortag eingetroffenen Bremers, als sie ihre ersten Worte wechselten. Die Kellnerin, täglich nur eine einzige, von manchen Gästen des Stils des Hauses wegen, vielleicht auch wegen der Nähe zur Schweizer Grenze, die »Saaltochter« genannt, hatte heute – an einem »Weintag« – die Karaffen mit einem Spätburgunder aus Baden und einem Weißwein aus der Wachau vor sie hingestellt. Das war der äußere Anlass für einen Austausch: »Ja, die Heike! Was für ein freundliches Wesen!«, sagte Häusser. »Woher sie nur immer ihre gute Laune nimmt!«, fügte der Mann aus dem Norden hinzu. »Aber«, bemerkte er noch, »die Monika«, das war der Name ihrer Kollegin, der Älteren, die heute dienstfrei war, »die Monika ist auch sehr nett. Bloß tue ich mich mit ihrem Dialekt etwas schwer!« Beide lachten. (Sie kamen schon lange ins Allgäu, nach Oberstaufen, hatten aber, vor allem der Bremer, immer noch Mühe mit dem Dialekt.) Häusser meinte danach: »Können Sie sich noch an Sabrina erinnern? Gutaussehend und witzig! Eine Augenweide!« Er fuhr fort: »Hat wahrscheinlich geheiratet und gleichzeitig auch die Stelle gewechselt. Zwei oder drei Jahre mögen es her sein.« »Keine Ahnung!«, sagte sein Gegenüber. »Wo mag Frau Kessel immer die netten Mädchen finden? Oder ist es Roswitha, die Allgäuer Assistentin, die fündig wird?« Sie sprachen übers Wetter, das herbstlich kühl, aber trocken, also eigentlich angenehm war. Noch kein Schnee, obwohl der gut zu Oberstaufen passte. Der Bremer bemerkte irgendwann: »Sie sind in diesem Jahr allein hier! Ich komme ja immer allein, die Schrothkur ist nichts für meine Frau. Auch nicht für meine zweite. An Sie kann ich mich in einer größeren Gruppe erinnern! Freundliche Süddeutsche. Aber wie macht man es, um Norddeutsche für Oberstaufen zu gewinnen?« Häusser nickte, er dachte nicht nur an seine verstorbene Frau, sondern auch an die gemeinsamen Freunde und natürlich an die beiden Begleiterinnen, Laura und Anne, die ihm in den Jahren nach Utes Tod hier Gesellschaft geleistet hatten, wenn auch immer nur für ein paar Tage. Man hatte immer einen unterhaltsamen Abendtisch gehabt, manchmal den fröhlichsten im Saal. Nach einem weiteren Löffel Kompott – ihm schien es, als seien die Kaffeelöffel das kleinste vorstellbare Modell – sagte er: »Meine Frau lebt schon seit Jahren nicht mehr. Sie fuhr aber eigentlich nur mit, um mich bei der Diät zu halten. Auch machten wir damals nach Tisch größere Spaziergänge. Dieses Jahr hatte ich kein Glück mit irgendeiner Begleitung: Allen meinen Freunden, Männern wie Frauen, passte es nicht ins Programm. In den Familien gab es irgendwas, entweder man erwartete Besuch oder es könnte ihnen zu langweilig hier sein, vielleicht auch nur zu einfach. Ich bin da wohl eine Ausnahme. Die Kur tut mir gut, auch bin ich ein Gewohnheitstier. Jugend im Schwarzwald, später lange in Afrika! In kleinen Staaten. Und noch ehe das Fernsehen nach Schwarzafrika kam! Ich lese gern; habe es früh genug gelernt!« Der Bremer stimmte zu: »Ich bin auch immer gerne hier. Die strenge Landschaft stört mich nicht. Aber die Geschmäcker sind verschieden. Meine erste Frau fühlte sich hier nicht wohl. Die zweite liefert mich auch nur ab, fährt am nächsten Tag weiter. Aber wenn man das ganze Jahr über genug Abwechslung hat, kann man ein paar Wochen Alleinsein gut ertragen.«
Tags darauf setzten sie ihr Gespräch fort. Ein anderes Thema, eine Oktav positiver.
Nach der Rückkehr von seinem Spaziergang hinauf ins Dorf, kurz nach vier, trat der Bremer auf halber Höhe des Aufgangs ins Kaminzimmer, in dem er nur Häusser, lesend, bei einer Tasse Kräutertee – zwischen dem summenden Samowar und dem Bücherschrank – vorfand. Auch er goss sich eine Tasse Tee auf und setzte sich Häusser gegenüber, der neben dem Bücherregal auf dem Ledersofa saß, in einen Sessel. Häusser fragte ihn beiläufig, fast etwas verschmitzt: »Sagt Ihnen der Name Laurence Sterne eigentlich etwas?« Der Bremer schüttelte den Kopf. Häusser fuhr fort: »Ein englisch-irischer Schriftsteller aus dem 18. Jahrhundert. Unter die Heiteren, nicht einmal unter die Humoristen zu rechnen. Auch bei uns früher einmal bekannt. Lessing schätzte ihn, Nietzsche sehr. Und Goethe sagte irgendwann zu Eckermann, gäbe es einen Laurence-Sterne-Club, dem würde er beitreten! Dabei war Sterne für damalige Verhältnisse nicht nur frei, sondern ganz schön anstößig. Ich bin letztes Jahr, hier im Kaminzimmer, wieder auf seinen Bestseller gestoßen: ›Leben und Ansichten von Tristram Shandy, Gentleman‹. Welcher Gast mag ihn zurückgelassen haben? Oder gehörte er gar noch dem alten Dr. Kessel? Freilich ist das Buch heute wahrscheinlich selbst in England vergessen. Aber für mich, bei der Schrothkur in den Bergen, genau das Richtige! Vergnüglich und abgründig. Hatte gar nicht mehr gewusst, wie sehr seine Schilderungen es in sich haben! Der eine Band, eröffnet von einer gelehrten, vor allem nicht enden wollenden Unterhaltung zwischen Tristrams seriösen Vater und dessem unschuldigen Bruder, dem herzensguten Onkel Toby über das Wesen der Frau, wobei der Onkel, ein höherer Offizier und sogar Kriegsheld im Spanischen Erbfolgekrieg, einräumt, während seines Lebens ›in drei ganzen Jahren nicht ebenso viele Worte mit einer Frau gewechselt‹ zu haben und daher auch ›das richtige nicht vom falschen Ende einer Frau unterscheiden zu können! Ähnlich heikle Formulierungen, obwohl niemals obszöner Art, sind in dem Buch in Fülle vorhanden.« Fridtjof Häusser, in den fünfziger Jahren noch ein junger Student in Tübingen, half in Stuttgart an einem Wochenende bei der Auflösung der Bibliothek seiner verstorbenen Tante, welche gleichzeitig die Bücherschätze seines vor dem Ersten Weltkrieg verstorbenen Großvaters enthielt! Sah damals, nur wegen seines zerlesenen Zustands, in einen der Bände des Tristram Shandy hinein! Und verbrachte ein Wochenende damit. Dann wurde der Roman mit einem ganzen Schwung anderer alter »Schmöker« an den Antiquar gegeben! »Und hier, im Alter, entdecke ich ihn in einer nahezu neuen Ausgabe aus den fünfziger Jahren, erneut. Ich lese ihn natürlich nicht von vorne bis hinten, neun Bände! Aber ich stöbere neugierig und mit Vergnügen darin.« Der Bremer hatte nichts von diesem Autor gehört. Häusser, angeregt: »Natürlich liest so etwas heute niemand mehr! Auf langen Autofahrten lege auch ich mir Hörbücher von Lee Child oder John Le Carré ein! Aktionsliteratur! Tristram Shandy wäre keinesfalls geeignet für eine sich so hinziehende Strecke wie den Ebersberger Forst! Die ersten vier Bände befassen sich mit der verwickelten Zeugungsstory des Titelhelden, die nächsten zwei mit seiner Geburt, seinem versehentlich eingedrückten Näschen, der missglückten Namensgebung bei der Nottaufe, den von der entnervten Magd verwechselten Vornamen! Tristrams Vater, ein ältlicher Landadeliger, rechtschaffen, aber unsäglich umständlich, der, nur als Beispiel, die Erfüllung seiner ehelichen Pflichten ein für alle Mal mit der ihm als Hausherrn obliegenden Pflicht des monatlichen Aufziehens der Uhr im Hausflur gekoppelt hat, wird durch seine junge und liebenswerte Gattin im denkbar unpassendsten Augenblick mit der Frage erschreckt, ob er die Standuhr schon aufgezogen habe. Mr. Shandy, bei Platon und Aristoteles zu Hause, ist felsenfest davon überzeugt, beim Akt der Zeugung würden, fast als wichtigstes Kapital für das neue Leben, die »Lebensgeister« übertragen, daher quält ihn, ob der Störung, die Angst, sein künftiger Sohn (denn ein Sohn musste es werden) werde ob dieses Lapsus ohne das »Lebenselixier« zur Welt kommen! (Darüber zumindest ein Kapitel.) Das eingedrückte Näschen des Neugeborenen, neun Monate später durch eine neumodische Geburtszange platt gedrückt, führt sodann zu einer langen Abhandlung über den Zusammenhang zwischen der Form der Nase und der Phantasie eines Menschen, ferner über die Bedeutung von Nasen überhaupt in der Geschichte der Menschheit. Es geht prompt weiter. Statt des vom Vater sorgfältig ausgewählten griechischen Götternamens Trismegistus, Beinamen des Hermes, verwechselt die zur Nottaufe eilende Magd diesen mit dem banalen Vornamen Tristram, dem Vornamen des Geistlichen. Kurzum, drei Kalamitäten rund um die Geburt seines Sohnes führen zur abgrundtiefen Verzweiflung des alten Vaters. Das Buch besteht aus einer Fülle ähnlich ernster oder künstlicher Verwicklungen, eigentlich nur aus solchen, längst ehe man zum Schicksal der dramatischen Hauptperson, dem Onkel Toby, vorstößt. Dass diesem vor vielen Jahren bei der Belagerung von Namur durch die englischen Truppen ein Brocken der herabstürzenden Stadtmauer ausgerechnet auf die Schamleiste gefallen ist, mit den entsprechenden irreparablen Folgen. Das Werk setzt sich also, wie es dem nicht gewarnten Außenstehenden scheinen möchte, aus einer Kette von unsäglichen Abschweifungen zusammen. Wo aber sonst findet man einen ähnlichen Autor! In unserem Lande gewiss nicht, auch wenn ein unverfrorener Franzose (Michel Houellebecq, Prix Goncourt) es tatsächlich gewagt hat, Goethe vor Kurzem als unerträglichen Schwafler zu verleumden!« Der Bremer blickte ernst, eher beunruhigt als amüsiert, zu seinem Tischnachbarn hinüber. (»Ein Jurist? Machte das einen Reim? Hatte es vielleicht damit zu tun, dass dieser aus dem Schwarzwald kam?«) Häusser, bestens gelaunt, aber in aggressiver Stimmung, hielt inne und trank einen Schluck Tee, lauwarmen grünen Tee, während sein Gegenüber sich an dem heißen Rooibos in seiner Tasse wärmte. Ängste ahnend, streute Häusser ein: »Es hält sich aber alles in Grenzen, selbst das Fragwürdigste bleibt stets in einer züchtigen Sprache!« Der Bremer, im Umgang mit Menschen erfahren, betrachtete sein Gegenüber aufmerksam. Die Teestunde klang aus.
»Ein Autor wie Laurence Sterne«, nahm Häusser einen Tag später beim Abendessen den Faden wieder auf (vor beiden Herren stand auf ihren Tellern »Warmes Sauerkraut mit Scheiben von Ananas«), »trotz seinem anglo-irischen Humor, wäre dennoch ohne sein mehrmals abgebrochenes Theologiestudium und seine spätere langdauernde Anstellung als Vikar kaum denkbar. Manchmal muss ich denken, so einer könnte am ehesten die zugleich einfachen und verzwickten, teils traurigen, teils drolligen Begebenheiten beschreiben, die mir nach dem Tod meiner lieben Frau begegnet sind. Da würde man auf Anhieb auch den Unterschied zwischen den Schwierigkeiten eines Witwers, wieder im Leben Fuß zu fassen, und dem Leben eines geschiedenen Mannes erkennen!« (War er zu weit gegangen? Nein, sein Gegenüber, geschieden, wenigstens einmal, verzog keine Miene.)
Ja«, sagte der Bremer, voller Höflichkeit, geduldig: »Sie haben mir den Mund ganz schön wässrig gemacht mit Ihrem Tristram Shandy, allerdings auch mit der Bemerkung über die fundamentalen Unterschiede zwischen den Erfahrungen eines Witwers und denen eines nur geschiedenen heutigen Zeitgenossen! Die delikaten Schilderungen von Zeugung, Niederkunft und Taufe hin oder her, aber geben Sie doch bitte zu, dass Ihnen selbst, ohne Theologe oder gar Ire zu sein, eine Neigung zum Skurrilen nicht fremd ist! Ich bin kein großer Leser, bin kaum über Wilhelm Busch, Erich Kästner, einige Shortstories von Ernest Hemingway und eine kürzere Novelle von Günter Grass hinausgekommen, aber wissen Sie, was mir bei unseren Gesprächen immer wieder durch den Kopf geht? Vielleicht sollten Sie sich Ihre Erfahrungen einmal selbst von der Seele schreiben.« Der Bremer, der Häusser, wie der Leser gespürt haben wird, von Anfang an sympathisch war, obwohl er gefühlt hatte, dass seinem Tischgenossen die Erwähnung, nein Überdehnung gewisser primärer Vorgänge des Lebens außer Heiterkeit auch ein gewisses Unbehagen verursachte. Häusser, der in seinem Leben oft mit Ausländern, vor allem Franzosen und Angelsachsen und deren Literatur, zu tun hatte, deren Sprachen heutzutage wenige Aspekte des Lebens ausklammerten. Ja, die Kulturen waren sogar recht verschieden. Aber sie beide, an ihrem Zweiertisch, waren sich sowohl nicht nur recht sympathisch, sie wussten auch, dass die Schrothkur nur in anregender Gesellschaft erfreulich ablief. Zumal der Schwarzwälder Jurist sich außer für schrullige Autoren auch noch für anderes interessierte. Dem Getreidehändler war oben im Dorf, vor einem Schaufenster mit Handys und IPads und anderem digitalem Gerät, eine oder vielmehr mehrere Fragen seines Tischgenossen wieder eingefallen: Was er vom da und dort angekündigten kaum noch aufzuhaltenden Zurückdrängen der Papierbücher bei der Ausbildung der heutigen Generation von Schulkindern durch Google und Wikipedia halte und was vom Vordringen der Drohnen, dieser neu entwickelten ferngesteuerten Flugkörper, mit denen man bis zu Windstärke 5 sämtliche Bodenziele konturenscharf erfassen und fotografieren könne? Mit einer minimalen Umrüstung ließen sich durch diese Explosivstoffe bis zu fünf Kilogramm Gewicht über weite Strecken befördern! Ob er, der Bremer, in Zukunft Konferenzen mit Führungsfiguren aus Washington, Moskau, Peking, Paris und Berlin, wie kürzlich in Taormina, Hamburg oder Davos, noch in Sicherheit wähne? Häusser hatte beiläufig auf die neueste Ausgabe der NZZ, neben sich, gewiesen. All dies digitale Teufelszeug, oder doch das meiste davon, sei immer noch frei im Handel, gar im Internet oder über Amazon erhältlich, die asiatischen Importe zu erschwinglichen Preisen. (Welch absonderliche Nachrichten dieser alte Jurist doch noch in sich aufnahm!)
Häusser, wie gesagt, empfand die Anregung des Bremers, seine zurückliegenden Erfahrungen selbst einmal zu Papier zu bringen, keineswegs als befremdend. Er hatte auch schon daran gedacht. »Warum sollte ich das nicht aufschreiben«, sagte er zu sich, »Schreiben ist zwar zeitraubend und kann auch anstrengend sein, das weiß ich aus meinem Beruf, ich weiß aber auch, dass einem kaum etwas besser die Zeit vertreibt als die Anfertigung eines Textes. Ehe man allzu viel von dem Erlebten vergessen hat, ehe einem die treffendsten Formulierungen verloren gegangen sind, und jetzt auch noch, ehe man womöglich auch noch stirbt, was in meinem Alter auch nicht mehr sehr lange auf sich warten lassen kann!« Außerdem erinnerte er sich an eine Bemerkung, die Laurence Sterne seinem Tristram irgendwo in den Mund gelegt hat, dass nämlich die Schriftstellerei, wenn man sie ernsthaft betreibe, »nur eine andere Bezeichnung für Konversation ist«! Mit solchen Gedanken beendete Fridtjof Häusser den Abend vor dem Fernseher bei einer trotz des Mords relativ gediegen verlaufenden Fortsetzung der Serie Inspector Barnaby, die er, zunehmend schläfrig – und zuletzt schlummernd auf dem Kanapee seines Zimmers, unter einem alten Stich der Stadt Konstanz, hinter sich brachte. Aber, fiel ihm irgendwann ein, woher nahm Sternes Buch eigentlich den großen Charme? Musste man Pfarrer und dazuhin noch Ire gewesen sein, oder hatte der Autor Freunde besessen, die ihn mit kritischen Bemerkungen über die Jahre in Gang gehalten hatten? Nun, auch Häusser hatte immer noch wachsame Köpfe um sich (um nur einen Namen aus dem Freundesreservoir seiner verstorbenen Frau zu nennen – Emily), um nicht zu sagen, es gab da einen ganzen boshaften Kreis. Aber gewisse Erfahrungen seiner fast zehn Jahre als Witwer, auch mit seiner eigenen Entwicklung, soweit er sie erkennen konnte, verdienten wohl, dass man sie festhielt. Mit dieser Erkenntnis schlief er ein.
Erster Teil
Der alte Witwer
I
Gegen Ende des in Oberbayern, zumindest auf dem Lande, immer noch üblichen Leichenschmauses, hier nach der Beerdigung seiner Frau, wurde Fridtjof Häusser, der Witwer, von einem guten Bekannten, einem Kunstmaler (einem seit Langem pensionierten höheren Beamten aus dem Bayrischen Landwirtschaftsmuseum, noch mehrere Jahre älter als Häusser, und schon seit einer ganzen Anzahl von Jahren verwitwet), der sich verabschieden wollte, angesprochen. Er werde ihn in der kommenden Woche anrufen, sagte er, und ihm bei Aldi, Edeka, Lidl und auch Norma zeigen, wo es die »besten und günstigsten Dosen- und Tütensuppen« gab. Er sagte »Dütensuppen«, denn er stammte aus der Oberpfalz, nahe bei Kulmbach. Häusser hatte ihm für sein Kommen und seine Anteilnahme gedankt und ihm die Hand gedrückt. Der neben ihm am Tisch sitzende Pfarrer, auch seit Jahren im Ruhestand, der Utes Asche vor zwei Stunden der Erde übergeben hatte, nickte dem ihm gut bekannten, wiewohl evangelischen Künstler freundlich zu. Bald danach, einige Trauergäste verweilten noch bei Kaffee und Kuchen, näherte sich ein weiterer Freund, ein ehemaliger Kollege aus Brüssel; er müsse aufbrechen, um seinen Flieger in München zu erreichen, wolle ihm aber noch etwas ans Herz legen: Er solle in den allernächsten Tagen ein gutes Immobilienbüro mit dem Verkauf seines Hauses beauftragen, das für ihn allein viel zu groß sei und nur noch Ballast bedeute. Auch ihm hatte Häusser herzlich für sein Kommen und sein Mitgefühl gedankt und der Pfarrer hatte freundlich herübergenickt. Etwas später verabschiedete sich eine gut gekleidete alte Dame, offenbar eine frühere Bekannte seiner Frau, die auf die Zeitungsanzeige in der Süddeutschen hin (»Statt Karten!«) von München zur Beerdigung aufs Land heraus gekommen war. Sie sagte: »Es ist vielleicht noch zu früh, über so etwas zu sprechen. Aber denken Sie bitte irgendwann daran, ich könnte Sie mir sehr gut in unserem Augustinum vorstellen!« Der Pfarrer hatte wieder freundlich genickt. Wieder eine halbe Stunde später, auf dem Parkplatz, umarmte ihn seine jüngere Schwester, mit der Mahnung, nicht zu versäumen, dem Kirchenchor mit ein paar netten Zeilen für die würdige Umrahmung der Messe zu danken und einen »anständigen Schein« in den Umschlag zu legen. Er winkte ihr nach, aber vor ihm tat sich, jetzt, wo die Reihe der vertrauten Gesichter sich gelichtet hatte, etwas wie ein Abgrund auf: Was erlaubten sich alle mit ihm? Jeder meinte, ihm einen Ratschlag auf seinen neuen Lebensweg mitgeben zu müssen! Freunde und Verwandte wollten ab sofort sein Leben regeln, sie wussten klar, was ihm jetzt gut – und vor allem, was ihm nottat. Mit der Totenmesse, dem Vaterunser am Grab »für den aus unserer Mitte, der als Nächster abberufen wird« und dem Leichenschmaus, lief nicht nur Utes, sondern auch seine Selbständigkeit nach Meinung nicht weniger aus. Gut gemeint war es sicher. Seine Frau war tot, der beschränkte Teil ihrer Pflege, der auf ihn entfallen war, lag hinter ihm. Der Haferflockenbrei, der Salbeitee, frühmorgens ans Bett gebracht, die Gänge zur Apotheke, die telefonischen Arzttermine, der Schreibkram mit der Krankenversicherung, die Fahrten zum Krankenhaus und manchmal noch die Einkaufstouren, bei denen sie fast bis zuletzt gerne dabei sein wollte, das war’s gewesen. (»Sterben ist so langweilig!«, hatte sie einmal in einem gedehnten Ton gesagt, der ihm ins Herz geschnitten hatte.) Das war’s gewesen! Kinder hatten sie keine gehabt, sein Berufsalltag lag lange zurück, Ute hatte ihren Lehrerberuf bald nach der Eheschließung aufgegeben und war ihm ins Ausland gefolgt, wo man aber keine deutschen Lehrerinnen für Sport und Kunsterziehung brauchte. Jetzt war er seit zwölf Jahren im Ruhestand. Die Gartenarbeit hatte sie geliebt, ihn hatte sie nie besonders interessiert. Da war wenig Programm für ihn gewesen. In der Gemeinde hatte er mit dem entwickelten Gespür des »Zugereisten« nie eine ehrenamtliche Aufgabe angestrebt. Ein gleichaltriger Nachbar, ein Freund, den er mehrmals im nahen Krankenhaus besucht, und ein weiterer Nachbar, Bekannter, man tauschte aber Neuigkeiten oder die Tageszeit über den Gartenzaun aus, den er im Altersheim einmal monatlich besucht hatte, entfielen als Unterhaltung; beide lagen seit Jahren, wenige Reihen von Utes Grab entfernt, auf dem Dorffriedhof. Von den Gleichaltrigen im Dorf gab es, außer ihm, nur noch eine Nachbarin und den vormals »letzten Bauern des Dorfes«. Dabei war 77 doch heutzutage kein Alter mehr. Seine Frau war nur 68 geworden. Vielleicht hatte sie sich die Blutkrankheit in Afrika geholt? Er war eigentlich noch recht gesund für sein Alter, nur sein Namens- und Zahlengedächtnis ließ nach, wie bei älteren Leuten üblich. Viel gelaufen war er nie gern. Seine Pension war auskömmlich, verglichen mit anderen aus seinem Bekanntenkreis war sie sogar gut. Er konnte also der nächsten Zukunft ins Auge sehen. Aber jeder fühlte sich bemüßigt, ihm Ratschläge zu geben! Die Bemerkung seiner vier Jahre jüngeren Schwester, neben ihrem Auto – während sie ihm ein Haar, ein weißes, von seinem schwarzen Anzug entfernte – war zu viel gewesen: So weit hatte er es gebracht! Ute und er hatten ihr eigenes Leben gelebt! In Afrika, wo er zunächst in einem Land als ausländischer Regierungsberater, danach in mehreren anderen als Kontrolleur für Entwicklungshilfe und zuletzt als Diplomat tätig gewesen war, hatten sie fast ebenso viele Staatsstreiche wie Länder überlebt. Und dann ihr letztes Land, da war er Botschafter in einem der schwierigsten Staaten Asiens gewesen. Sie hatten unter Verhältnissen gelebt, die die Freunde hier nicht einmal aus den Abendnachrichten kannten, sich (auch wenn alles in dem Land ruhig war!) nicht einmal entfernt vorstellen konnten! Noch als Ute schwer krank war, legte sie zwischen den verschiedenen letztlich unwirksamen Therapien Wert darauf, mit ihm Reisen zu unternehmen, wie sie es gewohnt war. Mit Hurtigruten über Neujahr nach Norwegen. Eine Bus-Schiffs-Reise durch das ganze Baltikum, (mit dem winzigen Pharmakühlschrank im Gepäck, für die Spritzen). Sie bestand auf der Reise nach Israel, Jerusalem, Tel Aviv, Totes Meer. Und ein paar Monate vor dem endgültigen Aus flogen sie noch nach Kuba! Ein alter Traum von ihr, denn als blutjunge Lehrerin waren sie und ihr erster Freund, ein viel älterer polyglotter Übersetzer mit Bart, Anhänger von Fidel Castro und Che Guevara gewesen. Es waren Reisen von acht bis zehn Tagen, der Zeit zwischen den Bluttransfusionen. »Du spinnst ja«, hatte sie gesagt, als er für den Kubaflug Business Class buchen wollte. Es waren eigentlich ihre besten Reisen geworden. Die richtigen Bücher hatten sie immer gelesen; und ordentliche Hotels hatten sie sich auch immer geleistet! Die Suite in Havanna allerdings war eine Premiere. Die andere Neuerung auf Cuba war die häufige Benutzung von Taxis! Keinen Bus mehr, keinen Mietwagen. Man musste das Taxi im Hotel bestellen; staatliche Fahrzeuge mit ausgewählten Fahrern. Nützlich, falls man je ein Krankenhaus anlaufen musste. Das blieb ihnen allerdings erspart. Sie besuchten Hemingways finca und fuhren weit weg vom Meer ins Land hinein, zu den historischen Höhlen, in denen Fidel und Che vor ihrem Aufstand, der Revolution gegen Battista, heimlich ihre guerilleros gedrillt hatten! Das überall beworbene Ziel hatten sie hauptsächlich deshalb angegeben, um, abseits der Nationalstraße No 1, einen Blick auf ein paar Bauerndörfer werfen zu können. »Ordentliche Dächer, die Fenster korrekt!«, hatte Ute festgestellt. Frischgewaschene Jeans, bunte Hemden und Wäsche für Männer und Frauen hingen überall zum Trocknen auf Wäscheleinen. »500 Gramm flüssiges Waschpulver als Zuteilung in der 49. Woche«, zitierte Ute aus der Parteizeitung, die der Taxifahrer, immer derselbe, neben sich liegen hatte. Sein Englisch war korrekt und er schätzte Ute und ihre Fragen, an denen er ihr politisches Interesse für seine Insel ablas. »Hat Ihre Frau schon die 300 Gramm Geflügel und die 300 Gramm Mortadella pro Kopf abgeholt, Comrade?«, fragte Ute. Genosse! Und er antwortete: »Sie geht morgens kurz nach fünf Uhr los und stellt sich in die Schlange. Meine Tochter steht in der anderen Schlange. Aber der Fisch taugte nicht viel. Sie kam zu spät. Es gab nur noch Köpfe und Eingeweide!« Ute: »So war’s auch bei uns nach dem verlorenen Krieg. Meine Mutter machte eine gute Fischsuppe daraus.« Häusser verfolgte die Dialoge mit Interesse. Utes Tabletten und das Morphiumpflaster gegen Schmerzen waren immer in ihrer Umhängetasche dabei. Eine Wasserflasche führte heute sowieso jeder Tourist mit sich. Was hatten sie noch besichtigt? Zwei Grundschulen (»Ich bin eine ehemalige Lehrerin!«), eine Sanitätsstation, eine Zigarrenfabrik, eine ziemlich neu wirkende Siedlung des Sozialen Wohnungsbaus. Deren Qualität ließ allerdings zu wünschen übrig. Die Betonstufen vor den Häusern hatten Risse; offenbar zu wenig Zement; die Fensterrahmen deren Farbe abblätterte; mehrere Eingänge waren schon gesperrt, Einsturzgefahr. (»Cement has to be imported. Foreign exchange problems!«, sagte der Fahrer.) Bettler sah man allerdings nirgends. (Ute hatte in der Hotelhalle, wo jeden Abend zwei Männer Gitarre und Ziehharmonika spielten und dazu sangen, an ihren Jugendfreund geschrieben und ihm, vielleicht war er noch Marxist, das wusste sie aber nicht, ihre Eindrücke aus Kuba geschildert, kurz nach Fidel Castros Ablösung durch seinen Bruder Raul.)
*
Ein paar Stunden nach der Beerdigung dieser bis zum letzten Augenblick voll lebendigen Frau, sieben Monate nach dieser Reise, sollte er sich jetzt auf »günstige Suppen« konzentrieren, sich stante pede von seinem Haus voll von Büchern und Bildern und Andenken trennen, und sich womöglich auf ein Ende in einem vornehmen Seniorenstift in Gesellschaft von höheren Beamten oder ihren Witwen einmieten. Er hörte noch einen verstorbenen Freund knirschen: »Bridge lernen. Im Schrank ein dunkler Anzug, ein Sportsakko und eine Cordhose!« Der war, nach ein paar Jahren in einem vornehmen Seniorenstift, kurz nach seinem neunzigsten Geburtstag, wieder zurück aufs Land in sein Häuschen gezogen, das er zum Glück nicht aufgegeben hatte. Zu seinen Büchern und all den Dingen, die sich in seinem Leben angesammelt hatten, darunter Erinnerungen an seine beiden Ehen! Den Hausarzt, seine zuverlässige Zugehfrau, jemand Robusteren für den Garten, mehr brauchte er nicht. Fünf Jahre hatte das noch gut funktioniert. So etwas schwebte auch Häusser vor.
Aber er sagte am Beerdigungstag nichts, unterdrückte seine Gefühle, dankte mit den gebräuchlichen Worten allen, auch namens seiner Frau (wie sein Vater damals), für Freundschaft und Anteilnahme. Ehe er nach Hause ging, zahlte er beim Wirt in der Küche mit der Bank Card und war zufrieden, als dieser, der ihn lange kannte, einige nur halb geleerte Weinflaschen – Veltliner, Trollinger mit Lemberger, Rosé – wieder verkorken und in den Kofferraum seines Autos bringen ließ. Wie bei Häussers Geburtstagsessen.
*
Zeit seines Lebens hatte Häusser darüber nachgedacht, wie man unnötige Fehler vermeiden konnte. Vor allem keine Überstürzung! Im Büro, in der Familie. Leben im eigenen Haus, umgeben vom Garten, das passte zu ihm. Seine Frau war, wie schon erwähnt, eine sogenannte Gartenfrau gewesen, täglich war sie eine Weile draußen, und er hatte zwar die Bäume und Büsche gerne vor Augen gehabt, im Frühjahr und Herbst vor allem, aber in den Fingern gejuckt, selbst anzufassen, etwa um Unkraut zu rupfen, hatte es ihn nie. Natürlich goss er an heißen Sommertagen abends oder morgens den Garten, wenn nötig sogar zweimal am Tag. Unter Anleitung seiner Frau. Da war noch etwas anderes: Der Kontakt mit seiner Familie spielte in Häussers Leben nur eine eingeschränkte Rolle, zumindest seit seine Mutter nicht mehr lebte. Die Häussers waren kinderlos, es gab nur die Geschwister und deren Kinder und Enkel! Seine Frau suchte die Geschenke aus, bei Büchern bestimmte er mit.
Sollte er sich, als »pensionierter Diplomat und Witwer in fortgeschrittenem Alter«, wie es in Anzeigen gelegentlich hieß, eine Haushälterin suchen? Gewiss nicht! Denn das war nicht nur ein teures Vergnügen, eine Haushälterin würde ihn vor allem in seiner Freiheit einschränken! Wie ein katholischer Pfarrer musste man dann so gut wie immer zu Hause essen! An bestimmten Tagen konnte man sich, nach voriger Anmeldung, nicht spontan noch einen Gast einladen! Oder sollte er sich noch eine Frau suchen? Heiraten war in seinem Alter nicht mehr angesagt. Und nur, wenn er nach der Eheschließung noch ganze fünf Jahre leben würde, hätte, in seinem Fall, seine Ehefrau noch Versorgungsansprüche! Überhaupt zeigte schon das Alter, in dem er einst geheiratet hatte, in seinen Vierzigern, dass er kein Ehefan war! Eine Partnerin wäre wohl denkbar, weniger verpflichtend. Man musste ja nicht zusammen ziehen. Aber es fiel ihm niemand Geeignetes ein. Übrigens: Würde sie in ihrer eigenen Wohnung wohnen bleiben? Wahrscheinlich blieb jeder am besten bei sich wohnen. Jeder alte Mensch musste auf die für ihn passende Fasson leben, die konnte man im Alter kaum noch ändern. Ute war die ersten Jahre nach ihrer Heirat im Schuldienst geblieben, während er in Afrika in seiner Funktion als Kontrolleur der Entwicklungshilfe allein in einer geräumigen Residenz mit Personal gelebt hatte. Mit Urlaubsbesuchen – mal sie in Afrika, mal er in Düsseldorf – hatte es seinen Anfang genommen. Später hatte er sich an die Ehe und das Zusammenleben gewöhnt. Aber das war einmal.
Wo sich für sein künftiges Leben Rat holen? Den brauchte er. In seiner Schulzeit hatten seine Eltern ihm einmal zu Weihnachten ein Buch geschenkt, »Der kleine Chemiker«. Auch die dazugehörige Schachtel mit den farbigen Pulvern in kleinen Fläschchen sah er noch im Geiste vor sich. Sein Vater hatte das Schülerhandbuch mit Experimenten, wahrscheinlich nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwo entdeckt und für ihn erstanden. Und viele Jahre später, nach dem Assessorexamen, hatte Häusser in Heidelberg, in der Buchhandlung gegenüber der Neuen Aula, ein in Hellblau gebundenes dickes Buch mit dem Titel »Der kleine Rechtsanwalt« erworben (vielleicht hieß es auch »Der junge Rechtsanwalt«). Es war ungemein nützlich für Berufsanfänger, enthielt alle möglichen Mustertexte, Formulare, Blanko-Anträge, -anfragen, -einsprüche und -beschwerden. Vieles ließ sich fast unverändert verwenden. War nicht auch ein Muster für eine Gebührenabrechnung dabei gewesen? Jetzt stand er, fast fünfzig Jahre später, vor einer ähnlichen Situation. Wo war der »Leitfaden für Witwer«? Für alte Witwer? Bei einem Samstagsbesuch in Wasserburg fragte er zuerst seine gut informierte Buchhändlerin, dann seinen Antiquar, einen gebildeten Schweizer, nach dergleichen. Neu oder alt? Beide, verständnisvoll, vertieften sich in ihre Computer und mussten etwas später mit Bedauern verneinen. Der Antiquar betonte aber, zur Zeit des Freiherrn von Knigge, im späten achtzehnten Jahrhundert, habe man sehr viel auf Anleitungen zum richtigen Leben gegeben. Er könne sich auf der bevorstehenden Leipziger Bücher- und Antiquariatsmesse noch einmal umhören. Häusser stieß unterdessen im Küchenschrank seiner Frau auf deren beinahe allwissendes »Koch- und Haushaltsbuch von Henriette Davidis«, 34. Auflage, 1894. Ute und er hatten es kurz nach ihrem endgültigen »Zusammenziehen«, er war damals Chef der Europäischen Delegation in einem armen Bergland in Zentralafrika gewesen, von seiner Tante geschenkt bekommen. Ute hatte große Stücke auf das Kochbuch der Pfarrköchin vom Niederrhein gehalten! Neben den Koch- und Backrezepten für jeden Anlass gab es darin auch Ratschläge für junge Ehefrauen über korrekte Kleidung, über Tischdekoration, auch für die Sitzordnung (Verlobte stets nebeneinander!), und über sparsame Haushaltsführung. In K., der Hauptstadt des Landes, damals von der Größe einer süddeutschen Kreisstadt, gab es seit der Unabhängigkeit von Belgien einen Staatspräsidenten, zehn Minister, einen Apostolischen Nuntius, ein paar Botschafter, den Schweizer Geschäftsträger, die Vertreter der UNO und der Europäischen Gemeinschaften. Ein italienischer Bauunternehmer, gleichzeitig Besitzer zweier Kleinflugzeuge und Vertreter der Automarke FIAT war Honorarkonsul seines Heimatlandes, ein britischer Kaffeefarmer Honorarkonsul von Großbritannien. Ein sportlicher Mann. Alles war leicht überschaubar. Verwitwet war einzig der Schweizer Geschäftsträger. Mit dem diplomatischen und konsularischen Corps verbrachte man seine Freizeit – spielte Tennis und Volleyball – und lud sich reihum zum Abendessen ein. Oft genug trafen die Männer sich tagsüber, vor allem auf dem Flugplatz, weil die Abreise oder Rückkehr des Staatspräsidenten die Anwesenheit des diplomatischen Corps erforderte. Für die Essen mit Tischordnung war das Kochbuch der Davidis ziemlich brauchbar. Da, wo sie dem örtlichen Pfarrer oder einem zur Firmung gekommenen Bischof den Platz als Ehrengast zugewiesen hatte, platzierte man den Außenminister oder den Apostolischen Nuntius oder den rangältesten Botschafter, meist den Belgier. Davon abgesehen, konnte man bei Davidis aber noch Wichtiges für die Küche entnehmen! Woran erkannte man auf dem ländlichen Wochenmarkt oder am Hoftor, ob das angebotene lebendige Geflügel, ein Huhn, eine Gans oder eine Ente, noch jung und schmackhaft oder alt und zäh waren? »Aufs Brustbein drücken, auf die Farbe der Ständer achten.« Womit streckte man den Braten, wenn plötzlich noch ein unerwarteter Gast auftauchte? Freilich, nichts fand Häusser, als Witwer, Jahrzehnte später, in seinem bayrischen Dorf, in diesem Klassiker aus dem 19. Jahrhundert über die richtige Haushalts- und Lebensführung von Witwern! Nirgends ein Leitfaden, auch nicht in den Unterlagen des Schweizer Antiquars. Dieser jedoch, mehrsprachig und promoviert, entdeckte bei Google, im 15. Jahrhundert habe es von dem 1498 in Florenz auf dem Scheiterhaufen verbrannten Dominikanermönch Girolamo Savonarola eine Anleitung für Witwen gegeben. »Libro de la uita viduale«. Es gab keine deutsche Übersetzung, und Häusser konnte kein Italienisch, geschweige denn Altflorentinisch.
*
Wie viele Menschen mit bürgerlicher Erziehung neigte Häusser dazu, sich beim Eintritt in eine neue Lebenslage nach Vergleichsfällen umzusehen, den Similes seiner einstigen Juristenausbildung. Wo stand man, wie sollte man reagieren? Daran hatte das Alter bei ihm nichts geändert. Wenn er auch längst gelernt hatte, die Lehrfälle seinen Bedürfnissen anzupassen. Trotzdem ließ er sie immer noch nicht außer Acht. Eher war er noch vorsichtiger geworden.
Häussers verstorbener Vater, ein Maler, war ein gründlicher, vielseitig interessierter und recht schwieriger Mann (mit Ausnahme für gutaussehende Frauen) gewesen, mit dem der Sohn, von Kindheit an, nie recht warm geworden war. Vielleicht begann es damit, dass dieser nach langen Abwesenheiten auf Malreisen plötzlich zu Hause aufzutauchen und ins Schlafzimmer der Mutter einzuziehen pflegte und des Söhnchens Kinderbett deshalb auf Rädern ins Nebenzimmer gerollt wurde. Er drängte sich also in des Kindes harmonisches Zusammenleben mit seiner Mutter ein. Fridtjofs Mutter, seine zweite Frau, war gestorben, als der Vater 77 war. Sie war zwei Jahre älter als ihr Mann gewesen, hatte immer Herzprobleme gehabt. Nun war sein jüngerer Sohn, Fridtjof, im selben Alter verwitwet. Der Vater, den Häusser am Tage nach der Beerdigung der Mutter zum letzten Mal gesehen hatte, ehe er wieder nach A. an der westafrikanischen Küste zurückflog, hatte, wie der Sohn später feststellte, sich in den ihm verbliebenen zwölf Monaten damit beschäftigt, Ordnung in der Wohnung, das heißt bei seinen Bildern und Aufzeichnungen zu schaffen. Die große Altbauwohnung, die er und seine Frau fünfundzwanzig Jahre lang bewohnt hatten, war einerseits voll mit seinen Arbeiten und andererseits mit den Büchern, Belegexemplaren und Manuskripten seiner Frau. Sie war bis zur Decke, einschließlich dem Keller und Speicher, vollgestopft. Ordnung war ihm immer wichtig gewesen. Durch das Zusammenkommen mehrerer Zufälle, die dem Sohn, Fridtjof, fast sogleich entfielen, da zu dieser Zeit Flugzeugverspätungen und verpasste Anschlüsse nicht nur in Afrika, sondern wegen der französischen Pilotenstreiks auch in Europa an der Tagesordnung waren, kam er zwar zur Beerdigung seiner Mutter noch rechtzeitig an, landete aber erst Stunden nach der seines Vaters in Stuttgart. Die Mutter hatte er noch im Sarg gesehen, das Grab des Vaters daneben war schon mit Erde aufgefüllt, als ihn sein Bruder und die jüngere Schwester vom Flugplatz abgeholt hatten. Man hatte nicht auf ihn warten können, die Beerdigung fand zur vorgesehenen Zeit statt. Sorgfalt hatte der Vater in dem ihm verbliebenen Jahr offenbar auch auf die Gestaltung und Beschriftung des Grabsteins für seine Frau und auch für sich verwendet. Häusser erfuhr davon, als ihm der Steinmetz, der alte G., die Mappe des Verstorbenen mit dessen handschriftlichen Entwürfen und Skizzen übergab. Dass es keine ganz einfache Zusammenarbeit gewesen war, wäre dem Sohn auch ohne die Andeutungen des Steinmetzen klar gewesen. Änderungen über Änderungen. Fast täglich. Vom Pfarrer, einem ziemlich jungen Mann, der erst seit wenigen Jahren an die katholische Kirche der überwiegend evangelischen Schwarzwaldstadt versetzt worden war und der das auffallende alte Künstlerpaar in deutlicher Erinnerung hatte, sie schwer und untersetzt, er groß und mager, hörte er, sein Vater sei nach dem Tod der Mutter noch ein paar Mal, mit dem Taxi, zur Sonntagsmesse gekommen. Er habe ihn einmal in seinem Atelier besucht und sie hätten eine Flasche Mineralwasser zusammen getrunken. Vorsichtig vermutete er, der alte Häusser habe zuletzt wohl die ihm seit seinem Herzinfarkt vor vielen Jahren verschriebenen Tabletten nicht mehr so regelmäßig eingenommen wie zu Lebzeiten seiner Frau. Beide hatten, wie der Sohn sich von seinen beiden letzten Besuchen erinnerte, eine Anzahl von Fläschchen und Tabletten auf dem Esstisch stehen. Sie waren beide kurz vor achtzig. »Unsere Lebensverlängerer« hatte der Vater die Medikamente ironisch genannt. Gemalt hatte er wohl nach dem Tode der Mutter nicht mehr, wohl aber manche seiner Bilder, soweit sie noch im Atelier waren, entweder mit ein paar Pinselstrichen vervollständigt, oder, wenn sie ihm missfielen, vernichtet. Vor allem hatte er darauf geachtet, dass alle Arbeiten signiert waren. Sein Schriftzug war bis zum Ende derselbe geblieben, ein kühner Schriftzug. Keine Spur von Zögern. Was er bei seinem Aufenthalt nach dem Tode des Vaters noch über ihn hörte, erschien dem Sohn wie ein geordneter Rückzug aus dem Leben. Dieses hatte zwei Weltkriege und die sich anschließenden Nachkriegszeiten umfasst, dazwischen kam das »Dritte Reich«, das ihm Arbeitsverbot eingetragen und der Familie, kurz vor dem Zweiten Weltkrieg aus Berlin in den Schwarzwald, in die Heimat der Familie der Frau gebracht hatte. Seine Eindrücke hatte er seit der Schulzeit festgehalten. Die Veränderungen des Alltags, Elektrifizierung, Motorisierung, das Militär, der Zweite Weltkrieg, die niedrigen Überflüge massiver amerikanischer Bomberverbände bei Tag, die operettenhaft altmodischen Auftritte der französischen Besatzungstruppen, all das hatte den Vater nie unberührt gelassen. Elektrische Leitungen, Autos, Verkehrsschilder fand man dagegen auf seinen Landschaftsbildern so gut wie nie. Er verfolgte die Veränderungen in der Kunst, mehr noch des Kunstgeschmacks der Bevölkerung, aufmerksam. Er hatte die moderne Kunst, Abstraktion und ungegenständliche Kunst, aus Paris und Rom, aber auch schon aus Berlin gekannt, als anregend, vielleicht sogar als Bereicherung empfunden, ohne sich ihnen für seine eigene Arbeit anzuschließen, deren politische Deklassierung als »entartet« im Dritten Reich hatte er als Horror erlebt (»Experimente sind unverzichtbare Elixiere der Kunst!«). Ihre Rückkehr nach 1945 hatte er als normal empfunden, nur die bald danach, in Westdeutschland fast zuerst in der benachbarten Landeshauptstadt, bald in einigen großen westdeutschen Zeitungen einsetzende Gleichsetzung von moderner Kunst, Freiheit und Demokratie als neues Alarmsignal begriffen. Die wachsende Geringschätzung der traditionellen, seiner eigenen Malerei, der Natur- und Landschaftsdarstellung, ihre Gleichsetzung mit der »Blut-und-Boden-Kunst« der Nazis, die Verdammung der Beschäftigung mit Licht und Landschaft (Häusser seniors wachsende Leidenschaft schon seit Ende der zwanziger Jahre), als faschistisch oder als Kitsch (»Spitzpinsel-Malerei«), empörte und erbitterte ihn! »1945 und die Rückkehr der Freiheit der Kunst!!«, notierte er. Hohn! Der zuerst tastende, dann dauerhafte Umschwung zum Ungegenständlichen, allmählich gefolgt von der Abwendung von der sogenannten Palette der Farben, von Leinwand, Pinsel und Rahmen, wurden von ihm als persönlicher Affront empfunden. Seine Reise in die künstlerische Vereinsamung. Es hatte wahrlich nicht an Krisen in seinem Leben gefehlt, von der Kindheit über die Kriegsverwundung bis zum Arbeitsverbot des NS-Regimes, aber dies war die schwerste und, wie sich zeigte, die dauerhafteste. Sie begleitete ihn bis zu seinem Tod. Er führte Tagebuch, machte sich Notizen, sammelte Zeitungsausschnitte. So jemand hatte dann viel zu tun, um vor seinem Tode Ordnung zu schaffen.
Das Leben von Fridtjof Häusser, seinem Sohn, war höchst verschieden von dem seines Vaters verlaufen. In einer anderen Zeit, der des friedlichen Aufbaus und des europäischen Zusammenschlusses in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg. Dies war auch eine Zeit der Entwicklungshilfe für die früheren europäischen Kolonien. Er hatte Rechtswissenschaft gewählt, weniger weil es der Beruf des Vater seines Vaters gewesen war. Aber auch Häussers Mutter war Juristin gewesen, zeitweise aktiv, wenn es finanziell erforderlich war, allerdings eine, die daneben Artikel und Bücher schrieb. Das lag ihrem Sohn. Entsprach seinen eigenen Vorstellungen. Und seinem Charakter. (Im Laufe der Zeit kam es ihm manchmal so vor, als spiele auch sein Sternzeichen eine Rolle: Er war Löwe, umgänglich, gelegentlich aufbrausend, aber eigentlich nie nachtragend, doch er vergaß nichts.) Fridtjofs Tätigkeit in Wirtschaftsverbänden, daneben seine Anwaltszulassung, passten gut in die Zeit des Aufbaus, des sogenannten »Wirtschaftswunders«, nach dem Krieg. Dazu kamen die Auswirkungen mit der europäischen Annäherung, der Konstruktion, mit Luxemburg, dann Brüssel, zunächst in der Sechserpackung von Mitgliedsländern, bald darauf mit neun und elf, schließlich zu fünfzehnt. Ehe er Mitte dreißig war, stand er in den Diensten der Europäischen Kommission. Um, wie es sich herausstellte, endgültig zu bleiben. Und wenige Jahre nach seinem Eintritt, die Zahl der Mitgliedsstaaten wuchs rasch, die der Zuständigkeiten beängstigend langsam, bekleidete er eine diplomatische Funktion. Seine Tätigkeit führte ihn im Drei- oder Vierjahrestakt in eine Reihe von neuen Staaten, die nach dem Zweiten Weltkrieg aus den europäischen Kolonien hervorgegangen waren. So gut wie alle wurden sie von wirtschaftlichen Schwierigkeiten, von Armut, viele auch von inneren politischen Unruhen heimgesucht. Fast immer handelte es sich um die 1960 selbständig gewordenen Länder Afrikas. Seine Frau und er blieben unbehelligt, auch verschont von einer Ausweisung nach irgendeinem Staatsstreich der Militärs, was ihm bei seinen Kontrollen der europäischen Entwicklungshilfe und Zusammenstöße mit korrupten Ministern und Offizieren durchaus hätte passieren können. Ebenso erlagen sie weder der Malaria noch einer der anderen Tropenkrankheiten. Vielleicht wegen der Impfungen gegen Gelbfieber und Typhus und weil sie ihr Wasser abkochen und ihre Wäsche bügeln ließen, Letzteres gegen den Hakenwurm.
Auch er schrieb Tagebuch und sammelte afrikanische Masken und Statuen, damals naheliegend. Die Afrikaner der west- und zentralafrikanischen Stämme betrachteten sie im Einklang mit den »neuen« Religionen, als überholt und verkauften sie auf Flugplätzen und vor Hotelausgängen an europäische Touristen. Preisgünstige Reisesouvenirs. Wie sein Vater die ihm nach seiner Verwitwung verbliebene Zeit nutzte, um Ordnung in die Überbleibsel seines langen Lebens, in Atelier und Wohnung zu bringen, so schwebte dem Sohn zunächst Ähnliches vor. Unnötig war das nicht, denn es herrschte erhebliche Unordnung. Nur, Ordnung musste einem auch liegen. Ihm lag das Aufräumen von Kindheit an fern. Da die Statistiken davon ausgingen, die Lebenserwartung habe sich, zumindest in den industrialisierten Ländern, in den letzten Jahrzehnten dank der Fortschritte von Medizin und Pharmazie, und angesichts einer gesünderen Lebensweise, um drei bis fünf Jahre erhöht, ging er davon aus, dass ihm etwas mehr Zeit blieb als seinem Vater, dessen zwölfeinhalb Monate, im gleichen Alter. (Drei Jahre war es statistisch gesehen bei Männern!) Folglich würde er irgendwann noch Zeit finden, um Ordnung zu schaffen. Ute war bei ihnen im Haus die Ordentliche gewesen. Seine Sekretärinnen waren im Büro für Ordnung zuständig. Ausnahmen galten allenfalls für sein Arbeitszimmer und für den Teil des Speichers, in dem er den Nachlass, seinen Anteil an den Bildern des Vaters bis zur endgültigen Sichtung (oder dem Verkauf) untergebracht hatte. Jedenfalls schwebte ihm Interessanteres vor als bloßes Aufräumen. Schon in seinem Kinderzimmer hatte er die väterliche Weisung am Tag vor seinem Geburtstag gehasst, aufzuräumen. Er fand doch alles!
*
In den 20 Jahren seiner Tätigkeit in Afrika hatte er immer häufiger bedauert, im Zeitalter der Flug- und nicht mehr in der der Schiffsreisen zu leben. Eine Nacht im Flugzeug statt zwei Wochen an Bord eines Schiffes. Langsame Fortbewegung, Änderung des Klimas, wechselnde Anblicke von Küsten und selbst von Schiffen, denen man begegnete, von Häfen, in denen man für ein paar Stunden an Land ging, unterschiedliche Gerüche, neue Eindrücke von Menschen, von Gesprächen, die einen beeindruckten. Natürlich, auch das Zeitalter der Fernflüge bot Eindrücke. Meist flog man abends in Paris oder London ab, überflog das Mittelmeer, dann Afrika von Norden nach Süden oder umgekehrt, nach dem opulenten Abendessen – er hatte nach wenigen Jahren eine Position, in der er Anspruch auf Reisen in der Business Class oder, zuletzt noch einige Jahre lang, in der First Class hatte, mit erheblichen Vorteilen in der Verpflegung. Die Sitznachbarn mit ihrem Cognac, Whiskey oder Soda, bei ihm war der Abschluss ein Bier – schlafend oder dösend – zerstreut aus dem Bullauge hinabblickend auf die tiefe und, von den wenigen Städten abgesehen, immer tiefere Dunkelheit, kaum von schwachen Dorffeuern unterbrochen; ähnliche Funktionen, oder Geschäftsleute. Bis eines Tages ein früherer Vorgesetzter, einst langjähriger französischer Kolonialbeamter in Westafrika, offen mit ihm redend, von den Nachtflügen über Afrika abriet, da allzu spärliche Eindrücke. »Sie sollten bei Tag fliegen, vor allem über der Sahara! Manchmal liegt sie im Dunst, aber selten die ganze Strecke. Man sieht die Bergmassive, in welche die alten Zivilisationen sich nach und nach zurückzogen. Unter ihnen liegt ein wichtiger Teil der Geschichte der Menschheit!« Und wirklich, eines Tages, Häusser erinnerte sich nicht mehr, in welchem Jahr, in welcher Jahreszeit es gewesen war, ja er wusste nicht einmal sicher, ob das Wunder wirklich ihm oder doch nur seinem Gesprächspartner widerfahren war. Es musste an diesem Tag in einem Teil der Sahara stark geregnet haben, und für einen kurzen Augenblick zeigte sie dem aufmerksamen Flugpassagier ihre Konturen, ihr ursprüngliches Gesicht. Umrisse im ewigen Sand ließen die einstigen Flüsse und Seen ineinander mündend erkennen. Man sah, wo Dörfer sich einmal befunden hatten, erkannte wie in einem Spiel, wo die Umrisse menschlicher Behausungen, heute verschwunden, unter dem Sand lagen. »Gewaltige Klimaveränderungen, Trockenheitsperioden und Sandstürme, die die Geschicke der Menschheit immer beeinflusst haben. Die Bewegungen der Erdachse wurden seit langem dafür verantwortlich gemacht. Noch während Häusser auf diese Linien einer vergangenen Zeit wie auf eine Fata Morgana hinabstarrte, entschwanden sie wieder. Die da unten herrschende Wüstenhitze, der Wind übernahmen wieder die Herrschaft. Nur einmal auf den vielen Überflügen der Wüste, vermutlich drei oder vier im Jahr, war ihm dieser Eindruck zuteilgeworden! Seine Frau veranlasste ihn, seinen Eindruck gleich auf einer Papierserviette festzuhalten! Französische und amerikanische Universitäten forschten schon vor dem Ersten Weltkrieg über die Geschichte der Sahara, vieles lag publiziert vor. Häusser vergaß den Anblick der für eine verregnete Stunde, für einen Augenblick, wieder zum Leben erwachten durchstrukturierten Wüste nie wieder. Hatte er auch das Gegenbild von Vegetation erblickt, einen Wald oder Hain heute ausgestorbener Pflanzen. Fotografien von Steinzeichnungen trugen Spuren jener verflossenen Welt.
*
Häusser machte sich nach dem Tod seiner Frau mit aller gebotenen Eile an das Nächstliegende, die Erledigung der Formalitäten und die Bezahlung der vielen Rechnungen. Nachlassgericht, Finanzamt, Versicherungen, Banken, Ärzte, Krankenhäuser, Labors und Bestattungsinstitut. Er schaffte sich Luft. Ohne Zögern erfüllte er einen Wunsch seiner Frau und »arbeitete die Liste ihrer Vermächtnisse ab«, in der sie ihre Verwandtschaft, auch eine nur Monate vor ihrem Tod geborene Großnichte, bedacht hatte. Dies, samt dem damit verbundenen Ärger, lenkte ihn von der Leere des Hauses und der Trostlosigkeit seiner Mahlzeiten ab. Wenn das Wetter es erlaubte, schwamm er morgens im nahen See und spielte manchmal, wenn es nicht regnete, nachmittags ein paar Löcher Golf. (Wer hatte gesagt »Golf ist eine Methode, die Verzweiflung auf Distanz zu halten«?) Spaziergänge, wie er sie mit seiner Frau fast täglich unternommen hatte, auch über kurze Entfernungen, waren ihm zu langweilig, obwohl sie im Alter das A und O für die Gesundheit sein sollten. (Anders, in München, wenn er im Menschengewühl an Schaufenstern entlangging, vom Stachus bis zum Odeonsplatz, oder, sogar sicher doppelt so weit, vom Odeonsplatz bis zur Münchener Freiheit.) Eingeladen wurde er nur noch selten.
Er ging, wohl zum ersten Mal, zu einem »Adventstee« im Dorf nebenan, bisher das Ressort seiner Frau. Er hatte dafür immer an den Beerdigungen von Nachbarn im Dorf teilgenommen, eine traditionelle Pflicht, wenn man auf dem Land lebte. Das ganze Dorf war zu Utes Begräbnis gekommen.
Wenn er zur Postagentur musste, ein- oder zweimal in der Woche, machte er bei gutem Wetter häufig den Umweg über den Dorffriedhof, um sicher zu sein, dass das Grab seiner Frau in Ordnung war. An sie gewandt, murmelte er dabei halblaut: »Zu Hause ist auch alles in Ordnung, auch der Garten. Mir ist sterbenslangweilig. Soll ich wieder einen Hund anschaffen? Nur das Verreisen wird dann so schwierig. Aber allein im Haus sein, ist sterbenslangweilig. Die Abende vor allem. Deine Vermächtnisse habe ich alle ausgeführt. Krebshilfe und Kirche haben ihr Geld bekommen. Ich suche auf den Friedhöfen in der Umgebung noch nach einem geeigneten alten Grabkreuz für dein Grab. Bis Allerheiligen habe ich ja noch Zeit.«
Wenn er im Wagen durch die Gegend fuhr, ließ er eine CD laufen mit seinen Lieblingssongs (darunter »La paloma«, »Surabaja Johnny, warum bist Du so roh«, »Oh moon of Alabama, we now must say Goodbye« und »Mississippi roll along«), und wenn er nachts nicht schlafen konnte, las er unkonzentriert in »Moby Dick«. Etwas musste geschehen; er war Langeweile nicht gewohnt. Schade, dass er zu alt war, um noch einmal die Anwaltsrobe anzuziehen! Die Zulassung bekam man, solange man noch »ganz bei Trost war«. Aber es gab zu viele neue Gesetze, seit er vor vierzig Jahren aufgehört hatte. Gewiss wäre noch einmal mindestens ein Winter beim Repetitor erforderlich. Wenn nicht ein neues Studium! Aber Jura langweilte ihn, anders als früher. Das wollte er nicht mehr. – Wenn er wenigstens einen Freund hätte, um manchmal wie früher »Schiffe versenken« zu spielen! Aber das Spiel gab’s längst nicht mehr, man konnte es sich nicht mehr vorstellen! (Vielleicht im Knast?) Eine siebzigjährige Cousine im Schwarzwald gestand ihm am Telefon, dass sie frühmorgens in ihrem Dorf die Zeitung austrug. In Wasserburg gab es einen netten alten Mann mit einem Stock, der unten in einer Zange endete, der täglich durch die mittelalterliche Kleinstadt strich, um sie sauber zu halten, Papier und Abfälle aufpiekste, ohne Auftrag, ohne Bezahlung. Er wollte auch kein Trinkgeld. Er wirkte fröhlich. Immer an der frischen Luft. Häusser nickte ihm manchmal zu. Mit ein wenig Neid. Heinz, wie die Buchhändlerin ihn nannte, auch weit über siebzig. Der hatte eine nützliche Aufgabe gefunden!
2
Etwa einen Monat nach Utes Beerdigung, 26 Tage danach, legte Häusser den leichteren der beiden Samsonite-Rollis, den seiner Frau, im Schlafzimmer auf das zweite, auf ihr Bett, und tat hinein, was ihm für eine einwöchige Reise durch Europa in dieser Sommerszeit als nützlich erschien. Er hatte sich entschlossen, eine schon lange eingegangene Einladung zu einer Gaudy in Oxford wahrzunehmen, einem der britischen akademischen Wochenende – am St. Antony’s College, an dem er vor zwanzig Jahren, nach seiner Zeit in Afrika, einige Monate, genaugenommen zwei Terms, zugebracht hatte. Im Mittelpunkt stand für ihn aber anderes als eine Analyse der Lage im Irak, das Thema des Weekends, er wollte nämlich unterwegs je einen Stopp in London, in Brüssel und in Mannheim bei drei verwitweten Freunden beziehungsweise ehemaligen Kollegen einlegen. Die mit Utes Tod zusammenhängenden dringlichen Angelegenheiten waren unter Kontrolle. Die Frage für Häusser war weniger, ob er in der Verfassung sein würde, den Vorträgen von zivilen und militärischen westlichen Experten und irakischen Politikern über die politische Stabilisierung und den Wiederaufbau des vom Krieg zerstörten Landes geistig zu folgen. Obwohl ihn das interessierte, trieb ihn etwas anderes um. Er wollte sich unterwegs über das Leben der drei verwitweten Freunde, ähnlich wie er selbst einzuordnende Witwer informieren. Natürlich flog er nicht, sondern ließ sich im Reisebüro Bahnverbindungen von Rosenheim nach Oxford und wieder zurück heraussuchen. Mit Unterbrechungen je eine Nacht in London, Brüssel und Mannheim. Dort lebten die drei, die ihre Frauen schon vor Jahren – alle nach ihrer Pensionierung – , verloren hatten. – Wie lebten die heute? Wie sah ihr Leben heute aus? Er packte eine dunkle Jacke für das Dinner im College ein, Smoking war dort schon vor zwanzig Jahren, 1990, »out« gewesen.
Er wollte sehen, wie diese Oldies heute lebten, wie sie ihr Leben ohne ihre Frauen eingerichtet hatten. Zwei waren ehemalige Diplomaten wie er, Andrew Fowler, 87, und Hubert Armbruster, 80. Mit dem Dritten, Klaus Seefeld, 82, einem ehemaligen Universitätsprofessor, war Häusser seit seiner Referendarszeit in Heidelberg befreundet. Er war längst emeritiert, seine Frau, eine frühere Schauspielerin, war kurz vor seinem achtzigsten Geburtstag gestorben. Häussler hatte an ihrer Beerdigung teilgenommen, einer säkularen Beerdigung, ohne anderen Redner als den Ehemann. Bei Utes Beerdigung war Häusser erleichtert gewesen, dass Klaus, sein ältester Freund, überzeugter Atheist, nicht darauf bestanden hatte, seine Rede, die er mit Sicherheit in der Tasche hatte, entweder in der Kirche oder am Grabe zu halten. Verbieten hätte er es ihm nicht können. Klaus hatte bei ihrer Trauung gesprochen, ebenso an Utes fünfzigstem Geburtstag, an Häussers sechzigstem und siebzigstem Geburtstag, humorvolle, wegen der eingeflochtenen Anekdoten einprägsame Reden! Aber die Predigt des katholischen Pfarrers, der Ute lange gekannt und sehr geschätzt hatte, obwohl sie nicht katholisch war und aus der evangelischen Kirche schon als marxistische Junglehrerin ausgetreten war, war so zutreffend, so reichhaltig und vor allem so freundschaftlich, dass der alte Freund seinen Text stecken ließ.
Die Wohnorte aller drei Freunde lagen an Häussers Strecke. Er hatte sie alle rechtzeitig angerufen und sich angemeldet, er wolle sie einmal wieder sehen.
Die Tagung war interessant und relativ schnell vorüber. Beim Dinner und dem vorangehenden Drink in der Bibliothek sowie dem anschließenden Nachtisch (mit Portwein und Glockenmahnung), welcher, gemäß der Tradition des Hauses, ohne die Roben (der Dozenten) im umgebauten Keller stattfand, hatte Häusser, wissenschaftlich stets ein Außenseiter, seine Bekanntschaft mit ein paar bekannten alten Gesichtern erneuert und eine neue Bekanntschaft, die mit einer witzigen alten Unterhausabgeordneten, gemacht. Dann wartete das Taxi. Der für ihn wichtigste Teil der Reise konnte beginnen.
Andrew, der Erste, der Brite, lebte in einem Vorort von London. Er war zehn Jahre älter als Häusser und war ursprünglich Berufsoffizier gewesen, ehe London den Colonel, im Zuge der Einsparungsmaßnahmen der Regierung Wilson, mit einer Reihe anderer, des Französischen oder des Deutschen mächtigen Offiziere, alle im Rang von Colonels, dem neu geschaffenen europäischen Außenamt zur Verfügung gestellt hatte. Der sympathische Offizier hatte in Häussers damaliger Delegation in einer ehemaligen britischen Kolonie im südlichen Afrika die Personal- und Verwaltungsabteilung unter sich gehabt und den deutschen Missionschef, Häusser, bei Abwesenheiten und bei Feierlichkeiten, die mit der deutschen Kapitulation 1918 und 1945 zusammenhingen, vertreten. Beide kamen vorzüglich miteinander aus. Auch ihre Frauen, Betty und Ute, beide mit dem Hang zu sparsamer Haushaltsführung und zur Gärtnerei, fanden sich beim Austausch von Rezepten und Blumensamen. Neun Jahre nach Bettys plötzlichem Tod lebte Andrew weiter in dem altmodischen kleinen Cottage an einer engen Schleife der Themse. Seine beiden Söhne, verheiratet, beide mit Kindern, lebten in Singapur und Kanada. Lange nach Andrews Pensionierung war Betty, seine Frau, welche im Kollegenkreis »the Colonel« genannt wurde, tot umgesunken, während sie an einem Pullover strickte und dabei BBC hörte. Erst Mitte siebzig! Weiterhin hatten Häusser und Andrew sich auf den Jahrestagungen pensionierter europäischer Beamter irgendwo in Europa getroffen. Zu ihren Geburtstagen wechselten sie humorvolle Postkarten. Am Jahresende oder wenn ihnen in ihrer Pensionsabrechnung etwas unklar war (war die Unfallversicherung teurer geworden, oder war die EU-Steuer gestiegen?) telefonierten sie oder wechselten E-Mails. Nach Bayern war Andrew bisher zweimal gekommen, das zweite Mal in Begleitung von Nellie, einer attraktiven britischen Witwe. Nellie begleitete Andrew gerne auf Reisen. Während ihrer Ehe mit dem Manager eines Möbelhauses war sie – eher ungewöhnlich bei Briten – wenig ins